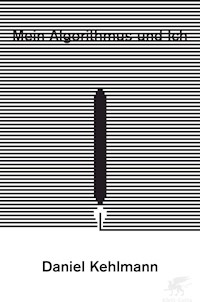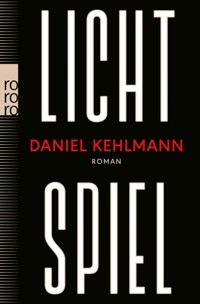
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einer der Größten des Kinos, vielleicht der größte Regisseur seiner Epoche: Zur Machtergreifung dreht G. W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun Ostmark heißt. Die barbarische Natur des Regimes spürt die heimgekehrte Familie mit aller Deutlichkeit. Doch der Propagandaminister in Berlin will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er dem Werben widerstehen, dass er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die rettungslose Verstrickung gegangen. Daniel Kehlmanns Roman über Kunst und Macht, Schönheit und Barbarei ist ein Triumph. Lichtspiel zeigt, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Lichtspiel
Roman
Über dieses Buch
Einer der Größten des Kinos, ein Gigant des deutschen Stummfilms: Zur Machtergreifung dreht Georg Wilhelm Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht der weltberühmte Regisseur mit einem Mal aus wie ein Zwerg. Nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun Ostmark heißt. Die barbarische Natur des Regimes spürt die heimgekehrte Familie mit aller Deutlichkeit. Doch der Propagandaminister in Berlin will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er dem Werben widerstehen, dass er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die rettungslose Verstrickung gegangen.
Daniel Kehlmanns Roman über Kunst und Macht, Schönheit und Barbarei ist ein Triumph. Lichtspiel zeigt, was Literatur vermag: durch Erfindung die Wahrheit hervortreten zu lassen.
Vita
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Welt war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit, und auch sein Roman Tyll stand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Daniel Kehlmann lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
ISBN 978-3-644-01845-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Anne
und
für Thomas Buergenthal (†)
Wie man’s denn damals überhaupt machte, daß man morgens noch aufstand, und wieder und wieder? Emporgehoben und dahintreibend auf einer breiten Woge des Unsinns, obwohl wir es doch wußten und sahen, und um so schlimmer! Aber dieses Wissen allein war es zuletzt, was uns überleben ließ, während viel Bessere als wir verschlungen wurden.
Heimito von Doderer, Unter schwarzen Sternen
DRAUSSEN
Was gibt es Neues am Sonntag
Warum bin ich in diesem Auto?
Ich sitze still. Wenn man sich nicht bewegt, kommt die Erinnerung manchmal zurück.
Aber es funktioniert nicht. Fest steht nur, der Fahrer raucht. Das Fahrzeug ist voll von schwerem Qualm. Meine Augen brennen. Mir ist schlecht. Der Mann hat graue Haare, auf seinen Schultern liegen Hautschuppen. Am Rückspiegel pendelt ein kleines Kreuz an einer Perlenkette.
Eins nach dem anderen. Der Fahrer hat mich abgeholt, hat mir die Tür aufgehalten, und die anderen haben mit offenen Mündern zugesehen, der dürre Franz Krahler, die dumme Frau Einzinger und auch der kleine Mann, dessen Name mir nie einfällt.
Denn eigentlich ist im Sanatorium Abendruh jeder Tag wie der andere. Beim Frühstück läuft das Radio, man geht in den Park, der Rücken schmerzt, es gibt Mittagessen, man schaut in die Zeitung und ärgert sich, während der Fernseher läuft; einige sehen zu, andere schlafen, immer hustet irgendwer zum Gotterbarmen. Dann ist es auch schon halb vier, und das Abendessen kommt, und danach liegt man wach und muss jede halbe Stunde auf die Toilette. Manchmal kommt Besuch, aber nie zu mir. Manchmal stirbt einer und wird weggebracht. Aber wer noch lebt, wird üblicherweise nicht von einem schwarzen Auto mit Chauffeur abgeholt.
Wir halten an einer Kreuzung, drei Jugendliche mit langen Haaren überqueren sehr langsam die Straße, der Fahrer kurbelt das Fenster hinunter und schreit, dass Halbstarken wie ihnen ein Krieg wieder guttun würde, und als sie ihn nicht beachten, wird er nur noch wütender. Er fährt los, schimpft aber dabei immer noch.
Und jetzt weiß ich wieder: ins Fernsehstudio.
Aber welche Sendung? Ich beuge mich vor und frage.
Der Fahrer dreht sich um und sieht mich durch die Rauchschwaden an, ohne zu verstehen.
Ich wiederhole die Frage.
Ihm doch egal, ruft er. Warum ihn denn so ein Scheißdreck interessieren solle!
Also sage ich nichts mehr.
Aber er kommt in Fahrt. In Ruhe lassen soll man ihn, in Ruhe! Sei das zu viel verlangt?
Als wir vor dem Funkhaus halten, hat er sich gerade wieder gefasst. Er steigt aus, geht ums Auto, öffnet mir die Tür. Er packt mich am Ellenbogen, zieht mich hoch. Das ist eine Frechheit, aber es hilft mir tatsächlich, ohne Sturz auf die Straße zu kommen.
Die Fassade des Funkhauses ist noch grauer, als es die Fassaden drum herum sind. Alle Häuser in Wien sind jetzt grau, bis auf ein paar, die dunkelbraun sind. Die ganze Stadt scheint mit Dreck überzogen. Im Winter ist der Himmel steinern und niedrig, im Sommer gelblich feucht. Selbst das war einmal anders. Wenn man alt genug ist, weiß man, dass in dieser Stadt aus Müll, Kohlenrauch und Hundescheiße sogar das Wetter nicht mehr ist wie früher.
Die Drehtür rotiert stockend, und für einen Moment habe ich Angst, dass meine Reise hier enden wird, aber ich komme hindurch, und in der Lobby wartet tatsächlich jemand auf mich: ein sehr dünner junger Mann mit klugem Gesicht und runden Brillengläsern, der mir die Hand gibt und sich als zuständiger Redakteur Rosenzweig vorstellt.
«Sehr gut», sage ich. Es freut mich immer, wenn junge Menschen höflich sind. Das kommt nicht mehr oft vor. «Zuständig wofür?»
«Für die Sendung.»
«Welche?»
Er sieht mich ein paar Sekunden an, bevor er fragt: «Was gibt es Neues am Sonntag?»
«Das weiß ich nicht.»
«Die Sendung!»
«Was?»
«So heißt die Sendung. Was gibt es Neues am Sonntag.»
Wovon redet dieser Mensch?
«Hier entlang bitte!» Er weist auf eine Tür am anderen Ende der Lobby. Ich folge ihm, wir gehen einen kurzen Gang entlang, dann stehen wir, und das ist jetzt gar nicht gut, vor einem Paternoster.
Die erste Kabine zieht vorbei, eine zweite folgt, in die dritte muss ich wohl, ich bekomme Angst, sie zieht ebenfalls vorbei. Komm, sage ich mir, du hast Schlimmeres erlebt. Als die vierte Kabine vor mir aufsteigt, schließe ich die Augen und taumele voran. Ich schaffe es hinein, wäre aber hingefallen, wenn er mich nicht an der Schulter gehalten hätte. Gut, dass er so schnell reagiert hat.
«Lassen Sie mich los», sage ich scharf.
Das Aussteigen ist natürlich noch schwerer. Aber er sieht es kommen, legt mir die Hand auf den Rücken und gibt mir einen kleinen Stoß. Ich taumele hinaus, er hält mich gottlob wieder fest.
«Lassen Sie das!», sage ich.
Es riecht nach Kunststoff, von irgendwoher kommt das Brummen großer Maschinen. Wir gehen einen Gang entlang, links und rechts hängen signierte Fotos von grinsenden Leuten. Ein paar kenne ich: Paul Hörbiger, Maxi Böhm, Johanna Matz und dort Peter Alexander, der aus irgendeinem Grund Einen großen Dank meinem lieben, lieben Publikum unter seine Unterschrift gekritzelt hat.
Der junge Mann öffnet eine Tür, auf der Maske steht. Vor einem Schminkspiegel sitzt ein dicker Kerl mit Vollbart, eine Kostümbildnerin steht hinter ihm und bearbeitet sein Gesicht mit einem Pinsel. Als sie zurücktritt, springt er so plötzlich auf, dass ich zusammenzucke, und umarmt mich. Er riecht nach Rasierwasser und Bier. Mit vor Glück weinerlicher Stimme fragt er: «Wie geht’s dir denn, Franzl?»
Ich murmle, dass es mir gutgeht, was eigentlich nie stimmt, jetzt gerade aber am allerwenigsten. Ich versuche, nicht einzuatmen. Sein Bart kitzelt auf meiner Wange.
«Und dir?», keuche ich.
«Ach Franzl, was soll ich sagen. Die Liesl ist vor zwei Jahren gestorben, und die Sache mit dem Wurmitzer ist nicht gut ausgegangen. Und ich sag noch zu ihm: Ferdl, das musst jetzt machen wegen der alten Freundschaft, aber hat er hören wollen? Und du weißt ja, ich bin dann lieber beim Senger geblieben, aber der war nicht ehrlich.»
Ich bekomme keine Luft. Wer zur Hölle ist das? Wer sind die Leute, von denen er redet? Endlich lässt er mich los, nimmt eine Lodenjacke mit Hirschhornknöpfen vom Garderobenhaken, groß wie ein Zelt, wirft sie sich um, geht hinaus.
Ich setze mich. Die Maskenbildnerin macht sich an meinem Gesicht zu schaffen und fragt, wie Maskenbildnerinnen das immer fragen, was ich denn tue und was mich in die Sendung bringt. Nie wissen sie es vorher, nie kennen sie jemanden, nie haben sie nachgeschaut, immer fragen sie.
«Herr Wilzek ist Regisseur», sagt der junge Mann, der mich hergebracht hat. Ich wünschte, er hätte mir seinen Namen gesagt, aber die jungen Menschen wissen nicht mehr, wie man sich benimmt.
Natürlich fragt sie jetzt, was für Filme ich so gemacht habe, und ich zähle mit dem gleichen mulmigen Gefühl wie immer meine drei mageren Titel auf: Peter tanzt mit allen mit Peter Alexander, Gustav und die Soldaten, auch mit Peter Alexander und mit Gunther Philipp, und Der Schlück, der geht als letzter heim mit Leuten, an die ich mich nicht erinnere.
Und jetzt fragt sie natürlich nach Peter Alexander. Wie der denn so sei. Der sei nämlich noch nie bei ihr gewesen zum Schminken, erstaunlicherweise. Sie hätte ihn ja so gerne einmal getroffen.
Ich erzähle die Anekdote, die ich immer erzähle. Schon am ersten Drehtag von Peter tanzt mit allen habe er seinen ganzen Text auswendig gekonnt. Dann habe man kurzfristig den Drehplan ändern müssen, und eine junge Schauspielerin, deren Namen ich lieber nicht nennen wolle, sie sei inzwischen recht bekannt, habe nur den Text für diesen Tag gelernt gehabt, und da habe Peter sie angesehen und gesagt: «Liebes Fräulein, mit Text ist es wie mit Pferden, wollen Sie wissen, warum?»
Gott, mein Spiegelbild! Im Sanatorium Abendruh haben wir keine Spiegel, weil keiner sich selbst rasiert; das macht jeden Morgen der Pfleger Zdenek. Und so kommt der Anblick unerwartet: meine Augen tief in den Höhlen, die schlaffen Hautsäcke, die eingerissenen Lippen, die faltig graue Haut auf dem kahlen Kopf. Das Sakko sitzt schief, weil die Schultern es nicht mehr füllen, die Krawatte hat nicht nur Flecken, sie ist auch schlecht gebunden, was nicht meine Schuld ist, weil ich schon lang keine Krawatte mehr binden kann, das hat auch Zdenek gemacht. Kann er sich keine Mühe geben? Wie oft kommt es schon vor, dass einer von uns ins Fernsehen gebracht wird? Ich schließe meine Augen, um mich nicht mehr sehen zu müssen. Es zischt, kalter Wind aus der Haarspraydose weht über meine Kopfhaut. Warum nur? Ich habe doch kaum Haare.
«Ja warum?», fragt die Kostümbildnerin.
Was ist los?
«‹Wie mit den Pferden›, hat er gesagt, warum?»
Was will sie von mir?
«Na gut», sagt sie nach einer Pause. «Fertig.»
Ich stehe auf, meine Knie geben nach, die Maskenbildnerin und der junge Mann stützen mich.
«Keine Sorge», sagt er, während er mich hinaus auf den Gang führt. An den Wänden hängen signierte Fotos von Paul Hörbiger, Johanna Matz, Peter Alexander. Mit dem habe ich einmal gearbeitet.
«Herr Professor Conrads wird Ihnen nur die Fragen stellen, die wir schon im Vorgespräch hatten. Sie erzählen ein paar von den alten schönen Geschichten, da kann nichts passieren. Herr Professor Conrads stellt immer nur Fragen, die ihm die Redaktion vorher aufgeschrieben hat. Und die Redaktion, das bin in dem Fall ich. Er improvisiert nie.»
«Ich muss auf die Toilette.»
Er sieht auf die Uhr. Rosenblatt! Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber so heißt er. Etwas daran macht mir Sorgen, aber ich kann gerade nicht sagen, was.
Er zeigt auf eine Tür. «Aber bitte schnell.»
Ich gehe hinein. Alles ist kompliziert: Meine Finger sind taub und können Gürtelschnalle und Hosenknöpfe nicht gut ertasten, so ist es auch nicht gerade leicht, die Hose herunterzulassen, und außerdem ist der Toilettensitz zu tief angebracht. Dann fällt noch die Rolle mit dem Papier zu Boden. Ich bücke mich, aber als ich sie heranziehen will, rollt sie sich weiter ab und verschwindet durch die Spalte unter der Kabinenwand.
Ich höre Schritte, jemand geht auf und ab, ruft meinen Namen: «Herr Wilzek, wir müssen ins Studio!»
«Ja, ja!», rufe ich.
«Es ist eine Livesendung!»
«Ja, gleich. Gleich.»
Schon sind da mehrere Leute. Ich höre aufgeregte Stimmen. Und ich bin ja auch fertig, aber das Aufstehen ist höllisch schwer, weil der Sitz zu tief ist, und jetzt sind die Hosenknöpfe und die Gürtelschnalle an der Reihe. Ich mache alles so langsam, wie es nötig ist. Wenn ich mich abhetze, wird es nur schwieriger.
Ich trete aus der Kabine. Fünf Männer und drei Frauen stehen da. Offenbar warten alle auf mich. Wie kann das sein, dass Frauen hier hereindürfen? Sind wir schon wieder so weit, ist gar nichts mehr heilig? Aber bevor ich mich noch beschweren kann, haben sie mich umringt – einer stützt mich von rechts, ein anderer von links, ein Dritter schiebt, sie lassen mich nicht einmal die Hände waschen.
«Die Sendung hat schon angefangen», sagt einer.
«Wir haben den zweiten Gast vorgezogen», sagt ein anderer.
«Sie müssen rein. Sie sind dann sofort live», sagt ein Dritter.
Eine Stahltür geht auf, wir sind in einem Studio. Zwei Kameras bewegen sich lautlos durch den Raum, ich höre den hohen Pfeifton der Scheinwerfer, Mikrofone hängen an Drähten von der Decke. In der Mitte ist ein Stückchen Wohnzimmer aufgebaut: geblümte Tapeten, darauf genagelt Landschaftsbildchen in goldenen Rahmen, ein Sofa, ein Lehnstuhl, ein Tisch mit Kaffeetassen. Auf dem Sofa sitzt ein riesiger Mann mit Bart, er trägt eine Lodenjacke. Neben ihm steht ein Mann, den ich kenne, er ist ständig auf dem Fernseher im Sanatorium Abendruh zu sehen, aber mir fällt sein Name nicht ein. Gerade eben singt er zu blecherner Musik aus dem Lautsprecher, dabei küsst er immer wieder seine Fingerspitzen. Jemand schiebt mich voran, fast wäre ich über ein Kabel gestolpert, man manövriert mich an der Kamera vorbei, nun sitze ich neben dem Bärtigen auf dem Sofa.
Der Moderator singt nicht mehr, er spricht über mich. Eine besondere Freude, sagt er in einem eigenartigen Singsang, dass Franz Wilzek bei ihm sei, sein lieber alter Freund!
Und ich kenne ihn ja gar nicht. Ich weiß, ich bin ein wenig vergesslich, aber diesem Menschen bin ich wirklich noch nie begegnet.
Er dreht sich um und kommt mit ausgestreckter Hand zu mir. «Lieber Franzl!» Die erste Kamera fährt in einer Kreisbewegung um ihn herum, während die zweite sich zu meinem Gesicht dreht, das Rotlicht springt von einer zur anderen, und auf einem Monitor sehe ich mich selbst, verkrampft lächelnd, mit großen Tränensäcken.
Er heißt Conrads! Plötzlich ist es mir eingefallen, Heinz Conrads, so schlecht ist mein Gedächtnis gar nicht. Aber ich bin ihm wirklich noch nie begegnet. Ich gebe ihm die Hand, ohne aufzustehen. Seine schweinchenkleinen Augen blitzen wütend. Es missfällt ihm sichtlich, dass er sich zu mir herunterbeugen muss.
Er wendet sich zur Kamera und spricht weiter über mich. Dabei liest er von einem Stapel Karten, dehnt aber die Worte in einer so überraschten, verwirrt nachdenklichen Weise, dass man gar nicht auf die Idee käme, dass er das, was er von sich gibt, nicht in jedem Moment aus seinem eigenen Hirn holt. Regisseur, sagt er, schöne lustige Filme, uns allen viel Freude gemacht, Gustav und die Soldaten, Der Peter tanzt mit allen, gearbeitet mit allen Publikumslieblingen! Auf dem Monitor sieht man einen Ausschnitt: Peter Alexander singt, springt und grinst. Ich nicke freundlich, obwohl ich sehe, dass ich nicht im Bild bin, das Rotlicht leuchtet an der Kamera, die Heinz Conrads filmt, der Monitor zeigt jetzt wieder sein teigiges Gesicht unter der betonharten weißen Haarhaube.
Und jetzt ist es passiert. Er schweigt und sieht mich an. Das Licht springt um, auf dem Monitor erscheint mein Gesicht. Hat er mich etwas gefragt? Nur einen Moment war ich unaufmerksam, und ausgerechnet da ist es geschehen!
Ich horche in die pfeifende, elektrisch knisternde Stille. Dann erzähle ich aufs Geratewohl eine Anekdote über den Schauspieler Schlück Battenberg. Sie ist halbwegs lustig, und sie funktioniert auch: Heinz Conrads küsst seine Fingerspitzen und ruft: «Köstlich!» Auch der bärtige Mensch neben mir schlägt sich lachend auf die Brust.
«Kennt ihr zwei euch schon länger?», fragt Heinz Conrads.
«Das ganze Leben», sagt der Mann, den ich nicht kenne.
Beide lachen wieder. Alles in allem scheint es gut zu laufen. Mein Kopf arbeitet nicht wie früher, aber so eine Sendung kann ich immer noch meistern.
Also warte ich die nächste Frage gar nicht ab, sondern erzähle die Anekdote, wie Gunther Philipp bei den Dreharbeiten zu Gustav und die Soldaten ins Wasser gefallen ist. Eigentlich eine schwache Geschichte, es gibt keine Pointe, der dumme Kerl ist eben ins Wasser gefallen, und dann hat man ihn herausgezogen, aber die beiden lachen wieder, und so erzähle ich noch meine beste Geschichte, das Glanzstück: die junge Schauspielerin, die nur den Text für den ersten Tag gelernt hat. Und wie Peter Alexander sie angesehen und gesagt hat: ‹Liebes Fräulein, mit dem Textlernen ist das wie mit Pferden! Wollen Sie wissen, warum?›
«Ja, der Peter!», ruft der Idiot neben mir. «Das ist ein ganz Großer!»
Ich sehe ihn scharf an, um ihm zu zeigen, dass er ruhig sein soll.
«Warum?», fragt der Moderator.
«Warum – was?»
«Mit den Pferden?»
Das Pfeifen der Scheinwerfer ist so schrill und doch so leise, dass man nicht sicher sein kann, ob man es wirklich hört. Das Rotlicht springt von der einen Kamera zur andern. Ich folge ihm mit dem Blick und sehe, wie mein Kopf auf dem Monitor hin und her ruckt.
«Ach, wie mit den Pferden!» Ich hole Luft, um fertig zu erzählen.
Aber etwas ist aus dem Rhythmus geraten, die Geschichte hat sich verhakt, der nächste Satz will nicht kommen. Der übernächste steht bereit, also überspringe ich den nächsten, aber just in diesem Moment löst sich auch der übernächste auf – noch spüre ich seine Kontur, und mir ist, als könnte meine Zunge ihn tasten. Aber als die Worte sich nicht formen, mache ich den Fehler, auf den Bildschirm zu sehen. Dort bin ich, mit verwirrtem Gesicht und offenem Mund. Und wenn man sich selbst so gegenübersitzt, in zwei geteilt, und weiß, dass alle im Sanatorium Abendruh es mitverfolgen, fällt einem wirklich nichts mehr ein.
Der Moderator nickt, faltet die Hände mit den Karten, blickt zur Decke wie im Gebet und ruft: «Köstlich! Pferde!»
Der Mann neben mir lacht.
«Herrlich!», ruft der Moderator.
Ganz krank vor Neid müssen sie jetzt im Heim sein, besonders der Franz Krahler und die dumme Frau Einzinger. Und weil ich das Bild nicht wegschieben kann, ich sehe den Krahler blass auf seinem Stuhl hocken und die Einzinger mit offenem Mund daneben, passiert es schon wieder, und ich verpasse die nächste Frage.
«Wie bitte?»
Heinz Conrads schlägt die Augen zur Decke, seufzt und liest von seiner Karte: «Der Franz Wilzek ist ja erst spät selbst Regisseur geworden. Vorher war er der Assistent von G.W. Pabst.»
Warum redet er plötzlich in der dritten Person von mir?
«G.W. Pabst», erklärt er. «Einer der großen Regisseure. Ein Großmeister, eine große Legende, ich hab ihn ja noch gekannt, aber keiner hat ihn gekannt wie du!»
Auf dem Monitor flackern Bilder: Greta Garbo in der Freudlosen Gasse, Louise Brooks in der Büchse der Pandora, Mackie Messer wirbelt mit dem Spazierstock. Ich räuspere mich und erkläre: «Das ist die Garbo. Die hat er für den Film entdeckt. Ich bin erst später dazugekommen. 1941 bei Komödianten. Kennengelernt haben wir uns am Set von … Ein Jahr vorher. Bei einem anderen Film. Ich war eigentlich Kameraassistent.»
Jetzt füllt wieder Heinz Conrads’ Gesicht den Bildschirm. «Da war er gerade zurückgekommen», liest er von der nächsten Karte. «Aus dem Exil. Um wieder Filme auf Deutsch zu drehen. Du wurdest sein neuer Assistent.»
Ich nicke. Offenbar soll ich noch mehr sagen, aber was? Hinter der Kamera ist ein junger Mann mit runder Brille aus dem Dunkel getreten. Ich habe ihn schon einmal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Ich weiß nur, dass er Rosenkranz heißt.
«Hat er dir erzählt, warum er zurückgekommen ist?», liest Heinz Conrads ab. «Er war schon in Amerika. Und dann war er wieder hier und drehte Filme für …» Er verstummt und hält seine Karte, als stimmte da etwas nicht. Es dauert nur einen Moment, dann bekommt er seine Züge in den Griff, verzieht den Mund zu seinem teigigen Lächeln, schiebt die Karte hinter den Stapel.
«Und nach den Komödianten habt ihr Paracelsus gemacht», liest er. «Mit dem großen Werner Krauß, ein großer Film, ein Klassiker.»
«Ein Meisterwerk!», sage ich.
«Wie war er denn so, der G.W. Pabst, er hat sich ja immer mit den beiden Initialen schreiben lassen, G.W., nicht wahr, meist wurde er auch so angeredet, also wie war der so, wie würdest du ihn beschreiben?»
«Ein bisschen zu dick.»
Heinz Conrads lacht. «Der Franzl! Immer ein Scherz!»
«Er wollte immer abnehmen», sage ich. «Er war nicht sehr groß, aber etwas rund, und am Set hat er viel gelacht, aber wenn die Scheinwerfer ausgingen, war er oft wie ausgeleert. Wie ein Kostüm, das keiner trägt.»
Das Pfeifen ist lauter geworden und schriller, auch die Helligkeit ist mit einem Mal kaum auszuhalten. Ich kann den Moderator kaum noch sehen, so geblendet bin ich.
«Aber wenn er einen Befehl gab, haben alle gehorcht. Etwas anderes fiel einem gar nicht ein. Außer wenn seine Mutter da war. Ich hab sie nur einmal gesehen, sie kam zu Besuch, als wir Komödianten drehten, er sah sofort aus wie ein Kind. Ein paar Monate später ist sie gestorben.» Ich muss schlucken. Mein Hals ist trocken, die Couch unter mir scheint langsam durch den Raum zu schwimmen. «Er hatte eine eigene Theorie vom Filmschnitt. Dass ein Schnitt immer durch eine Bewegung begründet sein muss, sodass ein nie abreißender Fluss von der ersten Einstellung bis zur letzten entsteht. Als ich später selbst Regie geführt habe, habe ich bemerkt, dass es in der Praxis kaum …» Nein, ich bin zu weit gegangen, so kann man hier nicht reden. «Von der Greta Garbo hat er oft gesprochen!», rufe ich. «So eine schöne Frau! Und von der Louise Brooks, die kennt man heute kaum mehr, aber damals war sie ein fast so großer Star wie die Garbo. Die hat er auch entdeckt.»
«Ach ja! Die schönen Frauen!» Heinz Conrads lacht erleichtert. Er legt wieder eine Karte nach hinten und liest: «Und bei eurem nächsten Film, Der Fall Molander, da hat der große Paul Wegener die Hauptrolle gespielt?»
«Welchem?»
«Bei eurem nächsten Film», liest er von der Karte. «Der Fall Molander. Da hat Paul Wegener die Hauptrolle gespielt.»
«Den gibt es nicht.»
«Den Paul Wegener?»
«Diesen Film. Gibt es nicht, der wurde geplant, aber nie gedreht.»
Ein paar Sekunden ist es still, dann sagt Heinz Conrads: «Doch, doch, hier steht … Gedreht ist er schon worden. Es hat ihn nur keiner gesehen, er ist dann verloren gegangen.»
«Nicht gedreht.»
Heinz Conrads blickt irgendwohin hinter der Kamera. «Also mir hat man gesagt, ihr habt ihn fertig gedreht, Anfang fünfundvierzig in Prag. Unter schweren Bedingungen, in den letzten Kriegswochen, aber dann ist halt das Material verschwunden.» Er blickt mit schmalen Augen auf seine Karte. Es ist offenbar die letzte. Er dreht sie um, sieht hilflos auf ihre Rückseite.
«Nicht gedreht!», rufe ich. «Verdammt! Es ist nicht wahr, es gibt ihn nicht! Es ist ein Irrtum! Eine Lüge.»
«Wie bitte?»
«Eine Lüge!»
Heinz Conrads sieht auf seine letzte Karte, dann auf den jungen Mann mit der Brille, dann noch einmal auf die Karte. «Franzl, du wirst dich doch an deinen Film erinnern.»
«Der wurde nie gedreht!»
Heinz Conrads runzelt die Stirn so stark, dass sich sein Gesicht nach innen zu krümmen scheint. Da trifft mein Blick den des jungen Mannes mit der Brille. Er sieht nicht seinen Chef an, sondern mich, ganz aufmerksam und direkt, mit einem dünnen, starren Lächeln.
Ich sehe auf den Bildschirm. Sehe mich selbst, wie ich irgendwohin sehe – natürlich, der Monitor ist nicht die Kamera, man muss in die Kamera sehen, um sich selbst vom Monitor aus anzusehen, nur dass man sich ja dann nicht sehen kann, weil man in die Kamera sieht, nicht auf den Monitor. Und jetzt zeigt der Monitor, obwohl er ja mich zeigt, zugleich etwas anderes, und um es nicht zu sehen, schließe ich die Augen, aber das hilft nicht, und ich sehe sie noch: schwarzweiße Menschen in einem Konzertsaal. Von hoch oben sehe ich auf sie herab, als ob ich flöge, ein Kristallluster strahlt, ich sitze neben der Kamera auf dem Arm eines langen Krans, sie blicken alle nach vorne, denn hinaufsehen dürfen sie nicht.
Ich öffne die Augen, aber ich sehe es immer noch, sehe so deutlich wie je, so wie wir es einst auf dem kleinen Bildschirm gesehen haben, als Pabst neben mir den Film geschnitten hat. Und zugleich sehe ich es von oben, vom weit ausschwingenden Kran, an dem ich hänge, während Pabst unten durchs Megafon dirigiert, weiter nach vorne, jetzt Schwenk nach rechts, zum Podium, weiter, wo der Schauspieler steht und geigt!
«Wurde nicht gedreht! Ihre Redaktion hat schlecht gearbeitet! Sie irren sich! Kam nie zustande!»
Die Menschen unter mir. Sie dürfen nicht heraufsehen. Wenn einer es täte, würde es alles ruinieren. Entscheidend ist, dass die Soldaten nicht ins Blickfeld kommen, denn die Einstellung muss heute abgedreht sein, und da tritt Heinz Conrads auf mich zu: «Lieber Franzl, so eine Freude, dass du hier warst, leider ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei!» Mir ist, als holte er zum Schlag aus, und ich hebe die Hände vor mein Gesicht, aber er dreht sich zur Kamera, das Rotlicht blitzt, der Monitor zeigt sein Gesicht so groß, dass die Nasenlöcher wie Krater erscheinen. «Guten Abend, die Mad’ln», sagt er in singendem Ton, «servus, die Buam, danke, liebe Gäste, bleiben Sie alle recht schön gesund!» Blechern klimpernde Klaviermusik aus den Lautsprechern, das Rotlicht erlischt, auf dem Monitor formen wirbelnde Buchstaben die Worte Was gibt es Neues am Sonntag mit Heinz Conrads.
Offenbar ist es vorbei. Der junge Mann mit der Brille, der mich die ganze Zeit über unverwandt angesehen hat, kommt auf mich zu.
«Der Nachspann wird jetzt dreimal zur Gänze durchlaufen. Wir mussten früher aussteigen. Das ist noch nie passiert. Da können Sie stolz sein.»
«Ich hoff, dir geht’s bald besser», sagt der bärtige Mann in Lodenjacke neben mir. «War schön, dich wiederzusehen, Franzl.»
«Dich auch», sage ich, weil mir nichts anderes einfällt.
«Habt ihr Molander wirklich nicht gedreht? Ich dachte immer, der wäre noch fertig geworden, aber als dann der Aufstand in Prag begann –»
Ich wende mich ab und strecke meinen Arm aus, um dem jungen Mann, dessen Name mir plötzlich einfällt, er heißt Rosenkranz, und aus irgendeinem Grund gefällt mir das nicht, zu bedeuten, dass er mir aufhelfen soll. Er tut es. In kleinen Schritten gehen wir zur Tür.
Aber Heinz Conrads versperrt uns den Weg. Sein Gesicht ist verzerrt vor Wut.
«Auf Wiedersehen, lieber Heinzi», sage ich.
«Kriech in dein Scheißloch und verreck.»
Ich starre ihn an. Für einen Moment meine ich, ich hätte mich verhört.
«Und du?», sagt er zu dem jungen Mann. «Was lädst du so einen alten Dreck in meine Sendung! Zu senil im Scheißhirn, und ich steh da mit meinen Fragen, du packst deine Sachen und schleichst dich, ich will dich nie mehr sehen!»
«Sehr gern», sagt Rosenkranz.
«Pappen halten. Will ich gar nicht hören, schleichst dich!»
«Gern», sagt Rosenkranz wieder. Wir gehen um den vor Wut bleichen Heinz Conrads herum. Ich gehe mit halb geschlossenen Augen, ich höre, wie eine schwere Tür aufgeht und sich schließt.
«Seit Monaten wollte ich aufhören», sagt Rosenkranz. «Aber einfach kündigen kann jeder, dachte ich. Da muss dir doch was Besseres einfallen.»
Ich fühle mich schwach. Die Sendung hat mich doch erschöpft, nicht nur meine Hände, auch meine Arme und Schultern zittern. Was ist eigentlich passiert? Die Erinnerung verschwimmt bereits. Zuerst habe ich Geschichten erzählt, alles lief gut, dann war natürlich von Pabst die Rede, nach ihm werde ich immer gefragt, und dann ist alles in Unordnung geraten. Geärgert habe ich mich, vielleicht sogar geschrien, und ich habe mich an die Dreharbeiten von Molander erinnert, aber das kann eigentlich nicht sein, denn Molander haben wir nicht gedreht.
«Und dann hat der Chef gesagt, gut, laden wir ihn eben ein, und dann habe ich ihm die Fragen aufgeschrieben, wie immer.» Er schweigt einen Moment, dann sagt er: «Mein Vater war dabei.»
«Ihr Vater?»
«Bei den Statisten. Im Konzertsaal … In der Halle sieben, im Atelier in Barrandov, als Sie den Fall Molander gedreht haben.»
«Wo ist die Toilette?»
Ich muss stehen bleiben. Der Boden schwankt; mir ist, als müsste ich vornüberfallen. Aber er hat nicht recht, der Film wurde nie gedreht. Das weiß ich, weil ich dabei war. Ich war da, als wir den Film nicht gedreht haben. Ich erinnere mich daran, dass es nicht geschehen ist. Ich räuspere mich, ich will es ihm erklären.
«Ich habe überall gesucht», sagt er. «Es gibt keine Kopie. Das Negativ ist verloren. Sie sind wohl der Einzige, der die Muster gesehen hat. Außer Pabst natürlich. Aber Pabst ist tot.»
Ich drücke auf die Klinke der Toilettentür und gehe hinein. Für einen Moment befürchte ich, dass er mir folgen wird, aber zum Glück bleibt er draußen.
Die Tür fällt zu. Alles ist schwierig, die Kleidung widersetzt sich. Die tauben Finger kommen mit den Hosenknöpfen nicht zurecht, die Schüssel ist zu tief angebracht. Erst als ich sitze, fällt mir auf, dass die Papierrolle auf dem Boden liegt – ich ziehe daran, aber sie wickelt sich nur weiter ab, alles ist so mühsam. Mein Ellenbogen schmerzt, mein Rücken ist steif, meine Knie sind so schwach und wackelig, dass ich kaum aufstehen kann. Man sollte jung sterben. Als ich ein Kind war, kam immer der Doktor Sämann, wenn ich krank war. Seine kühle Hand auf meiner Stirn. «Sind wir krank?», sagte er immer, «haben wir Fieber?», und ich dachte, warum sagt er wir, er hat doch gar nicht Fieber, nur ich hab Fieber. Ich weiß nicht, warum er mir jetzt einfällt, ich habe seit Jahrzehnten nicht an ihn gedacht.
Als ich herauskomme, wartet ein junger Mann mit Brille. Seine Frisur ist unordentlich, seine Augen sind rot unterlaufen, als hätte er geweint. Wahrscheinlich ein Alkoholiker. Die jungen Menschen haben keine Haltung mehr.
«Was ist mit Ihnen?»
«Ich musste an meinen Vater denken.»
«Bringen Sie mich zur Straßenbahn?»
Er nimmt seine Brille ab, setzt sie wieder auf und sagt leise, nein, keine Straßenbahn, ein Auto werde mich fahren.
Wir gehen durch einen langen Gang. Von den Wänden grinsen Schauspielergesichter. Mit einigen habe ich gedreht. Dort zum Beispiel ist Peter Alexander.
«Das ist ein Profi», sage ich. «Der Peter! Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann schon am ersten Drehtag den ganzen Text. Eine junge Schauspielerin, ich sage den Namen jetzt nicht, weil sie inzwischen –»
«Schon gut!», sagt er scharf.
Ich verstumme gekränkt.
Und hier, zu allem Überfluss, ein Paternoster! Irgendwie taumele ich in die Kabine; fast wäre ich gefallen, aber er hält mich. Der Moderator, das weiß ich noch, war der berühmte Heinz Conrads. Sie werden sich ganz schön darüber ärgern im Sanatorium Abendruh, dass ich beim Heinz Conrads gewesen bin, während es für alle anderen nur ein weiterer endloser Sonntagvormittag mit schlechtem Frühstück war.
Kann es sein, dass die Sendung nicht gut gelaufen ist? Ich erinnere mich an Aufregung, an dumme Fragen, es gab Ärger, jemand hat mich beleidigt; oder ich habe jemanden beleidigt, eines von beidem. Über Pabst ist natürlich auch gesprochen worden, das versteht sich von selbst, alle fragen nach ihm, meine eigene Laufbahn als Regisseur war lächerlich, da gibt es nichts zu beschönigen. Das Einzige, was wichtig an mir ist: dass ich mal sein Assistent war.
Der junge Mann schiebt mich aus dem Paternoster, hält mich wieder. Wir durchqueren die Lobby. Hier ist auch noch eine Drehtür. Die Glaswände rotieren, Spiegelungen durchdringen einander, ich schiebe mich vorwärts und stehe auf der Straße. Ich sollte mich bald hinlegen.
Am Straßenrand parken drei Autos, auf jedem davon steht Österreichischer Rundfunk. Der junge Mann, wie heißt er noch?, öffnet die Tür des vordersten und hilft mir beim Einsteigen.
«Mein Vater hat überlebt», sagt er. «Falls Sie es wissen wollen.»
«Das freut mich.» Was ist denn jetzt mit seinem Vater?
Er sieht seltsam aus, seine Augen sind weit, wild und zugleich irgendwie voll Mitleid. Er sieht beinahe verrückt aus. Er öffnet den Mund, aber dann schüttelt er den Kopf und schlägt die Tür einfach zu. Die jungen Menschen haben kein Benehmen mehr.
Das Auto fährt an. Auf dem Rücksitz liegt eine vergessene Ausgabe der Volksstimme: Der Bundeskanzler hinter einem Rednerpult blickt ernst und drohend eine Gruppe von Männern in Anzügen an. Todesstoß für Kraftwerk Zwentendorf, sagt die Schlagzeile.
«In welcher Sendung waren Sie?», fragt der Fahrer.
«Heinz Conrads.»
«Den sieht meine Frau gern. Der ist ein Gentleman, sagt sie. So ein Mann aus der alten Zeit. Als Wien noch Wien war!»
«Und was ist Wien jetzt?»
Er antwortet nicht.
Ich versuche mich zu erinnern. Etwas ist geschehen, aber was? Es beginnt zu regnen, Wassertropfen ziehen geschwungene Linien übers Glas.
«Haben Sie zugeschaut?», frage ich.
«Ja wie denn!», sagt er in dem singenden Ton, in dem man mit Kindern und alten Leuten spricht. «Ich sitz doch den ganzen Tag im Wagen. Entweder fahre ich, oder ich warte darauf, dass jemand einsteigt. Ich kann erst abends fernsehen. Aber meine Frau hat es bestimmt gesehen.»
Draußen klappen Menschen Regenschirme auf. Ich lehne den Kopf an die kühle Scheibe. Ich kann es kaum erwarten zurückzukommen. Im Heim sind sicher alle krank vor Neid.
Moderner Held
Kein Windhauch, erstarrt die Palmen ums Schwimmbecken. Pabst kam es vor, als wäre er in ein koloriertes Foto geraten. Ein Vogel schwebte reglos über ihnen. Die Sonne spiegelte sich im Wasser so grell und rund, wie Kinder sie zeichnen. Die Zigarette schmeckte nach kalter Asche. Er sog, kein Rauch stieg auf. Der Mann im Liegestuhl, dessen Namen er vorhin nicht verstanden hatte, und jetzt war es zu spät zum Nachfragen, sah ihn an, ohne die orange getönte Brille abzunehmen.
Dann sprach der Mann, Pabst verstand kein Wort.
Er nickte. Was sollte er sonst auch tun? Seitdem er in Hollywood angekommen war, kämpfte er darum, sich nicht anmerken zu lassen, wie schlecht sein Englisch war.
Ermutigt durch Pabsts Nicken, sagte der Mann noch etwas, und jetzt verstand Pabst immerhin, dass er einen Film lobte, in dem es entweder um Cowboys oder um eine verliebte Frau ging. Der Mann hatte, auch das verstand Pabst, diesen Film entweder gerade gesehen oder noch nicht gesehen. Entweder hatte er ihn selbst produziert, oder aber er wollte ihn produzieren.
«Großartig», sagte Pabst. Great. Er wusste, dieses Wort war immer am Platz bei Amerikanern, so wie es auch nie falsch war, ihre Schuhe zu loben.
Der Mann sagte, dass er sich sehr freue, Pabst zu treffen, weil er ein großer Bewunderer von dessen Werken sei. Das verstand Pabst, weil es ihm alle sagten. Am Anfang hatte ihn das mit Stolz erfüllt und mit Vorfreude auf die Arbeit hier, aber inzwischen wusste er, dass es nichts bedeutete.
Der Mann sagte, dass seine Anwesenheit ein großes Glück und eine Chance für die Warner Brüder sei.
Pabst nestelte an seinem Kragen und lockerte seine Krawatte. Er hatte einen Fehler gemacht: In seinem Hotelzimmer war es der Klimaanlage wegen so kalt gewesen, dass er das dicke Leinenhemd und sein warmes Jackett angezogen hatte. Er spürte, dass ihm Schweißtropfen übers Gesicht liefen.
Er freue sich sehr über dieses Treffen, sagte Pabst. Er habe ja vieles gemacht, seit er seine Heimat verlassen musste, habe Filme in Frankreich gedreht, unter anderem Don Quixote mit dem Sänger Schaljapin …
Ja ja ja ja, sagte der Mann, ein großartiger Film. Great!
Pabst legte, weil es keinen Aschenbecher gab, seine Zigarettenkippe ins Gras. Es war unmöglich, dass der Mann Don Quixote gesehen hatte, es gab nur ein halbes Dutzend Kopien, keine davon befand sich in Amerika.
Weggeblasen habe ihn der Film, sagte der Mann. Jetzt hielt es ihn nicht mehr auf seinem Liegestuhl, er setzte sich kerzengerade auf und klatschte in die Hände. Der Film habe ihn völlig ausgelöscht! Habe seinen Kopf explodieren lassen, peng und zack, unglaublich, die reine Herrlichkeit!
Pabst nickte dankbar und nestelte an seiner Krawatte, um mehr Luft zu bekommen.
Aber am besten, sagte der Mann, habe ihm Metropolis gefallen.
Der sei nicht von ihm, sagte Pabst.
Der Mann lobte ihn für seine Bescheidenheit. Er konnte nicht älter als dreißig sein, und er war so dünn, dass sein Anblick Pabst, der sich selbst seit seinem zehnten Lebensjahr übergewichtig vorkam, mit Neid erfüllte.
Pabst brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass das sein Stichwort war: Bescheidenheit. Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die orange schillernden runden Gläser, in denen sich der Pool und sein eigenes schwitzendes Gesicht spiegelten. Plötzlich fiel ihm auf, dass der Vogel immer noch über ihnen im Himmel klebte. Er holte tief Luft.
Aber bevor er sprechen konnte, unterbrach ihn ein Diener. Er trug eine Livree, lächelte starr und fragte, was er bringen dürfe.
«Wasser bitte.» Pabst hätte lieber Alkohol getrunken, aber ihm fielen die richtigen Worte nicht ein.
Sein Gastgeber sagte etwas Unverständliches. Der Diener verbeugte sich und verschwand, ohne dass man ihn hätte davongehen sehen.
Also gut, sagte Pabst, an seiner Zigarette ziehend, er habe eine Idee, sie sei groß. Great. Ein Schiff, Luxus, auf hoher See. Auf einmal: Krieg erklärt! Streit, Passagiere überall, Gewalt auch. Spannung groß! Er schloss für einen Moment die Augen. Er hatte gehofft, sein Englisch würde besser werden, sobald er ins Reden kam, aber das geschah nicht. Und dabei war War Has Been Declared wirklich eine gute Idee, auf kleinstem Raum konnte man das Zerbrechen einer Zivilisation zeigen: elegante Menschen aus der ganzen Welt, eben noch in distinguierter Eintracht, aber auf einmal schleicht sich Misstrauen ein, Streit bricht aus, Fraktionen bilden sich, Menschen verfallen wahnhafter Wut. Er sah einen Mann mit einem Messer durch den Schiffsgang laufen, Blut troff ihm von den Ärmeln, er sah ein gesprungenes Bullauge, er sah zwei Frauen in Ballkleidern, die zitternd hinter einem umgeworfenen Tisch in einem einstmals eleganten Salon kauerten, und er sah den Höhepunkt: ein kleiner Mann mit Halbglatze, aschfahl im Gesicht, gespielt von Peter Lorre, mit gefesselten Händen an einem Kronleuchter aufgehängt, umringt von einer blutdürstigen Menge, und just in dem Augenblick, da sie ihn in Stücke reißen werden, fliegt die Tür auf. Ein Funker kommt herein und bringt die Nachricht, dass kein Krieg ausgebrochen ist, es war ein falscher Funkspruch, die Zivilisation besteht fort! Pabst sah vor sich, wie sie entsetzte Blicke wechselten, wie sie gar nicht wussten, wie sie jetzt weitermachen sollten, nachdem sie sich voreinander so entblößt hatten. Schnell steigt einer auf den Tisch und bindet Lorre los, und sogar der tut, als wäre nichts gewesen. Und dann die lange Kamerafahrt durch den Speisesaal, wo man die Tische wieder aufgestellt hat und sich zum Essen setzt. Viele von ihnen haben noch Wunden im Gesicht, und ihre Kleider sind zerrissen, aber zögernd beginnt der Pianist, oder nein, besser: beginnt eine Kapelle, von neuem Im Prater blüh’n wieder die Bäume zu spielen, und für die Mehrzahl der Zuschauer im Kino ist es tatsächlich ein glückliches Ende, nur für die kleine Minderheit, die alles begreift, ist es der blanke Schrecken.
«Schiff», hörte sich Pabst sagen. «Groß, reich, Menschen. Krieg! Alle wütend. Glas kaputt, und Spiegel, und Peter Lorre. Aber nicht wahr! Kein Krieg! Lustig, ernst, man weiß nicht! Kapelle spielt!» Er machte Bewegungen, als striche er eine Geige, dann summte er die Melodie des alten Wienerlieds, denn das immerhin konnte er ja, das ging in jeder Sprache.
Der Diener stellte zwei Martini auf einen kleinen Gartentisch. Also hatte man seine Bitte um Wasser missverstanden. Pabst nahm eines der Gläser und trank. Der kühle, leicht fettige Olivengeschmack des Alkohols tat ihm gut.
Großartig, sagte der Mann. Great. Was für eine Herrlichkeit. Er nippte an seinem Glas und lächelte dünn. Aber eine Klarheit sei noch nicht die Frage, wie sie beantwortet werden solle.
Pabst beugte sich vor, als könnte ihm das helfen, besser zu verstehen.
Und das Zweite, sagte sein Gastgeber und stellte das Martiniglas vorsichtig in den Rasen, aber das sei nicht das Entscheidende, denn das Erste komme zuvor, ja?
Pabst stellte sein Glas ebenfalls vor sich auf den Rasen und nahm die Brille ab, um sich die Augen zu reiben und seine Gläser an der Krawatte zu putzen. Erst als er die Brille wieder aufsetzte, sah er, dass sein Glas umgefallen war, der staubtrockene Boden saugte die Feuchtigkeit auf.
Pabst fragte, ob er das bitte wiederholen könne.
Aber statt zu antworten, zeigte sein Gastgeber zum Haus hinüber. Von dort kam ein Mann, dünn, im seidenen Hemd ohne Jacke, mit federnden Schritten.
Jake, rief der Gastgeber.
Bob, sagte der Neuankömmling.
Beide erklärten, dass es großartig sei, einander zu sehen. Sie schüttelten einander die Hände mit einer Begeisterung, als wären sie Brüder, die sich zum ersten Mal wiedersahen, nachdem das Schicksal sie in einer fernen, schweren Kindheit voneinander getrennt hatte.
Und das hier, sagte sein Gastgeber, von dem Pabst jetzt wenigstens wusste, dass er Bob hieß, sei Will Pabst. Der größte Regisseur Europas.
Will, sagte Jake. So glücklich sei er! Sein Händedruck war warm und fest.
Es freue ihn auch sehr, sagte Pabst.
Er kenne Wills Werk, sagte Jake. So eine übergroße Freude, man könne sie gar nicht beginnen zu beschreiben! Wochenlang habe er nach dem Dracula-Film nicht geschlafen. Filme aus Deutschland seien das Allergroßartigste, auch wenn der Tag dort manchmal mit dem Mond beginne.
Vor allem nachts, sagte Bob.
Beide lachten. Pabst fragte sich, was er gerade missverstanden hatte.
Also sei man jetzt einig, sagte Jake. A Modern Hero werde gedreht?
Nein, nein, sagte Pabst. Aufgeregt drückte er seine Zigarette an seinem Schuh aus. Das sei ein furchtbares Drehbuch. Ein ganz abscheuliches Melodram. Das könne er nicht machen.
Die beiden sahen ihn ein paar Sekunden lang mit ausdruckslosen Gesichtern an.
Es gebe in dem Film aber einen Zirkus, sagte Jake dann.
Und Einwanderer, sagte Bob.
Herzzerbrechend, sagte Jake. Um das zu unterstreichen, legte er beide Hände auf seine Brust.
Jean Muir und Richard Barthelmess, sagte Bob.
Die Besten der Besten, sagte Jake.
Und beide wollten es machen, sagte Bob. Hätten fest zugesagt!
Aber nur mit Will Pabst, sagte Jake.
Weil G.W. Pabst nunmal der Beste sei, sagte Bob.
Pabst räusperte sich. Aber wenn das so sei, sagte er dann, wenn er wirklich der Beste sei … Also wenn das stimme, dann könne man ihm doch vertrauen, dann hätte sein Urteil über ein Drehbuch doch Gewicht, oder?
Bob nippte an seinem Martini. Pabst sah sich selbst in seinen Brillengläsern.
Man habe volles Vertrauen, sagte Jake. Großes, warmes, herzliches Vertrauen. Aber die ersten Dinge müssten auch die ersten bleiben.
A Modern Hero sei bereit, sagte Bob. Die Schauspieler stünden bereit, das Drehbuch und der Hund seien bereit, es gebe grünes Licht, sogar die Kameraperson sei engagiert.
Wieso der Hund, fragte Pabst. Was für ein Hund?
Nun war es Bob, der sich vorbeugte und den Kopf schief legte, als gäbe es Störgeräusche, die sie daran hinderten, einander zu verstehen.
Jake fragte, wozu er denn einen Hund brauche.
Nein, sagte Pabst, er habe keinen Hund verlangt, er habe nur nach dem Hund gefragt, weil Bob von einem Hund gesprochen habe, aber das sei nun auch egal. Er musste sich wieder räuspern, sein Mund war trocken, er hätte jetzt gerne einen Schluck Wasser gehabt. Ob der Vogel wohl noch immer dort oben hing, an der gleichen Stelle? Er wagte nicht hinaufzusehen.
Na dann großartig, sagte Bob, enorm gutes Treffen, dann könne man es ja so machen.
Jake klatschte in die Hände, seine Begeisterung schien unbezähmbar – bebend erfüllte sie seinen ganzen Körper. Das sei so phantastisch gewesen, rief er. Das beste Treffen immer!
Nein, sagte Pabst.
Sie sahen ihn beide an, nicht ungehalten, sondern ohne Verständnis, als hätte sich vor ihnen etwas Unbegreifliches ereignet, ein Wunder der Natur, ein Rätsel, wie die Welt es bisher nicht gesehen hatte.
A Modern Hero sei ein grundschlechtes Skript, sagte Pabst. Nichts habe Sinn! Der Held sei dumm, das Mädchen sei dumm, die Geschichte sei kompliziert, aber dumm trotzdem! Alles sinnlos! Man müsse ihm das bitte glauben!
Er wartete. Die beiden schwiegen.
In Deutschland sei Hitler, sagte Pabst. Drum sei er hergekommen. Deswegen seien sie alle hier, die Flüchtlinge. Die Menschen hätten Angst vor neuem Krieg. War Has Been Declared erzähle genau davon: Schiff klein, aber ganze Welt im Schiff! Jeder würde verstehen. Er verspreche es!
Die beiden nickten, und für eine schwindelerregende Sekunde hielt Pabst es für möglich, dass er sie überzeugt hatte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen. Damals, als er Die freudlose Gasse gedreht hatte, hatten ihm alle gesagt, dass man keinen Film machen konnte, der einfach im Alltag spiele. In deutschen Filmen ging es um Drachen und Vampire und Geister und romantische Schatten, aber nicht um Mädchen, die ihre Körper aus Hunger verkauften, nicht um Inflation, nicht um verzweifelte Leute auf einer Wiener Straße, aber er hatte es trotzdem geschafft, und als er eine junge Schwedin für die zweite Hauptrolle hatte engagieren wollen, hatten ihm auch alle abgeraten, aber er hatte auf seiner Wahl bestanden, und der Film war ein Erfolg geworden, obwohl die Zensur ihn überall verstümmelt und kein Mensch ihn so gesehen hatte, wie er eigentlich hätte sein sollen. Sogar hier in Amerika war der Film berühmt, in Hollywood, wo er nun vor zwei dämonischen Idioten saß, denen er sich nicht verständlich machen konnte. Und nach der Freudlosen Gasse hatte er Wedekinds Lulu verfilmt und wieder eine junge Frau gefunden, die noch keiner kannte, eine Amerikanerin mit einem Charisma, wie er es noch nie erlebt hatte, und der Film hatte die Welt erobert. Zählte das alles nichts?
Alle im Studio, sagte Jake, alle bei den Warner Brüdern liebten A Modern Hero.
Vertrauen Sie uns, Will, sagte Bob.
Danach könne man sehen, sagte Jake.
Als er nach Hollywood gekommen sei, rief Pabst, hätten alle zu ihm gesagt: Mach, was du willst! Mach, was du in Deutschland gemacht hast, nur noch besser! Alle hätten das gesagt!
Und jetzt war es passiert: Er war laut geworden. Und dabei hatten ihn alle gewarnt, dass das die eine Sache war, die in Amerika nicht passieren durfte. Es gebe hier kein Nein, hatte Lubitsch ihm erklärt, auch wenn man jemandem sagen wolle, dass er nicht recht habe, müsse man ihm zuerst sagen, wie recht er habe.
Wir hören Sie, sagte Jake.
Wir verstehen, sagte Bob.
Aber es ist so, sagte Jake.
Dass A Modern Hero wirklich ein großartig außergewöhnlich erstaunlicher Film sein werde, sagte Bob. Alle dächten das.
Jeder, sagte Jake.
Und deswegen, sagte Bob, müsse George Will Pabst den Film drehen. Weil George Will Pabst der Beste sei. In Deutschland, in Europa, überall!
Und weil er der Beste sei, sagte Pabst, wolle man ihm ein altes, schlechtes Drehbuch geben und Schauspieler aus der zweiten Schlange?
Schlange?, wiederholte Bob.
Ja wie auch immer man das sage, rief Pabst. Der zweiten Linie. Reihe!
Jake und Bob nickten nachdenklich. Und jetzt war auch der Diener wieder da, beugte sich vor und fragte mit dem gleichen funkelnd mechanischen Lächeln, ob er noch etwas bringen dürfe.
Alle seien gut, sagte Bob. Aber danke, Jim! Es sei ausnehmend nett.
Also dann sei ja alles fein, sagte Jake. Dann habe man sich verstanden. Wie wunderbar das sei.
Ganz großartig, sagte Bob.
Man werde so viel zusammen machen, sagte Jake. Zuerst A Modern Hero. Das werde so aufregend!
Und danach, sagte Bob, wenn A Modern Hero ein gewaltiger Erfolg geworden sei, woran es keinen Zweifel gebe, dann werde man wohl auch früher oder später die großartige Idee mit dem Schiff verfolgen!
Die beiden standen auf. Und Pabst, der nicht wusste, was er sonst tun sollte, tat es ihnen nach. Bob legte ihm den Arm um die Schulter, und so gingen sie los, in schönster Eintracht, in Richtung der Straße.
Da man sich einig sei, könne man die Details erledigen, sagte Bob. Seine Leute würden Pabsts Leuten das Nötige schicken.
Pabst nickte, ohne zu begreifen, was das heißen sollte. Denn sie waren ja nicht einig, und zudem wusste er auch nicht, von welchen Leuten Bob sprach, er war ein Emigrant, außer seiner Frau und seinem kleinen Sohn hatte er keine Leute! In Deutschland war er von Mitarbeitern umgeben gewesen, in Frankreich hatte er immerhin noch Produzenten und Agenten gehabt, aber hier hatte er niemanden.
Er blieb stehen. Das brauchte einige Willensanstrengung, weil Bob ihn ja in seiner Umarmung voranschob.
«Nein», sagte Pabst.
Jake hinter ihnen fragte, ob alles in Ordnung sei.
Die Sonne war so hell. Pabst hörte eine Mücke sirren. Sie verstummte, einen Moment später fühlte er ihren Stich an der Wange. Er schlug zu, jetzt klebte sie an seinen Fingern.
«Nein», wiederholte er.
Die beiden lächelten starr.
«Nichts ist in Ordnung», sagte Pabst. «Nichts.»
Pfauen
Sie hatte ihn eine Dreiviertelstunde warten lassen; nicht weil sie beschäftigt gewesen wäre, sondern weil sie es bei jedem Besucher so hielt. Die ganze Zeit hatte sie am Fenster gestanden und den bunten Vögeln beim Herumspazieren zugesehen. Der Gärtner hatte ihr einmal die Namen all der Gattungen aufgezählt, aber ihr Gedächtnis war nie gut gewesen, normalerweise stand beim Drehen jemand mit einem Schild neben der Kamera, auf dem in großen Buchstaben ihr Text zu lesen war. Deshalb hatte sie sich einen gewissen fahrig suchenden Blick angewöhnt, der auf der Leinwand sehr geheimnisvoll aussah.
Der Grund dafür, dass sie so gerne Ziervögel beobachtete, war, dass sie eigentlich Drehbücher hätte lesen sollen. Jeden Tag kamen neue, sie kamen mit Empfehlungen, mit flehentlichen Bitten, mit Gebeten. Niemand in dieser Stadt schrieb ein Drehbuch ohne die Hoffnung, dass sie es wider alle Wahrscheinlichkeit lesen und die Hauptrolle annehmen würde.
Zu ihrer Überraschung freute sie sich darauf, ihn wiederzusehen. Kurz betrachtete sie sich im Spiegel: Sie trug ein einfaches braunes Seidenkleid und keine Schuhe. Ihr Gesicht war nicht geschminkt, die Haare fielen ihr glatt auf die Schultern. Sie prüfte ihren Gesichtsausdruck, die Züge waren so reglos und unlesbar, wie sie sein sollten. Sie atmete aus und öffnete die Tür zum Besuchszimmer.
Dieses lag wie immer in kühlem Halbdunkel. Es gab darin nur eine Couch, einen kleinen Marmortisch, auf dem schon seit über einem Jahr der immer gleiche noch nie geöffnete Roman von Rupert Wooster lag, und einen niedrigen Lehnstuhl mit sehr gerader Rückenlehne. Der war natürlich für sie. Fast alle Besucher begriffen das instinktiv, nur ganz selten setzte sich einer statt auf das Sofa in den Stuhl. Wenn das passierte, entschuldigte sie sich schnell mit Kopfschmerzen und ließ den betreffenden Dummkopf nie wieder ins Haus.
Pabst saß natürlich auf dem Sofa. Vorgebeugt saß er, die Ellenbogen auf die Knie gestützt, die Brille vorne auf der Nasenspitze. In seinem Mundwinkel steckte eine Zigarette, die er, weil ihr Butler jeden Besucher bat, nicht zu rauchen, nicht angezündet hatte.
Er sah auf. Da die Vorhänge geschlossen waren und das Zimmer hinter ihr in hellem Licht lag, konnte er nur ihre Silhouette sehen. So machte sie es immer: Die Augen der Gäste mussten sich erst anpassen, um sie zu erkennen.
Er blickte sie an, und hier war es, das breite, aber kühle Lächeln, an das sie sich so gut erinnerte, das Pabst-Lächeln. Zugleich bewegte sein Körper sich zurück, und die Augen kniffen sich einen Moment zusammen, als sähe er in zu starkes Licht. Dann stand er auf.
«Mon pape», sagte sie und streckte den Arm aus. Er nahm mit einer perfekten Geste, eingeübt in einer Wiener Tanzschule zu einer Zeit, als noch ein Kaiser regierte, ihre Hand und bückte sich zu einem angedeuteten Handkuss, ohne dass seine Lippen ihre Haut berührten. Lächelnd deutete sie einen Knicks an.
«Greta», sagte er, «einer anderen … Jeder anderen würde ich sagen, Sie werden immer schöner. Aber nicht Ihnen.»
«Nicht mir?»
«Es ist zu offensichtlich. Es wäre die platteste Feststellung. Als wollte man Regen nass nennen oder die Nordsee kalt.»
Sie senkte den Kopf, als wollte sie sich bedanken, wofür es natürlich keinen Anlass gab, denn er hatte ja recht, sie war die schönste Frau der Welt, und jeder wusste es. Das war es auch, was ihr Leben so schwer machte. Alle verhielten sich verschreckt in ihrer Gegenwart, besorgt und wirr, Frauen nicht weniger als Männer. Übergroße Schönheit war schwer zu ertragen, sie verbrannte etwas in den Menschen um sie, sie war wie ein Fluch. Manchmal schien es ihr, als würde sie sich bald vor der Welt verstecken müssen. Dann würde sie nur mehr am Fenster sitzen und ihre Vögel betrachten.
«Ich höre, Sie haben einen Film gedreht?»
«A Modern Hero», sagte er leise.
«Wer spielt die Hauptrolle?» Sie ließ sich in ihren Stuhl nieder. Er setzte sich wieder aufs Sofa, trotz seines Gewichtes so vorsichtig, dass die Federn kein Geräusch von sich gaben. Dieser schwere Mann hatte immer schon Anmut besessen.
«Jean Muir», sagte er, und seine Augen blitzten, weil er natürlich verstanden hatte, dass sie nicht die männliche Hauptrolle meinte.
«Warum haben Sie nicht mich gefragt, mon pape?»
«Hätten Sie es in Erwägung gezogen?»
«Ich kann doch Ihnen nichts abschlagen.»
Beide wussten, dass das eine Lüge war. Aber er neigte den Kopf und tat, als glaubte er es. «Nie hätte ich es gewagt, Ihnen so etwas anzubieten. Ein jämmerliches Drehbuch, ein armseliges Budget, und der Produzent hat sich ständig eingemischt. Sie müssen sich vorstellen, er hat mir Kameraeinstellungen vorgeschrieben! Ich habe … Sie wissen, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe die Kunst der bewegten Kamera miterfunden. Und danach hat er sich noch in den Schnitt eingemischt. Immerhin habe ich ihnen das Happy End verdorben. Der moderne Held wird jetzt von der Frau verlassen und kehrt zurück zur Mutter.»
Sie lachte.
«Und Richard Barthelmess. Warum wird so jemand Schauspieler! Sie wissen, dass ich Schauspieler zu ihrer Größe führen kann, Greta. Aber nicht ihn.»
«Haben Sie bei ihm auch schneller gekurbelt?»
Damals, an den ersten Drehtagen in Berlin, war sie wie vor Nervosität erstarrt gewesen. So fremd war ihr alles erschienen – die Zeppelinhalle in Berlin eisig kalt unter den Jupiterlampen, Regisseur und Kameramann hatten dicke Mäntel getragen, während sie in ihrem tief ausgeschnittenen Georgettekleid gefroren hatte; aber noch schlimmer als die Kälte war ihr Lampenfieber gewesen, ihre Angst, ihr Unbehagen an ihrem schmalen frierenden Körper. Und da war er auf die Idee gekommen, den Kameramann immer dann, wenn ihr Gesicht zu sehen war, schneller kurbeln zu lassen. Es war ein regelrecht magischer Trick: Jede dieser Zeitlupengroßaufnahmen zeigte ein rätselhaftes, undurchdringlich vieldeutiges Mienenspiel, von dem man nicht den Blick lassen konnte. Bei ihren nächsten Filmen hatte sie es ebenso machen lassen.
«Bei Barthelmess hilft das nicht, glauben Sie mir. Weder Seelenarbeit noch Kurbel. Ich werde beim Drehen nie laut, aber manchmal war ich kurz davor, ihn anzuschreien.»
«Warum lässt Pabst sich zu so einem Film herab?»
«Weil Pabst ein Flüchtling ist. Heimat- und hilflos.»
«Heimatlos mag Pabst sein», sagte sie, «aber ich kenne ihn schon lange und weiß, hilflos ist er nie.»
«Nicht, solange er Freunde hat.»
«Zu denen ich mich rechnen darf?»
«Greta, dass ich der Ihre bin, wissen Sie. Dass Sie mir auch freundschaftlich gesinnt sind, darf ich doch immer noch hoffen?»
Sie nickte lächelnd – stolz darauf, dass ihr Deutsch gut genug war, um diesen Satz verstanden zu haben. Ja, natürlich war er hier, weil er etwas von ihr wollte. Das überraschte sie nicht. Jeder wollte etwas, immerzu. Die Menschen konnten nicht anders.
«Ich habe eine Idee», sagte er. «Reiche und arme Leute auf einem Ozeanschiff, ein Salon, ein Orchester, edle Gesittung, Tee und Kuchen, Likörgläser, aber plötzlich kommt ein Funkspruch: Der Krieg wurde erklärt!»
«Sie wollen noch einen Kriegsfilm drehen?»
«Nein. Und ja. Aber doch nein. Denn der Funkspruch ist falsch. Und auf dem Schiff bricht dennoch Krieg aus. Die Passagiere kämpfen, Gruppen bilden und bewaffnen sich, vielleicht gibt es sogar Tote, unter Umständen wäre das zu viel, vielleicht nicht. Müsste man überlegen. Aber dann stellt sich heraus, dass es nur ein Irrtum war. Eine Illusion. Und dann – Greta, das ist das Wichtigste! – müssen aber alle weitermachen mit der Schmierenkomödie der Zivilisation. Als wäre nichts gewesen.»
Sie schwieg einen Moment, bevor sie sagte: «Das ist gut.»
«Und, wollen Sie?»
«Es ist kein Film für mich.»
«Wenn ich ihn drehe, ist es ein Film für Sie.»
«Es ist ein Film für ein Ensemble. Ein Pabst-Film. Kein Garbo-Film.»
«Sie vertrauen Ihrem Entdecker nicht mehr?»
Sie betrachtete ihn neugierig. Nun sah man ihm die Nervosität doch an. Er nahm den Wooster-Roman, blätterte achtlos, legte ihn weg.
«Es ist richtig, dass Sie mich entdeckt haben, aber diese Entdeckung hat auch Sie groß gemacht. Und danach haben Sie Louise Brooks entdeckt, die Sie noch größer gemacht hat. Wollen Sie nicht sie fragen?»
Er senkte den Kopf, rückte an seiner Brille, nahm die nicht angezündete Zigarette aus dem Mund und schob sie in seine Brusttasche. Es tat ihr leid, dass sie so mit ihm hatte sprechen müssen, aber eines hatte die Erfahrung sie gelehrt: Regisseure akzeptierten kein sanftes Nein, was schlicht und einfach daran lag, dass Menschen, die ein sanftes Nein akzeptierten, nie Regisseure hätten werden können.
«Ich schreibe eine Rolle für Sie. Eine feine Dame, die sich im vermeintlichen Krieg auf dem Schiff als wahnsinnig entpuppt, als blutrünstig und hochgefährlich. Wahnsinn würden Sie gut spielen, Greta, Sie haben das nervöse Temperament. Zusammen schaffen wir etwas Unvergessliches. Zum zweiten Mal.»
Sie stand auf und trat ans Fenster. Durch den Spalt im Vorhang sah sie eine Palme im Wind zittern. Das Meer musste jetzt herrlich sein. Und theoretisch konnte sie es ja tun – zum Strand fahren, in die Gischt springen, sich von den Wellen hierhin und dorthin werfen lassen. Aber in Wirklichkeit ging es natürlich nicht: Menschen würden zusammenlaufen, Reporter mit Kameras auftauchen, die Zeitungen würden darüber schreiben: Garbo spotted on the beach.
Vielleicht sollte man es ja wirklich tun. Vielleicht sollte man ja sagen zu seinem Film. Er konnte es wohl noch, er war älter als damals, aber alt war er noch nicht. Und es stimmte natürlich, dass sie ihm den Ruhm verdankte.
Er hatte ihr damals beigebracht, wie man an einer Rolle arbeitete. Keine Gesten, hatte er gesagt, beweg kaum dein Gesicht, spiel nicht. Das Leid dieses Mädchens ist nicht etwas, das du empfindest, es ist nicht einmal etwas, von dem du weißt, es ist die Substanz deines Daseins, deine Atemluft, und doch widerstehst du, das Leid verschlingt dich nicht, du siehst dich noch nach Wegen um, du willst entkommen. Wenn das Leben dich einmal zerbrochen hat, gibst du auf, aber so weit ist es nicht. Er hatte ihr das mit einem Ernst erklärt, von dem sie gar nicht gewusst hatte, dass Menschen beim Film ihn besitzen konnten. Film – das war bis vor kurzem Spektakel und Augenrollen gewesen, Cowboys mit Pistolen, Zweikämpfe unter Rittern, Geister in der Nacht und Clowns, die vor Polizisten flohen. Aber wenn er sprach, klang es mit einem Mal wie Theater, wie ein Roman, wie echte Kunst. Denk nicht an die Kamera, denk am besten überhaupt nicht. Ich habe alles Notwendige schon getan, als ich dich besetzt habe.