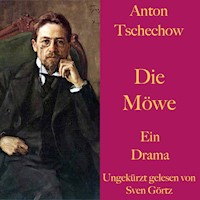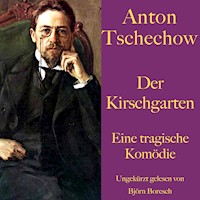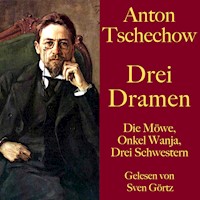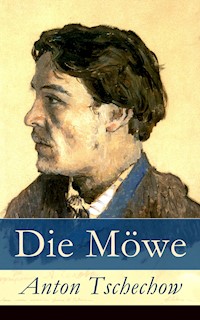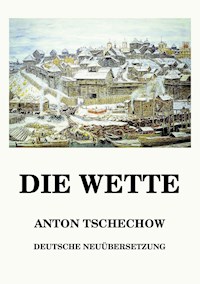1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. »Es ist langweilig ohne eine starke Liebe«, schreibt Anton Tschechow in einem Brief aus dem Jahr 1892. Was aber, wenn es nur noch die Angst vor der Langeweile ist, die zur starken Liebe führt? Und was tun, wenn die einst starke Liebe immer schwächer wird? Die nächste Liebe suchen? Was ist überhaupt so schlimm an der Langeweile? – Kein anderer Autor hat die Liebe so feinfühlig und nüchtern seziert wie der große russische Erzähler Anton Tschechow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Anton Tschechow
Liebesgeschichten
Aus dem Russischen von Alexander Eliasberg
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Von der Liebe
Zum Frühstück gab es ausgezeichnete Pasteten, Krebse und Hammelkoteletts; während man am Tische saß, kam der Koch Nikanor herauf, um zu fragen, was die Gäste zum Mittag wünschten. Der Koch war ein Mann von mittlerem Wuchs, mit aufgedunsenem Gesicht und kleinen Augen. Es war bartlos, sah aber so aus, als ob sein Schnurrbart nicht wegrasiert, sondern ausgerupft wäre.
Aljochin erzählte, dass die hübsche Pelageja in diesen Koch verliebt sei. Sie wolle aber den Säufer und Raufbold nicht heiraten, sei jedoch bereit, mit ihm »einfach so« zu leben. Er sei aber sehr religiös, und seine Überzeugungen gestatteten ihm nicht, mit ihr »einfach so« zu leben; er bestehe darauf, dass sie ihn heirate, und wenn er betrunken sei, so beschimpfe er sie und schlage sie sogar. So oft er betrunken sei, flüchte sie hinauf und weine, und in solchen Fällen blieben Aljochin und die Dienstboten stets zu Hause, um sie im Notfalle in Schutz zu nehmen.
So kam das Gespräch auf die Liebe.
»Wie die Liebe entsteht«, sagte Aljochin, »warum Pelageja sich nicht in einen andern Mann, dessen seelische und äußere Eigenschaften besser zu ihr passten, sondern gerade in Nikanor, diese Schnauze – man nennt ihn hier überall ›Nikanor die Schnauze‹ – verliebt hat; inwiefern für die Liebe Gründe des persönlichen Glücks maßgebend sind – all das ist unbekannt, und es steht jedem frei, diese Frage in jedem beliebigen Sinne zu behandeln. Von der Liebe ist bisher nur eine einzige unbestreitbare Wahrheit gesagt worden, nämlich, dass ›dieses Geheimnis groß ist‹; doch alles Übrige, was von der Liebe je gesprochen oder geschrieben wurde, ist keine Lösung, sondern nur eine neue Formulierung der Fragen, die stets ungelöst bleiben. Eine Erklärung, die für irgendeinen bestimmten Fall zu taugen scheint, taugt für zehn andere Fälle gar nicht; das Beste ist wohl, so glaube ich wenigstens, jeden einzelnen Fall für sich zu behandeln und Verallgemeinerungen zu vermeiden. Man muss, um mit den Ärzten zu sprechen, die Fälle individualisieren.«
»Sehr richtig«, bemerkte Burkin.
»Wir anständige Russen haben stets eine Vorliebe für solche Fragen, die ungelöst bleiben müssen. Sonst pflegt man die Liebe zu poetisieren und mit Rosen und Nachtigallen auszuschmücken; aber wir schmücken unsere Liebe nur mit diesen schicksalsschweren Fragen aus, wobei wir unter ihnen die uninteressantesten auswählen. Als ich noch Student in Moskau war, hatte ich ein Verhältnis mit einer recht lieben Dame, die jedes Mal, wenn sie in meinen Armen lag, nur daran dachte, wie viel Geld ich ihr monatlich geben würde und was jetzt das Rindfleisch kostete. So sind auch wir; wenn wir lieben, beschäftigen wir uns fortwährend mit ähnlichen Fragen: ob es anständig oder unanständig von uns sei, ob klug oder dumm, wohin diese Liebe führen könne und so weiter. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht; aber ich weiß, dass es stört und ärgert und jeden Genuss verleidet.«
Man hatte den Eindruck, dass er etwas erzählen wollte. Menschen, die zurückgezogen leben, haben immer etwas auf dem Herzen, was sie gerne erzählen möchten. Daher gehen Junggesellen so gerne ins Dampfbad oder ins Restaurant, um ihr Herz auszuschütten und den Bademeistern und Kellnern Geschichten zu erzählen, die zuweilen sehr interessant sind; und auf dem Lande schütten solche Menschen ihr Herz vor den Gästen aus. Man sah aus dem Fenster einen trostlos grauen Himmel und vom Regen durchnässte Bäume; bei solchem Wetter konnte man wirklich nichts Besseres anfangen, als erzählen oder zuhören.
»Ich lebe hier in Ssofjino und bewirtschafte dieses Gut seit vielen Jahren«, begann Aljochin, »seit ich die Universität absolviert habe. Meiner Erziehung nach bin ich Faulenzer, meinen Neigungen nach – Stubenhocker und Bücherwurm; als ich herkam, war das Gut arg verschuldet, und da mein Vater diese Schulden gemacht hatte, um mir die beste Erziehung geben zu können, so fasste ich den Entschluss, hier zu bleiben und zu arbeiten, bis ich alle Schulden bezahlt haben würde. Das hatte ich mir vorgenommen und stürzte mich in die Arbeit, offen gestanden, nicht ohne einigen Widerwillen. Der Boden ist hier wenig ergiebig, und wenn man ihn ohne Verlust bewirtschaften will, so muss man entweder eine Anzahl leibeigene oder gedungene Landarbeiter – es kommt ja auf dasselbe hinaus – beschäftigen, oder aber die Wirtschaft auf Bauernart betreiben, d.h. selbst mit seiner ganzen Familie im Felde arbeiten. Einen Mittelweg gibt es nicht. Damals machte ich aber keine solchen feinen Unterschiede. Ich ließ kein Fleckchen Boden unbestellt, ich trieb alle Männer und Weiber aus den nächsten Dörfern zusammen, und die Arbeit ging wie mit Dampf; ich pflügte, säte und mähte mit eigenen Händen, langweilte mich aber dabei und rümpfte oft die Nase, wie eine Dorfkatze, wenn sie vor Hunger im Gemüsegarten Gurken frisst; mein ganzer Körper war wie zerschlagen, und ich schlief oft im Stehen. In der ersten Zeit glaubte ich, dieses Arbeitsleben mit den Angewohnheiten eines Kulturmenschen vereinen zu können: ich glaubte, dass es dazu genüge, in seinem Leben eine gewisse äußere Ordnung einzuhalten. Ich bewohnte die Paraderäume im Obergeschoss, ließ mir nach jeder Mahlzeit Kaffee mit Likör reichen und las allabendlich vor dem Einschlafen den ›Europäischen Boten‹. Einmal besuchte mich aber unser Dorfpope P. Iwan und trank auf einen Zug alle meine Liköre aus. Und der ›Europäische Bote‹ befand sich von nun an ständig in Händen der Popentöchter: während der Erntezeit war ich immer so müde, dass ich fast niemals in mein Bett kam, sondern in einem Schlitten, der in der Scheune stand, oder in einer Waldhütte einschlief; wie konnte ich da ans Lesen denken? So siedelte ich allmählich in die unteren Räume über, aß mit dem Hausgesinde in der Küche zu Mittag, und von allem früheren Prunk blieb mir nur diese Dienerschaft zurück, die ich noch von meinen Vater geerbt habe und die zu entlassen ich nicht übers Herz bringen konnte.
Gleich im ersten oder zweiten Jahre wurde ich zum Ehren-Friedensrichter gewählt. Nun musste ich ab und zu in die Stadt fahren, um an den Sitzungen des Bezirksgerichts teilzunehmen; das brachte einige Abwechslung in mein Leben. Wenn man hier so an die zwei, drei Monate ununterbrochen gelebt hat, besonders im Winter, so sehnt man sich schließlich nach einem Gehrock. Im Bezirksgericht gab es aber Gehröcke, Uniformen und Fräcke in Hülle und Fülle; lauter Juristen mit Hochschulbildung, also Menschen, mit denen ich sprechen konnte. Nach den Nächten im Schlitten und in der Scheune und dem Essen in der Küche war es ein ganz besonderer Genuss, in reiner Wäsche und leichten Schuhen, mit einer Richterkette auf der Brust in einem weichen Lehnsessel zu sitzen.
In der Stadt wurde ich überall freundlich empfangen und schloss gerne Bekanntschaften. Unter diesen war mir, offen gestanden, die Bekanntschaft mit dem Vizepräsidenten des Bezirksgerichts Luganowitsch die angenehmste. Sie kennen ihn ja beide: er ist ein reizender Mensch. Es war gleich nach dem berühmten Brandstifterprozess; die Verhandlungen hatten zwei Tage gedauert, und wir waren beide todmüde. Luganowitsch blickte mich an und sagte:
›Wissen Sie was? Kommen Sie doch zu mir zum Mittagessen.‹
Das kam sehr unerwartet, denn wir kannten uns nur rein offiziell, und ich war noch kein einziges Mal bei ihm im Hause gewesen. Ich ging also zu mir ins Hotel, zog mich um und begab mich zu ihm. Bei dieser Gelegenheit lernte ich Luganowitschs Gattin, Anna Alexejewna kennen. Sie war damals noch sehr jung, kaum über zweiundzwanzig, und hatte erst vor einem halben Jahre ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das Ganze gehört ja schon der Vergangenheit an, und ich kann heute gar nicht sagen, was an ihr so ungewöhnlich gewesen war, das auf mich solchen Eindruck machte; aber damals beim Mittagessen war mir das vollkommen klar; ich sah vor mir eine junge, hübsche, gute, gebildete, entzückende Frau, wie ich eine solche noch niemals gesehen hatte. Und ich fühlte in ihr sofort ein so verwandtes und vertrautes Wesen, als hätte ich ihr Gesicht mit den freundlichen, klugen Augen schon einmal in meiner Kindheit im Photographienalbum, das auf der Kommode meiner Mutter lag, gesehen.
Im Brandstifterprozess wurden vier Juden verurteilt, wobei man als strafschärfend, meiner Ansicht nach mit Unrecht, das Vorhandensein einer bandenartigen Organisation annahm. Während des Essens sprach ich immer vom Prozess und regte mich sehr auf. Es war mir so schwer ums Herz, und ich weiß nicht mehr, was ich alles zusammenredete; aber ich weiß noch, wie Anna Alexejewna fortwährend den Kopf schüttelte und zu ihrem Mann sagte:
›Dmitrij, wie ist es nur möglich?‹
Luganowitsch war im Grunde genommen gutmütig, hielt aber hartnäckig an der Ansicht fest, dass ein Mensch, der vor Gericht steht, unbedingt der Schuldige sei und dass man seine Zweifel über das Urteil nur auf dem vorgeschriebenen Instanzenwege und schriftlich, aber keineswegs in einem Privatgespräch beim Mittagessen äußern dürfe.
›Wir beide haben ja keine Brandstiftung begangen‹, sagte er mild, ›wir stehen nicht vor Gericht und kommen auch nicht ins Zuchthaus.‹
Alle beide, Mann und Frau, nötigten mich, möglichst viel zu essen und zu trinken; aus verschiedenen Kleinigkeiten, z.B. wie sie gemeinsam den Kaffee bereiteten und wie gut sie einander fast ohne Worte verstanden, konnte ich schließen, dass sie glücklich und friedlich zusammen lebten und sich über jeden Gast von Herzen freuten. Nach dem Essen spielte man vierhändig Klavier, und als es dunkel wurde, nahm ich Abschied und fuhr heim. Das war in den ersten Frühlingstagen. Den folgenden Sommer verbrachte ich ohne Unterbrechung in Ssofjino und hatte gar keine Zeit, an die Stadt zu denken; doch die Erinnerung an die schlanke, blonde Frau lebte in mir alle diese Tage; ich dachte eigentlich gar nicht an sie, aber die Erinnerung ruhte wie ein leichter Schatten auf meiner Seele.
Im Spätherbst gab es in der Stadt irgendeine Wohltätigkeitsvorstellung. Der Gouverneur ließ mich in seine Loge bitten; als ich während eines Zwischenaktes in die Loge eintrat, sah ich neben der Gouverneurin Anna Alexejewna sitzen. Und ich geriet wieder in den Bann ihrer Schönheit und ihrer lieben freundlichen Augen; und mich überkam von neuem das Gefühl der seelischen Nähe.
Wir saßen nebeneinander und gingen nachher zu zweit im Foyer auf und ab.
›Sie sind etwas abgemagert‹, sagte sie. ›Waren Sie krank?‹
›Ja. Ich habe rheumatische Schmerzen in der Schulter und kann bei regnerischem Wetter fast gar nicht schlafen.‹
›Sie sehen wirklich schlecht aus. Damals im Frühjahr, als Sie bei uns zu Mittag aßen, schienen Sie jünger und rüstiger. Sie waren damals aufgeregt, sprachen sehr viel und interessant, und ich muss gestehen, dass Sie auf mich Eindruck machten. Aus irgendeinem Grunde musste ich an Sie im Laufe des Sommers oft denken; auch heute, vor dem Theater, kamen Sie mir in den Sinn, und ich hatte das Gefühl, dass ich Sie hier treffen werde.‹
Sie lachte.
›Aber heute sehen Sie schlecht aus‹, wiederholte sie. ›Das macht Sie älter, als Sie sind.‹
Am folgenden Tage frühstückte ich bei den Luganowitschs; nach dem Frühstück fuhren sie nach ihrer Sommerwohnung hinaus, um allerlei Anordnungen für den Winter zu treffen, und ich begleitete sie. Dann kehrte ich mit ihnen in die Stadt zurück und trank bei ihnen um Mitternacht, in friedlichstem Familienkreise, Tee; im Kamin brannte ein lustiges Feuer, und die junge Mutter ging jeden Augenblick hinaus, um zu sehen, ob ihre Kleine ruhig schlafe. So oft ich später in die Stadt kam, besuchte ich regelmäßig die Luganowitschs. Sie gewöhnten sich an mich, und ich mich an sie. Meistens erschien ich unangemeldet, wie ein naher Verwandter.
›Wer ist da?‹, hörte ich aus einem fernen Zimmer die gedehnte Stimme, die mir damals so schön erschien.
›Es ist Pawel Konstantinowitsch‹, antwortete das Dienstmädchen oder die Kinderfrau.
Anna Alexejewna kam mir mit etwas besorgtem Gesicht entgegen und fragte jedes Mal:
›Warum hat man Sie so lange nicht gesehen? Ist etwas passiert?‹
Ihr Blick, die schöne, vornehme Hand, die sie mir reichte, ihr Hauskleid, ihre Frisur, ihre Stimme und der Klang ihrer Schritte machten auf mich jedes Mal den gleichen Eindruck von etwas Neuem, Ungewöhnlichem und für mich sehr Wichtigem. Wir verbrachten die Zeit in langen Gesprächen und auch in langem Schweigen, wobei ein jeder das seinige dachte; oder sie spielte mir etwas vor. Wenn aber niemand zu Hause war, so blieb ich da und wartete. Ich unterhielt mich mit der Kinderfrau, spielte mit der Kleinen oder lag auf dem türkischen Sofa im Herrnzimmer und las eine Zeitung; wenn Anna Alexejewna nach Hause kam, empfing ich sie im Vorzimmer, nahm ihr alle ihre Pakete ab und trug sie mit solcher Liebe, mit solchem Triumph ins Zimmer, als ob ich ein verliebter Knabe wäre.
Es gibt ein russisches Sprichwort: ›Die Frau hatte zu wenig Sorgen und schaffte sich darum ein Ferkel an.‹ Die Luganowitschs hatten zu wenig Sorgen und machten darum meine Bekanntschaft. Wenn ich einmal lange ausblieb, so hieß es gleich, dass ich krank sei oder dass mir etwas zugestoßen sei, und beide waren dann um mich sehr besorgt. Es machte ihnen auch Sorge, dass ich, ein gebildeter Mann mit großen Sprachkenntnissen, statt mich mit Wissenschaft oder Literatur zu beschäftigen, draußen auf dem Lande lebte, mich abrackerte und dabei meistens kein Geld hatte. Sie glaubten, dass ich darunter sehr leide und, wenn ich spreche, lache oder esse, es nur dazu tue, um meine Qualen zu verbergen; selbst in den lustigsten Augenblicken, wenn mir wirklich wohl zumute war, fühlte ich auf mir ihre prüfenden und besorgten Blicke ruhen. Besonders rührend benahmen sie sich, wenn ich wirklich irgendwelche Schwierigkeiten hatte, wenn mich ein Gläubiger bedrängte oder mir das Geld für eine fällige Zahlung fehlte; Mann und Frau flüsterten einige Minuten am Fenster, darauf ging er mit ernstem Gesicht auf mich zu und sagte:
›Pawel Konstantinowitsch, wenn Sie augenblicklich Geld brauchen, so bitten wir Sie, sich nicht zu genieren und von uns zu nehmen.‹
Vor Aufregung wurden ihm dabei die Ohren rot. Es kam auch vor, dass er, nachdem er so mit seiner Frau am Fenster getuschelt hatte, mit roten Ohren auf mich zuging und sagte:
›Meine Frau und ich bitten Sie, von uns dieses kleine Geschenk anzunehmen.‹
Und er überreichte mir ein Paar Manschettenknöpfe, ein Zigarettenetui oder eine Tischlampe; ich revanchierte mich dafür mit Geflügel, Butter und Blumen von meinem Gut. Ich muss bemerken, dass sie recht wohlhabend waren. In der ersten Zeit machte ich große Schulden und war darin wenig wählerisch: ich nahm Geld, wo ich es mir nur verschaffen konnte. Aber keine Macht in der Welt hätte mich zwingen können, von den Luganowitschs etwas zu borgen. Was soll ich noch viel davon sprechen …
Ich war nicht glücklich. Zu Hause, im Felde und in der Scheune dachte ich nur an sie und gab mir Mühe, das Geheimnis der jungen, schönen und klugen Frau zu erraten, die mit einem uninteressanten alten Mann (er war damals über vierzig) verheiratet war und von ihm Kinder hatte; das Geheimnis dieses uninteressanten, gutmütigen und treuherzigen Mannes zu ergründen, der über alle Dinge so vernünftig und langweilig sprach, auf Bällen und bei Abendunterhaltungen im Kreise der älteren soliden Herren, langweilig und überflüssig, mit einem Ausdrucke von Demut und Teilnahmslosigkeit saß und dabei doch an sein Recht, glücklich zu sein und von dieser Frau Kinder zu haben, glaubte; ich versuchte immer zu begreifen, warum sie ihm und nicht mir begegnet war, und wem dieser verhängnisvolle Fehler in unserem Leben etwas nützen konnte.
Und so oft ich in die Stadt kam, las ich in ihren Augen, dass sie mich erwartet hatte; sie gestand mir auch manchmal selbst, dass sie an diesem Tage schon vom frühen Morgen an eine eigentümliche Vorahnung gehabt habe. Wir sprachen und schwiegen stundenlang; wir gestanden uns aber unsere Liebe nicht ein und verheimlichten sie scheu und eifersüchtig. Wir fürchteten alles, was unsere Liebe uns selbst hätte enthüllen können. Ich liebte sie zärtlich und tief. Doch ich hatte allerlei Bedenken und fragte mich, wozu unsere Liebe führen könnte, wenn wir nicht die Kraft hätten, sie in uns niederzuringen; es erschien mir als unwahrscheinlich und unmöglich, dass meine stille, traurige Liebe dem glücklichen Leben ihres Mannes, ihrer Kinder und des ganzen Hauses, wo man mich so sehr liebte und mir so vertraute, ein rohes und jähes Ende bereiten könnte. Wäre das anständig? Sie würde mir wohl folgen; doch wohin? Wohin könnte ich sie führen?
Wenn ich wenigstens ein schönes, interessantes Leben hätte, wenn ich z.B. für die Befreiung meiner Heimat kämpfte oder ein berühmter Gelehrter, Schauspieler oder Maler wäre; so müsste ich sie aber aus der einen gewöhnlichen und alltäglichen Umgebung in eine ähnliche, womöglich noch gewöhnlichere bringen. Und wie lange würde unser Glück dauern? Was würde aus ihr im Falle meiner Krankheit oder meines Todes werden, oder wenn unsere Liebe ein Ende nähme?
Sie schien die gleichen Zweifel zu haben. Sie dachte viel an ihren Mann, an ihre Kinder und an ihre Mutter, die den Schwiegersohn wie einen eigenen Sohn liebte. Wenn sie sich ihrem Gefühl hingäbe, müsste sie entweder lügen oder die Wahrheit sagen; in ihrer Lage wäre aber beides gleich entsetzlich und unbequem. Auch sie quälte sich mit der Frage: ob ihre Liebe mir Glück bringen würde, ob sie mein Leben, das schon ohnehin schwer und voller Misserfolge war, nicht noch schwieriger gestalten würde? Sie glaubte, dass sie nicht jung genug für mich sei, nicht fleißig und energisch genug, um ein neues Leben zu beginnen, und sie sagte oft zu ihrem Mann, dass es gut wäre, wenn ich ein kluges und meiner würdiges junges Mädchen heiratete, das eine gute Hausfrau und eine getreue Helferin sein müsste; sie fügte aber gleich hinzu, dass in der ganzen Stadt wohl kein einziges solches Mädchen zu finden sei.
So gingen die Jahre dahin. Anna Alexejewna hatte bereits zwei Kinder. Wenn ich zu den Luganowitschs kam, so lächelten mir die Dienstboten freundlich zu, die Kinder schrien, dass Onkel Pawel Konstantinowitsch gekommen sei und fielen mir um den Hals, und alle freuten sich. Niemand wusste, was in meinem Innersten vorging, und alle glaubten, dass auch ich mich freute. Alle hielten mich für einen edlen Menschen. Die Erwachsenen und die Kinder hatten das Gefühl, dass in ihrem Hause ein edler Mensch anwesend sei, und das verlieh ihren Beziehungen zu mir einen ganz besonderen Reiz, als ob ihr Leben in meiner Gegenwart edler und schöner wäre. Anna Alexejewna und ich besuchten oft das Theater und gingen jedes Mal zu Fuß hin; wir saßen im Parkett nebeneinander, unsere Schultern berührten sich, ich nahm aus ihren Händen schweigend das Opernglas und fühlte in diesen Augenblicken, dass sie mir nahe sei, dass sie mir gehöre, dass wir ohne einander gar nicht leben können; aber wenn das Theater zu Ende war, trennten wir uns wie Fremde; es war wie ein seltsames Missverständnis. In der Stadt wurde bereits manches über uns gemunkelt; doch an allem Gerede war kein einziges Wort wahr.
In den folgenden Jahren reiste Anna Alexejewna öfters fort, bald zu ihrer Mutter, bald zu ihrer Schwester; sie war oft schlechter Laune und hatte wohl das Bewusstsein, dass ihr Leben verfehlt sei; in solchen Augenblicken wollte sie weder ihren Mann noch ihre Kinder sehen. Sie war bereits so weit, dass sie sich von Nervenärzten behandeln lassen musste.
Wir schwiegen fast immer; in Gegenwart von Fremden hatte sie meistens eine seltsam gereizte Stimmung gegen mich; was ich auch sagen mochte, stets widersprach sie mir, und wenn ich mit jemand stritt, so ergriff sie Partei für meinen Gegner. Wenn ich etwas fallen ließ, sagte sie kühl:
›Ich gratuliere Ihnen.‹
Wenn ich mit ihr ins Theater ging und das Opernglas mitzunehmen vergaß, sagte sie:
›Ich wusste, dass Sie es vergessen werden.‹
Zum Glück oder Unglück gibt es in unserem Leben nichts, was nicht früher oder später ein Ende nähme. Luganowitsch wurde zum Präsidenten ernannt und in eines der westlichen Gouvernements versetzt; wir mussten uns trennen. Die Luganowitschs verkauften nun ihre Möbel, Pferde und die Sommerwohnung. Als wir aufs Land hinausfuhren und auf dem Rückwege zum letzten Mal auf den Garten und das grüne Dach der Sommerwohnung zurückblickten, war es uns allen sehr traurig zumute, und ich begriff, dass ich nicht nur von der Sommerwohnung allein Abschied nehmen musste. Es wurde beschlossen, dass Anna Alexejewna Ende August auf ärztlichen Rat nach der Krim gehen und Luganowitsch mit den Kindern erst nachher nach seinem westlichen Gouvernement abreisen sollte.
Wir begleiteten Anna Alexejewna in großer Gesellschaft zum Zug. Als sie bereits von ihrem Mann und den Kindern Abschied genommen hatte und jeden Augenblick das dritte Glockenzeichen ertönen musste, sprang ich noch zu ihr ins Coupé hinein, um ein Körbchen, das sie vergessen hatte, ins Gepäcknetz zu legen; und nun musste ich von ihr Abschied nehmen. Als unsere Blicke sich in diesem Augenblick begegneten, ließen uns alle unsere Kräfte im Stich. Ich umarmte sie, sie schmiegte ihr Gesicht an meine Brust, und Tränen liefen ihr die Wangen hinab. Ich bedeckte ihr tränenfeuchtes Gesicht, ihre Schultern und Hände mit Küssen. Mein Gott, wie unglücklich waren wir beide! Ich gestand ihr meine Liebe und sah erst jetzt mit brennendem Weh im Herzen ein, wie nichtig, trügerisch und unnötig alles war, was unserer Liebe im Wege stand. Ich begriff, dass wenn man liebt, man an wichtigere Dinge als an Glück und Unglück, Tugend und Sünde in landläufigem Sinne denken, oder überhaupt gar nicht denken soll.
Ich küsste sie zum letzten Mal, drückte ihr die Hand, und wir trennten uns für immer. Der Zug war bereits abgefahren. Ich setzte mich ins Nachbarcoupé, das zufällig leer war, und saß bis zur nächsten Station da und weinte. Und dann ging ich zu Fuß nach Ssofjino heim …«
Während Aljochin erzählte, hörte der Regen auf, und die Sonne kam zum Vorschein. Burkin und Iwan Iwanowitsch traten auf den Balkon hinaus; die Aussicht auf den Garten und den Teich, der in der Sonne wie ein Spiegel glänzte, war wunderschön. Sie genossen die Aussicht und dachten zugleich mit Mitleid an diesen Mann mit den klugen und guten Augen, der ihnen so offenherzig seine Geschichte erzählt hatte und der sich auf diesem Riesengute abrackerte, statt sich mit Wissenschaft oder anderen Dingen, die sein Leben hätten angenehmer gestalten können, abzugeben; und sie dachten, welch trauriges Gesicht die junge Dame gehabt haben müsse, als er von ihr im Coupé Abschied nahm und er ihr Gesicht und ihre Schultern küsste. Beide hatten sie öfters in der Stadt gesehen, und Burkin war mit ihr sogar bekannt und fand sie hübsch.
Der Kuss
Am 20. Mai, abends acht Uhr, erreichten sämtliche sechs Batterien der N.’schen Reserveartilleriebrigade, die in ihr Sommerlager zog, das Kirchdorf Mestetschki, wo das Nachtquartier aufgeschlagen werden sollte. Mitten im größten Trubel, als ein Teil der Offiziere sich bei den Geschützen zu schaffen machte, und die übrigen sich auf dem freien Platze vor der Kirche versammelt hatten, um die Meldungen der Quartiermacher entgegenzunehmen, kam plötzlich hinter der Kirche ein Reiter in Zivilkleidung auf einem sehr sonderbaren Pferde zum Vorschein. Das kleine falbe Pferd mit dem schönen Hals und kurzem Schweif bewegte sich nicht geradeaus, sondern irgendwie seitwärts, wobei es mit den Beinen zierliche tänzelnde Bewegungen machte, als ob man es mit der Peitsche auf die Beine schlüge. Der Mann ritt auf die Offiziere zu, lüftete den Hut und sagte:
»Seine Exzellenz Generalleutnant von Rabbeck, der hier in der Nähe ein Gut hat, bittet die Herren Offiziere, sogleich zu ihm zu einer Tasse Tee zu kommen …«