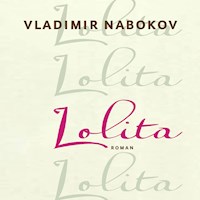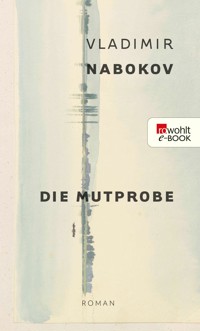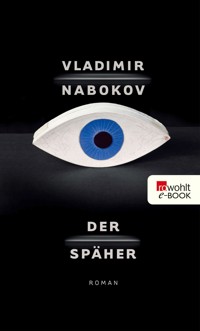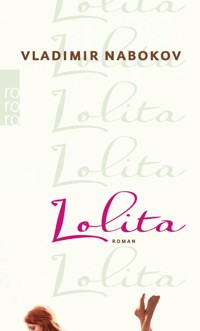
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nabokov: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Der zweifach verfilmte Roman einer fatalen Obsession, ein Weltbestseller: Der Literaturwissenschaftler Humbert verliebt sich in das noch sehr junge Mädchen Dolores Haze, nennt sie «Lolita». Die einseitige Leidenschaft mündet in einer Odyssee quer durch die USA und am Ende in einen Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Lolita
Roman
Über dieses Buch
Der vielumstrittene, längst zu Weltruhm gelangte und zweifach verfilmte Roman einer tragischen Passion: Ein Vierzigjähriger verfällt dem grazilen Zauber einer kindlichen Nymphe und erfährt die Liebe als absolute Macht über Leben und Tod.
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 5. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Impressum
Die Erstausgabe erschien 1955 bei Olympia Press, Paris, und 1958 bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 8, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.
Überarbeitete Ausgabe April 2017
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2007
Copyright © 1959, 1989, 2007, 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Lolita» Copyright © 1955 by Vladimir Nabokov
Veröffentlicht im Einverständnis mit The Estate of Vladimir Nabokov
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildungen Buffy Cooper/Trevillion Images; Jutta Klee/Getty Images
ISBN 978-3-644-05631-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Véra
Vorwort
Lolita oder Die Bekenntnisse eines Witwers weißer Rasse, dies waren die beiden Titel, unter denen dem Autor dieser Vorbemerkung die merkwürdigen Seiten zugingen, welchen sie nunmehr voransteht. «Humbert Humbert»[1], ihr Verfasser, war am 16. November 1952 in Untersuchungshaft an Koronarthrombose verstorben, ein paar Tage vor dem Termin, für den sein Prozess angesetzt war. Sein Anwalt, mein guter Freund und Verwandter, Clarence Choate Clark, Esq., aktuell zugelassen am Gericht des District of Columbia, bat mich, das Manuskript im Hinblick auf eine Veröffentlichung zu redigieren, und berief sich dabei auf eine Klausel im Testament seines Mandanten, die meinen hochangesehenen Vetter ermächtigte, die Drucklegung von Lolita nach eigenem Ermessen in die Wege zu leiten. Bei Mr. Clarks Entscheidung mag eine Rolle gespielt haben, dass der von ihm gewählte Herausgeber gerade den Poling-Preis für eine kleine Arbeit (Vom Sinn und Unsinn der Sinne) erhalten hatte, in der gewisse morbide Geistesverfassungen und Perversionen erörtert wurden.
Es stellte sich heraus, dass meine Aufgabe einfacher war, als er und ich vermutet hatten. Abgesehen von Korrekturen offenkundiger Flüchtigkeitsfehler und der sorgfältigen Ausmerzung einiger hartnäckiger Einzelheiten, die «H.H.»s eigenen Bemühungen zum Trotz in seinem Text als Wegweiser und Grabmale stehen geblieben waren (Hinweise auf Orte und Personen, die der Anstand mit rücksichtsvollem Schweigen zu übergehen gebietet), geben wir diese außerordentlichen Aufzeichnungen unverändert heraus. Der bizarre Deckname des Verfassers ist seine eigene Erfindung, und natürlich durfte diese Maske – durch die zwei hypnotische Augen zu glühen scheinen – dem Wunsch ihres Trägers gemäß nicht gelüftet werden. Während sich «Haze» nur mit dem wahren Namen der Heldin reimt, ist ihr Vorname dagegen zu eng in das innerste Gefüge des Buches verwoben, als dass er geändert werden dürfte, wofür (wie der Leser selber feststellen wird) indessen auch keine Veranlassung bestand. Berichte über «H.H.»s Verbrechen können Wissbegierige in der Tagespresse vom September und Oktober 1952 finden; seine Gründe und sein Zweck wären auch weiterhin ein Geheimnis geblieben, hätten diese Memoiren nicht den Weg in den Lichtkreis meiner Leselampe gefunden.
Altmodischen Lesern zu Gefallen, die über die «wahre» Geschichte hinaus das Schicksal ihrer «echten» Personen weiterverfolgen wollen, können wir ein paar Mitteilungen zum Besten geben, die wir von Mr. «Windmuller» aus «Ramsdale» erhielten, der ungenannt zu bleiben wünschte, damit «der lange Schatten dieser tristen und trüben Angelegenheit» nicht auf das Städtchen falle, dessen Bürger zu sein er stolz ist. Seine Tochter «Louise» absolviert gerade ihr zweites College-Jahr, «Mona Dahl» studiert in Paris. «Rita» hat vor kurzem den Besitzer eines Hotels in Florida geheiratet. Mrs. «Richard F. Schiller» starb im Wochenbett, am ersten Weihnachtstag 1952, nach der Niederkunft mit einem totgeborenen Mädchen, in Gray Star[2], einer Siedlung im entlegensten Nordwesten. «Vivian Darkbloom»[3] hat unter dem Titel Mein Q eine demnächst erscheinende Biographie geschrieben, und Kritiker, die das Manuskript überflogen haben, nennen es ihr bestes Buch. Die Wärter der betreffenden Friedhöfe vermelden, dass keine Gespenster umgehen.
Rein als Roman betrachtet, handelt Lolita von Situationen und Empfindungen, die dem Leser auf ärgerliche Weise unklar bleiben müssten, hätte ihr Autor ihren Ausdruck in blassen und platten Umschreibungen etiolieren lassen. Gewiss, im ganzen Werk findet sich kein einziges obszönes Wort; ja, für den abgebrühten Philister, den die modernen Bräuche dahin gebracht haben, in einem banalen Roman jede Menge verpönter Wörter ohne Skrupel hinzunehmen, wird hier deren Fehlen einen regelrechten Schock darstellen. Sollte aber um der Seelenruhe eines solchen bigotten Lesers willen ein Herausgeber den Versuch unternehmen, Szenen, die gewisse Geister «aphrodisisch» nennen könnten, zu verwässern oder ganz wegzulassen (siehe hierzu das historische Urteil von Ehrwürden John M. Woolsey vom 6.12.1933 in Bezug auf ein erheblich deutlicheres Buch[4]), so müsste man auf eine Veröffentlichung von Lolita überhaupt verzichten, denn gerade diese Szenen, denen man unsinnigerweise selbstzweckhafte Sinnlichkeit vorwerfen könnte, sind es, die im strengsten Sinne zweckhaft einer Geschichte dienen, welche unbeirrbar nichts Geringerem zustrebt als einer moralischen Apotheose. Ein Zyniker könnte behaupten, dass gewerbsmäßige Pornographie denselben Anspruch erhebe; Gelehrte könnten einwenden, dass «H.H.»s leidenschaftliches Bekenntnis ein Sturm im Reagenzglas sei; dass wenigstens 12% der erwachsenen amerikanischen Männer – Dr. Blanche Schwarzmann[5] zufolge eine vorsichtige Schätzung (mündliche Mitteilung) – jährlich in der einen oder anderen Form die besonderen Erlebnisse genießen, die «H.H.» mit so viel Verzweiflung beschreibt; dass keine Katastrophe eingetreten wäre, wenn unser geistesverwirrter Tagebuchschreiber in dem verhängnisvollen Sommer 1947 einen kompetenten Psychopathologen konsultiert hätte; dann aber gäbe es freilich auch dieses Buch nicht.
Dem Kommentator sei verstattet zu wiederholen, was er in eigenen Büchern und Vorträgen immer wieder betont hat, nämlich, dass «anstößig» oft nur ein anderes Wort für «ungewöhnlich» ist; und dass ein großes Kunstwerk selbstverständlich immer originell ist; dass es seinem Wesen nach erschüttern und in Erstaunen setzen soll. Ich habe durchaus nicht die Absicht, «H.H.» zu beschönigen. Kein Zweifel, er ist ein Scheusal, er ist verworfen, er ist ein leuchtendes Beispiel moralischen Aussatzes, eine Mischung von Grausamkeit und schnödem Witz, die vielleicht äußerste Seelennot verrät, ihn aber nicht gerade attraktiv macht. Er ist auf gravitätische Art kapriziös. Viele seiner beiläufigen Ansichten über Land und Leute in Amerika sind grotesk. Die verzweifelte Ehrlichkeit, die seine Beichte durchpulst, spricht ihn nicht von seinen teuflisch verschlagenen Sünden los. Er ist anomal. Er ist kein Gentleman. Aber wie zauberisch kann seine singende Violine eine Zärtlichkeit für Lolita, ein Mitleid mit ihr heraufbeschwören, die uns dazu bringen, von dem Buch hingerissen zu sein, während wir seinen Autor verabscheuen!
Als klinischer Fall wird Lolita in psychiatrischen Fachkreisen zweifellos klassischen Rang einnehmen.[6] Als Kunstwerk geht das Buch über eine reine Beichte weit hinaus. Noch wichtiger indessen als die wissenschaftliche Bedeutung und der literarische Wert ist uns die moralische Wirkung, die es auf jeden ernsthaften Leser ausüben dürfte, denn in dieser zerquälten persönlichen Studie steckt eine allgemeingültige Lehre; das vernachlässigte Kind, die egozentrische Mutter, der keuchende Wahnsinnige – sie sind nicht nur lebensvolle Figuren einer einzigartigen Geschichte, sie warnen uns auch vor gefährlichen Strömungen, weisen auf herrschende Übelstände hin. Lolita sollte für uns alle – Eltern, Sozialarbeiter, Erzieher – Anlass sein, uns mit noch größerer Wachsamkeit und Hellsicht der Aufgabe zu widmen, eine gesündere Generation in einer weniger unsicheren Welt großzuziehen.
Dr. phil. John Ray jun.[7]
Widworth, Massachusetts
5. August 1955
Erster Teil
1
Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden. Meine Sünde, meine Seele. Lo-li-ta: die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta.[1]
Sie war Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie vier Fuß zehn groß[2] in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita.
Hatte sie eine Vorläuferin? Ja doch, die hatte sie. Es hätte vielleicht gar keine Lolita gegeben, hätte ich nicht eines Sommers ein gewisses Ur-Mädchenkind geliebt. In einem Prinzenreich am Meer.[3] Ach, wann war es doch?[4] Ungefähr so viele Jahre vor Lolitas Geburt, wie mein Alter in jenem Sommer betrug. Bei einem Mörder können Sie immer auf einen extravaganten Prosastil zählen.
Meine Damen und Herren Geschworene, Beweisstück Nummer eins ist, was die Seraphim neideten, die schlecht unterrichteten, naiven, edelbeschwingten Seraphim. Ergötzen Sie sich an diesem Dorngestrüpp.
2
Ich wurde 1910 in Paris geboren.[1] Mein Vater war ein weichmütiger, leichtlebiger Mann, ein Russischer Salat von Rassegenen: Schweizer Staatsangehöriger gemischt französisch-österreichischer Herkunft mit einem Schuss Donau in den Adern. Ich werde gleich ein paar wunderhübsche, blau überglänzte Ansichtskarten herumreichen. Er besaß ein Luxushotel an der Riviera. Sein Vater und zwei Großväter hatten mit Wein respektive Juwelen und Seide gehandelt. Mit dreißig Jahren heiratete er eine junge Engländerin, Tochter von Jerome Dunn, dem Alpinisten, und Enkelin von zwei Pastoren in Dorset, Kennern auf so obskuren Gebieten wie Paläopedologie[2] beziehungsweise Äolsharfen. Meine sehr photogene Mutter starb durch einen bizarren Unfall (Picknick, Blitz), als ich drei war, und außer einer Tasche voll Wärme in der dunkelsten Vergangenheit ist nichts von ihr in den Mulden und Höhlungen meiner Erinnerung haften geblieben, über denen – wenn Sie meinen Stil noch ertragen können (ich schreibe unter Bewachung) – die Sonne meiner ersten Kindheit untergegangen war: Sicher kennen Sie alle jene duftenden Überreste des Tages, die zusammen mit den Zuckmücken um eine blühende Hecke hängen oder in die man beim Dahinwandern plötzlich gerät und die man durchschreitet, am Fuße eines Hügels, in der Sommerdämmerung; pelzige Wärme, goldene Zuckmücken.
Die ältere Schwester meiner Mutter, Sybil, die ein Vetter meines Vaters geheiratet und dann sitzen gelassen hatte, diente in meiner nächsten Familie als eine Art unbezahlter Gouvernante und Haushälterin. Später erzählte mir jemand, sie sei in meinen Vater verliebt gewesen, und er habe sich dies an einem Regentag leichten Herzens zunutze gemacht und es wieder vergessen, sobald das Wetter sich klärte. Ich war ihr außerordentlich zugetan, trotz der Strenge – der verhängnisvollen Strenge – mancher ihrer Vorschriften. Vielleicht wollte sie erreichen, dass ich zu gegebener Zeit einen besseren Witwer abgäbe als mein Vater. Tante Sybil hatte rosageränderte, himmelblaue Augen und einen wächsernen Teint. Sie schrieb Gedichte. Sie war auf poetische Weise abergläubisch. Sie sagte, sie wisse, dass sie kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag sterben werde, und so geschah es auch. Ihr Mann, ein großer Reisender in Wohlgerüchen, brachte den Hauptteil seines Lebens in Amerika zu, wo er eines Tages eine Firma gründete und ein wenig Grundbesitz erwarb.
Ich wuchs als glückliches, gesundes Kind in einer hellen Welt von illustrierten Büchern, sauberem Sand, Orangenbäumen, zutraulichen Hunden, Ausblicken aufs Meer und lächelnden Gesichtern auf. Um mich her drehte sich das glanzvolle Hotel Mirana[3] wie eine Art privaten Universums, ein weiß getünchter Kosmos innerhalb des größeren blauen, der draußen strahlte. Vom beschürzten Geschirrwäscher bis zum flanellbekleideten Potentaten mochten und hätschelten mich alle. Ältliche amerikanische Damen, auf ihre Stöcke gestützt, neigten sich mir zu wie Türme von Pisa. Ruinierte russische Fürstinnen, die meinen Vater nicht bezahlen konnten, kauften mir teure Pralinen. Er, mon cher petit papa, nahm mich zum Rudern und Radeln mit, brachte mir Schwimmen und Tauchen und Wasserski bei, las mir Don Quijote und Les Misérables vor, und ich vergötterte ihn, achtete ihn und war froh für ihn, sooft ich die Bediensteten über seine verschiedenen Freundinnen sprechen hörte, schöne und freundliche Wesen, die viel von mir hermachten und girrten und kostbare Tränen über meine vergnügte Mutterlosigkeit vergossen.
Ich besuchte eine englische Tagesschule, ein paar Kilometer von zuhause entfernt, und spielte dort Tennis und Fives[4] und bekam ausgezeichnete Zensuren und vertrug mich mit meinen Schulkameraden wie mit den Lehrern bestens. Die einzigen Erlebnisse eindeutig sexueller Art vor meinem dreizehnten Geburtstag (also ehe ich meine kleine Annabel kennen lernte) waren, soweit ich mich erinnere: ein ernstes, schickliches, rein theoretisches Gespräch über Pubertätsüberraschungen, das ich im Rosengarten der Schule mit einem amerikanischen Jungen führte, dem Sohn einer damals gefeierten Filmschauspielerin, die er in der dreidimensionalen Welt selten zu sehen bekam; und ein paar interessante Reaktionen meines Organismus beim Anblick der unendlich sanften, perlgrau- und umbragetönten Rundungen auf den Photographien in Pichons Prachtband La Beauté Humaine, den ich in der Hotelbibliothek unter einem Berg marmoriert gebundener Graphic-Hefte hervorstibitzt hatte. Später gab mir mein Vater in seiner köstlich unbefangenen Art alle Aufklärungen über Sex, die ich seiner Meinung nach brauchte; das war kurz bevor er mich im Herbst 1923 auf ein Gymnasium in Lyon schickte (wo wir drei Winter zubringen sollten); aber ach, im Sommer desselben Jahres machte er mit Mme de R. und ihrer Tochter eine Italienreise, und ich hatte niemanden, dem ich mein Leid klagen, niemanden, den ich um Rat fragen konnte.
3
Annabel war, wie der Autor, gemischter Herkunft: halb englischer, halb niederländischer in ihrem Falle. Heute erinnere ich mich ihrer Züge viel weniger deutlich als vor ein paar Jahren, ehe ich Lolita kennen lernte. Es gibt zwei Arten visueller Erinnerung: eine, bei der man im Laboratorium des Intellekts kunstgerecht und mit offenen Augen ein Bild wiedererschafft (und dann sehe ich Annabel in so allgemeinen Begriffen wie «honigfarbene Haut», «dünne Arme», «hellbrauner Pagenkopf», «lange Wimpern», «leuchtender großer Mund»); und die andere, bei der man mit geschlossenen Augen auf der dunklen Innenseite der Lider blitzschnell das objektive, ganz und gar optische Ebenbild eines geliebten Gesichts heraufbeschwört, eine kleine Geistererscheinung in natürlichen Farben (und so sehe ich Lolita).
Ich möchte mich daher zur Beschreibung von Annabel auf die steife Aussage beschränken: Sie war ein entzückendes Kind, ein paar Monate jünger als ich. Ihre Eltern waren seit langem mit meiner Tante befreundet und in Anstandsfragen ebenso penibel wie jene. Sie hatten nicht weit vom Hotel Mirana eine Villa gemietet. Der braune, kahlköpfige Mr. Leigh und die dicke, gepuderte Mrs. Leigh (geborene Vanessa van Ness[1]). Wie hasste ich sie! Zuerst sprachen Annabel und ich über Nebensächliches. Sie hob immer wieder eine Handvoll feinen Sandes auf und ließ ihn durch die Finger rinnen. Unser Denken war auf den Ton gestimmt, der unter intelligenten europäischen Voradoleszenten unserer Zeit und unserer Kreise damals vorherrschte, und ich bezweifle, dass unserem Interesse für die Wahrscheinlichkeit anderer bewohnter Welten, für Tennisturniere, die Unendlichkeit, den Solipsismus und so weiter viel Originalität eigen war. Die Zartheit und Verletzlichkeit neugeborener Tiere berührte uns beide gleich schmerzlich. Sie wollte Krankenschwester in einem asiatischen Hungergebiet werden; ich ein berühmter Spion.
Mit einem Mal waren wir wahnsinnig, unbeholfen, schamlos, qualvoll ineinander verliebt; hoffnungslos, sollte ich hinzufügen, denn dies rasende Verlangen nach gegenseitigem Besitz wäre nur dadurch zu stillen gewesen, dass wir des anderen Leib und Seele in jeder Faser in uns aufgesogen und uns zu eigen gemacht hätten; aber so standen wir da und waren nicht in der Lage, uns wenigstens so zu paaren, wie Slum-Kinder es können, die leicht eine Gelegenheit finden. Nach einem tollen Versuch, uns nachts in ihrem Garten zu treffen (mehr davon später), wurde uns an Ungestörtheit nur noch zugestanden, uns außer Hörweite, aber nicht außer Sichtweite an einer belebten Stelle der plage aufzuhalten. Dort auf dem weichen Sand, ein paar Schritt von den Erwachsenen entfernt, rekelten wir uns den ganzen Vormittag in einem versteinerten Paroxysmus der Begierde und benutzten jede glückliche Fügung in Zeit und Raum, einander zu berühren: Ihre halb im Sand verborgene Hand kroch auf mich zu, die schlanken, braunen Finger rückten schlafwandlerisch näher und näher; dann machte sich ihr opalisierendes Knie auf eine lange, vorsichtige Reise; manchmal traf es sich, dass eine von jüngeren Kindern errichtete Sandburg genügend Deckung gewährte, die salzigen Lippen des anderen zu streifen; diese unvollkommenen Berührungen versetzten unsere gesunden und unerfahrenen jungen Körper in einen Zustand derartiger Überreiztheit, dass nicht einmal das kühle Wasser, unter dem wir noch immer nacheinander griffen, sie zu lindern vermochte.
Unter den Kostbarkeiten, die ich auf den Irrfahrten meiner erwachsenen Jahre verlor, befand sich ein von meiner Tante aufgenommener Schnappschuss, auf dem Annabel, ihre Eltern und der gesetzte, lahme ältere Herr, ein Dr. Cooper, der in jenem Sommer meiner Tante den Hof machte, als Gruppe um den Tisch eines Terrassen-Cafés zu sehen waren. Von Annabel war nicht viel zu erkennen, weil sie sich gerade über ihr chocolat glacé beugte, und ihre dünnen nackten Schultern und der Scheitel in ihrem Haar waren (soweit ich mich an das Bild erinnere) so ungefähr alles, was man von ihr in dem Sonnendunst ausmachen konnte, in den ihr verlorener Liebreiz überging; ich hingegen, auf meinem Platz ein wenig abseits von den anderen, war mit einer Art dramatischer Auffälligkeit festgehalten: ein launischer, finster dreinsehender Junge in einem dunklen Sporthemd und gut geschnittenen weißen Shorts, der mit übergeschlagenen Beinen im Profil dasitzt und wegsieht. Dieses Photo wurde am letzten Tag unseres schicksalhaften Sommers aufgenommen, ein paar Minuten, bevor wir unseren zweiten und letzten Versuch unternahmen, dem Schicksal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Unter dem fadenscheinigsten Vorwand (es war unsere allerletzte Chance, und es kam nicht mehr darauf an) entwischten wir aus dem Café und suchten eine menschenleere Stelle am Strand; dort, im violetten Schatten einiger roter Felsen, die eine Art Höhle bildeten, kam es zu einem kurzen Austausch gieriger Liebkosungen, deren einziger Zeuge eine Sonnenbrille war, die irgendwer verloren hatte. Ich lag auf den Knien, im Begriff, meinen Liebling zu besitzen, als zwei bärtige Schwimmer, der alte Wassermann und sein Bruder, mit unflätigen Ermunterungsrufen aus dem Meer tauchten, und vier Monate später starb sie auf Korfu an Typhus.
4
Wieder und wieder durchblättere ich diese armseligen Erinnerungen und stelle mir immer von neuem die Frage, ob damals, im Glitzer jenes fernen Sommers, der Riss in mein Leben gekommen ist, oder ob mein unbändiges Verlangen nach jenem Kind nur das erste Zutagetreten einer bereits in mir angelegten Besonderheit war.[1] Wenn ich versuche, meinen Begierden, Motiven, Handlungen und so weiter auf den Grund zu gehen, überlasse ich mich einer rückblickenden Phantasie, die mein analytisches Vermögen mit unbegrenzten, einander widersprechenden Möglichkeiten versorgt, sodass jeder in der Vorstellung eingeschlagene Pfad sich in der wahnsinnig komplexen Landschaft meiner Vergangenheit endlos verzweigt und wieder verzweigt. Ich bin jedoch überzeugt, dass Lolita auf eine gewisse magische und schicksalhafte Weise mit Annabel begann.
Ich weiß auch, dass der Schock, den Annabels Tod mir verursachte, das darbende Verlangen jenes Albtraumsommers fixierte und es all die kalten Jahre meiner Jugend zum dauernden Hindernis für andere Liebesregungen machte. Das Geistige und das Körperliche hatten sich in unserer Liebe mit einer Vollkommenheit vermengt, die dem sachlichen, groben Standardgehirn heutiger Jugendlicher unbegreiflich bleiben muss. Lange nach ihrem Tod fühlte ich ihre Gedanken durch die meinen fluten. Lange bevor wir uns begegneten, hatten wir die gleichen Träume gehabt. Wir verglichen unsere Notizen. Wir entdeckten seltsame Verwandtschaften. Im gleichen Juni des gleichen Jahres (1919) war ein verirrter Kanarienvogel in ihr und in mein Haus geflattert, in zwei weit voneinander entfernten Ländern. Ach, Lolita, hättest du mich doch so geliebt!
Ich habe den Bericht über unser erstes gescheitertes Stelldichein dem Abschluss meiner «Annabel-Phase» vorbehalten. Eines späten Abends gelang es ihr, die bösartige Wachsamkeit ihrer Familie zu überlisten. In einem nervösen und schlankblättrigen Mimosenhain hinter ihrer Villa fanden wir einen Platz auf den Überresten einer niedrigen Steinmauer. Durch die Dunkelheit und das zarte Laub konnten wir die Arabesken erleuchteter Fenster sehen, die mir heute, von den farbigen Tinten empfindsamen Erinnerns angetuscht, wie Kartenblätter erscheinen – vermutlich, weil ein Bridgespiel den Feind ablenkte. Sie zitterte und zuckte, als ich den Winkel ihrer geöffneten Lippen und ihr heißes Ohrläppchen küsste. Ein Haufen Sterne glühte blass zwischen den Silhouetten der langen dünnen Blätter über uns; der vibrierende Himmel schien so nackt zu sein wie sie selber unter ihrem leichten Kleid. Ich sah ihr Gesicht in diesem Himmel, seltsam deutlich, als strahle es einen ihm eigenen schwachen Glanz aus. Ihre Beine, die liebreizenden, lebendigen Beine, waren nicht zu dicht beieinander, und als meine Hand fand, was sie suchte, kam ein träumerischer, unirdischer Ausdruck, halb Lust, halb Schmerz, in ihre kindlichen Züge. Sie saß etwas höher als ich, und sooft es sie in ihrer einsamen Verzückung dazu drängte, mich zu küssen, senkte sie den Kopf mit einer schläfrigen, sanften, matten Bewegung, die fast märtyrerhaft war, und ihre nackten Knie hielten und pressten mein Handgelenk und lockerten sich dann wieder; und ihr bebender Mund, von der Schärfe eines geheimnisvollen Tranks verzogen, kam mit einem zischenden Einziehen des Atems nah an mein Gesicht. Sie versuchte, die Liebespein zu lindern, indem sie zuerst ihre trockenen Lippen rau gegen die meinen rieb; dann zog sich meine Liebste mit einem nervösen Schütteln des Haars zurück, kam dunkel wieder an mich heran und ließ mich an ihrem offenen Mund weiden, während ich mit einer Hingabe, die bereit war, ihr alles zu schenken, mein Herz, meine Kehle, meine Eingeweide, ihrer ungeschickten Faust das Zepter meiner Leidenschaft zu halten gab.
Ich erinnere mich an den Duft eines Körperpuders – ich glaube, sie hatte ihn der spanischen Zofe ihrer Mutter gestohlen –, einen süßlichen, billigen Moschusduft. Er mischte sich mit ihrem eigenen Biskuitgeruch, und meine Sinne waren auf einmal bis zum Rand gefüllt; ein plötzliches Geraschel in einem nahen Gebüsch hinderte sie am Überfließen – und als wir auseinanderfuhren und mit schmerzenden Pulsen auf das horchten, was wahrscheinlich eine wildernde Katze war, drang vom Haus her die rufende, immer aufgeregter ansteigende Stimme ihrer Mutter – und Dr. Cooper kam gewichtig in den Garten herausgehumpelt. Aber dieser Mimosenhain, der Sternenschleier, das Prickeln, die Flamme, der Honigtau und die Qual blieben in mir, und jenes kleine Mädchen mit den vom Meer polierten Gliedern und der glühenden Zunge verfolgte mich immer seither – bis ich sie zuletzt, vierundzwanzig Jahre später, in einer anderen verkörperte und so ihren Zauber bannte.
5
Wenn ich mich zu jenen Tagen meiner Jugend zurückwende, kommt es mir vor, als flögen sie in immer gleichen bleichen Fetzen von mir fort, ähnlich dem morgendlichen Gestöber benutzten Krepppapiers, das ein Eisenbahnreisender im Aussichtswagen hinter sich wegwirbeln sieht. Bei meinen hygienischen Beziehungen zu Frauen ging ich fortan praktisch, ironisch und bündig vor. Als Student in London und Paris genügten mir bezahlte Damen. Mein Studium war peinlich genau und intensiv, wenn auch nicht sonderlich ergiebig. Zuerst hatte ich vor, Psychiatrie zu meinem Prüfungsfach zu machen, wie so viele nicht ganz hinreichend Begabte es tun; aber bei mir reichte es noch weniger; eine merkwürdige Erschöpfung – Herr Doktor, ich bin so bedrückt – stellte sich ein, und ich wechselte zur englischen Literatur über, bei der so viele verhinderte Dichter als pfeiferauchende Lehrer in Tweedjacken enden. Paris sagte mir zu. Ich diskutierte Sowjetfilme mit Emigranten. Ich saß mit Uranisten[1] im Café ‹Deux Magots›. Ich veröffentlichte verquälte Essays in obskuren Blättern. Ich verfasste Pastiches:
… Fräulein von Kulp
mag sich wenden, die Hand an der Tür;
ich folge weder Fresca noch ihr
und auch nicht der Möwe.[2]
Einer meiner Artikel, Das Proust-Thema in einem Brief von Keats an Benjamin Bailey, wurde von den sechs oder sieben Literaten, die ihn lasen, mit Schmunzeln aufgenommen.[3] Ich nahm im Auftrag eines Verlags mit großem Namen eine Histoire abrégée de la poésie anglaise in Angriff und begann, das Handbuch der französischen Literatur für englischsprachige Studenten (mit vergleichenden Auszügen aus der englischen Literatur) zusammenzustellen, das mich bis zum Ende der vierziger Jahre beschäftigen sollte – und dessen letzter Band bei meiner Verhaftung beinahe druckfertig war.
Ich fand eine Stelle als Englischlehrer einer Erwachsenengruppe in Auteuil. Danach unterrichtete ich ein paar Winter lang in einer Knabenschule. Ab und zu benutzte ich die Bekanntschaft, die ich mit Sozialarbeitern und Psychotherapeuten angeknüpft hatte, um in ihrer Begleitung allerlei Einrichtungen wie Waisenhäuser oder Besserungsanstalten zu besuchen, wo man dichtbewimperte, blasse, pubertierende Mädchen mit so völliger Straffreiheit anstarren durfte, wie es einem sonst nur in Träumen gestattet ist.
Hier möchte ich folgenden Gedanken vortragen. Zwischen den Altersgrenzen von neun und vierzehn gibt es Mädchen, die gewissen behexten, doppelt oder vielmal so alten Wanderern ihre wahre Natur enthüllen; sie ist nicht menschlich, sondern nymphisch (das heißt dämonisch); und ich schlage vor, diese auserwählten Geschöpfe als «Nymphetten»[4] zu bezeichnen.
Man wird bemerken, dass ich Raumbegriffe durch Zeitbegriffe ersetze. Ich möchte nämlich, dass der Leser «neun» und «vierzehn» als Grenzen – spiegelnder Strand und rötliche Felsen – einer verzauberten Insel sieht, auf der diese meine Nymphetten ihr Wesen treiben, umgeben von einem weiten, dunstigen Meer. Sind innerhalb der angegebenen Altersgrenzen alle Mädchenkinder Nymphetten? Natürlich nicht. Sonst hätten wir, die Eingeweihten, wir einsamen Wanderer, wir Nympholeptiker[5] längst schon den Verstand verloren. Das hübsche Äußere ist ebenfalls kein Kriterium, und Vulgarität, oder was man in gewissen Kreisen darunter versteht, beeinträchtigt bestimmte geheimnisvolle Merkmale auch nicht unbedingt: die Koboldgrazie, den ungreifbaren, verschmitzten, seelenzerrüttenden, heimtückischen Zauber, die die Nymphette von ihren Altersgenossinnen unterscheiden, welche unvergleichlich stärker in der Raumwelt synchroner Erscheinungen zuhause sind als auf der unfassbaren Insel entrückter Zeit, wo Lolita mit ihresgleichen spielt. Innerhalb derselben Altersgrenzen ist die Anzahl echter Nymphetten auffallend gering gegenüber den voraussichtlich unansehnlichen oder nur «ganz netten» oder «herzigen» oder sogar «süßen» und «entzückenden» gewöhnlichen, dicklichen, formlosen, kalthäutigen, durch und durch menschlichen kleinen Mädchen mit Bäuchen und Zöpfen, die sich vielleicht – oder auch nicht – dereinst als große Schönheiten entpuppen werden (man denke an die Pummel in schwarzen Strümpfen und weißen Hüten, die sich in atemraubende Leinwandstars verwandeln). Ein normaler Mann, dem man ein Gruppenbild von Schulmädchen oder Pfadfinderinnen mit der Aufforderung zeigt, er solle die Reizvollste aussuchen, wird nicht unbedingt die Nymphette unter ihnen wählen. Man muss ein Künstler sein, und ein Wahnsinniger obendrein, ein Spielball unendlicher Melancholie, dem ein Bläschen heißen Gifts in den Lenden kocht und eine Flamme schärfster Wollust unablässig in der elastischen Wirbelsäule lodert (ach, wie sehr man sich zu ducken und zu verkriechen hat), um an unbeschreibbaren Anzeichen – der leicht geschwungenen Raubtierkontur eines Backenknochens, dem Flaum an den schlanken Gliedern und anderen Merkmalen, die aufzuzählen mir Verzweiflung, Scham und Tränen der Zärtlichkeit verbieten – sofort den tödlichen kleinen Dämon unter den normalen Kindern zu erkennen … Da steht sie, von ihnen unerkannt und ihrer mythischen Macht selbst nicht bewusst.
Außerdem dürfte, da der Zeitbegriff in dieser Sache eine so magische Rolle spielt, der Wissbegierige nicht erstaunt sein zu erfahren, dass eine Kluft von mehreren Jahren, mindestens zehn, möchte ich sagen, gewöhnlich dreißig oder vierzig, in einigen bekannten Fällen sogar neunzig, zwischen Mädchen und Mann liegen muss, um Letzteren in den Bann einer Nymphette geraten zu lassen. Es ist eine Frage der Blickeinstellung, einer bestimmten Distanz, die das innere Auge mit Freuden überbrückt, eines bestimmten Gegensatzes, bei dem der Verstand, wenn er ihn bemerkt, vor perversem Entzücken nach Luft schnappt. Ein Kind noch war ich und war sie, und damals war meine kleine Annabel keine Nymphette für mich; ich war ihresgleichen, selber ein kleiner Faun auf unserer verzauberten, zeitlosen Insel; aber heute, im September 1952, nach neunundzwanzig Jahren, glaube ich, in ihr die verhängnisvolle Ur-Elfe meines Lebens zu erkennen. Wir liebten einander mit einer frühreifen Liebe, der eine Heftigkeit eigen war, wie sie so oft das Leben Erwachsener zerstört. Ich war ein kräftiger Bursche und überlebte, aber das Gift war in der Wunde, und die Wunde blieb immer offen, und ich wuchs heran in einer Zivilisation, die einem Fünfundzwanzigjährigen erlaubt, einer Sechzehnjährigen den Hof zu machen, aber nicht einer Zwölfjährigen.
Kein Wunder also, dass mein Leben in der Zeit, die ich als Erwachsener in Europa verbrachte, in einer ungeheuerlichen Zweiteilung verlief. Nach außen hin hatte ich sogenannte normale Beziehungen zu mehreren irdischen Frauen mit Kürbissen oder Birnen als Brüste; im Innern wurde ich von einem Höllenbrand lokalisierter Lust auf alle vorbeispazierenden Nymphetten verzehrt, denen ich mich als gesitteter Waschlappen nie zu nähern wagte. Die massigen Menschenweibchen, die zu handhaben mir erlaubt war, dienten nur als Palliative. Ich möchte annehmen, dass die Gefühle, die mir die sogenannte natürliche Hurerei verschaffte, so ziemlich die gleichen waren wie die normaler erwachsener Männer, die sich mit normalen erwachsenen Frauen in jenem Routinerhythmus wiegen, der die Welt bewegt. Das Dumme war nur, dass diese Herren nicht wie ich von einer unvergleichlich intensiveren Seligkeit gekostet hatten. Der matteste meiner Pollutionsträume war tausendmal hinreißender als all die Ehebrecherei, die sich das virilste Schriftstellergenie oder der talentierteste Impotente ausmalen könnten. Meine Welt war gespalten. Für mich gab es nicht ein, sondern zwei andere Geschlechter, von denen mir keines gehörte; beide würde ein Anatom mit «weiblich» bezeichnen. Aber im Prisma meiner Sinne waren sie für mich ‹so verschieden wie Schimmer und Schimmel›. Alles das sind heutige Rationalisierungen. In meinen Zwanzigern und frühen Dreißigern hatte ich nicht so viel Verständnis für meine Leiden. Während mein Körper wusste, wonach er sich sehnte, lehnte mein Verstand jedes Ansinnen meines Körpers ab. Einen Augenblick lang war ich beschämt und beängstigt, im nächsten tollkühn optimistisch. Tabus schnürten mir die Kehle zu. Psychoanalytiker umwarben mich mit Pseudoliberationen von Pseudolibidiotien. Die Tatsache, dass die einzigen Objekte meiner bebenden Verliebtheit Schwestern von Annabel, ihre Zofen und Mädchenpagen waren, kam mir manchmal wie ein Vorbote des Wahnsinns vor. Zu anderen Zeiten sagte ich mir, alles sei Einstellungssache und wirklich nichts Schlimmes dabei, sich bis zur Raserei zu kleinen Mädchen hingezogen zu fühlen. Ich möchte den Leser daran erinnern, dass im Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, das 1933 in England verabschiedet wurde, Mädchenkinder als «Mädchen über acht und unter vierzehn Jahren» definiert werden (danach, von vierzehn bis siebzehn, heißen sie offiziell «junge Personen»). In Massachusetts, USA, hingegen ist ein «wayward child» ein liederliches Kind «zwischen sieben und siebzehn Jahren» (das noch dazu gewohnheitsmäßig mit lasterhaften und unmoralischen Personen Umgang hat).[6] Hugh Broughton[7], ein umstrittener Autor zur Zeit von Jakob dem Ersten, hat nachgewiesen, dass Rahab[8] im Alter von zehn Jahren eine Hure war. Das alles ist hochinteressant, und ich vermute, dass Sie mich bereits mit Schaum vor dem Mund lostoben sehen. Aber nein, das tue ich nicht. Ich schnipse nur glückliche Gedanken ins Becherchen. Noch ein paar Bilder: Hier Vergil, who could nymphets sing in single tone[9], aber aller Wahrscheinlichkeit nach das Perineum eines Knaben vorzog. Dort zwei der vor-mannbaren Niltöchter des Königs Echnaton[10] und der Königin Nofretete (das königliche Paar hatte einen Wurf von sechs), die, auf Kissen ruhend, nichts am Leib tragen außer Halsketten aus glänzenden Perlen, nach dreitausend Jahren noch immer unberührt an ihren weichen braunen Welpenkörpern, mit kurzgeschorenem Haar und langgeschlitzten Ebenholzaugen. Hier ein paar zehnjährige Bräute, die in den Tempeln klassischer Gelehrsamkeit gezwungen wurden, sich auf das Fascinum, das virile Elfenbein, zu setzen. Heirat und Konkubinat vor dem Pubertätsalter sind in gewissen ostindischen Provinzen noch heute nichts Ungewöhnliches. Bei den Leptschas[11] kopulieren Greise von achtzig mit Mädchen von acht, und niemand findet was dabei. Schließlich verliebte sich Dante sinnlos in seine Beatrice, als sie neun war, ein sprühendes Mägdlein in einem karmesinroten Kittelchen, geschminkt und holdselig und juwelengeschmückt; und das geschah 1274 in Florenz, bei einem privaten Fest im Wonnemonat Mai. Und als Petrarca sich besinnungslos in seine Laura verknallte, war sie eine blonde Nymphette von zwölf, die im Winde lief, im Blütenstaub, eine dahinfliegende Blume in der schönen Ebene, die man von den Hügeln der Vaucluse aus erblickt.[12]
Seien wir korrekt und zivilisiert. Humbert Humbert gab sich große Mühe, brav zu sein. Wirklich und wahrhaftig, das tat er. Er hatte äußersten Respekt vor gewöhnlichen Kindern, vor ihrer Reinheit und Verletzbarkeit, und unter keinen Umständen hätte er die Unschuld eines Kindes angetastet, wenn die geringste Gefahr eines Skandals bestand. Aber wie schlug sein Herz, wenn er in der unschuldigen Schar ein Dämonkind erspähte, enfant charmante et fourbe[13]; düstere Augen, leuchtende Lippen, zehn Jahre Zuchthaus, wenn man sich nur anmerken lässt, dass man sie betrachtet. So ging das Leben dahin. Humbert war durchaus zum Geschlechtsverkehr mit Eva fähig, doch war es Lilith[14], nach der er sich sehnte. Das Knospenstadium der Brustentwicklung setzt in der Kette somatischer Veränderungen während der Reifezeit früh ein (10;7 Jahre). Danach ist das erste Erscheinen pigmentierten Schamhaars fällig (11;2 Jahre). Mein Becherchen ist bis zum Rand voll mit Spielflöhen.
Schiffbruch. Ein Atoll.[15] Auf einer Südsee-Insel allein mit dem schaudernden Kind einer ertrunkenen Passagierin. Liebling, es ist ja nur ein Spiel! Wie wundervoll waren die Abenteuer meiner Phantasie, wenn ich auf einer harten Parkbank saß, scheinbar in ein zitterndes Buch vertieft. Um den stillen Gelehrten spielten Nymphetten so unbekümmert, als sei er eine vertraute Statue oder Teil vom Schatten- und Lichtspiel eines alten Baums. Einmal stellte eine vollkommene kleine Schönheit in einem Schottenkleidchen klappernd ihren schwer beschuhten Fuß neben mich auf die Bank, um den Riemen ihres Rollschuhs festzuziehen, und reckte ihre schmalen bloßen Arme in mich hinein; und ich löste mich in der Sonne auf, mein Buch als Feigenblatt, als ihr kastanienbraunes Gelock über das aufgeschundene Knie fiel, und der Blätterschatten, den wir teilten, auf ihrem strahlenden Schenkel neben meiner chamäleonischen Wange zitterte und schmolz. Ein anderes Mal hing in der Metro ein rothaariges Schulmädchen an der Halteschlaufe über mir, und der Anblick ihres rötlichen Achselflaums, der mir zuteilwurde, haftete wochenlang in meinem Blut. Ich könnte eine lange Liste solcher einseitigen Miniromanzen aufstellen. Manche von ihnen endeten mit einem würzigen Vorgeschmack der Hölle. Zum Beispiel kam es vor, dass ich von meinem Balkon aus gegenüber ein erleuchtetes Fenster sah und etwas, das wie eine Nymphette schien, im Begriff, sich vor einem kooperativen Spiegel auszuziehen. In ihrer Isolierung, in dieser Entfernung war die Vision von ganz besonders starkem Reiz, der mich mit Höchstgeschwindigkeit meiner einsamen Befriedigung zurasen ließ. Aber plötzlich, teuflisch, verwandelte sich das zarte Bild der Nacktheit, das ich vergöttert hatte, in den widerlichen, lampenbeleuchteten, nackten Arm eines Mannes in Unterzeug, der in dieser heißen, feuchten, trostlosen Sommernacht am offenen Fenster seine Zeitung las.
Seilspringen, Kreishüpfen. Die Alte in Schwarz, die sich neben mich auf die Bank setzte, auf meine Folterbank der Lust (eine Nymphette suchte unter mir eine verlorene Murmel zu ertasten), und fragte, ob ich Leibschmerzen hätte, die unverschämte alte Hexe! Ach, lasst mich allein in meinem Kleinmädchenpark, in meinem moosigen Garten. Lasst sie für alle Zeiten um mich spielen. Nie erwachsen werden.
6
Apropos: Ich habe mich oft gefragt, was aus diesen Nymphetten später geworden sein mochte. Könnte es in unserer schmiedeeisernen Gitterwelt von Ursache und Wirkung sein, dass die heimliche Lust, die ich ihnen stahl, keinen Einfluss auf ihre Zukunft gehabt hätte? Ich hatte sie besessen – und sie erfuhr es nie. Gut. Aber würde es sich nicht irgendwann doch zeigen? Hatte ich nicht irgendwie an ihrem Schicksal herumgepfuscht, indem ich ihr Bild mit meiner Lust verflocht? Ach, es war und bleibt die Quelle einer großen und schrecklichen Ungewissheit.
Eines Tages erfuhr ich, wie diese berückenden, verrückt machenden, dünnarmigen Nymphetten als Erwachsene aussehen. Ich entsinne mich eines grauen Frühlingsnachmittags, als ich in der Nähe der Madeleine eine belebte Straße entlangging. Ein schlankes, kleines, junges Mädchen kam, auf hohen Hacken trippelnd, eilig an mir vorbei; wir sahen uns gleichzeitig um, sie blieb stehen, und ich sprach sie an. Sie reichte kaum bis an mein Brusthaar und hatte ein rundes kleines Grübchengesicht wie so viele französische Mädchen, und mir gefielen ihre langen Wimpern und das enge Tailleur, die perlgraue Hülle ihres jungen Körpers, der – o nymphisches Echo, Schauer des Entzückens, Aufruhr meiner Lenden – noch ein kindliches Etwas bewahrte, das sich in das professionelle frétillement[1] ihres schmalen, beweglichen Hinterteils mischte. Ich fragte nach dem Preis, und sie erwiderte prompt und mit melodisch silbriger Präzision (Vogel, ganz Vogel!): «Cent.»[2] Ich versuchte zu handeln, aber sie sah das schreckliche Verlangen in meinen gesenkten Augen, die sich auf ihre runde Stirn und ihren angedeuteten Hut richteten (ein Band, ein Sträußchen), und mit einem Aufschlag der Wimpern sagte sie: «Tant pis»[3] und tat, als wolle sie gehen. Vielleicht hätte ich ihr vor nur drei Jahren beim Heimweg von der Schule begegnen können! Diese Vorstellung gab den Ausschlag. Sie führte mich die übliche steile Treppe hinauf, bahnte mit dem üblichen Klingelzeichen dem Monsieur den Weg, dem vielleicht nicht daran gelegen war, bei seinem trauervollen Anstieg zu dem verworfenen Zimmer, ganz Bett und Bidet, einem anderen Monsieur zu begegnen. Wie üblich forderte sie sofort ihr petit cadeau[4], und wie üblich fragte ich gleich nach ihrem Namen (Monique) und ihrem Alter (achtzehn). Ich war mit der banalen Art der Straßenmädchen gut vertraut. Alle antworten sie dix-huit[5], ein hübsches Gezwitscher, ein zweckbestimmter Laut versonnener Täuschung, den sie bis zu zehnmal pro Tag von sich geben, die armen kleinen Dinger. Aber in Moniques Fall konnte kein Zweifel bestehen, dass sie ihrem Alter nur ein oder zwei Jahre hinzufügte. Ich schloss dies aus allerlei Einzelheiten ihres straffen, knappen, merkwürdig unterentwickelten Körpers. Sie hatte ihre Kleider mit faszinierender Schnelligkeit abgestreift und stand, zur Hälfte in den schmuddeligen Tüll der Gardine gehüllt, eine Weile am Fenster, um mit kindlichem Vergnügen und so unverwandt wie nur was einem Leierkastenmann unten im dämmrigen Hinterhof zuzuhören. Als ich ihre kleinen Hände besah und sie auf ihre unsauberen Fingernägel aufmerksam machte, sagte sie mit naivem Stirnrunzeln: «Oui, ce n’est pas bien»[6], und ging zum Waschbecken; aber ich sagte, es mache nichts, mache gar nichts. Mit ihrem braunen Pagenkopf, den leuchtenden grauen Augen und der blassen Haut sah sie einfach bezaubernd aus. Ihre Hüften waren nicht breiter als die eines hockenden Jungen; wirklich, ich habe keine Bedenken zu sagen (und dies ist der eigentliche Grund, warum ich so dankbar mit der kleinen Monique in dem gazegrauen Zimmer der Erinnerung verweile), dass unter den etwa achtzig grues[7], die sich an mir zu betätigen hatten, sie die Einzige war, die mir den Schauer echter Lust verschaffte. «Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là»[8], sagte sie liebenswürdig und schlüpfte mit der gleichen stilvollen Schnelligkeit wieder in ihre Kleider.
Ich schlug eine zweite, gründlichere Zusammenkunft später am Abend vor, und sie sagte, sie werde mich um neun im Eckcafé erwarten, und beteuerte, sie habe in ihrem ganzen jungen Leben noch nie posé un lapin[9]. Wir gingen wieder in dasselbe Zimmer, und ich konnte nicht unterlassen, ihr zu sagen, wie hübsch sie sei, worauf sie wohlerzogen antwortete: «Tu es bien gentil de dire ça»[10], und dann, als sie im Spiegel, der unser kleines Eden zurückwarf, bemerkte, was auch ich bemerkte – die schauerliche Grimasse einer Zärtlichkeit mit zusammengebissenen Zähnen, die meinen Mund verzerrte –, wollte die pflichtgetreue kleine Monique (ach, sie war gewiss eine Nymphette gewesen) wissen, ob sie das Lippenrot abwischen solle avant qu’on se couche[11], falls ich die Absicht hätte, sie zu küssen. Natürlich hatte ich die Absicht. Mit ihr ließ ich mich viel mehr gehen als mit irgendeiner der jungen Damen vor ihr, und das letzte Bild der langbewimperten Monique an diesem Abend ist belebt von einer Fröhlichkeit, die sonst kaum einer Begebenheit meines demütigenden, elenden, verschwiegenen Liebeslebens eigen war. Sie strahlte vor Freude über den Bonus von fünfzig, den ich ihr gab, als sie in die nieselnde Aprilnacht hinaustrottete und Humbert Humbert hinter ihrem schmalen Rücken herhumbelte. Vor einem Schaufenster blieb sie stehen und sagte mit großem Behagen: «Je vais m’acheter des bas!»[12], und ich werde nie vergessen, wie ihre Pariser Kinderlippen bei dem Wort «bas» explodierten und es mit solchem Gelüst aussprachen, dass sein «a» beinahe wie ein kurzes, lustiges, berstendes «o» klang.
Ich hatte für den nächsten Tag um Viertel nach zwei eine Verabredung mit ihr in meiner Wohnung, aber diese verlief weniger befriedigend; über Nacht schien sie erwachsener geworden, mehr Frau. Eine Erkältung, die ich mir bei ihr geholt hatte, veranlasste mich, die vierte Verabredung abzusagen, und es tat mir auch nicht leid, eine Serie von Gemütsbewegungen abzubrechen, die mich mit herzzerreißenden Phantasien zu belasten drohte und in öder Enttäuschung versickern musste. Die geschmeidige, schmale Monique mag bleiben, was sie ein paar Minuten lang gewesen ist: eine verderbte Nymphette, die durch das tüchtige Hürchen hindurch zu erkennen war.
Meine kurze Bekanntschaft mit ihr gab Anlass zu Gedankengängen, die dem Leser, der sich auskennt, ziemlich naheliegend scheinen müssen. Eine Annonce in einer anrüchigen Zeitschrift führte mich eines Tages in das Büro von Mademoiselle Edith, die mir als Erstes anbot, aus einer Sammlung ziemlich konventioneller Photos in einem ziemlich schmierigen Album eine verwandte Seele herauszusuchen («Regardez-moi cette belle brune!»[13]). Als ich das Album beiseiteschob und es irgendwie zustande brachte, mit meinen kriminellen Wünschen herauszurücken, sah sie aus, als wolle sie mir die Tür weisen; als sie mich aber gefragt hatte, welche Summe ich anzulegen bereit sei, ließ sie sich dazu herbei, mich mit einer Person in Verbindung zu setzen, qui pourrait arranger la chose[14]. Am nächsten Tag führte mich eine asthmatische, grobgeschminkte, geschwätzige, knoblauchimprägnierte Frau mit einem fast possenhaft provenzalischen Akzent und einem schwarzen Schnurrbart über violett geschminkten Lippen in eine Wohnung, die allem Anschein nach ihre eigene war, und nachdem sie schmatzend die gebündelten Spitzen ihrer fetten Finger geküsst hatte, um auf die köstliche Rosenknospenqualität ihrer Ware hinzuweisen, zog sie mit theatralischer Geste einen Vorhang beiseite und enthüllte den Teil des Zimmers, in dem sonst wahrscheinlich eine große, anspruchslose Familie schlief. Doch die Bühne war zu dieser Stunde leer, ausgenommen ein ungeheuer dickes, fahles, widerwärtig nichtssagendes Mädchen von wenigstens fünfzehn Jahren mit rot bebänderten schweren schwarzen Zöpfen, das auf einem Stuhl saß und mechanisch eine kahle Puppe wiegte. Als ich den Kopf schüttelte und der Falle zu entschlüpfen suchte, machte sich die Frau unter schnellem Reden daran, vom Rumpf der jungen Riesin den schmuddeligen Pullover herunterzuzerren; dann, als sie sah, dass ich entschlossen war zu gehen, verlangte sie «son argent»[15]. Eine Tür hinten im Zimmer ging auf, und zwei Männer, die in der Küche gesessen hatten, mischten sich in das Gezänk; sie waren verwachsen, kragenlos, sehr dunkelhäutig, und einer von ihnen trug eine Sonnenbrille. Ein kleiner Junge und ein schmieriges, o-beiniges Kleinkind lauerten hinter ihnen. Mit der unverschämten Logik eines Albtraumes zeigte die aufgebrachte Kupplerin auf den Mann mit der Brille und sagte, er habe bei der Polizei gedient, lui, und ich solle lieber tun wie geheißen. Ich trat neben Marie – denn so lautete ihr stellarer Name[16] –, die inzwischen ihr schweres Gesäß in aller Ruhe auf einen Stuhl am Küchentisch gewuchtet hatte und ihre Suppe weiterlöffelte, während das Kleinkind seine Puppe aufhob. In einer Aufwallung von Mitleid, die meine idiotische Geste dramatisierte, drückte ich einen Geldschein in ihre gleichgültige Hand. Sie lieferte meine Gabe dem Exdetektiv ab, woraufhin ich gehen durfte.
7
Ich halte es für möglich, dass das Album der Zuhälterin ein weiteres Glied im Gänseblümchenreigen des Schicksals war; jedenfalls beschloss ich um meiner eigenen Sicherheit willen bald danach, zu heiraten. Ich stellte mir vor, dass ein geregeltes Leben, selbstgekochte Mahlzeiten, all die Konventionen der Ehe, die vorbeugende Monotonie ihrer Schlafzimmerbetätigungen und, wer weiß, das schließliche Aufblühen gewisser moralischer Werte, eines gewissen spirituellen Ersatzes mir dazu verhelfen könnten, mich von meinen entwürdigenden und gefährlichen Begierden wenn nicht endgültig zu reinigen, so doch sie friedlich im Zaum zu halten. Etwas Geld, das mir nach dem Tod meines Vaters zugefallen war (nicht sehr viel, das Mirana war schon lange vorher verkauft worden), und dazu mein auffallend gutes, wenn auch etwas brutales Aussehen erlaubten mir, mit Gleichmut auf die Suche zu gehen. Nach vielfachen Erwägungen fiel meine Wahl auf die Tochter eines polnischen Arztes: Der gute Mann behandelte mich gerade wegen Schwindelanfällen und Tachykardie. Wir spielten Schach; seine Tochter beobachtete mich hinter ihrer Staffelei und fügte Augen oder Knöchel, die sie mir entnahm, in den kubistischen Unfug, den gebildete junge Damen damals anstelle von Flieder und Lämmchen malten. Mit ruhiger Bestimmtheit muss ich wiederholen: Ich war und bin noch immer, trotz mes malheurs[1], ein ungewöhnlich gutaussehender Mann; groß, mit langsamen Bewegungen, weichem dunklem Haar und einer schwermütigen und deshalb umso verführerischeren Körperhaltung. Außergewöhnliche Virilität tritt oft in den vorzeigbaren Zügen des Betreffenden als ein mürrisches und gestautes Etwas zutage, das dem entspricht, was er verbergen muss. Und das war bei mir der Fall. Ach, ich wusste nur zu gut, dass ich mit einem Fingerschnipsen jedes erwachsene Weibsbild haben konnte, das ich nur irgend wollte; aber ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, Frauen keine Aufmerksamkeit zu schenken, aus Angst, sie könnten mir Hals über Kopf wie eine vollreife Frucht in den kalten Schoß torkeln. Wäre ich ein français moyen[2] mit Sinn für schicke Schönheiten gewesen, so hätte ich unter den vielen liebestollen Weibern, die gegen meinen starren Fels gespült wurden, leicht viel faszinierendere Geschöpfe gefunden als Valeria. Meine Wahl wurde jedoch von Überlegungen bestimmt, denen, wie ich zu spät erkannte, ein jämmerlicher Kompromiss zugrunde lag. Was alles nur zeigt, wie dumm der arme Humbert in Liebesdingen immer war.
8
Obwohl ich mir sagte, dass ich lediglich auf eine beschwichtigende Präsenz, einen besseren pot-au-feu[1], eine animierte Penishülse Wert legte, zog mich in Wahrheit an, wie sie das kleine Mädchen spielte. Sie tat es nicht etwa, weil sie mich durchschaut hätte; es war einfach ihr Stil – und ich fiel darauf herein. In Wirklichkeit war sie wenigstens hoch in den Zwanzigern (ihr genaues Alter konnte ich nie feststellen, da selbst ihr Pass log), und ihre Jungfernschaft war ihr unter Umständen abhandengekommen, die nach den Launen ihrer Erinnerung wechselten. Ich meinerseits war so naiv, wie nur ein Pervertierter es sein kann. Sie sah aus, als wäre sie leichtes Spiel und immer zu Streichen aufgelegt, zog sich à la gamine[2] an, ließ reichlich viel glattes Bein sehen, verstand, die Weiße eines nackten Spanns durch das Schwarz eines Samtpantoffels zur Geltung zu bringen, und schmollte und machte Grübchen und tollte und dirndelte und schüttelte ihr kurzes lockiges Blondhaar, wie man es sich drolliger und platter nicht vorstellen kann.
Nach einer kurzen Zeremonie auf der Mairie[3] brachte ich sie in die neue Wohnung, die ich gemietet hatte, und ließ sie, ehe ich sie anrührte, ein wenig zu ihrer Verwunderung das schlichte Kleinmädchennachthemd anziehen, das aus dem Wäscheschrank eines Waisenhauses zu stibitzen mir gelungen war. Die Hochzeitsnacht machte mir einigen Spaß, und bei Sonnenaufgang hatte ich die Idiotin so weit, dass sie hysterische Zustände bekam. Doch bald bekam die Wirklichkeit wieder die Oberhand. Die gebleichte Locke offenbarte ihre Melaninwurzel; der Flaum auf dem rasierten Schienbein wurde zu Stacheln; der bewegliche feuchte Mund, sosehr ich ihn auch mit Liebe stopfte, enthüllte seine schmähliche Ähnlichkeit mit dem entsprechenden Teil auf einem hochverehrten Porträt ihrer krötenhaften, toten Mama; und bald hatte Humbert Humbert statt eines blassen kleinen Gassenmädchens eine große, aufgedunsene, kurzbeinige, dickbusige und so gut wie hirnlose baba[4] auf dem Hals.
Diese Sachlage währte von 1935 bis 1939. Das einzige Gute an Valeria war ihre Sanftmütigkeit, die dazu beitrug, eine merkwürdige Art von Behaglichkeit in unserer armseligen kleinen Wohnung aufkommen zu lassen: zwei Zimmer, ein dunstiges Panorama in dem einen und eine Backsteinmauer in dem anderen Fenster, eine winzige Küche, eine schuhförmige Badewanne, in der ich mich wie Marat fühlte, nur dass es keine Maid mit weißem Halse gab, mich zu erdolchen. Wir verbrachten eine ganze Reihe gemütlicher Abende zusammen, sie in ihren Paris-Soir vertieft, ich an einem wackligen Tisch bei der Arbeit. Wir gingen ins Kino, zu Radrennen und Boxkämpfen. Ich erhob sehr selten, nur in Fällen großer Dringlichkeit und Verzweiflung, Anspruch auf ihr schales Fleisch. Der Kolonialwarenhändler gegenüber hatte eine kleine Tochter, deren Schatten mich verrückt machte; aber mit Valerias Hilfe fand ich schließlich doch ein paar legale Auswege aus meiner phantastischen Bedrängnis. Was das Kochen betrifft, so hatten wir wortlos den pot-au-feu abgeschafft und aßen meistens in der Rue Bonaparte, in einem überfüllten Lokal mit Weinflecken auf dem Tischtuch und viel Geschwätz in fremden Zungen. Und nebenan stellte ein Kunsthändler in seinem vollgestopften Schaufenster einen herrlichen alten amerikanischen Druck in glühenden Farben aus: grün, rot, gold und tintenblau – eine Lokomotive mit riesigem Schornstein, großen bizarren Scheinwerfern und einem gewaltigen Kuhfänger, die ihre malvenfarbenen Waggons durch die stürmische Prärienacht zog und eine Menge funkenstiebenden schwarzen Rauches unter die pelzigen Gewitterwolken mischte.
Sie barsten. Im Sommer 1939 starb mon oncle d’Amérique[5] und hinterließ mir eine Jahresrente von ein paar tausend Dollar unter der Bedingung, dass ich in die Staaten übersiedele und mich ein wenig um sein Geschäft kümmere. Diese Aussicht war mir höchst willkommen. Ich fühlte, dass mein Leben eine Aufrüttelung nötig hatte. Es kam noch etwas hinzu: dass im Plüsch unserer ehelichen Gemütlichkeit Mottenlöcher aufgetaucht waren. In den letzten Wochen hatte ich wiederholt bemerkt, dass meine dicke Valeria nicht wie sonst war; eine sonderbare Ruhelosigkeit war über sie gekommen; manchmal legte sie gar eine Art Gereiztheit an den Tag, die gar nicht zu der Rolle passte, die sie darzustellen hatte. Als ich ihr mitteilte, dass wir nächstens nach New York fahren würden, sah sie bekümmert und nachdenklich aus. Langwierige Schwierigkeiten mit ihren Papieren hielten uns hin. Sie hatte einen Nansen- oder besser Nonsens-Pass[6], den aus irgendwelchen Gründen nicht einmal die Verbindung mit der soliden Schweizer Staatsbürgerschaft ihres Ehegatten zu transzendieren vermochte; und ich kam zu dem Schluss, dass das Schlangestehen auf der Préfecture und die anderen Formalitäten sie so lustlos gemacht hatten – obwohl ich mich geduldig mühte, ihr Amerika als ein Land der rosigen Kinder und der hohen Bäume zu schildern, wo das Leben ein Fortschritt gegenüber dem trübseligen, schmuddeligen Paris wäre.
Eines Morgens kamen wir aus einem der Ämter – ihre Papiere waren beinahe in Ordnung –, als Valeria, während sie an meiner Seite watschelte, plötzlich ohne ein Wort energisch ihren Pudelkopf schüttelte. Ich ließ sie eine Weile gewähren und fragte dann, ob sie glaube, sie habe was darin. Sie antwortete (ich übersetze aus ihrem Französisch, was wahrscheinlich seinerseits die Übersetzung irgendeiner slawischen Plattitüde war): «Ein anderer Mann ist in mein Leben getreten.»
Nun, das sind hässliche Worte fürs Ohr eines Ehemannes. Ich gestehe, sie versetzten mir einen Schlag. Sie dort auf der Straße auf der Stelle zu versohlen, wie ein ordentlicher Kleinbürger es getan hätte, ging nicht an. Jahre geheimer Leiden hatten mich übermenschliche Selbstbeherrschung gelehrt. So schob ich sie in ein Taxi, das seit geraumer Zeit einladend an der Bordschwelle entlanggekrochen war, und schlug ihr in dieser relativen Abgeschiedenheit vor, ihr wirres Gerede zu erläutern. Eine aufsteigende Wut würgte mich – nicht, weil ich diese Schießbudenfigur namens Mme Humbert besonders gern gehabt hätte, sondern weil allein ich es war, dem in Fragen legaler und illegaler Bindungen die Entscheidung zustand; und jetzt saß sie da, Valeria, die Lustspielgattin, und schickte sich unverfroren an, nach ihrem eigenen Ermessen über meine Bequemlichkeit und mein Schicksal zu verfügen. Ich verlangte den Namen ihres Liebhabers. Ich wiederholte meine Frage; aber sie blieb bei ihrem grotesken Geschwätz über unsere unglückliche Ehe und ihre Absicht, sich sofort scheiden zu lassen. «Mais qui est-ce?»[7], schrie ich endlich und hieb ihr mit der Faust aufs Knie; und sie starrte mich an, ohne mit der Wimper zu zucken, als wäre die Antwort zu einfach für Worte, zuckte schnell mit den Achseln und zeigte auf den feisten Nacken des Taxifahrers. Er hielt vor einem kleinen Café und stellte sich vor. Ich erinnere mich nicht an seinen lächerlichen Namen, aber nach all den Jahren sehe ich ihn noch ganz deutlich vor mir – ein stämmiger ehemaliger weißgardistischer Oberst aus Russland mit buschigem Schnurrbart und militärisch kurzem Haarschnitt; in Paris gab es Tausende seinesgleichen, die demselben eselhaften Gewerbe nachgingen. Wir setzten uns an einen Tisch; der Zarist bestellte Wein, und Valeria, die eine nasse Serviette auf ihr Knie gelegt hatte, redete weiter, mehr in mich hinein als zu mir; sie goss ihre Worte mit einer Redegewandtheit, die ich ihr nie zugetraut hätte, in dieses würdige Gefäß. Und ab und zu ließ sie eine Salve Slawisch auf ihren unbeirrbaren Liebhaber los. Die Situation war grotesk und wurde es noch mehr, als der Taxioberst Valeria mit einem Besitzerlächeln Einhalt gebot und anfing, seine Ansichten und Pläne darzulegen. Mit einem scheußlichen Akzent in seinem gewählten Französisch umriss er die Welt der Liebe und Arbeit, in die er Hand in Hand mit seinem kindhaften Weibe Valeria einzutreten gedachte. Sie saß zwischen ihm und mir, widmete sich in der Zwischenzeit der Körperpflege, legte ihren gespitzten Lippen Rot auf, verdreifachte ihr Kinn, um an ihrem Blusenbusen zu zupfen, und so fort, und er sprach von ihr, als wäre sie gar nicht da und ein Waisenkind, das zu seinem eigenen Besten einem weisen Vormund weggenommen und einem noch weiseren anvertraut wird. Und obwohl mein ohnmächtiger Zorn gewisse Eindrücke übertrieben und entstellt haben mag, kann ich doch schwören, dass er mich allen Ernstes nach Dingen fragte wie ihrer Diät, ihrer Periode, ihrer Garderobe und den Büchern, die sie gelesen hatte oder lesen sollte. «Ich glaube», sagte er, «Jean-Christophe[8] würde ihr gefallen, oder?» Herr Taxowitsch war nämlich ein gebildeter Mann.
Ich machte dem Gewäsch mit dem Vorschlag ein Ende, Valeria möge sofort ihre paar Sachen zusammenpacken, worauf der Banause von einem Oberst galant anbot, sie in seinem Wagen zu befördern. Er kehrte zu seinen Berufspflichten zurück und chauffierte die Humberts nach Hause, und Valeria sprach die ganze Zeit, und Humbert der Schreckliche beriet sich mit Humbert dem Kleinen, wen Humbert Humbert ermorden solle, sie oder ihren Liebhaber oder beide oder keinen. Ich entsinne mich, dass ich einmal mit einem Revolver hantiert hatte, der einem Kommilitonen gehörte – in den Tagen (ich habe sie, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber das macht nichts), als ich mit dem Gedanken spielte, seine kleine Schwester zu vernaschen, eine ungewöhnlich strahlende Nymphette mit einer schwarzen Haarschleife, und mich dann zu erschießen. Jetzt fragte ich mich, ob Waletschka (wie der Oberst sie nannte) es wert sei, erschossen, erwürgt oder ersäuft zu werden. Sie hatte sehr empfindliche Beine, und ich beschloss, mich darauf zu beschränken, ihr grässlich wehzutun, sobald wir allein wären.
Aber dazu kam es nicht. Waletschka vergoss jetzt Ströme von Tränen, die sich im Geschmier ihres Regenbogen-Make-up färbten, fing an, kunterbunt einen Schrankkoffer, zwei Reisekoffer und einen platzenden Karton zu füllen, und das Verlangen, meine Bergstiefel anzuziehen und ihr mit Anlauf einen Tritt in den Steiß zu versetzen, ließ sich natürlich nicht in die Tat umsetzen, solange der verdammte Oberst die ganze Zeit herumlungerte. Ich kann nicht sagen, dass er sich frech oder sonstwie ungebührlich benommen hätte; im Gegenteil, er legte quasi auf einer Nebenbühne der Laienaufführung, zu der ich verleitet worden war, einen diskreten, altmodischen Anstand an den Tag, begleitete seine Gebärden mit allen möglichen falsch ausgesprochenen Entschuldigungen (j’ai demannde pardonne – entschuldigen Sie – est-ce que j’ai puis – darf ich – und so weiter) und wandte sich taktvoll ab, als Waletschka schwungvoll ihre rosa Höschen von der Wäscheleine über der Badewanne herunterzog; doch er schien gleichzeitig überall zu sein, le gredin[9], passte seinen Corpus der Anatomie der Wohnung an, las meine Zeitung auf meinem Stuhl, knotete eine verhedderte Schnur auf, drehte sich eine Zigarette, zählte Teelöffel, ging ins Badezimmer, half seinem Flittchen, den Föhn – ein Geschenk ihres Vaters – einzuwickeln und ihr Gepäck straßenwärts zu tragen. Ich lehnte mit einer Hüfte am Fensterbrett, die Arme verschränkt, und erstickte vor Hass und Langeweile. Endlich waren beide aus der bebenden Wohnung heraus, das Dröhnen der Tür, die ich hinter ihnen zugeknallt hatte, zitterte noch in allen meinen Nerven, ein armseliger Ersatz für den Schlag mit dem Handrücken, den ich ihr, den Regeln der heutigen Filme gemäß, quer über den Backenknochen hätte versetzen sollen. Schwerfällig spielte ich meine Rolle weiter und stapfte ins Badezimmer, um nachzusehen, ob sie mein englisches Toilettenwasser mitgenommen hatten; nein, hatten sie nicht; aber ich bemerkte mit einem würgenden Ekelkrampf, dass der ehemalige Hofrat des Zaren nach einer gründlichen Entleerung seiner Blase das Becken nicht gespült hatte. Der solenne Tümpel fremdländischen Urins mit einem durchweichten dunkelgelben Zigarettenstummel, der sich in ihm auflöste, traf mich wie eine äußerste Beleidigung, und ich sah mich wild nach einer Waffe um. In Wirklichkeit war es wohl nichts als eine russische Kleinbürgerhöflichkeit (vielleicht mit asiatischem Einschlag), die den braven Oberst (Maximowitsch! sein Name kommt plötzlich wieder angetaxelt), der wie alle Russen eine sehr förmliche Person war, veranlasst hatte, sein privates Bedürfnis in züchtige Stille zu hüllen, um nach seinem gedämpften Geträufel die Enge der gastlichen Behausung nicht durch das Rauschen einer mächtigen Kaskade zu unterstreichen. Dies fiel mir aber in dem Augenblick nicht ein, als ich vor Wut stöhnend die Küche nach etwas Besserem als einem Besen durchwühlte. Dann gab ich die Suche auf und raste mit dem heroischen Entschluss, mit bloßen Fäusten auf ihn loszugehen, aus dem Haus; trotz meiner kraftvollen Statur bin ich kein Faustkämpfer, während der kleine, aber breitschultrige Maximowitsch aus Gusseisen zu bestehen schien. Die Leere der Straße, auf der vom Auszug meiner Frau nichts mehr zu sehen war außer einem Strassknopf, den sie in den Schmutz hatte fallen lassen, nachdem sie ihn drei unnütze Jahre hindurch in einer kaputten Schachtel aufbewahrt hatte, ersparte mir vielleicht eine blutige Nase. Einerlei. Zu gegebener Zeit kam ich zu meiner kleinen Rache. Ein Mann aus Pasadena erzählte mir eines Tages, dass Mrs. Maximovich, geborene Zborovski, um 1945 im Kindbett gestorben sei; das Paar war irgendwie nach Kalifornien hinübergelangt und dort für ein glänzendes Gehalt zu einem einjährigen Experiment benutzt worden, das ein angesehener amerikanischer Ethnologe leitete. Das Experiment sollte die menschlichen und rassischen Reaktionen auf eine Diät von Bananen und Datteln bei ständiger Haltung auf allen vieren ermitteln. Mein Gewährsmann, ein Arzt, schwor, er habe meine beleibte Valeria mit ihrem inzwischen ergrauten und ebenfalls recht korpulenten Oberst emsig auf dem gut gefegten Fußboden einer hell erleuchteten Zimmerflucht (in einem Zimmer Obst, im zweiten Wasser, im dritten Matten und so weiter) umherkriechen sehen, in Gesellschaft mehrerer anderer gemieteter Vierfüßler, die ebenfalls aus mittel- und ratlosen Schichten stammten. Sogleich suchte ich in der Review of Anthropology nach Resultaten dieser Versuche, aber sie scheinen bisher noch nicht veröffentlicht zu sein. Natürlich brauchen derartige wissenschaftliche Produkte ihre Zeit, um zu reifen. Ich hoffe, sie werden mit guten Photographien illustriert sein, wenn sie erscheinen, obschon nicht anzunehmen ist, dass eine Gefängnisbücherei derlei gelehrte Bücher beherbergen wird. Die Bibliothek, auf die ich, trotz der Fürsprache meines Rechtsanwalts, hier beschränkt bin, gibt ein gutes Bild von dem faden Eklektizismus, der die Auswahl der Bücher in Gefängnisbibliotheken bestimmt. Es gibt die Bibel, natürlich, und Dickens (eine alte Gesamtausgabe, New York, Verlag G.W. Dillingham, MDCCCLXXXVII), und die Enzyklopädie für Kinder (mit einigen hübschen Photos von sonnenscheinhaarigen Pfadfindermädchen in Shorts), und Ein Mord wird angekündigt von Agatha Christie; aber sie haben auch so glänzende Nichtigkeiten wie Ein Vagabund in Italien von Percy Elphinstone[10], dem Verfasser von Wiedersehen mit Venedig, Boston 1868, und eine verhältnismäßig späte (1946) Ausgabe von Wer ist wer im Rampenlicht? – Schauspieler, Regisseure, Dramatiker und Standphotos. Beim Durchblättern dieses Bandes wurde mir gestern eines jener blendenden Zusammentreffen beschert, das Logiker verabscheuen und Dichter lieben. Ich schreibe den größten Teil der Seite ab:
Pym[11], Roland. Geboren in Lundy, Mass., 1922. Ausbildung am Elsinore Playhouse[12], Derby, N.Y. Erstes Auftreten in Sonnendurchbruch. Spielte unter anderem in Zwei Straßen weiter, Das Mädchen in Grün, Vertauschte Ehemänner, Der seltsame Pilz, Drittenabschlagen, Johann Lieblich, Ich träumte von dir.
Quilty, Clare[13]