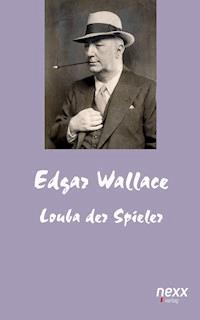
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Edgar Wallace Reihe
- Sprache: Deutsch
Der junge Leutnant Reggie Weldrake ist auf Malta stationiert und spielt gerne Roulette. Leider nicht sehr erfolgreich, in der Spielhölle von Emil Louba hat er große Summen verloren. Eines Tages wird Weldrake erschossen aufgefunden und sein Mentor, Captain Brown, hat jetzt nur noch ein Ziel: Louba und seine Spelunke müssen endlich verschwinden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Edgar Wallace
Louba der Spieler
Impressum
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958704718
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
1
Ein Schuss zerriss die Stille. Captain Hurley Brown fuhr herum – er wusste sofort, was geschehen war.
Reggie Weldrake! Der junge Mann war mit verstörtem Gesicht an ihm vorbei in sein Zimmer gerannt und hatte die Tür hinter sich zugeschlagen. Hätte er ihn nur aufgehalten ...
Hurley Brown hatte einen solchen Gesichtsausdruck schon einmal bei einem Menschen gesehen. Auch jener Mann – genau wie Reggie Weldrake ein junger Offizier – war eben von einer letzten Unterredung mit Emil Louba zurückgekommen ... Auch damals fiel gleich darauf ein Schuss.
Nachdem der Captain vorher Reggie gesehen hatte, war er voll Unruhe im Gang stehengeblieben und hatte eine Zigarette nach der anderen gepafft, unschlüssig, ob er sein eigenes Quartier aufsuchen sollte. Unentwegt musste er an das verzerrte Gesicht Weldrakes denken. Als der Captain sich eben entschloss, doch an der Tür seines Kameraden zu klopfen, krachte der Schuss. Mit zwei Sätzen war Brown an der Tür und rüttelte an der Klinke.
Es war abgeschlossen, und obwohl er mit aller Kraft gegen die Tür hämmerte und laut rief, kam keine Antwort – er erwartete auch keine. Mit seinen schweren Schuhen trat er gegen das Schloss und hatte es schon beinahe zertrümmert, als McElvie, Weldrakes Bursche, und ein paar Offiziere und Diener die Treppe heraufstürzten. Ihren vereinten Kräften gab das Schloss so plötzlich nach, dass sie alle miteinander einige Schritte in das Zimmer hineintaumelten.
Reggie Weldrake aufzurichten, ihm zu helfen, war sinnlos. Schon ein oberflächlicher Blick genügte, um festzustellen, dass er tot war. Den Raum durchzog ein beißender Geruch; Weldrakes Finger hielten immer noch krampfhaft den Armeerevolver umspannt.
»Dieser verfluchte Louba, der Teufel soll ihn holen!« Brown brach als erster das unheimliche Schweigen, und die anderen stimmten mit kräftigen Verwünschungen ein.
»Wenn sich doch jemand finden würde, der diesen Dreckskerl umlegt. Malta wäre bedeutend sauberer«, erklärte McElvie grimmig. Kein Mensch war anderer Meinung. Es war jedem ganz klar, dass Louba die Ursache dieser Tragödie war. Schließlich war es kein Einzelfall!
Captain Brown hasste Louba besonders. Schon zu oft hatte er es miterlebt, wie nette, ein wenig leichtsinnige Burschen durch ihn und seinesgleichen ruiniert wurden. Er hatte auch längst den Entschluss gefasst, diesen Louba aus Malta hinauszubefördern. Sein erster Schritt war es deswegen gewesen, sich mit seinen Vorgesetzten auf der Militärbehörde in Verbindung zu setzen – mit allem Nachdruck hatte er sie auf den schlimmen Einfluss aufmerksam gemacht, den Loubas Unternehmen auf die Truppen der Insel ausübte.
Brown hatte das Unheil, dem Reggie Weldrake entgegensteuerte, kommen sehen. Hätte der Junge nur ein wenig mehr Vertrauen zu ihm gehabt – aber alle seine Versuche, ihn zu warnen, waren fehlgeschlagen. Wahrscheinlich hatte Reggie schon zu tief in der Sache dringesteckt, als dass er sich noch hätte frei machen können.
Der Captain strich sich mit der Hand über die Stirn und riss sich zusammen. Die andern harten inzwischen den Toten aufs Bett gelegt – sie überließen ihn jetzt seiner Einsamkeit. Mit einem kurzen Entschluss trennte sich Brown von den Kameraden und ging quer über die Straße; dorthin, wo eine grell aufflammende Reklameschrift den Eingang zu Loubas Lokal kennzeichnete.
Das Kabarett, das er betrat, war nur eine prunkvolle Attrappe für den anderen, bedeutend wichtigeren Teil des Unternehmens. Nach einigen Schritten blieb er stehen – irgendetwas Außergewöhnliches musste passiert sein.
Das Lärmen der Jazz-Musik war verstummt, die allgemeine Unterhaltung wie abgestorben. Auf den Tischen standen die Gläser unberührt, und alle Augen starrten neugierig nach einer Richtung. Auf der niedrigen Bühne im Hintergrund des Saales schien zwischen einem der Gäste und der Sängerin der Jazz-Band eine Auseinandersetzung im Gang zu sein. Der Mann, mit dem sich das Mädchen zankte, war sehr dick. Er hatte ein volles, hochrotes Gesicht, und neben der aufdringlichen Eleganz seiner Kleidung schien ihn vor allem seine Zungenfertigkeit auszuzeichnen.
Brown näherte sich langsam der Tür zu den Spielsälen. Im gleichen Moment wurden die verdeckenden Vorhänge davor beiseitegeschoben, und Emil Louba trat ein.
»Gut, dass du kommst«, unterbrach der beleibte Herr seinen Redefluss.
»Ah, da Costa – mein Freund da Costa! Schau mal einer an ...«, ließ sich Louba mit einer geradezu katzenschnurrenden Sanftmut vernehmen.
»Hat sich was von wegen Freund – dein Ruin werde ich sein!« brüllte da Costa aufgeregt. Gegen den großen, breitschultrigen Louba erschien er recht klein, und als der andere ihn grinsend von oben herab betrachtete und nur ein wenig mit seinem schwarzen Schnurrbart zuckte, schrie da Costa in einem neuen Wutanfall: »Schon wieder hast du dich in meine Angelegenheiten eingemischt! Wann wirst du das endlich unterlassen?«
»In der Liebe und im Geschäft ist alles fair, mein Bester verstanden? Deswegen können wir trotzdem gute Freunde bleiben ... Aber komm, wir stören den Betrieb.«
Er packte da Costas Arm und versuchte, ihn außer Sicht und Hörweite der gaffenden Menge zu zerren. Da Costa fiel jedoch nicht auf sein freundliches Lächeln herein und schrie energisch:
»Ich will den Betrieb stören! Das Mädchen da hat einen Vertrag mit mir ... Ich zahle ihr dreimal so viel Gage, wie sie wert ist ..., ich habe sie ausgebildet, und mir verdankt sie alles ...!«
»Sie lügen!« kreischte das Mädchen in kräftigem Diskant dazwischen. »Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen – ich kann hingehen, wohin ich will, und ...«
»Und die Dame zieht eben Malta diesem erbärmlichen Tripolis vor«, schaltete sich Louba wieder ein. »Das ist es.«
»Wenn das alles wäre – aber es ist noch lange nicht alles, du hast bei mir noch viel mehr auf dem Kerbholz!« explodierte da Costa. »Habe ich irgendwo eine gute Sache eingefädelt, dann kommst sofort du und machst mir Konkurrenz. Oder du machst mir meine besten Künstler abspenstig, oder ...«
»Oder ich beweise auf andere Art, dass ich der Tüchtigere von uns beiden bin«, sekundierte ihm Louba grinsend. »Geschäft ist ein feines Spiel, da Costa – wenn man zu spielen versteht. Und jetzt komm! Du hast den Betrieb lange genug gestört.«
Seine Finger gruben sich noch ein wenig tiefer in da Costas fetten Arm, und er zerrte ihn wieder ein oder zwei Schritte nach der vorhangverhängten Tür.
»Undankbares Frauenzimmer! Du kommst sofort mit nach Tripolis zurück oder bezahlst mir den Kontraktbruch«, drohte da Costa, indem er sich losriss und auf die Frau zusprang.
Er fuchtelte ihr mit der Faust vor dem Gesicht herum, aber sie war seinen Beschimpfungen durchaus gewachsen – in einem halben Dutzend Sprachen schrie sie ihn an, bis Louba dazwischentrat.
»Ruhig jetzt und weitergearbeitet!« kommandierte er und schob sie zur Bühne.
Er gab den Musikern ein Zeichen, winkte zwei Kellnern, und als ob es überhaupt keine Unterbrechung gegeben hätte, spielte die Kapelle weiter. Das Mädchen zauberte sofort ein verführerisches Lächeln auf ihr Gesicht und begann mit mehr heiserer als dunkler Stimme den neuesten Schlager der Saison. Gleichzeitig packten die zwei Kellner da Costa und zerrten ihn quer durch den Saal auf die Straße, wo sie sich noch einige Zeit mit ihm herumbalgten.
Louba verbeugte sich vor den Gästen; sein glattes, schwarzes Haar schimmerte in der Saalbeleuchtung.
»Bitte tausendmal um Entschuldigung« meinte er geschmeidig. »Wenn man ein so erstklassiges Etablissement hat wie ich, muss man eben mit dem Neid der Konkurrenz rechnen.«
Er wollte gerade wieder hinter der Portiere verschwinden, als Hurley Brown auf ihn zutrat.
»Ah, Captain Brown!« Louba verneigte sich mit spöttischer Übertreibung. »Reizend von Ihnen! Welch seltenes Vergnügen ... Ihr junger Freund, Leutnant Weldrake, ist ein häufigerer Gast.«
»Das ist vorbei«, lautete die grimmige Antwort.
»Wirklich?« Louba grinste. »Nun, wir werden ja sehen. Wenn er, bevor er geht, seinen Verpflichtungen nachkommt, kann mir das ja gleich sein ... Verlässt er uns tatsächlich?«
»Er hat uns schon verlassen. Genau wie Sie uns verlassen werden, Louba, und wenn ich Ihnen dazu einen Stein an den Hals hängen und Sie ins Meer werfen müsste.«
»Was soll das heißen ›Er hat uns schon verlassen?‹ Es ist kaum eine Stunde her, seit ich ihn an seine Verpflichtungen mir gegenüber erinnert habe – mit Vorhaltungen wie britischer Offiziers ›Ehrenmann‹ und so weiter.«
»Louba«, sagte Hurley Brown heiser. »Ich weiß wirklich nicht, warum ich Ihnen keine Ohrfeige gebe.«
»Vielleicht weil Sie wissen, dass Sie hinausfliegen, bevor Sie mich nur angerührt haben, werter Freund.«
»Sie ...!«
Captain Browns Arm wurde geschickt abgefangen, als er zuschlagen wollte.
»Durch Gewalt erreichen Sie wirklich nichts«, sagte Louba. »Außerdem schickt sich so was nicht, wie? – Was soll das ganze Gerede, dass der junge Mann fort ist, bedeuten?«
»Er wurde soeben ermordet.«
»Ermordet? Von wem?«
»Von Ihnen, Louba.«
»Oho ...! Ach so«, sagte Louba nach kurzem Besinnen. »So steht die Sache. Und was wollen Sie dann hier, wenn ich fragen darf?«
»Ihnen nur sagen, dass ich selbst Sie mit einem Fußtritt aus Malta hinausbefördere, falls die Behörden Sie nicht hinauswerfen. Wir haben uns ja schon früher getroffen, Louba, und ich muss sagen – je länger Sie leben, desto gemeingefährlicher werden Sie.«
»Blödsinn! Ich begegne nur immer häufiger solchen Narren wie Sie einer sind. Und was Ihre Behörde betrifft – das habe ich für sie übrig!« Er schnippte mit den Fingern. »Man kann mich doch nicht für jeden dummen Jungen verantwortlich machen!«
Grinsend verzog er das Gesicht.
»Eines Tages«, sagte Hurley Brown, »ist das Maß Ihrer Frechheiten voll.«
»Wenn das eine Drohung sein soll«, entgegnete Louba höhnisch, »kann ich nur lachen. Ich gehe meinen Weg und zertrete das, was mir im Wege ist. Oder ich gehe darüber hinweg. Die anderen können entscheiden, ob ich sie zertreten soll oder nicht.«
Captain Brown murmelte einen Fluch und ließ den Mann stehen.
Er drängte sich durch die Menge der Gäste, die gerade laut Beifall für die Sängerin klatschten.
Natürlich hatte er gleich gewusst, dass es sinnlos war, in dieses Lokal zu gehen – aber trotzdem war es schmählich, jetzt an Reggie Weldrake denken zu müssen, der steif und still auf seinem schmalen Bett lag, während Emil Louba in aller Gemütsruhe seinen schmutzigen Geschäften nachging.
Er fuhr zusammen, als eine wütende Stimme von der andern Straßenseite herüber an sein Ohr drang.
»Das wirst du mir noch büßen! Und wenn ich zwanzig Jahre warten muss!«
Es war da Costa, der mit der Faust nach dem Lokal Loubas drohte.
2
Die Aufgabe, Reggie Weldrakes Vater in Empfang zu nehmen, als er in Malta eintraf, war nicht gerade angenehm.
Der tote Offizier war unter den Mannschaften und Kameraden sehr beliebt gewesen; deshalb hörten alle mit Genugtuung, dass sein Vater erwartet wurde. McElvie drückte einen allgemeinen Wunsch aus, als er sagte, dass der alte Herr Weldrake hoffentlich ein kräftiger Mensch sei und die feste Absicht habe, mit Louba abzurechnen.
»Er kann ja aus keinem andern Grund die weite Reise gemacht haben«, bemerkte McElvie hoffnungsvoll. »Vergesst nicht – er trägt keine Uniform und kann diesem Louba eins auswischen, dass ihm Hören und Sehen vergeht.«
Hurley Brown übernahm die Aufgabe, Mr. Weldrake Senior zu begrüßen, mit einer gewissen Skepsis. Immerhin hielt auch er unwillkürlich nach einem großen und resoluten Mann, nach einer älteren und stärkeren Auflage Reggies, Ausschau. Er war sehr erstaunt, als sich ihm ein schmächtiger, verschüchterter Herr als der Vater seines toten Freundes vorstellte.
Hatte schon vorher allgemeine Entrüstung geherrscht, so waren die Leute beim Anblick des traurigen kleinen Mannes geradezu empört. Man sah ihm so deutlich an, dass sein Junge seine Welt und sein alles gewesen war und dass ihn der Tod Reggies furchtbar mitgenommen hatte.
Er klagte nicht und verlangte auch kein Mitleid. Er saß stundenlang mutterseelenallein im Zimmer des toten Offiziers herum, berührte dessen Habseligkeiten und las immer wieder seine letzten Aufzeichnungen. Eine kleine, einsame Gestalt, pilgerte er tagtäglich zu seinem Grab.
Die Sympathie, die man Reggie Weldrake entgegengebracht hatte, wurde auf seinen Vater übertragen. Der bloße Anblick des hilflosen alten Mannes war Brennstoff für das Feuer, das unter der Asche gegen Emil Louba glühte.
Da Costa entfachte die Flamme zu einer Riesenglut.
Eines Nachts traf er Weldrake, der ziel- und planlos in der Gegend umherirrte, sprach ihn an und zeigte ihm Loubas Haus.
»Wissen Sie, dass dies der Platz ist, an dem Ihr Sohn ruiniert wurde? Wissen Sie, dass der Mann, der ihn zum Selbstmord trieb, Emil Louba heißt?«
Weldrake wandte sich langsam der von roten Scheinwerfern beleuchteten Fassade des Vergnügungslokals zu.
Ohne da Costa einen weiteren Blick zu gönnen, ging er nach kurzem Zögern geradewegs auf das Lokal zu. Da Costa wusste, was für ein Empfang dem kleinen Mann bevorstehen würde, und rannte deshalb wie besessen in die Kaserne, um die Soldaten zu alarmieren.
»Mr. Weldrake ist zu Louba gegangen! Wahrscheinlich befördert ihn Louba auf die Bühne und lässt ihn für die Gäste tanzen. Los, helft ihm!«
Das genügte. Die Soldaten, die Freizeit hatten, liefen im Sturmschritt voraus – aber da Costa kam noch zeitig genug hinterher, um zu sehen, wie Weldrake mit einer Schramme quer über dem Gesicht weggeführt wurde.
Im Lokal war die Hölle los, die Kapelle spielte wie wild, wahrscheinlich, um das Durcheinander zu übertönen. Leute standen auf den Tischen, andere protestierten aufgeregt und trampelten mit den Füßen. In der Saalmitte versuchten die Kellner und einige Tänzerinnen mit vereinten Kräften, einen Haufen aufgeregter und wütender Soldaten zurückzuhalten.
»Wo ist Louba? Heraus mit ihm!« schrien sie immer wieder.
»Louba hatte überhaupt nichts mit dem alten Weldrake zu tun«, rief ein Mädchen. »Er hat ihn nicht einmal zu sehen gekriegt, weil er oben beschäftigt war.«
»Er hat den Befehl gegeben, ihn hinauszuwerfen!«
»Stimmt nicht! Der kleine Mann war unverschämt und wollte unter keinen Umständen weggehen. Wir haben ihn zuerst ganz sanft vor die Tür gesetzt, aber er kam immer wieder herein.«
»Wo ist Louba?«
Das Stimmengewirr hatte seinen Höhepunkt erreicht, als Louba auftauchte.
»Meine Herren, meine Herren, ich bitte Sie!«
Seine geschmeidigen Manieren gossen nur Öl ins Feuer.
Immer mehr Soldaten strömten in das Lokal. Da Costa, der im Hintergrund eifrig schürte, sah seine Absicht gelingen. Vorerst ließ sich Louba allerdings nicht einschüchtern und sparte nicht mit höhnischen Bemerkungen.
Als er mit der entsprechenden Betonung erklärte, dass furchtbar viel Lärm um einen degenerierten jungen Narren gemacht werde, der nicht einmal Ehre genug im Leib gehabt hätte, seine Schulden zu bezahlen – da wurde der erste Schlag ausgeteilt.
Louba schlug sofort zurück. Seine Leibgarde mischte sich in die Keilerei – die Soldaten empfingen sie mit hochgekrempelten Ärmeln.
»Wir schlagen das ganze Lokal kaputt!«
Die Drohung wurde mit Begeisterung aufgenommen und durch einen lauten Krach unterstrichen – eine Weinflasche zersplitterte an einem der glitzernden Wandspiegel.
Sofort rissen eifrige Hände jeden einigermaßen zum Werfen geeigneten Gegenstand an sich, Teller, Gabeln, Stuhlbeine – alles flog durch die Luft. Ein ohrenbetäubender Lärm ließ erkennen, dass jedes Stückchen Glas in dem Lokal im Begriff war, in Scherben zu gehen.
Von der Straße kamen immer neue Leute hereingelaufen und vermehrten das Durcheinander nach Kräften.
»Nach oben, Jungs, und schmeißt seinen Plunder aus dem Fenster!«
»Werft den Kerl samt seinem Geld ins Meer!«
Die Spieler an den Roulettetischen im ersten Stock widersetzten sich dem Eindringen der Menschenmengen. Sie hatten keine Ahnung, um was es eigentlich ging, und der Tumult wurde immer größer.
Da Costa huschte über die Bühne und erreichte mit ein paar Sprüngen den winzigen Ankleideraum, der dahinter lag. Das Zimmerchen war leer.
An den Wänden hing eine Reihe hauchdünner Chiffonkostüme, der Ankleidespiegel war mit einem Seidenvorhang drapiert – da Costa hatte ein elegantes Feuerzeug, und die Flammen züngelten im Nu an den dünnen Stoffen hoch.
Als er wieder in den Saal kam, war er fast leer; die Menge drängte sich am Treppenaufgang, um sich den übrigen im ersten Stock anzuschließen. Da Costa ließ einen Sprühregen von brennenden Streichhölzern im Saal los, besonders dort, wo sich Alkohollachen aus zerbrochenen Flaschen in den Teppich einsaugten.
Die Flammen züngelten von einem Brandherd zum andern und fraßen sich an den Vorhängen schnell in die Höhe. Schon hörte man den ersten schrillen Warnungsschrei.
Kein Mensch dachte an Löschen. Jeder rettete sich schleunigst aus dem brennenden Haus.
Da Costa erreichte als einer der ersten die Straße und lief, bis er in sicherem Abstand war.
Von dort beobachtete er, wie sich das Feuer ausbreitete vom flackernden Glühen bis zu einer mächtigen Flamme, die den Himmel blutrot beleuchtete.
Leute rannten an ihm vorbei; Offiziere und Militärpolizei in Autos sausten vorüber. Auch Captain Hurley Brown war darunter. Dass Loubas Lokal brannte, war ihm zwar einerlei, doch hatte er Sorge um seine Soldaten.
Endlich sah da Costa einen Menschen, dem er seine Freude mitteilen konnte. Es war ausgerechnet der arme Mr. Weldrake, dem er frohlockend verkündete:
»Loubas Lokal brennt ab!«
Als das Feuer schwächer wurde und ein schwarzer Rauchvorhang sich davorlegte, kehrte Hurley Brown zurück und blieb einen Augenblick bei Weldrake stehen. An ihnen vorbei zogen Mannschaften zurück in die Kaserne. Ohne Rock, mit rußverschmiertem Gesicht, trat plötzlich Louba auf sie zu.
»Das wird eine Kleinigkeit kosten, Captain Brown!« rief er drohend. »Wollen sehen, was Ihre Militärbehörde dazu sagt!«
»Falls du ein bisschen Grütze im Kopf hast, Louba, dann fährst du ab und lässt die Sache auf sich beruhen«, warf da Costa ein. »Die Militärbehörde könnte dir einige sehr unangenehme Fragen stellen.«
»Ah, du bist auch da? Ich weiß schon, dass du deine Hand im Spiel gehabt hast, da Costa! Eugénie hat dich gesehen!«
»Jetzt kommt sie gern mit mir zurück nach Tripolis, was?« höhnte da Costa.
»Vielleicht ... und vielleicht begleite ich sie sogar. Kein schlechter Gedanke! Ich habe dich aus Port Said vertrieben, und ich werde dich auch aus Tripolis hinausbefördern.«
»Nur keine Drohungen, Louba! Ich bin dir überlegen, merk dir das. Und was du mir in der Vergangenheit geschadet hast, das wirst du schon noch bereuen.«
»Ich bereue niemals«, gab Louba hochmütig zurück und kehrte ihm den Rücken zu. »Und wenn Sie denken, Captain Brown, dass dieses Feuerchen da mich aus Malta vertreibt, dann irren Sie sich!«
»Ich sagte Ihnen, Sie würden gehen, Louba – und Sie werden gehen«, versetzte Brown bestimmt. »Auch dieser Abend kommt auf Ihr Konto.«
»Es soll Ihnen noch leidtun, Captain ...«
»Das einzige, was mir leid tut, ist, dass du nicht mitsamt deiner Bude verbrannt bist«, mischte sich da Costa wieder ein.
Louba sah ihn aus den Augenwinkeln an.
»Nur die Ruhe«, murmelte er. »Ich habe Zeit ...«
Weldrake war schweigsam geblieben und hatte die Szene ohne ein äußeres Zeichen von Genugtuung betrachtet. Dies war erst ein Teil der Vergeltung, und ohne ein Wort schlüpfte er davon.
Eine Stunde danach, während Hurley Brown besorgt nach ihm Ausschau halten ließ, kniete er in der Dunkelheit am Grab seines toten Jungen.
»Keine Sorge, Reggie«, flüsterte er in beruhigendem Ton. »Du wirst gerächt. Ich denke daran. Ich vergesse es nicht. Ich bleibe nicht zu Hause, bis er gebüßt hat ... Keine Sorge, Reggie. Du wirst gerächt ...«
3
Das Zimmer unterschied sich sehr wesentlich von einer Mietwohnung, wie sie im Londoner Westend üblich ist.
Orient-Teppiche und stickereiverzierte Seidenstoffe lagen verstreut umher, arabische Sitzkissen aus Leder gab es im Überfluss. Neben einer breiten Ottomane stand ein Nargileh, dessen blassblauer Rauch sich langsam zur Decke emporkräuselte. Die süßlich duftenden Rauchringe einer parfümierten Zigarette, die ein auf dem Fußboden kauerndes Mädchen zwischen den Fingern hielt, vermischten sich damit.
Die einzige Beleuchtung spendete eine grotesk getriebene Bronzelaterne, die an Ketten von der Decke herabhing. Ihr melancholisches, düsteres Licht fiel auf die glänzend schwarzen Haare eines Mannes, der neben der Wasserpfeife hockte. Seine westeuropäische Kleidung wurde durch einen bestickten Kaftan verdeckt. Für das Mädchen, dessen Träume von dem Zauber des Ostens durch die bizarren Effekte um sie herum in Erfüllung gegangen schienen, war er eine Gestalt von echtester Romantik. Sein gebrochenes Englisch passte zu ihm und erhöhte den Reiz noch erheblich.
»Sie scheinen Kairo schon zu kennen?« bemerkte er eben.
»Nein, nur das wenige, was mir Jimmy von der Stadt erzählt hat. Er wusste immer so interessante Dinge.«
»Aber jetzt sind sie nicht mehr interessant?« fragte Louba.
Sie schnitt eine reizende kleine Grimasse.
»Er sprach bald nur noch über Mord und Totschlag und seinen Polizeidienst – kein Wort mehr von Romantik und Kairo und Bagdad. Lassen wir ihn aus dem Spiel! Wenn ich hier in diesem Zimmer bin, möchte ich vergessen, dass um uns herum London und England liegt. Ich möchte die langweiligen Spießbürger und ihre faden Vergnügungen vergessen und wenigstens für ein paar Stunden in einem Traum leben.«
»Es ist nett von Ihnen, zu erklären, dass ich schöne Träume für Sie mache. Sie bedauern doch unsere Zusammenkünfte nicht? Oder sind Ihnen die kleinen Unannehmlichkeiten, die Sie dabei in Kauf nehmen müssen, zuviel?«
»Mir ist alles egal, wenn ich nur ab und zu ein wenig hierher flüchten kann.«
»Schade, dass Sie dazu jedes Mal entfliehen müssen«, murmelte er. »Wäre es nicht viel schöner, wenn Sie die ganze Zeit im Orient leben könnten? Wenn Sie sich nicht durch ein Zimmer mit orientalischen Teppichen und Schnitzereien täuschen lassen müssten, sondern mitten im geheimsten Herzen des Orients selbst wären? Eingetaucht in die Tiefen seiner jahrhundertealten Geheimnisse ...«
»Bitte, nicht ...! Sie machen mich ganz unglücklich! Das werde ich ja doch nie erleben – und möchte es so gerne.«
»Warum sollen Sie es nicht erleben, Kate? Nur die Fesseln der spießigen Gesellschaft, die Sie selbst verachten, halten Sie zurück!«
»Wer kommt?« unterbrach sie ihn erschrocken und hielt die Zigarette steif von sich weg.
Die Klingel hatte geläutet, und er wandte den Kopf.
»Ich erwarte niemand«, sagte er. »Miller wird schon aufpassen.«
Sein Diener Miller öffnete gerade zwei Herren, die er nicht gut von sich aus abweisen konnte, die Tür. Er bat sie, einen Moment zu warten, während er sie anmeldete.
»Wer ist da?« rief Louba, als der Diener an der Tür klopfte.
Das Mädchen sprang entsetzt auf, als es die Namen hörte.
»Papa und Jimmy! Um Gottes willen – lassen Sie mich weg! Wie komme ich hinaus?«
»Die Treppen können Sie nicht mehr benützen. Bleibt nur das Fenster. Vielleicht ist es besser, ich empfange die Herren erst gar nicht«, beruhigte sie Louba.
»Das geht nicht! Jimmy schöpft sofort Verdacht. Wie kann man durch das Fenster entkommen?«
»Über die Feuerleiter. Allerdings wird die Alarmvorrichtung läuten ... Wenn Sie unten ankommen, müssen Sie schnell um die Hinterfront des Hauses herumlaufen, damit Sie niemand sieht. Keine Angst, es wird schon gutgehen.«
Er hatte das Fenster aufgeklinkt und zog wie besessen daran, um es zu öffnen. Alle Kraftanwendung nützte nichts, und er rannte zur Tür, vor der Miller wartete.
»Was ist mit dem Fenster los, Miller?« rief er hinaus.
»Der Riegel, Sir, der Riegel am unteren Rahmen!«
Louba lief zurück zu dem Fenster, vor dem schluchzend das Mädchen stand.
»Ist es nicht doch besser, wenn ich die Herren wegschicke?« flüsterte Louba und riss sich dabei die Finger blutig bei dem vergeblichen Versuch, den verklemmten Riegel zu lockern.
»Nein, nein!« Das Mädchen war völlig kopflos vor Aufregung. »Jimmy sah, wie wir einmal ein paar Worte miteinander wechselten – er wird etwas erraten. Ich muss fort, und wenn wir das Fenster einschlagen müssen!«
Endlich gelang es ihm, den Riegel hochzuziehen und das Fenster aufzustoßen. Ohne ein Wort des Abschieds stieg sie hastig auf den Sims und kletterte in wilder Eile die Feuerleiter hinunter. Die letzten Sprossen übersprang sie, nur einen kurzen Moment schrillte die zur Sicherung gegen Einbrecher dort angebrachte Alarmklingel, dann stand sie auf der Erde und verschwand gleich darauf in der nebligen Dunkelheit des Londoner Abends.
»Miller, lassen Sie die Leute herein«, rief Louba und öffnete die Tür.
Hastig wickelte er sich ein Taschentuch um den verletzten Finger und ging dann den Gästen entgegen.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie so lange warten ließ! Ich war ein wenig eingeschlafen ..., aber ich freue mich sehr, Sie zu sehen – treten Sie doch näher.«
Die Besucher schienen etwas anderes erwartet zu haben, und nach ganz kurzer Zeit verabschiedeten sie sich wieder ziemlich verlegen.
Gleich nachdem die Tür zugefallen war, verflog die Höflichkeit auf Loubas Gesicht und machte einem mürrischen Ausdruck Platz. »Miller!«
»Jawohl, Sir«, der Diener erschien sofort.
»Warum war der Fensterriegel so verklemmt? Ich habe mir einen Nagel abgebrochen, bevor ich ihn verschieben konnte.«
»Ich hatte ihn mit dem Hammer festgeschlagen, Sir. Im Hinblick auf die Feuertreppe vor dem Fenster erschien mir das sicherer.«
»Mussten Sie das so machen, dass ich fast das ganze Gebäude aus dem Fundament heben musste, um das Fenster öffnen zu können?« fragte Louba ärgerlich.
»An einem nebligen Abend wie heute kann man die Wohnung nicht fest genug verschließen, Sir«, entgegnete Miller mit einem schwachen Versuch, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Die schlechte Laune seines Herrn wurde dadurch nicht besser.
»Was soll denn das heißen?« rief Louba misstrauisch.
»Nichts Besonderes«, erwiderte der Diener mit dem unschuldigsten Gesicht der Welt. »Ich meinte nur, dass Sie sich vor Einbrechern schützen sollten.«
Louba knurrte ungeduldig und ging ins Zimmer zurück.
Er blickte aus dem Fenster, verfolgte mit den Augen die schwachen Konturen der Feuertreppe. Allerdings, auf diesem Weg konnte man leicht einbrechen ...
Langsam schloss er die Fensterflügel, zog die Vorhänge ganz dicht zu und ging dann zur Zimmermitte – dort blieb er stehen und kaute nachdenklich an einem Finger.
Er war ein vielgehasster Mann. Es gab Leute ... Ach was! Verächtlich zuckte er mit den Schultern.
4
Wenige Tage nach dem Vorfall in Loubas Wohnung unterhielt sich dasselbe Mädchen leise mit einem Mann in weißem Laborkittel, der ein Reagenzglas in der Hand hielt. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch die Milchglasscheiben des Fensters und warfen einen hellen Fleck auf das unscheinbare, fast hässliche Gesicht des Mannes.
Er gab sich offensichtlich den Anschein, mit dem Reagenzglas beschäftigt zu sein. Das Mädchen selbst stand gegen die halboffene Tür gelehnt und flüsterte hastig.
»Verstehen Sie doch, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen«, sagte er, ohne den Kopf zu wenden. »Wir dürfen nicht im Gespräch miteinander ertappt werden.«
»Natürlich nicht – aber ich fürchte, er hat uns schon vorher miteinander sprechen sehen.«
Ein Geräusch hinter ihr ließ sie erschrecken und sich umdrehen. Sie blickte in die ernsten, gütigen Augen gerade des Mannes, von dem sie am wenigsten hier gesehen werden wollte.
»Oh, Papa ... Ich hörte dich gar nicht kommen. Gerade wollte ich nach dir schauen«, stammelte sie. »Willst du nicht eine Tasse Tee trinken, bevor du wieder zu arbeiten anfängst?«
»Natürlich, Kate, gerne!«
Er wechselte ein paar Worte mit seinem Assistenten und ging dann mit dem Mädchen in die Wohnung hinauf.
»Ich dachte immer, du machst dir nichts aus Barry«, bemerkte er nach einer Weile, als sie am Tisch saßen.
»Zuerst war er mir auch unangenehm«, antwortete sie. »Aber ich glaube, ich habe nur seine Art missverstanden.«
»Kann sein ... Er muss hier noch eine ganze Menge lernen, wenn er auch ein guter Arbeiter ist. Pünktlich ist er gerade nicht.«
Nachdenklich runzelte er die Stirn. Sein Zweifel an der Redlichkeit Charles Berrys wuchs ständig. Wertvolle Instrumente waren seit dem Eintritt Berrys aus dem Laboratorium verschwunden.
Am nächsten Morgen stand Kate früh auf und schrieb einen Brief, den sie dann in ihre Handtasche steckte. Beim Fortgehen traf sie die Haushälterin.
»Miss Kate, gehen Sie schon aus?« wunderte sich die Frau. »Vor dem Frühstück?«
»Ja, ich muss. Ich gehe nach Covent Garden, um Blumen einzukaufen – dann treffe ich eine Freundin. Vielleicht bleibe ich sogar über Mittag weg«, gab sie zur Antwort und huschte aus der Tür.
»Na, sie macht ja öfters so komische Sachen«, brummte die Frau und blickte ihr nach.
Am Abend brachte die Post den Brief, den das Mädchen geschrieben hatte, bevor es weggegangen war. Der Umschlag trug den Poststempel Dover.
Charles Berry kam an diesem Tag nicht zum Dienst und wurde auch nie wieder im Haus seines Arbeitgebers gesehen. Nachforschungen nach ihm hatten keinen Erfolg.
Kate war indessen längst über alle Berge. Sie hatte Charles Berry, mit dem sie sich zuletzt ganz gut verstanden hatte, fast vergessen. Bei ihr war Emil Louba, der ihren Hang zur Romantik geschickt ausgenutzt hatte und dem sie bis hierher nach Kairo gefolgt war. Sie saßen jetzt nebeneinander auf einem der flachen Dächer und blickten auf das Labyrinth der engen Straßen hinab.
»Ich kann es kaum glauben, dass das alles echt ist!« rief Kate.
»Es ist echt, ganz echt«, erwiderte er stolz. »Du hast den grauen Alltag hinter dir gelassen und beginnst jetzt zu leben. Ich wusste, dass wir eines Tages zusammen hier sein würden.«
»Wie konntest du das denn wissen ...?«
»Ich wollte dich hierherbringen, und was ich will, setze ich durch. Ich wollte dich von diesem Burschen fortholen ..., und ich habe es fertiggebracht.«
»Meinst du Jimmy?«
»Ja.«
Er stieß das Wort bösartig hervor.
»Mein Gott, du sagst das in einem Ton, als ob du ihn geradezu hasstest. Jimmy hat dir doch noch nie etwas zu Leide getan.«
Er lachte leise und zuckte mit den Schultern.
Etwas später am Abend, als es kühler geworden war, gingen sie noch ein wenig im Bazar spazieren. Kate ließ sich ganz gefangen nehmen von all den Merkwürdigkeiten. Selbst der schmierigste Bettler erschien ihr romantisch und ausgesprochen orientalisch.
Besonders das Feilschen hatte es ihr angetan. Diese orientalische Methode des Kaufens und Verkaufens fand sie reizend.
Dagegen nahm sie alles übel, was irgendwie englisch aussah. Den Herrn, dem man den Engländer von weitem ansah und der sie am Ärmel zupfte, als Louba einen Augenblick mit einem Händler in dessen hintere Verkaufsräume verschwand, bedachte sie mit einem sehr unfreundlichen Blick.
»Verzeihen Sie, brauchen Sie vielleicht irgendwelche Hilfe?« fragte der Mann etwas verlegen und zugleich eifrig. »Sie scheinen ganz allein hier zu sein – nur mit Louba. Wir sind weit entfernt von England, und ...«
»Wir sind zwar weit genug von England entfernt, aber das ist noch lange kein Grund zur Aufdringlichkeit«, versetzte Kate zornig. »Ich kenne Sie ja gar nicht.«
»Das stimmt. Dafür kenne ich Louba, und Sie sehen nicht gerade so aus, als ob er die richtige Gesellschaft für Sie wäre.«
»Ich kenne ihn gut genug, um seine – Freundschaft zu schätzen«, sagte sie und wandte sich empört ab.
»Natürlich, ich bin ein Fremder für Sie«, entgegnete er ruhig. »Und ich kann Sie nicht darum bitten, mir zu vertrauen. Dennoch möchte ich Ihnen raten – fahren Sie so schnell wie möglich nach Hause. Ganz egal, was Sie dort erwartet; verlassen Sie Louba, solange Sie noch was vom Leben erwarten.«
Bevor sie antworten konnte, trat er schnell einen Schritt zurück, versteckte sich hinter einem Stapel von Teppichen und war im nächsten Augenblick in einer der schmalen Gassen, die vom Hauptbazar abzweigten, verschwunden.
Loubas Anblick hatte ihn verscheucht. Der war eben mit dem Ladeninhaber vor die Tür getreten und schaute einem Kunden nach, der mit einem Gegenstand unter dem Arm durch das Menschengewühl rannte.
»Interessant«, bemerkte Louba, als er wieder bei Kate war. »Für einen wertlosen Plunder hat der Mann da einen lächerlich hohen Preis gezahlt und macht sich jetzt davon, als hätte er Angst, dass ihm jemand seinen Schatz abjagt.«
»Was war es denn?« fragte Kate.
»Ein Kästchen, mit Glasperlen und farbigem Glas verziert.«
Seine Brauen zogen sich zusammen. Falls etwas zu gewinnen war, dann sah er es nicht gerne, wenn ein anderer der Gewinner war.
»Hm«, sagte er nach einer Weile. »Ich hätte gerne gewusst, was diese Sache zu bedeuten hat.«
Kate war auf dem Heimweg bei weitem nicht so aufgeräumt wie vorher beim Aufbruch. Der Zwischenfall mit dem englischen Herrn hatte den Glanz ihres romantischen Abenteuers erheblich getrübt.
Die Sonne ging unter, als sie den niedrigen Hügel hinaufstiegen; beim Zurückschauen sah die Stadt schmutzig und öde aus.
Sie schmiegte sich enger an Louba.
Mit noch größerer Begierde als sonst lauschte sie seinen extravaganten Komplimenten und hielt nun desto leidenschaftlicher an ihrem romantischen Traum fest, weil ein kühler Hauch der Wirklichkeit sie gestreift hatte.
Sie lächelte, als sie den eingezäunten Garten des Hauses auf dem Hügel erreichten. Dann blieb sie plötzlich erschrocken stehen – drei Schritte vor ihr ging Charles Berry vorbei und sah sie an.
Sie schauderte und lehnte sich an Louba, als sie den Hass in den Augen Berrys gewahrte. Hatte er die Zurücksetzung nicht vergessen? – War er ihr bis hierher gefolgt?
Es fröstelte sie.
»Gehen wir hinein, komm«, sagte sie zu Louba. »Mir ist kalt.«
5
»Liebe Kate, ich weiß mir kein größeres Vergnügen, als dich mit meinen vielen Fehlern zu verschonen! Wenn es mir nicht gelingt – rege dich nicht darüber auf. Ich bitte dich inständig!«
Abgestumpft und fast gleichgültig schaute sie ihn an. Sein hämisches Lächeln, sein frecher Blick, selbst die offene Verachtung in seinen Augen konnten sie längst nicht mehr aufregen.
Mit halboffenem Mund wartete sie auf die Fortsetzung seiner Rede. Der Spott in seinem Ton, seine gehobene Laune bedeuteten nichts Gutes. Das wusste sie aus bitterer Erfahrung.
»Ich habe das Missgeschick, dir schon seit einiger Zeit zu missfallen«, fuhr er endlich fort. »Das quält mich ..., und ich will unbedingt dein Glück vor meinem eigenen berücksichtigen.«
Er zündete sich sorgfältig eine Zigarre an und warf das Streichholz in den dunklen Garten hinaus.
Im Zimmer war kein Licht. Sie standen sich in dem matten gelben Schein gegenüber, der durch die Glasscheibe der Tür fiel.
Sie war eben aus den hellerleuchteten Räumen geflohen, in denen Louba sein altes Geschäft betrieb – sich auf Kosten anderer Leute zu bereichern. In diesem kleinen Zimmer auf der Rückseite des Lokals saß sie abends gewöhnlich stundenlang.
»Hast du vorhin wirklich den jungen Amerikaner beim Spiel betrogen?« fragte sie.
»Sei nicht so zimperlich, liebste Kate«, versetzte er höhnisch. »Dein Verhalten war – zum mindesten unbesonnen und hätte zweifellos Folgen gehabt, wenn ich nicht so geschickt reagiert hätte. Im Übrigen – sei lieber ruhig ... Du bist mir nicht einmal im Geschäft eine Hilfe! Dabei habe ich dich aus lauter Rücksicht auf deine gute Erziehung nicht einmal gebeten, im Kabarett als Tänzerin aufzutreten. Ich habe nicht mehr und nicht weniger von dir verlangt, als dass du an den Spieltischen präsidierst und möglichst hübsch aussiehst.«
Gelangweilt zog er die Schultern in die Höhe.
»Vielleicht kannst du tatsächlich nichts dafür, dass du nicht mehr hübsch bist – aber das ist noch lange kein Grund, meine Kundschaft mit deinem unfreundlichen Gesicht anzuöden.«
»Nun, und weiter ...?« fragte sie. Es war ihr klar, dass dies alles nur die Einleitung war.
»Da ich dich nicht mehr glücklich machen kann, habe ich beschlossen, dich an jemand abzutreten, der es bestimmt fertigbringt.«
»Abtreten ... mich ...?« Sie lehnte sich weit vor. Ihr weißes Gesicht zeichnete sich im Lichtschimmer, der durch die Tür fiel, scharf gegen die Dunkelheit des Zimmers ab.
Er hob die Hand.
»Nur keine Missverständnisse, Kate! Ich spreche von einem Gatten für dich, und ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass die Ehe glücklich wird.«
Sie griff sich an den Hals, konnte aber keine Worte hervorbringen.
»Keine Angst, keine Angst – ein alter Freund von dir ... Charles Berry ist der Glückliche. Du liebst ihn doch, wie?« fragte Louba im sanftesten Tonfall und mit verstecktem Spott.





























