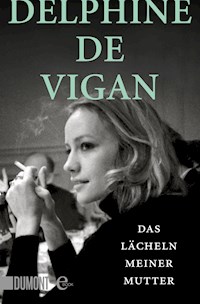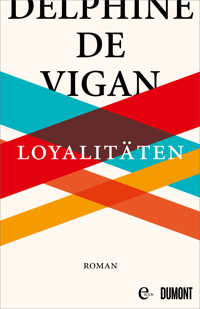
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe ist alles Der 12-jährige Théo ist ein stiller, aber guter Schüler und ein vorbildlicher Sohn: selbstständig und fürsorglich. Er scheint zu funktionieren. Doch eine Lehrerin schlägt Alarm, und auch die Mutter seines besten Freundes beobachtet ihn mit Misstrauen. Die beiden Frauen haben die richtige Ahnung: Théo ist mit seinem Leben überfordert und sucht einen gefährlichen Ausweg. In ihrem Roman erzählt Delphine de Vigan von der manchmal gefährlichen Komplexität unserer Beziehungen. Dabei erweist sie sich einmal mehr als unbestechliche Chronistin zwischenmenschlicher Missstände.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der 12-jährige Théo ist ein stiller, aber guter Schüler. Dennoch glaubt seine Lehrerin Hélène besorgniserregende Veränderungen an ihm festzustellen. Doch keiner will das hören. Théos Eltern sind geschieden und mit sich selbst beschäftigt. Der Junge funktioniert und kümmert sich um die unglückliche Mutter und den vereinsamten Vater. Um ihren Sohn müssen sie sich keine Sorgen machen. Doch Théo trinkt heimlich, und nur sein Freund Mathis weiß davon. Der Alkohol wärmt und schützt ihn vor der Welt. Eines Tages wird ihn der Alkohol ganz aufsaugen, das weiß Théo. Doch wer sollte ihm helfen? Hélène, seine Lehrerin, würde es tun, wie aber soll das gehen, ohne dass er die Eltern verrät? Mathis beobachtet das alles voller Angst. Zu gerne würde er sich seiner Mutter anvertrauen, allerdings ist Théo sein einziger Freund. Und einen Freund verrät man nicht. Außerdem würde er damit auch demjenigen in den Rücken fallen, der den Minderjährigen den Alkohol besorgt. Und der ist es, der das gefährliche Spiel in dem schneebedeckten Park vorschlägt, bei dem Théo bewusst den eigenen Tod in Kauf nimmt.
Wer möchte nicht denen gegenüber loyal sein, die er liebt? In ihrem neuen Roman erzählt Delphine de Vigan von der manchmal gefährlichen Komplexität unserer Beziehungen. Dabei erweist sie sich einmal mehr als unbestechliche Chronistin zwischenmenschlicher Missstände.
© Delphine Jouandeau
DELPHINE DE VIGAN, geboren 1966, zählt zu den wichtigsten literarischen Stimmen Frankreichs. Für ihren Roman ›Nach einer wahren Geschichte‹ (DuMont 2016) erhielt sie 2015 den Prix Renaudot. Bei DuMont ist 2017 ihr Debütroman ›Tage ohne Hunger‹ erschienen. ›Loyalitäten‹ steht seit dem Erscheinen des Romans auf der französischen Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.
DORIS HEINEMANN, geboren 1957, studierte Romanistik und Germanistik in Köln und Montpellier, arbeitete als Sprachlehrerin, als Übersetzerin im Generalsekretariat des EG-Ministerrats und übersetzt seit 1997Literatur, u.a. von Delphine de Vigan, Christian Gailly, Gabriel Chevallier, Theresa Révay, Yann Queffélec, Jean-Claude Derey und Olivier Rolin.
Delphine de Vigan
LOYALITÄTEN
Roman
Aus dem Französischen von Doris Heinemann
eBook 2018 Die französische Originalausgabe erschien 2018unter dem Titel ›Les loyautés‹ bei JC Lattès, Paris. © 2018 by Éditions Jean-Claude Lattès
© 2018 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Doris Heinemann Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8428-5
www.dumont-buchverlag.de
LOYALITÄTEN
Das sind die unsichtbaren Verbindungen, die uns mit den anderen – den Toten wie den Lebenden – verbinden, leise gemachte Versprechungen, deren Auswirkungen wir nicht kennen, still gehaltene Treue, das sind Verträge, die wir zuallermeist mit uns selbst geschlossen haben, Befehle, die wir hingenommen, aber nie gehört haben, und in den Nischen unserer Erinnerungen nistende Schulden.
Das sind die Gesetze der Kindheit, die in unseren Körpern schlummern, die Werte, in deren Namen wir uns aufrecht halten, die Fundamente, die es uns ermöglichen, Widerstand zu leisten, unlesbare Grundsätze, die an uns nagen und uns einschließen. Unsere Flügel und unsere Fesseln.
Das sind die Sprungbretter, auf denen sich unsere Kräfte entfalten, und die Gruben, in denen wir unsere Träume begraben.
HÉLÈNE
Ich dachte, der Kleine sei misshandelt worden, das dachte ich sehr bald, vielleicht nicht an den ersten Tagen, aber nicht lange nach Schuljahresbeginn, es war etwas an seiner Art, sich zu halten, sich dem Blick zu entziehen, das kenne ich, das kenne ich nur zu gut, diese Art, mit der Umgebung zu verschmelzen, transparent zu werden. Aber bei mir funktioniert das nicht. Schläge habe ich als Kind selbst bekommen, und die Spuren habe ich bis zum Schluss verborgen, also kann man mir da nichts vormachen. Ich sage »der Kleine«, weil man sie wirklich nur zu sehen braucht, die Jungs dieses Alters mit ihrem mädchenhaft weichen Haar, ihrer zarten Stimme und dieser Unsicherheit, die all ihren Bewegungen anhaftet, man muss sie nur sehen, wie sie erstaunt die Augen aufreißen oder mit zitternden Lippen die Hände hinter dem Rücken verschlingen, weil sie ausgeschimpft werden, man würde ihnen nicht die geringste Missetat unterstellen. Und doch besteht kein Zweifel, das ist das Alter, in dem es mit den wirklich schlimmen Dummheiten anfängt.
Einige Wochen nach Schuljahresbeginn bat ich den Schulleiter um ein Gespräch über Théo Lubin. Ich musste es mehrmals erklären. Nein, weder Spuren noch vertrauliche Mitteilungen, nur etwas im Verhalten des Schülers, etwas wie eine Abschottung, eine besondere Art, sich der Aufmerksamkeit zu entziehen. Monsieur Nemours musste erst einmal lachen: sich der Aufmerksamkeit entziehen – würde dies nicht für die halbe Klasse gelten? Ja, natürlich wusste ich, was er meinte: diese ihre Gewohnheit, auf dem Stuhl zusammenzusinken, um nicht drangenommen zu werden, in ihrem Rucksack zu kramen oder plötzlich den Tisch mit einer Aufmerksamkeit zu betrachten, als hinge das Wohl des ganzen Viertels davon ab. Die erkenne ich, ohne auch nur aufblicken zu müssen. Aber damit hatte es nichts zu tun. Ich fragte, was über den Schüler und seine Familie bekannt sei. Es müssten doch irgendwelche Informationen in den Unterlagen zu finden sein, Anmerkungen, ein früherer Hinweis. Der Schulleiter sah die Kommentare in den Zeugnissen noch einmal genau durch, tatsächlich hatten mehrere Lehrer im vergangenen Schuljahr bemerkt, wie stumm er war, aber mehr auch nicht. Er las mir die Kommentare laut vor: »sehr introvertierter Schüler«, »müsste mehr am Unterricht teilnehmen«, »gute Leistungen, aber zu schweigsam« und so weiter. Die Eltern leben getrennt, der Kleine in wechselnder Obhut, also nichts wirklich Ungewöhnliches. Der Schulleiter fragte mich, ob Théo sich mit anderen Jungen in der Klasse angefreundet habe, und ich konnte nichts Gegenteiliges behaupten, denn sie stecken immer zusammen, die beiden, sie haben sich gesucht und gefunden, das gleiche Engelsgesicht, dieselbe Haarfarbe, derselbe helle Teint, man könnte sie für Zwillinge halten. Ich beobachte sie durchs Fenster, wenn sie auf dem Pausenhof sind, sie bilden einen einzigen unzugänglichen Körper, eine Art Qualle, die sich plötzlich zusammenzieht, wenn sich jemand nähert, um sich dann, wenn die Gefahr vorüber ist, wieder auszudehnen. Die wenigen Momente, in denen ich Théo lächeln sehe, sind die, in denen er mit Mathis Guillaume zusammen ist und kein Erwachsener ihren Sicherheitsabstand unterschreitet.
Das Einzige, was den Schulleiter stutzig werden ließ, war ein Bericht, den die Schulschwester am Ende des vergangenen Schuljahrs geschrieben hatte. Der Bericht lag nicht in der Schulakte. Frédéric war es gewesen, der mir geraten hatte, für alle Fälle mal in der Krankenstation nachzufragen. Ende Mai hatte Théo darum gebeten, die Klasse verlassen zu dürfen. Wegen Kopfschmerzen, wie er sagte. Die Krankenschwester erwähnte ein ausweichendes Verhalten und völlig uneindeutige Symptome. Sie hat außerdem festgehalten, dass er gerötete Augen hatte. Théo habe behauptet, er brauche immer sehr viel Zeit, um einzuschlafen, manchmal könne er sogar die ganze Nacht lang nicht schlafen. Unten auf dem Blatt hat sie in Rot »anfälliger Schüler« geschrieben und es dreimal unterstrichen. Anschließend hat sie die Akte wahrscheinlich zugeklappt und wieder in den Schrank geräumt. Ich konnte sie nicht mehr dazu befragen, weil sie die Schule inzwischen verlassen hat.
Ohne dieses Dokument hätte ich nie erreicht, dass Théo von der neuen Schulschwester einbestellt wurde.
Ich sprach mit Frédéric darüber, er schien mir beunruhigt. Er sagte mir, ich solle mir diese Geschichte nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Seit einiger Zeit wirke ich erschöpft und extrem angespannt auf ihn, kurz vorm Zerspringen, so formulierte er es, und ich dachte sofort an das Messer, das mein Vater in der Küchenschublade aufbewahrte, wo es jedermann zugänglich war, ein Springmesser, mit dessen Sicherung er ständig spielte, ganz mechanisch, um seine Nerven zu beruhigen.
THÉO
Es ist eine Wärmewelle, die er nicht zu beschreiben weiß, brennend, versengend und schmerzlich und tröstlich zugleich, ein Moment, wie man ihn nicht oft erlebt und der bestimmt einen Namen trägt, den er nicht kennt, einen chemischen, physiologischen Namen, der seine Intensität ausdrückt und etwas mit Verbrennung oder Explosion oder Detonation zu tun hat. Er ist zwölfeinhalb, und wollte er auf die Fragen, die ihm die Erwachsenen stellen – »Welchen Beruf möchtest du später ausüben?«, »Was machst du am liebsten?«, »Was willst du werden?« –, ehrlich antworten und wäre da nicht seine Angst, ihm brächen dann sofort die letzten anscheinend noch bestehenden Möglichkeiten weg, Halt zu finden, würde er ohne jedes Zögern sagen: Ich liebe es, den Alkohol in meinem Körper zu spüren. Erst im Mund, dieser Augenblick, wenn die Kehle die Flüssigkeit aufnimmt, und dann diese wenigen Zehntelsekunden, in denen die Wärme in seinen Magen hinuntergleitet, er könnte ihrer Spur sogar mit dem Finger folgen. Er mag diese feuchte Welle, die ihm den Nacken streichelt und sich in seinen Gliedern wie ein Betäubungsmittel ausbreitet.
Er trinkt aus der Flasche und muss mehrmals husten. Mathis, der ihm gegenübersitzt, beobachtet ihn und lacht. Théo denkt an den Drachen in dem Bilderbuch, das ihm seine Mutter immer vorgelesen hat, als er klein war, an den gigantischen Körper, die wie mit dem Messer gezogenen Schlitzaugen und das offene Maul mit den Reißzähnen, die spitzer waren als die von bissigen Hunden. Wie gern wäre er dieses riesige Tier mit den Schwimmhäuten zwischen den Krallen, das alles verbrennen kann. Er atmet tief durch und setzt die Flasche noch einmal an. Wenn er sich vom Alkohol betäuben lässt, wenn er sich dessen Weg durch den Körper vorzustellen versucht, denkt er an eins der Schaubilder, die Madame Destrée im Unterricht verteilt und auf denen sie alles benennen müssen: Zeig den Weg des Apfels und nenne die an der Verdauung beteiligten Organe. Bei diesem Gedanken muss er lächeln, zum Spaß verändert er die Aufgabe. Zeig den Weg des Wodkas; male seinen Weg bunt nach; berechne die Zeit, die die ersten drei Schlucke brauchen, um bis in dein Blut zu gelangen … Er lacht vor sich hin, und Mathis lacht über dieses Lachen.
Nach einigen Minuten explodiert etwas in seinem Hirn, eine Tür wird mit dem Fuß aufgestoßen, es entsteht ein mächtiger Luftzug voller Staub, und jetzt steht ihm das Bild eines Wildwest-Saloons vor Augen, dessen Flügeltüren kreischend auffliegen. Einen Augenblick lang ist er der Cowboy in Reitstiefeln, der durch das Halbdunkel auf die Theke zugeht und dessen Sporen über den Boden scharren. Als er den Ellbogen auf den Tresen stützt und einen Whisky bestellt, hat er das Gefühl, alles sei aufgehoben, die Angst und die Erinnerungen. Die Raubvogelklauen, die seine Brust ständig zusammendrücken, haben sich endlich gelöst. Er schließt die Augen, alles ist weggewaschen, ja, und alles kann beginnen.
Mathis nimmt ihm die Flasche aus der Hand und setzt sie an den Mund. Jeder ist mal dran. Etwas Wodka fließt daneben, ein durchsichtiges Rinnsal läuft über Mathis’ Kinn. Théo protestiert: »Wieder ausspucken gilt nicht.« Also schluckt Mathis alles auf einmal, Tränen treten ihm in die Augen, er hustet, hält die Hand vor den Mund, und Théo fragt sich einen Augenblick lang, ob Mathis sich nicht übergeben muss, doch nach einigen Sekunden lacht Mathis unwillkürlich noch lauter auf. Hastig drückt ihm Théo die Hand auf den Mund, um ihn zum Schweigen zu bringen. Mathis hört auf zu lachen.
Sie halten den Atem an, reglos lauschen sie auf die Geräusche ringsum. Von Ferne ist die Stimme eines Lehrers zu hören, die sie nicht identifizieren können, ein tonloser Monolog, aus dem kein Wort hervorsticht.
Sie sind in ihrem Versteck, in ihrer Zuflucht. Das hier ist ihr Gebiet. Unter der Treppe zur Mensa haben sie eine leere Nische entdeckt, etwa ein Quadratmeter, auf dem sie fast stehen können. Um den Zugang zu ihr zu versperren, wurde ein großer Schrank davorgestellt, doch mit ein wenig Geschick können sie sich unter ihm hindurchzwängen. Es ist alles eine Sache des richtigen Augenblicks. Sie verstecken sich in der Toilette, bis alle Schüler wieder in den Klassenräumen sind. Und warten dann einige Minuten, bis sich der Aufseher entfernt hat, der jede Stunde nachsieht, ob sich irgendwelche Schüler auf den Gängen herumtreiben.
Jedes Mal, wenn es ihnen gelungen ist, sich hinter den Schrank zu schlängeln, stellen sie fest, dass es inzwischen um wenige Zentimeter geht. In einigen Monaten werden sie es nicht mehr schaffen.
Mathis hält ihm die Flasche hin.
Nach einem letzten Schluck leckt sich Théo über die Lippen, er mag diesen Geschmack nach Salz und nach Metall, der lange, manchmal sogar mehrere Stunden lang, im Mund bleibt.
Der Abstand zwischen Zeigefinger und Daumen zeigt ihnen, wie viel sie getrunken haben. Sie versuchen mehrmals zu messen, können jedoch beide nicht verhindern, dass der Finger verrutscht, und prusten jedes Mal los.
Sie haben viel mehr getrunken als beim letzten Mal.
Und beim nächsten Mal werden sie noch viel mehr trinken.
Das ist ihr Pakt, ihr Geheimnis.
Mathis nimmt die Flasche zurück, wickelt sie in Papier und schiebt sie dann in seinen Rucksack.
Sie nehmen jeder zwei Dragees Airwaves-Kaugummi Menthol-Lakritz. Sie kauen gewissenhaft, um das Aroma freizusetzen, und schieben den Kaugummi im Mund hin und her, nur diese Sorte kann den Geruch überdecken. Sie warten den richtigen Moment ab, um ihr Versteck zu verlassen.
Sobald sie stehen, fühlt sich alles ganz anders an. Théos Kopf schwankt vor und zurück, aber es ist nicht zu sehen.
Auf Zehenspitzen geht er über einen flüssigen Teppich mit geometrischem Muster, er fühlt sich außerhalb seiner selbst, einfach neben sich, als hätte er seinen Körper verlassen, würde ihn aber noch bei der Hand halten.
Die Geräusche der Schule dringen kaum bis zu ihm vor, sie werden gedämpft von einem unsichtbaren saugfähigen Material, das ihn beschützt.
Eines Tages möchte er gern das Bewusstsein verlieren, völlig.
Sich für ein paar Stunden oder für immer in das dicke Gewebe der Trunkenheit fallen, sich davon bedecken, begraben lassen, er weiß, dass so etwas vorkommt.
HÉLÈNE
Ich beobachte ihn unwillkürlich. Ich merke genau, dass meine Aufmerksamkeit unablässig zu ihm zurückkehrt. Ich zwinge mich, die anderen anzusehen, jeden einzeln, wenn ich spreche und sie zuhören oder wenn sie sich Montagvormittags auf ihren schriftlichen Test konzentrieren. Und just am Montag sah ich ihn noch blasser als sonst in den Unterricht kommen. Er wirkte wie ein Kind, das am Wochenende kein Auge zugetan hat. Er machte die gleichen Bewegungen wie die anderen – Jacke ausziehen, Stuhl vorrücken, Eastpak-Rucksack auf den Tisch stellen, Reißverschluss öffnen, Arbeitsheft herausnehmen –, und ich kann nicht einmal behaupten, er sei mir langsamer als sonst vorgekommen oder fahriger; dennoch sah ich, dass er am Ende seiner Kräfte war. Zu Beginn der Stunde dachte ich, er würde einschlafen, weil ihm das seit Schuljahresbeginn schon ein oder zwei Mal passiert ist.
Als ich später im Lehrerzimmer über Théo sprach, wies mich Frédéric ohne jede Ironie darauf hin, dass er nicht der Einzige in einer solchen Verfassung sei. Sie verbrächten so viel Zeit vor ihren Bildschirmen, dass wir pausenlos warnende Hinweise geben müssten, wenn wir uns um jeden müde wirkenden Schüler sorgen wollten. Augenringe würden also gar nichts beweisen.
Es ist irrational, das weiß ich.
Ich habe nichts. Absolut nichts. Keine Tatsache, keinen Beweis.
Frédéric versucht meine Befürchtungen zu beschwichtigen. Und meine Ungeduld. Die Schulschwester hat gesagt, sie würde ihn zu sich bestellen. Sie wird es tun.
Neulich versuchte ich ihm dieses Gefühl einer ablaufenden Frist zu erklären, das mich seit Tagen bedrückt, als wäre ohne unser Wissen eine Eieruhr aufgezogen worden und als verstriche kostbare Zeit, ohne dass wir das Ticken hörten, als würden wir uns in einem schweigenden Zug auf etwas Absurdes zubewegen, dessen Auswirkungen wir uns nicht vorstellen können.
Frédéric sagte noch einmal, dass ich überreizt wirke.
»Du bist diejenige, die sich ausruhen sollte«, sagte er.
Heute Morgen habe ich die Unterrichtseinheit über die Verdauung fortgesetzt. Théo richtete sich plötzlich auf und hörte aufmerksamer zu als sonst. Ich zeichnete das Schema über die Flüssigkeitsaufnahme an die Tafel, und er zeichnete es ungewöhnlich geduldig in sein Heft ab.
Als er nach der Stunde an mir vorbeikam, um den Klassenraum zu verlassen, konnte ich nicht anders, ich hielt ihn zurück. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren war, ich legte ihm die Hand auf die Schulter, damit er mir zuhörte, und sagte: »Théo, bitte bleib noch einen Augenblick.« Sofort lief empörtes Gemurmel durch die Gruppe: Wie kam ich dazu, ohne expliziten Grund einen Schüler zurückzuhalten, wo doch in der vergangenen Unterrichtsstunde nichts vorgefallen war, das meine Bitte rechtfertigte? Ich wartete, bis alle draußen waren. Théo stand mit gesenktem Kopf da. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich konnte auch nicht mehr zurück, ich musste einen Vorwand, eine Frage, irgendetwas finden. Was war bloß in mich gefahren? Als sich die Tür endlich hinter dem letzten Schüler (Mathis Guillaume, natürlich) geschlossen hatte, war mir immer noch nichts eingefallen. Die Stille dauerte einige Sekunden. Théo fixierte seine Nikes. Und dann hob er den Kopf, ich glaube, da sah er mich zum ersten Mal wirklich an, ohne meinem Blick irgendwie auszuweichen. Wortlos sah er mich an, und ich habe bei einem Jungen dieses Alters noch nie einen derart intensiven Blick erlebt. Er wirkte nicht erstaunt, auch nicht ungeduldig. Er sah mich an, und in seinem Blick lag keine Frage – als wäre es ganz normal, dass es so weit gekommen war, als wäre das alles vorherbestimmt gewesen und ganz natürlich. Und genauso natürlich war die Sackgasse, in der wir steckten, diese Unmöglichkeit, noch irgendeinen Schritt zu tun, etwas zu versuchen, was auch immer. Er sah mich an, als hätte er den Impuls verstanden, der mich dazu bewogen hatte, ihn zurückzuhalten, und als verstünde er ebenso, dass ich nicht weiter gehen konnte. Er wusste genau, was ich empfand.
Er wusste, dass ich es wusste und dass ich nichts für ihn tun konnte.
Das war es, was ich in diesem Augenblick dachte. Und mit einem Mal war meine Kehle wie zugeschnürt.
Ich weiß nicht, wie lange das dauerte, in meinem Kopf purzelten die Wörter durcheinander – Eltern, Zuhause, Müdigkeit, Traurigkeit, alles in Ordnung? –, doch keins davon führte zur Formulierung einer Frage, die ich mir ihm gegenüber hätte erlauben dürfen.
Schließlich lächelte ich, glaube ich, und dann hörte ich mich mit einer Stimme, die nicht meine war, einer unsicheren Stimme, die ich an mir nicht kannte, fragen:
»Bist du diese Woche bei deinem Vater oder bei deiner Mutter?«
Er zögerte, bevor er antwortete.
»Bei meinem Vater. Jedenfalls bis heute Abend.«
Er nahm seinen Rucksack, warf ihn sich über die Schulter und gab damit das Signal zum Aufbruch, das ich ihm schon längst hätte gewähren müssen. Er ging auf die Tür zu.
Kurz bevor er den Klassenraum verließ, drehte er sich noch einmal zu mir um und sagte:
»Aber wenn Sie mit meinen Eltern sprechen wollen, kommt meine Mutter.«
THÉO
Nach Schulschluss trieb er sich noch zehn Minuten vor dem collège herum, und dann ging er bei seinem Vater vorbei, um seine Sachen zu holen. Die Vorhänge waren nicht aufgezogen worden, er knipste nur in der Küche das Licht an, um zu seinem Zimmer zu gehen. Als er das Wohnzimmer durchquerte, hörte er ein seltsames Geräusch, ein ersticktes, auf- und abschwellendes Knistern, irgendwo musste ein Insekt gefangen sein. Er versuchte im Dunkeln die Geräuschquelle auszumachen, doch dann begriff er, dass das Radio seit dem Morgen weitergelaufen, der Ton aber so leise gedreht worden war, dass man die Worte nicht mehr verstehen konnte.
Jeden Freitag dasselbe Ritual: alles zusammensuchen, die Kleidungsstücke, die Sneaker, sämtliche Bücher, die Aktenordner und Arbeitshefte, den Schläger für die Tischtennis-AG, das Lineal, das Pauspapier, die Filzstifte, die Zeichenmappe. Bloß nichts vergessen. Jeden Freitag zieht er, beladen wie ein Muli, von einem Ort zum anderen.
Die Leute in der Metro sehen ihn an, vermutlich fürchten sie, er könne hinfallen oder zusammenbrechen, dieser kleine, unter den vielen Beuteln und Taschen schwankende Körper. Er beugt sich, aber er gibt nicht nach. Lehnt es ab, sich zu setzen.
Im Aufzug, vor der Ankunft am anderen Ufer, legt er seine Last ab und genehmigt sich endlich ein wenig Zeit zum Durchatmen.
Das ist es, was er jeden Freitag zur etwa gleichen Uhrzeit leisten muss: diesen Umzug von einer Welt in die andere, ohne Brücke, ohne Fährmann. Zwei nichtleere Mengen ohne jede Schnittmenge.
Acht Metrostationen entfernt: eine andere Kultur, andere Sitten, eine andere Sprache. Er hat nur wenige Minuten Zeit, um sich zu akklimatisieren.
Es ist 18Uhr30, als er die Tür öffnet, und seine Mutter ist schon da.
Sie sitzt in der Küche und schneidet Gemüse in feine Scheiben, dessen Form ihn interessiert, er würde gern fragen, wie es heißt, aber das ist jetzt nicht der passende Moment.
Sie sieht ihn an, mustert ihn, ein schweigender Scanner, das Radar-Auge, sie kann nicht anders. Sie schnüffelt an ihm. Eine Woche lang hat sie ihn nicht gesehen, doch es gibt keine Umarmung, es ist die Spur des anderen, die sie ebenso sucht, wie sie sie fürchtet, die Spur des Feindes.
Das ist für sie unerträglich: wenn er von der anderen Seite zurückkommt. Théo hat ihn sehr schnell verstanden, diesen Argwohn, den sie ausstrahlt, wenn er von seinem Vater zurückkehrt, und diesen Abwehrimpuls, den sie kaum verbergen kann.
Übrigens sagt sie meistens, noch bevor sie ihm Guten Tag sagt: »Geh duschen!«
Von den Tagen, die er bei seinem Vater verbracht hat, wird keine Rede sein. Die sind ein völlig lichtundurchlässiger Raum-Zeit-Riss, dessen Vorhandensein geleugnet wird. Sie wird keine Fragen stellen, das weiß er. Sie wird nicht fragen, ob er eine gute Woche gehabt habe oder ob es ihm gut gehe. Sie wird nicht fragen, ob er gut gegessen und geschlafen habe, was er getan und erlebt habe. Sie wird den Lauf der Dinge an dem Punkt weitergehen lassen, wo sie ihn eine Woche zuvor zurückgelassen haben, ganz so, als wäre nichts geschehen, als könnte nichts geschehen. Eine Woche seines Lebens aus dem Kalender gestrichen. Wenn er nicht seinen Quo-Vadis-Kalender hätte – in dem er für jeden verbrachten Tag aus der betreffenden Seite sorgsam die perforierte Ecke herauslöst –, könnte er selbst daran zweifeln, diese Woche erlebt zu haben.
Er wird die Kleidungsstücke, die er trägt, in die schmutzige Wäsche tun, ausnahmslos alle, und zwar getrennt in einer Plastiktüte, weil sie nicht will, dass sie mit den anderen in Berührung kommen. Unter der Dusche wird das warme Wasser den Geruch wegwaschen, den sie nicht erträgt.
In den Stunden nach seiner Rückkehr wird sie ihn mit diesem bösen Blick verfolgen, der ihr nicht einmal bewusst ist, den er jedoch bestens kennt, mit diesem inquisitorischen Blick. Denn unablässig forscht sie bei ihrem Sohn, der noch keine dreizehn Jahre alt ist, nach der Bewegung, dem Tonfall, der Haltung des Mannes, dessen Namen sie nicht mehr nennt. Jede reale oder unterstellte Nachahmung oder Ähnlichkeit bringt sie außer sich und führt zu einer sofortigen Gegenmaßnahme, diese Krankheit muss unverzüglich ausgerottet werden. Nun sieh doch mal, wie du dich hältst, leg deine Hände nicht so hin, setz dich richtig auf den Stuhl, nicht nur auf die Kante, hampel nicht so rum, halt dich gerade, man könnte meinen, du wärst der andere.
Geh auf dein Zimmer.
Wenn sie von seinem Vater spricht, wenn die Umstände sie dazu zwingen, von dem Mann zu sprechen, mit dem sie verheiratet war und bei dem ihr Sohn gerade eine ganze Woche verbracht hat, wenn sie es sich nicht ersparen kann, spricht sie nie seinen Vornamen aus.
Sie sagt »der andere«, »der Scheißkerl«, »der erbärmliche Wicht«.
»Dieser Knallkopf« oder »der Widerling«, wenn sie mit ihren Freundinnen telefoniert.
Théo steckt es ein, sein zarter Körper ist von Wörtern durchlöchert, doch sie sieht es nicht. Die Wörter zerstören ihn, es ist ein unerträglicher Ultraschall, ein Larsen-Effekt, den nur er zu hören scheint, eine unhörbare Frequenz, die ihm das Hirn zerreißt.