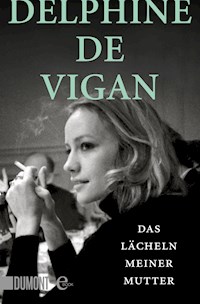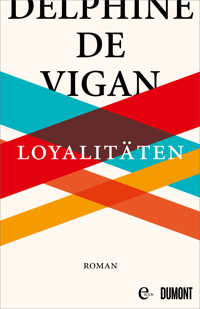9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Mathilde lebt mit ihren drei Söhnen in einer kleinen Wohnung in Paris. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich allein um sie und ist stolz auf das Resultat. Die Jungen sind selbstständig und kommen im Leben gut zurecht. Das kann Mathilde von sich nicht mehr behaupten. Bis vor einiger Zeit ist sie ihrem Beruf mit großer Begeisterung nachgegangen. Doch seit Monaten verschlechtert sich ihre Arbeitssituation zusehends. Liegt es wirklich daran, dass sie ihrem Chef in einer Besprechung offen widersprochen hat? Wird sie deshalb von allen wichtigen Sitzungen ausgeschlossen? Und landen deshalb nur noch belanglose Aufgaben auf ihrem Tisch? Verzweifelt und mit den Kräften am Ende sucht sie eine Wahrsagerin auf. Die prophezeit ihr eine besondere Begegnung für den 20. Mai. Mathilde beginnt zu hoffen. Doch worauf? Auf das befreiende Gespräch mit ihrem Chef? Auf die Rückkehr ihrer alten Stärke? Oder auf die Begegnung mit einem ganz besonderen Mann? Der Tag der Prophezeiung bricht an …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Ähnliche
Mathilde lebt mit ihren drei Söhnen in einer kleinen Wohnung in Paris. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich allein um sie und ist stolz auf das Resultat. Die Jungen sind selbstständig und kommen im Leben gut zu recht. Das kann Mathilde von sich nicht mehr behaupten. Bis vor einiger Zeit ist sie ihrer Arbeit mit großer Begeisterung nachgegangen. Doch seit Monaten verschlechtert sich ihre Arbeitssituation zusehends. Liegt es wirklich daran, dass sie ihrem Chef in einer Besprechung offen widersprochen hat? Wird sie deshalb von allen wichtigen Sitzungen ausgeschlossen? Und landen deshalb nur noch belanglose Aufgaben auf ihrem Tisch? Verzweifelt und mit den Kräften am Ende sucht sie eine Wahrsagerin auf. Die prophezeit ihr eine besondere Begegnung für den 20.Mai. Mathilde beginnt zu hoffen. Doch worauf? Auf das befreiende Gespräch mit ihrem Chef? Auf die Rückkehr ihrer alten Stärke? Oder auf die Begegnung mit einem ganz besonderen Mann? Der Tag der Prophezeiung bricht an …
© Delphine Jouandeau
Delphine de Vigan, geboren 1966, erreichte ihren endgültigen Durchbruch als Schriftstellerin mit dem Roman ›No & ich‹ (2007), für den sie mit dem Prix des Libraires und dem Prix Rotary International 2008 ausgezeichnet wurde. Ihr Roman ›Nach einer wahren Geschichte‹ (DuMont 2016) stand wochenlang auf der Bestsellerliste in Frankreich und erhielt 2015 den Prix Renaudot. Bei DuMont erschienen außerdem ›Tage ohne Hunger‹ (2017), ›Loyalitäten‹ (2019) und ›Dankbarkeiten‹ (2020) Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.
Delphine de Vigan
Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin
Roman
Aus dem Französischen von Doris Heinemann
Von Delphine de Vigan sind bei DuMont außerdem erschienen:
Nach einer wahren Geschichte
Tage ohne Hunger
Loyalitäten
Dankbarkeiten
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2009 by Editions Jean-Claude Lattès
Die französische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel ›Les heures souterraines‹ bei Editions Jean-Claude Lattès, Paris.
›Les heures souterraines‹ erschien auf Deutsch erstmals 2010 unter dem Titel ›Ich hatte vergessen, dass ich verwundbar bin‹ im Droemer Verlag, München.
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Doris Heinemann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Mia Takahara
Satz: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-7080-6
www.dumont-buchverlag.de
On voit de toutes petites choses qui luisent
Ce sont des gens dans des chemises
Comme durant ces siècles de la longue nuit
Dans le silence et dans le bruit
Comme un Lego,GÉRARDMANSET
(Man sieht winzig kleine Dinge leuchten
Es sind Leute in Hemden
Wie in dieser Jahrhunderte währenden langen Nacht
In der Stille und im Lärm
Comme un Lego,GÉRARDMANSET)
Die Stimme dringt durch den Schlaf, schwingt an der Oberfläche. Die Frau streicht über die umgedrehten Karten auf dem Tisch und wiederholt es mehrmals, in diesem Ton der Gewissheit: Am 20.Mai wird sich Ihr Leben ändern.
Mathilde weiß nicht, ob sie noch im Traum ist oder schon im anbrechenden Tag, sie wirft einen Blick auf den Radiowecker, vier Uhr morgens.
Sie hat geträumt. Von dieser Frau, die sie vor einigen Wochen aufgesucht hat, eine Wahrsagerin, ja, genau, zwar ohne Kopftuch und Kristallkugel, aber dennoch eine Wahrsagerin. Sie ist mit der Metro zum anderen Ende von Paris gefahren und hat sich hinter den dicken Vorhang im Erdgeschoss eines Hauses im XVI. Arrondissement gesetzt, sie hat dieser Frau hundertfünfzig Euro dafür gegeben, dass sie ihr aus der Hand las, inmitten all der Zahlen, die sie umgeben, ist sie hingegangen, weil es sonst nichts mehr gab, nicht den kleinsten Lichtstrahl, nach dem man die Hand hätte ausstrecken, kein Verb, das man hätte konjugieren können, keine Aussicht auf ein Danach. Sie ist hingegangen, weil man sich an irgendetwas klammern muss.
Sie ist weggegangen mit ihrem schlenkernden Handtäschchen und dieser lächerlichen Weissagung, als stünde es in den Linien ihrer Hand geschrieben, in der Stunde ihrer Geburt oder in den acht Buchstaben ihres Vornamens, als könnte man so etwas mit bloßem Auge erkennen: ein Mann, am 20.Mai. Ein Mann am Wendepunkt ihres Lebens, der sie erlösen würde. Man kann also einen Fachhochschulabschluss in Ökonometrie und Angewandter Statistik haben und den Rat einer Wahrsagerin suchen. Einige Tage darauf, als sie auf ihrem Kontoauszug die Ausgaben des Monats rot markierte, sagte sie sich, sie habe hundertfünfzig Euro zum Fenster hinausgeworfen, und damit basta, und dieser 20.Mai sei ihr so was von egal, genau wie alle anderen Tage, jedenfalls, wenn sie weiterhin so verlaufen würden.
Der 20.Mai schwebte weiterhin wie ein vages Versprechen über der Leere.
Heute ist der 20.Mai.
Heute könnte etwas geschehen. Etwas Wichtiges. Ein Ereignis, das ihr Leben in die Gegenrichtung lenken könnte, eine Abkoppelung, eine Zäsur, die schon seit Wochen schwarz in ihrem Kalender steht. Ein überaus wichtiges Ereignis, ersehnt wie die Rettung auf hoher See.
Heute, am 20.Mai, weil sie am Ende ist, am Ende dessen, was sie ertragen kann, was ein Mensch ertragen kann. So steht es in der Weltordnung. In diesem verschwimmenden Himmel, in der Konjunktion der Planeten zueinander, in den Schwingungen der Zahlen. Es steht geschrieben, dass sie heute an genau diesem Punkt sein würde, an dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, an dem nichts Normales mehr den Lauf der Stunden ändern, an dem nichts mehr geschehen kann, ohne das Ganze zu gefährden und alles in Frage zu stellen. Es muss etwas geschehen. Etwas Außergewöhnliches. Um da rauszukommen. Damit es aufhört.
Einige Wochen lang hat sie sich alles vorgestellt. Mögliches und Unmögliches. Bestes und Schlimmstes. Sie würde einem Attentat zum Opfer fallen, mitten in dem langen Gang zwischen der Metro und dem Vorortzug würde eine Bombe mit großer Sprengkraft explodieren, alles hinwegfegen und ihren Körper in kleinste Teile zerfetzen, sie würde durch die stickige Luft der Berufsverkehrszeit über den ganzen Bahnhof verteilt, und später erst würde man die Reste ihres geblümten Kleids und ihrer Monatskarte finden. Oder sie würde sich den Knöchel brechen, sie würde ganz blöd auf einem der Fettflecke ausrutschen, auf einer dieser glänzenden Stellen auf den hellen Bodenfliesen, denen sie manchmal ausweichen muss, oder sie würde die erste Stufe der Rolltreppe verfehlen und sich mit waagrecht ausgestreckten Beinen fallen lassen, man würde den Rettungswagen rufen, sie operieren, Metallplatten und -stifte festschrauben, sie für Monate ruhigstellen, oder aber sie würde am helllichten Tag versehentlich von einer unbekannten Splittergruppe entführt. Oder sie würde einem Mann begegnen, in der Bahn oder im Bahnhofscafé, einem Mann, der sagen würde, Madame, so dürfen Sie nicht weitermachen, geben Sie mir Ihre Hand, nehmen Sie meinen Arm, kehren Sie um, stellen Sie Ihre Tasche ab, bleiben Sie nicht stehen, setzen Sie sich hier an den Tisch, es ist vorbei, Sie gehen nicht mehr weiter, das ist nicht mehr möglich, Sie werden kämpfen, wir werden kämpfen, ich werde Ihnen zur Seite stehen. Ein Mann oder eine Frau, das ist letztlich nicht so wichtig. Jemand, der verstünde, dass sie nicht mehr dort hingehen kann, dass sie jeden Tag von ihrer Substanz zehrt, vom Eigentlichen. Jemand, der ihr über die Wange streichen würde oder über das Haar, der leise, wie zu sich selbst, sagen würde, wie haben Sie das nur geschafft, so lange durchzuhalten, woher nur haben Sie den Mut genommen und die Kraft. Jemand, der dagegen wäre. Der halt sagen würde. Der sich ihrer annehmen würde. Jemand, der sie dazu brächte, eine Station vorher auszusteigen, oder der sich in der Sitzecke einer Bar ihr gegenüber hinsetzen würde. Der die Zeiger auf der Wanduhr verfolgen würde. Und um zwölf Uhr mittags würde er oder sie lächeln und zu ihr sagen: Voilà, es ist vorbei.
Es ist Nacht, die Nacht vor diesem Tag, den sie unwillkürlich erwartet hat, es ist vier Uhr morgens. Mathilde weiß, dass sie nicht wieder einschlafen wird, sie kennt das Drehbuch schon auswendig, die Haltungen, die sie nacheinander einnehmen wird, wie sie versuchen wird, ihre Atmung zu beruhigen, wie sie sich das Kissen unter den Nacken stopfen wird. Und schließlich wird sie das Licht anknipsen, ein Buch zur Hand nehmen, für das sie sich doch nicht interessieren kann, die Bilder ihrer Kinder, die an der Wand hängen, betrachten, um nicht zu denken, sich den kommenden Tag nicht vorzustellen, um nicht zu sehen,
wie sie aus dem Zug aussteigt,
guten Tag sagt und dabei am liebsten schreien würde,
in den Fahrstuhl tritt,
leise über den grauen Teppichboden geht,
an diesem Schreibtisch sitzt.
Nacheinander dehnt sie die Gliedmaßen, ihr ist heiß, der Traum ist noch da, ihre zum Himmel gekehrte Handfläche in der Hand der Frau, sie sagt es noch ein letztes Mal: am 20.Mai.
Mathilde kann schon lange nicht mehr schlafen. Fast jede Nacht wird sie von ihrer Angst geweckt, sie weiß, in welcher Reihenfolge sie die Bilder, die Zweifel und Fragen unterdrücken muss, sie kennt die Tücken der Schlaflosigkeit auswendig, sie weiß, dass sie alles noch einmal von Anfang durchgehen wird, wie es begann, wie es schlimmer wurde, wie sie an diesen Punkt gelangte und dass die Zeit sich nicht zurückdrehen lässt. Schon hat sich ihr Herzschlag beschleunigt, die Maschine hat sich in Gang gesetzt, diese alles zermalmende Maschine, alles kommt dran, die Einkäufe, die sie machen muss, die Termine, die sie vereinbaren muss, die Freunde, die sie anrufen muss, die Rechnungen, die sie nicht vergessen darf, die Unterkunft, die sie noch für die Sommerferien suchen muss, all die Dinge, die ihr früher so leichtfielen und heute so schwer auf ihr lasten.
Er wird doch jetzt nicht heulen wie ein Idiot, um vier Uhr morgens in diesem Hotelbadezimmer, in dem er hinter abgeschlossener Tür auf dem Klodeckel hockt.
Er hat den noch feuchten Bademantel übergezogen, den Lila nach dem Duschen getragen hat, er riecht an dem Stoff, sucht nach diesem Duft, den er so sehr liebt. Er betrachtet sich im Spiegel, sein Gesicht ist fast so weiß wie das Waschbecken. Seine nackten Füße suchen auf dem gefliesten Boden nach der Weichheit des Teppichs. Lila schläft im Zimmer, mit ausgebreiteten Armen. Nach dem Sex ist sie eingeschlafen, unmittelbar danach, und hat leise zu schnarchen angefangen, sie schnarcht immer, wenn sie Alkohol getrunken hat.
Im Einschlafen hat sie noch Danke gemurmelt. Das war es, was ihm den Rest gegeben hat. Ihn durchbohrt hat. Sie hat Danke gesagt.
Sie sagt für alles Danke, Danke für das Essen im Restaurant, Danke für die Nacht, Danke für das Wochenende, Danke für den Sex, Danke, wenn er sie anruft, Danke, wenn er nachfragt, wie es ihr geht.
Sie gesteht ihm ihren Körper zu, einen Teil ihrer Zeit, ihre ein wenig ferne Anwesenheit, sie weiß, dass er gibt und dass sie nichts herausgibt, nichts Wesentliches.
Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, ist er aufgestanden und durch die Dunkelheit zum Badezimmer gegangen. Erst als er drinnen war und die Tür geschlossen hatte, hat er das Licht eingeschaltet.
Als sie eben vom Abendessen kamen, hat sie ihn, während sie sich auszog, gefragt:
»Wonach ist dir jetzt?«
Wonach ist dir, was bräuchtest du noch, was würde dir jetzt Freude machen, wovon träumst du, was möchtest du? Aus einer vorläufigen Blindheit oder vielleicht auch unheilbaren Kurzsichtigkeit heraus stellt sie ihm oft diese Fragen. Solche Fragen. Mit der Arglosigkeit ihrer achtundzwanzig Jahre. Heute Abend hätte er fast geantwortet:
»Mich am Balkongeländer festhalten und aus vollem Hals brüllen, meinst du, das ginge?«
Aber er hat nichts gesagt.
Sie haben das Wochenende in Honfleur verbracht. Sie sind am Strand spazieren gegangen, durch die Stadt gebummelt, er hat ihr ein Kleid und Flipflops geschenkt, sie haben hier und da etwas getrunken, im Restaurant zu Abend gegessen, dann haben sie bei zugezogenen Vorhängen und umgeben von den sich mischenden Gerüchen nach Sex und Parfüm im Bett gelegen. Morgen ganz früh werden sie wieder aufbrechen, er wird sie vor ihrer Haustür absetzen, die Zentrale anrufen, er wird gleich weitermachen mit seinem Tag, nicht erst nach Hause fahren, Roses Stimme wird ihm eine Adresse nennen, und er wird mit seinem Clio zum ersten und dann zum nächsten Patienten fahren, wie jeden Tag wird er in einer Flut von Symptomen und Einsamkeit untergehen, tief ins klebrige Grau der Stadt eintauchen.
Wochenenden wie dieses haben sie schon mehrmals verlebt.
Zeitspannen, die sie ihm gewährt, fern von Paris, fern von allem, und die immer seltener werden.
Man braucht sie beide nur zu sehen, wenn sie neben ihm hergeht, ohne ihn je zu streifen oder zu berühren, man braucht sie nur im Restaurant oder auf irgendeiner Caféterrasse zu beobachten, diese Distanz zwischen ihnen, man braucht sie nur von oben zu betrachten, an irgendeinem Pool, ihre parallelen Körper, seine Zärtlichkeiten, die sie nie erwidert und auf die er inzwischen verzichtet. Man braucht sie nur zu sehen, an diesem oder jenem Ort, in Toulouse, Barcelona oder Paris, ganz gleich, in welcher Stadt, ihn, wie er über einen Pflasterstein stolpert oder die Bürgersteigkante, aus dem Gleichgewicht gebracht, ertappt.
Weil sie sagt: Was bist du doch ungeschickt.
Dann möchte er ihr immer sagen, dass es nicht stimmt. Bevor ich dich kennenlernte, möchte er ihr sagen, war ich ein Adler, ein Raubvogel, bevor ich dich kennenlernte, flog ich über die Straßen, ohne je irgendwo dagegenzustoßen, bevor ich dich kennenlernte, war ich stark.
Er hat sich wie ein Idiot um vier Uhr morgens in einem Hotelbadezimmer eingeschlossen, weil er nicht schlafen kann. Er kann nicht schlafen, weil er sie liebt und weil sie darauf pfeift.
Sie, die sich ihm doch hingibt in der Dunkelheit der Schlafzimmer.
Sie, die er besitzen darf, streicheln, lecken, die er im Stehen nehmen kann, sitzend, kniend, sie, die ihm ihren Mund gibt, ihre Brüste, ihren Po, die ihm keine Grenze setzt, sie, die sein Sperma ohne jedes Zögern hinunterschluckt.
Doch außerhalb des Betts ist Lila nicht greifbar, entzieht sie sich ihm. Außerhalb des Betts küsst sie ihn nicht, streicht sie ihm nicht über den Rücken, streichelt sie nicht seine Wange, sieht sie ihn kaum an.
Außerhalb des Betts hat er keinen Körper oder aber einen Körper, den sie stofflich nicht wahrnimmt. Sie weiß nichts von seiner Haut.
Eins nach dem anderen nimmt er die Fläschchen vom Waschbecken und riecht daran, Feuchtigkeitsmilch, Shampoo und Duschgel liegen in dem Körbchen. Er spritzt sich Wasser ins Gesicht und trocknet sich an dem Handtuch ab, das über dem Heizkörper hängt. Er lässt die Momente Revue passieren, die er mit ihr verbracht hat, seit er sie kennengelernt hat, er erinnert sich an alles seit jenem Tag, als Lila beim Verlassen eines Cafés seine Hand genommen hat, an einem Winterabend, an dem er nicht hatte nach Hause gehen können.
Er hat nicht zu kämpfen versucht, nicht einmal zu Beginn, er hat sich abgleiten lassen. Er kann sich an alles erinnern, und alles passt zusammen und weist in dieselbe Richtung. Wenn er darüber nachdenkt, dann verrät Lilas Verhalten mehr als alle Worte ihren Mangel an Begeisterung – ihre Art, da zu sein, ohne dabei zu sein, ihre Statistenhaltung, außer vielleicht ein- oder zweimal, als er eine Nacht lang glaubte, es sei noch etwas möglich über die Tatsache hinaus, dass sie ihn auf seltsame Art brauchte.
Denn das war es doch, was sie an jenem oder an einem anderen Abend gesagt hatte: Ich brauche dich. »Kannst du das verstehen, Thibault, und dass es nichts mit Abhängigkeit oder Unterordnung zu tun hat?«
Sie hatte ihn am Arm gepackt und es wiederholt: Ich brauche dich.
Jetzt dankt sie ihm dafür, dass er da ist. Solange es nichts Besseres gibt.
Sie hat keine Angst, ihn zu verlieren, ihn zu enttäuschen, ihm zu missfallen, sie hat vor gar nichts Angst: Sie pfeift darauf.
Und dagegen ist er machtlos.
Er muss sie verlassen. Damit muss Schluss sein.
Er ist alt genug, um zu wissen, dass sich so etwas nicht ändern lässt. Lila ist nicht darauf programmiert, sich in ihn zu verlieben. So etwas steht tief in den Menschen geschrieben, so wie manches in einem leblosen Computer abgespeichert ist. Lila erkennt ihn nicht, wie ein Informatiker sagen würde, genauso wie manche Computer ein Dokument nicht lesen oder eine CD nicht öffnen können. Er gehört nicht zu ihren Parametern. Zu ihrer Konfiguration.
Was immer er zu tun oder zu sagen oder einzutippen versuchen würde.
Er ist zu sensibel, zu dünnhäutig, er steckt zu tief drin, seine Gefühle sind zu stark. Er ist nicht fern genug, nicht schick genug, nicht geheimnisvoll genug.
Er ist nicht genug.
Les jeux sont faits. Er ist alt genug, um zu wissen, dass er zu etwas anderem übergehen, Schluss machen, da rauskommen muss.
Morgen früh, wenn der Weckdienst das Telefon klingeln lässt, wird er sie verlassen.
Am Montag, dem 20.Mai, ein gutes Datum, findet er, es klingt nach einer runden Sache.
Aber wie in jeder Nacht seit mehr als einem Jahr sagt er sich auch in dieser Nacht, dass er es nicht schaffen wird.
Mathilde hat lange nach dem Ausgangspunkt gesucht, dem Anfang, dem allerersten Anfang, dem ersten Indiz, dem ersten Bruch. Sie nahm es noch einmal in umgekehrter Reihenfolge durch, Schritt für Schritt ging sie zurück und versuchte zu verstehen. Wie es dazu gekommen war, wie es angefangen hatte. Und jedes Mal kam sie zum selben Punkt, zum selben Datum: die Präsentation einer Studie an einem Montagvormittag Ende September.
Am Anfang von allem steht diese Sitzung, so absurd es auch erscheinen mag. Davor ist nichts. Davor war alles normal, ging alles seinen Gang. Davor war sie die Stellvertreterin des Marketingleiters im Haupttochterunternehmen für Ernährung und Gesundheit eines internationalen Nahrungsmittelkonzerns. Seit mehr als acht Jahren. Sie ging mit den Kollegen Mittag essen und zweimal in der Woche zur Gymnastik, nahm keine Schlafmittel, weinte weder in der Metro noch im Supermarkt und brauchte keine drei Minuten, um die Fragen ihrer Kinder zu beantworten. Sie ging zur Arbeit wie alle anderen auch, ohne sich jeden zweiten Tag beim Aussteigen aus dem Zug übergeben zu müssen.
Reicht das schon, eine Sitzung, damit alles kippt?
An jenem Tag hatten Jacques und sie die Mitarbeiter eines renommierten Instituts im Haus, die ihnen die Ergebnisse einer zwei Monate zuvor in Auftrag gegebenen Studie über das Konsumverhalten und die Konsumenteneinstellung auf dem Diätproduktemarkt vorstellen sollten. Über die Methodik hatte es einige interne Diskussionen gegeben, insbesondere was den prospektiven Teil anging, auf dessen Grundlage wichtige Investitionsentscheidungen getroffen werden sollten. Schließlich hatten sie sich für zwei komplementäre Ansätze entschieden, einen qualitativen und einen quantitativen, und mit beiden dasselbe Unternehmen betraut. Mathilde hatte für die Betreuung dieses Projekts nicht jemanden aus dem Team bestimmt, sondern es lieber selbst übernommen. Es war die erste Zusammenarbeit mit diesem Institut, dessen Forschungsmethoden noch relativ neu waren. Sie hatte an den Sitzungen der Gruppe teilgenommen, war hingefahren, um persönlich bei den Gesprächen anwesend zu sein, sie hatte die Online-Fragebögen selbst getestet und verlangt, dass vor der Zusammenfassung der Ergebnisse Kreuzsortierungen vorgenommen wurden. Sie war sehr zufrieden gewesen mit dem Arbeitsverlauf und hatte Jacques laufend informiert, wie sie es bei der Zusammenarbeit mit einem neuen Partner immer schon gemacht hatte. Für die Vorlage der Ergebnisse war ein Termin vereinbart worden, dann noch einer, doch Jacques hatte beide in letzter Sekunde verschoben, weil er zu viel um die Ohren hatte. Er wollte unbedingt dabei sein. Schon allein die Höhe des Budgets rechtfertigte seine Anwesenheit.
Am Tag der Präsentation war Mathilde früher im Büro, um den Raum aufzuschließen und sich zu vergewissern, dass der Projektor funktionierte und die Kaffeetabletts bereitstanden. Der Chef des Instituts kam persönlich, um die Ergebnisse vorzustellen. Mathilde hatte das gesamte Team eingeladen, die vier Produktchefs, die beiden Studienbeauftragten und den Statistiker.
Sie verteilten sich um den Tisch, und Mathilde wechselte ein paar Worte mit dem Leiter des Instituts, Jacques war noch nicht da. Jacques verspätete sich immer. Endlich kam er doch in den Raum, ohne ein Wort der Entschuldigung, nachlässig rasiert und mit angespannten Zügen. Mathilde trug ein dunkles Kostüm und die helle Seidenbluse, die sie so mag, daran erinnert sie sich seltsam genau, auch an die Kleidung des Mannes erinnert sie sich, an die Farbe seines Hemds, an den Ring an seinem kleinen Finger und an den Stift in der Brusttasche seiner Jacke, als hätte ihr Gedächtnis ohne ihr Wissen und noch bevor ihr die Bedeutung dieses Zeitpunkts und der durch nichts wiedergutzumachenden Geschehnisse bewusst wurde, auch noch die unbedeutendsten Einzelheiten gespeichert. Nach dem Vorstellungsritual begann der Leiter des Instituts mit seinem Vortrag. Er war bestens mit der Materie vertraut, er hatte sich nicht, wie so viele, darauf beschränkt, eine halbe Stunde vorher die Ausarbeitungen seiner Mitarbeiter zu überfliegen, er kommentierte die Schaubilder, ohne sich auf irgendwelche Notizen zu stützen, und drückte sich dabei auch noch außerordentlich klar aus. Der Mann war brillant. Und hatte Charisma. Das war selten. Er strahlte eine Art Überzeugung aus und fesselte damit die Aufmerksamkeit der Anwesenden, das spürte man sofort an der Art, wie das Team ihm zuhörte, intensiv und ohne die störenden halblauten Randbemerkungen, die solche Sitzungen sonst gern begleiteten.
Mathilde betrachtete die Hände dieses Mannes, daran erinnert sie sich, die ausholenden Bewegungen, mit denen er seine Worte begleitete. Sie fragte sich, woher er diesen leichten, kaum wahrnehmbaren Akzent hatte, diesen einzigartigen Beiklang, den sie einfach nicht zuordnen konnte. Sie spürte sehr bald, dass Jacques gereizt auf den Mann reagierte, wahrscheinlich weil dieser jünger war, größer und mindestens ebenso redegewandt wie er. Sie spürte sehr bald, dass Jacques sich versteifte.
Mitten im Vortrag zeigte Jacques die ersten Zeichen von Ungeduld, er seufzte demonstrativ auf und deutete durch lautes »Ja, ja« an, es gehe zu langsam voran und das Gesagte sei längst bekannt. Dann fing er an, so konzentriert auf seine Armbanduhr zu starren, dass seine Ungeduld nicht mehr zu übersehen war. Das Team ließ sich nichts anmerken, es kannte seine Launen. Später, als der Leiter die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung vorlegte, äußerte sich Jacques erstaunt darüber, dass deren Signifikanz nicht in den bereits gezeigten Grafiken dargelegt worden sei. Darauf hatte der Leiter mit ein wenig affektierter Höflichkeit erklärt, in den Grafiken seien nur die Ergebnisse mit einer Signifikanz von mehr als 95Prozent abgebildet worden. Nach dem Vortrag ergriff Mathilde in ihrer Eigenschaft als Auftraggeberin das Wort und dankte dem Institut für seine Arbeit. Auch Jacques hätte etwas sagen müssen. Sie drehte sich zu ihm um, begegnete seinem Blick und begriff sofort, dass er kein Dankeswort verlieren würde. Zu anderen Zeiten hatte er ihr eingeschärft, wie wichtig es sei, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Vertrauensverhältnis zu den externen Leistungserbringern aufzubauen.
Mathilde stellte die ersten Fragen, die nur ein paar Einzelheiten betrafen, und eröffnete dann die allgemeine Diskussion.
Jacques meldete sich als Letzter zu Wort, schmallippig und mit dieser extremen Selbstsicherheit, die sie gut an ihm kannte, um die in der Studie enthaltenen Empfehlungen eine nach der anderen zu zerpflücken. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse stellte er keineswegs in Frage, wohl aber die Schlüsse, die das Institut daraus gezogen hatte. Das war geschickt. Jacques war bestens mit dem Markt, der Markenidentität und der Firmengeschichte vertraut. Dennoch hatte er unrecht.
Mathilde hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, einer Meinung mit ihm zu sein. Vor allem, weil sie eine ganze Reihe von Überzeugungen teilten, aber auch, weil sie schon in den ersten Monaten ihrer Zusammenarbeit zu dem Schluss gekommen war, dass es sowohl bequemer als auch effizienter war, wenn sie seiner Meinung zustimmte. Sich ihm entgegenzustellen war völlig nutzlos. Allerdings gelang es Mathilde immer, ihre Gründe und eigenen Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen, was ihn manchmal bewogen hatte, seine Meinung zu ändern. Doch an jenem Tag erschien ihr Jacques’ Haltung derart ungerecht, dass sie einfach noch einmal das Wort ergreifen musste. Wie als Hypothese und ohne ihm direkt zu widersprechen, legte sie dar, inwiefern die vorgeschlagenen Maßnahmen in Anbetracht der Marktentwicklung und der anderen, konzernintern durchgeführten Studien ihrer persönlichen Ansicht nach eine genauere Betrachtung verdienen könnten.
Jacques sah sie lange an.
In seinen Augen las sie nur Erstaunen.
Er beharrte nicht auf seinem Standpunkt.
Daraus folgerte sie, er habe sich ihren Argumenten angeschlossen. Sie begleitete den Leiter des Instituts zum Fahrstuhl.
Es war nichts geschehen.
Nichts Schlimmes.
Sie brauchte mehrere Wochen, um auf diese Szene zurückzukommen, sie sich vollständig ins Gedächtnis zu rufen, sich klarzumachen, wie sehr jedes Detail in ihr Gedächtnis eingebrannt war, die Hände des Mannes, die Haarsträhne, die ihm in die Stirn fiel, wenn er sich vorbeugte, Jacques’ Gesicht, was er gesagt hatte, was ungesagt geblieben war, die letzten Minuten der Sitzung, die Art, wie der Mann ihr zugelächelt hatte, der Ausdruck von Dankbarkeit auf seinem Gesicht, die Art, wie er seine Sachen eingepackt hatte, ohne Eile. Jacques hatte den Sitzungssaal grußlos verlassen.
Später fragte Mathilde Éric, wie er diese Situation wahrgenommen habe: Sei sie verletzend gewesen oder kränkend, habe sie Grenzen überschritten? Leise antwortete Éric, an jenem Tag habe sie sich so verhalten, wie es sonst niemand aus dem Team gewagt hätte, und das sei gut so.
Mathilde kam auf diese Szene zurück, weil sich Jacques’ Haltung ihr gegenüber verändert hatte, weil danach nichts mehr so war wie vorher, weil danach ein langsamer Zerstörungsprozess begonnen hatte, den sie erst nach Monaten in Worte fassen konnte.
Doch jedes Mal stellte sie sich wieder diese Frage: Reichte das aus, damit alles kippte?
Reichte das schon aus, damit ihr gesamtes Leben von einem unsichtbaren, absurden und von vornherein verlorenen Kampf verschlungen wurde?
Der Grund dafür, dass sie so lange brauchte, um sich einzugestehen, was da geschah, welches Räderwerk sie in Gang gesetzt hatte, war die Tatsache, dass Jacques sie bis dahin immer unterstützt hatte. Von Anfang an arbeiteten sie zusammen, vertraten sie gemeinsame Standpunkte, waren sie sich einig in ihrem Wagemut, einer gewissen Risikofreude und der Verweigerung gegenüber den bequemsten Lösungen. Besser als jeder andere kannte sie seinen Tonfall, seine Körpersprache, sein Verteidigungslachen, die Art, wie er sich hielt, wenn er der Stärkere war, seine Unfähigkeit zur Resignation, seine Gereiztheiten, seine Wutausbrüche und seine milden Stimmungen. Jacques stand im Ruf, einen schwierigen Charakter zu haben. Er war als anspruchsvoll, sehr direkt und oft schroff bekannt. Diejenigen, die sich vor ihm fürchteten, wandten sich lieber an Mathilde, erkannten seine Kompetenz aber durchaus an. Als Jacques sie eingestellt hatte, hatte Mathilde schon drei Jahre nicht mehr gearbeitet. Er hatte sie aus den wenigen Kandidaten ausgesucht, die von der Personalabteilung ausgewählt worden waren. Sie war eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, was ihr bis dahin einige Absagen eingetragen hatte. Sie war ihm zu Dank verpflichtet. Sie wurde an der Festlegung des Marketingplans beteiligt, an den wichtigeren Beschlüssen über den Produktmix der einzelnen Marken, an der Konkurrenzbeobachtung. Im Laufe der Zeit übernahm sie immer mehr Aufgaben, schrieb ihm seine Reden und plante die Arbeit für ein siebenköpfiges Team.
An jenem Tag Ende September ist in einem Zeitraum von zehn Minuten etwas gekippt. Etwas, das sie weder gesehen noch gehört hatte, ist in die effiziente und präzise definierte Beziehung zwischen ihnen eingedrungen. Und es wurde noch am selben Abend deutlich, als Jacques sich laut und in Hörweite mehrerer Mitarbeiter darüber wunderte, dass sie schon um achtzehn Uhr dreißig die Firma verließ, und dabei anscheinend all die Abende, die sie für das Unternehmen geopfert hatte, um seine konzerninternen Präsentationen vorzubereiten, und all die Berichte, die sie zu Hause fertiggeschrieben hatte, vergessen hatte.
So hatte sich eine stille, unerbittliche Mechanik in Gang gesetzt, der sie sich immer weiter würde beugen müssen.
Als Erstes beschloss Jacques, dass die wenigen Minuten, die er ihr jeden Morgen widmete, um die Prioritäten und den Stand der laufenden Projekte zu überprüfen, vergeudete Zeit waren. Sie solle allein zusehen, wie sie zurechtkomme, und ihn nur im Bedarfsfall fragen. Zudem kam er abends nicht mehr in ihr Büro, ein Ritual, das er schon vor Jahren eingeführt hatte, eine kurze Pause, bevor er nach Hause fuhr. Er erfand mehr oder weniger glaubwürdige Vorwände, um nicht mehr mit ihr zu Mittag zu essen. Er zog sie nie mehr vor einer Entscheidung zu Rate, ihre Meinung interessierte ihn nicht mehr, er wandte sich in keiner Weise mehr an sie.
Dafür kam er ab dem darauffolgenden Monat zu der wöchentlichen Terminplanungssitzung, zu der sie das gesamte Team versammelte und an der er schon lange nicht mehr teilgenommen hatte. Ohne sein Kommen zu erklären, setzte er sich an die andere Seite des Tischs, in Beobachterhaltung, weit zurückgelehnt und mit verschränkten Armen. Und dann sah er sie an. Vom ersten Mal an fühlte sich Mathilde unbehaglich, denn dieser Blick war nicht vertrauensvoll, er urteilte, er lauerte auf Fehler.
Dann verlangte Jacques die Kopien bestimmter Dokumente und setzte es sich in den Kopf, die Arbeit der für die Vergabe von Studien zuständigen Mitarbeiter und der Produktmanager selbst zu kontrollieren, die Berichte nachzulesen und die Mittelverteilung auf die einzelnen Projekte zu evaluieren. Danach fing er an, ihr vor versammeltem Team zu widersprechen und dabei mühsam verhaltenen Ärger oder echten Zorn anklingen zu lassen, schließlich verhielt er sich auch vor anderen Leuten so, etwa bei den regelmäßigen Kontakten mit den einzelnen Direktionen des Unternehmens.
Dann begann er, systematisch jede einzelne ihrer Entscheidungen in Frage zu stellen, nachzufragen, Beweise und Rechtfertigungen, mit Zahlen unterlegte Argumente zu verlangen, Bedenken zu äußern und an ihr herumzunörgeln.
Dann kam er jeden Montag zur Terminplanungssitzung.
Dann beschloss er, diese selbst zu leiten, sie könne sich somit anderen Aufgaben widmen.
Sie dachte, Jacques würde wieder zur Besinnung kommen. Er würde seinen Zorn überwinden und den Dingen wieder ihren normalen Lauf lassen.