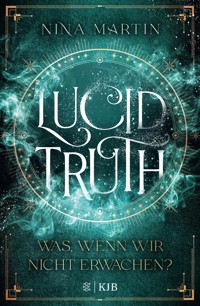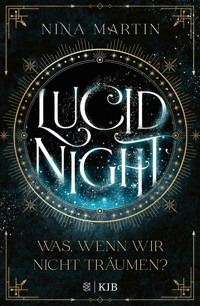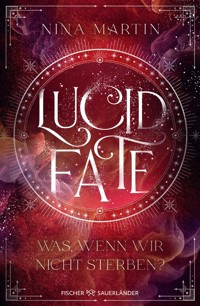
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: "Lucid"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im packenden Finale der »Lucid«-Trilogie werden Träume real ... und sie werden düster sein Es ist geschehen! Die Traumwelt Somna und die wache Welt sind zu einer geworden. Während alles um sie herum in Chaos verfällt und die Emotionen der Menschen zu gefährlichen Traumwandlungen führen, suchen Selena, Ria und ihre Freunde Schutz in einer abgelegenen Berghütte. Doch sie wissen: Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Erics Schergen sind ihnen auf den Fersen, und Selena und Ria haben nur eine Möglichkeit, die Welten wieder zu trennen: Sie und Eric müssen sterben! Aber sind sie wirklich bereit, dieses Opfer zu bringen? Eine mitreißende Contemporary Fantasy über die Welt der Träume, perfekt für alle Fans von Slow Burn, Strong FMC und female/female Romance.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nina Martin
Lucid Fate
Was, wenn wir nicht sterben?
Band 3
Über dieses Buch
Alle Bände der Lucid-Reihe:
Band 1: Lucid Night - Was, wenn wir nicht träumen?
Band 2: Lucid Truth - Was, wenn wir nicht erwachen?
Band 3: Lucid Fate - Was, wenn wir nicht sterben?
Es ist geschehen! Die Traumwelt Somna und die wache Welt sind zu einer geworden. Während alles um sie herum in Chaos verfällt und die Emotionen der Menschen zu gefährlichen Traumwandlungen führen, suchen Selena, Ria und ihre Freunde Schutz in einer abgelegenen Berghütte. Doch sie wissen: Ihnen bleibt nur wenig Zeit. Erics Schergen sind ihnen auf den Fersen, und Selena und Ria haben nur eine Möglichkeit, die Welten wieder zu trennen: Sie und Eric müssen sterben! Aber sind sie wirklich bereit, dieses Opfer zu bringen?
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Nina Martin, Jahrgang 1991, erzählt schon seit ihrer Kindheit Geschichten. Durch eine persönliche Erfahrung mit dem Thema Sterblichkeit, entschied sie, ihren Traum vom Schreiben endlich zu leben. Die Lucid-Reihe ist ihr Jugendbuch-Debüt. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in München.
Weitere Informationen zur Autorin auf Instagram unter ninamartin_books
Inhalt
Prolog
1 Selena
2 Ria
3 Selena
4 Ria
5 Selena
6 Ria
7 Selena
8 Ria
9 Selena
10 Ria
11 Selena
12 Ria
13 Selena
14 Ria
15 Selena
16 Ria
17 Selena
18 Ria
19 Selena
20 Ria
21 Selena
22 Ria
23 Selena
24 Ria
25 Selena
26 Ria
27 Selena
28 Ria
29 Selena
30 Ria
31 Selena
32 Ria
33 Selena
34 Ria
35 Selena
36 Ria
37 Selena
38 Ria
39 Selena
40 Ria
41 Selena
42 Ria
43 Selena
44 Ria
45 Selena
46 Ria
47 Selena
48 Ria
49 Selena
50 Ria
51 Selena
52 Ria
53 Selena
54 Ria
Epilog
Danksagung
Prolog
Das hier ist die dunkle Zeit, ehe die Welt eine hellere wird. Die Traumwelt und die wache Welt, Somna und Corpora, haben sich vermischt und uns damit unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet. Traumwandlungen sind jetzt überall möglich. Endlich können wir die Welt so gestalten, wie wir sie uns schon immer gewünscht haben!
Doch diese Chance kommt nicht ohne Preis. Die Vermischung der Welten führt dazu, dass sich unsere Emotionen jetzt ungehindert einen Weg nach draußen bahnen können. Dort manifestieren sie sich und machen Teile unserer Welt zu einem wahr gewordenen Albtraum. Das kann und möchte ich nicht schönreden. Aber ich verspreche euch, dass das nur von kurzer Dauer sein wird.
Schließt euch mir an! Kommt in meine Schutzzone in Dream City, die erste von vielen weltweiten Schutzzonen. Deutschland, Brasilien, Südafrika, Australien – überall bin ich derzeit dabei, Schutzzonen vorzubereiten. Dort werdet ihr und alle anderen Shielder tragen. Damit gelangen eure Emotionen nicht mehr ungehindert nach draußen und können keinen Schaden anrichten. Durch kontrollierte Traumwandlungen lassen wir so nur unsere positivsten Träume Realität werden. Lasst uns gemeinsam eine bessere Welt erschaffen!«
– Eric Clayton in seiner gestrigen Ansprache an die Weltbevölkerung
1Selena
Die Altbaufassaden werfen den Klang meiner Schritte zurück und lassen sie durch die leere Gasse hallen. Nur ab und zu huscht ein Mensch an mir vorbei, rennt um eine Ecke und verschwindet in einer Seitenstraße oder einem Gebäude. Aber niemand sieht mich an, niemand verweilt, niemand lacht. Es ist still – viel zu still für eine Stadt dieser Größe.
Mein Blick schweift über die Hausfassaden und bleibt einen Augenblick lang an dem Kirchturm hängen, der zwischen den Dächern hervorragt. Habe ich es mir eingebildet, oder hatte der vor wenigen Minuten noch eine etwas andere Form? Auszuschließen ist es nicht.
Ich schlucke gegen den Kloß in meinem Hals an und beschleunige meine Schritte. Ich werde noch bis zum Ende der Straße gehen, dann habe ich genug gesehen. Ein schweres Gefühl nagt an meinem Inneren wie ein unruhiges Tier, das ich unbedingt in Schach halten muss. Wie gerne würde ich den Menschen hier helfen – jeden Stein dieser Stadt so beständig und unverrückbar machen, wie er sein sollte. Denn seit der Vermischung der Welten ist nichts mehr beständig, nichts mehr berechenbar. Alles kann von einem Moment zum nächsten die Gestalt verändern, geformt von den bewussten oder unbewussten Gefühlen der Menschen. Aber wenn ich hier anfange, wo soll ich aufhören? Es ist nicht nur diese Stadt, in der das Chaos ausgebrochen ist und die Bewohner voreinander geflohen sind – es ist die ganze Welt. Die Menschen haben Angst voreinander. Vor ihren Gefühlen. Haben sie sich in einsamere Landstriche zurückgezogen? In den Wald? Meiden sie jeden Kontakt untereinander? Wie lange kann das gut gehen? Und wie sieht es an Orten aus, an denen die Menschen sich nicht so leicht aus dem Weg gehen können wie hier?
Eine Katze streift um eine Ecke, betrachtet mich kurz durch ihre leuchtend grünen Augen und jagt dann davon. Ich schaue ihr hinterher. Selbst sie könnte der Ausdruck irgendeines unbewussten Gefühls einer anderen Person sein. Alles ist möglich. Und genau diese Tatsache scheint aus jedem Stein, jeder Hauswand und jedem Straßenschild um mich herum zu sickern. So wie es früher in der Traumwelt Somna der Fall war. Nur, dass das hier nicht Somna ist.
Gänsehaut wandert über meine Arme.
Mit zusammengebissenen Zähnen gehe ich weiter. Ich sollte hier verschwinden, zurück in den Unterschlupf fliegen. Aber irgendwie fühle ich mich verpflichtet, bis zum Ende der Straße zu gehen. Als würde das irgendjemandem helfen. Als gäbe es auf den restlichen Metern doch noch die Chance, meine Schuld irgendwie gutzumachen.
Bei diesem Gedanken spüre ich es wieder: das Gewicht, das sich auf meine Schultern legt und sie niederdrückt, als wolle es mich in den Boden pressen und nie wieder aufstehen lassen. Ich habe es nicht geschafft, die Menschen vor alldem hier zu beschützen. Und schlimmer noch: Ich habe all das hier zu verantworten. Denn ich war es, die Eric bei der Zerstörung der goldenen Tore in Somna geholfen und so die Vermischung von Traum- und Wachwelt, Somna und Corpora, erst möglich gemacht hat.
Ich zwinge meine Schritte vorwärts. Es wird mir nichts bringen, zum ungezählten Mal über meine Schuld und über das, was vor gut zwei Wochen in Berlin passiert ist, nachzudenken. Vor zwei Wochen wäre es noch möglich gewesen, die Vermischung aufzuhalten. Aber ich bin gescheitert, zusammen mit Ria, damals auf dem Teufelsberg.
Alles, was wir dann tun konnten, war, unsere Familien und Freunde zu retten und in ein Versteck zu bringen. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier, in diesem österreichischen Städtchen, um nach dem Rechten zu sehen und mir ein Bild von der Lage zu machen. Wie lächerlich. Als würde das für die Menschen irgendeinen Unterschied machen.
Stimmen hallen durch die Straße, und ich runzele die Stirn. Sie kommen aus dem winzigen Supermarkt, an dem ich gerade vorbeigehe. Vor dem Laden stehen mehrere leere Boxen auf einer breiten Auslage, die einmal mit Obst und Gemüse gefüllt gewesen sein müssen. Nun ist außer einer einzelnen krummen Karotte nichts mehr übrig. Einen Moment stehe ich einfach da und betrachte die leere Auslage.
»Geben Sie her!«
Ich spähe durch das Schaufenster des Ladens, aber kann niemanden entdecken. Streiten sich die Leute nun um die verbliebenen Vorräte? Vermutlich haben sie noch nicht verstanden, dass sie in dieser neuen, vermischten Welt selbst Lebensmittel entstehen lassen können. Schließlich hat jetzt jeder Mensch dieselben Fähigkeiten, wie es früher in Träumen der Fall war. Oder aber, die Menschen haben ihre Fähigkeiten einfach noch nicht gut genug unter Kontrolle. Wie auch? Sie wurden ohne Vorwarnung in diese verrückte Welt katapultiert, deren Regeln selbst ich nicht richtig verstehe.
Kurzerhand greife ich nach der Karotte in der Box und rolle sie über meine Handfläche. Früher, vor der Vermischung der Welten, war es für mich so selbstverständlich, Traumwandlungen zu machen. So vertraut wie Atmen oder Gehen. Wann immer ich in Somna war, hat mir alles gehorcht und sich nach meinem Willen verändert. Meistens ist das auch jetzt in der vermischten Welt noch so, aber Lebensmittel scheinen irgendwie eine Ausnahme zu sein. Zwar macht das Essen satt, das ich erschaffe, aber es schmeckt meistens nach Pappe. Selbst Denise konnte mir den genauen Grund dafür nicht richtig erklären – die schlaue Denise, die die Einzige zu sein scheint, die auch nur im Ansatz begreift, was gerade mit der Welt passiert.
Ich seufze. Pappe hin oder her. Hauptsache, die Leute haben etwas im Magen. Und so, mit einer echten Karotte als Vorbild, ist der Geschmack immerhin nicht ganz so pappig wie ohne reale Vorlage. Das habe ich mittlerweile herausgefunden.
Ich schließe die Augen, spüre die runzelige Wurzel zwischen meinen Fingern und konzentriere mich. Und als ich meine Augen wieder öffne, steht sie vor mir: die zuvor leere Kiste, die nun bis zum Rand mit krummen Karotten gefüllt ist – exakte Ebenbilder des Gemüses in meiner Hand. Ich werfe die Karotte auf den Haufen und sehe mich um. Gibt es noch etwas, das ich vervielfältigen kann, bevor ich gehe?
»Lassen Sie mich los! Ich habe gesagt: Loslassen!«
Ich stocke. Das war die Stimme einer Frau. Und der Tonfall klang … verzweifelt. O nein.
Mit schnellen Schritten bin ich bei der offen stehenden Tür und betrete den Laden. Auch hier sind die meisten Regale leer, und die Kasse liegt verwaist da.
»Bitte beruhigen Sie sich!«, sagt eine weitere Frau.
Und dann spüre ich es: ein leichtes Vibrieren, das den Boden und alles um mich herum erfasst. Ich renne los. Die Regale fliegen an mir vorbei, und ich rutsche über die nackten Fliesen des Bodens, als ich um die Ecke biege. Im hinteren Teil des Ladens, in einer Nische, stehen noch mehr Regale und vor ihnen drei Menschen: eine Frau, die ihrem Outfit nach die Verkäuferin sein muss, sowie ein Kunde und eine Kundin.
Letztere scheinen um etwas zu ringen, das ich erst auf den zweiten Blick als einen Sack Kartoffeln erkenne.
»Jetzt geben Sie schon her!«, der Mann zerrt an dem Sack, den die Frau umklammert hält.
»So beruhigen Sie sich doch!«
Die Stimme der Verkäuferin schneidet schrill durch die Luft. Die anderen beachten sie gar nicht.
Das Zittern des Bodens wird immer heftiger.
»Stopp!«, rufe ich unwillkürlich.
Der Blick des Mannes trifft mich kurz, und darin steht etwas, das mir einen Schauer über den Rücken jagt: pure Verzweiflung. Nichts ist gefährlicher als das.
»Willst du jetzt auch noch die Kartoffeln, Mädchen?«, blafft er mich an. »Das sind meine! Geben Sie her!«
Er zerrt an dem Sack, den die Frau fest an sich presst. Sie wehrt sich so heftig, dass ihr Pferdeschwanz durch die Luft peitscht.
Kurz schließe ich die Augen. »Schaut mal, dahinten in der Kiste! Da sind noch mehr Kartoffeln!«
Doch die beiden Menschen vor mir beachten meine neuste Traumwandlung gar nicht. Denn in diesem Moment fällt der Kartoffelsack zu Boden, reißt auf und entlädt seinen Inhalt auf die Fliesen.
Ein Schrei, ein Keuchen, dann sind der Mann und die Frau auf den Knien und greifen hastig nach allen Kartoffeln, die sie erreichen können.
»So beruhigen Sie sich doch!«, schreit die Verkäuferin, die als Einzige noch steht, erneut und klammert sich dabei angstvoll an das Regal in ihrem Rücken.
Das Vibrieren wird heftiger, wird zu einem Wackeln. Auch ich greife nach einem der Regale, um mich zu stabilisieren.
»Ein Erdbeben«, stößt jetzt auch die Frau auf dem Boden hervor.
Doch ich weiß es besser.
»Sie müssen sich beruhigen! Ihre Emotionen! Bringen Sie sie unter Kontrolle!«
Ich hätte genauso gut nichts sagen können. Die Frau schreit auf, wirft sich zu Boden und hält sich die Hände schützend über den Kopf – genau im selben Moment, als aus einem Regal neben uns mehrere Einmachgläser rutschen. Scheppernd und spritzend landen sie auf dem Boden. Ein Regen aus Glassplittern und vielfarbigen Flüssigkeiten landet auf meinen Schuhen. Und dann spüre ich es: ein Kribbeln in meinem Nacken, als Staub auf mich herabrieselt. Nein, kein Staub – Putz. Über die Decke kriecht ein Netz aus feinen Rissen, verästelt sich, zieht über die Wände.
Verdammt. Das Haus wird einstürzen.
»Wir müssen hier raus!«, schreit der Mann, und noch während ich die Verästelungen an der Decke beobachte, erheben sich die zwei Personen vom Boden und hechten an mir vorbei in Richtung Ausgang.
Ich reiße meinen Blick von der Decke los und sehe die verbliebene Frau an. Die Verkäuferin. Ihre Augen sind rot gerändert und weit aufgerissen. Offenbar ist sie zu schockiert, um sich bewegen zu können.
Kurzerhand schließe ich die Augen. Das hier muss klappen. Ich kann das.
Irgendwo in mir suche ich nach den richtigen Emotionen, die tief vergraben sind unter all dem Adrenalin, das durch meine Adern rauscht. Ich blende das Dröhnen des Gebäudes, das Wimmern der Frau und das Krachen der umstürzenden Regale aus und denke an Mo. An das Geräusch ihres Atems, wenn sie einschläft. Daran, wie ihre Brust dann sanft auf und ab wogt. Und an das leichte Zucken ihres Herzschlags, direkt unter ihrem Ohr, wo die Haut so weich ist. Und dann habe ich ihn: den einen kurzen Augenblick der Ruhe. Das ist alles, was ich brauche. Ich lasse das Gefühl aus mir hinaus und in das Gebäude um uns herum strömen. Und wie so oft spüre ich die Wirkung sofort: Das Wackeln und Vibrieren des Bodens ebbt ab, und das Krachen und Dröhnen verstummt.
Langsam öffne ich die Augen und finde den Blick der Verkäuferin.
Die grauen Haare der Frau haben sich gelöst, aber in ihrem Blick steht nun nicht mehr blanke Panik, sondern etwas Neues: Verwunderung. Sie blinzelt. Sieht mich an.
»Hast du das gemacht? Hast du das Erdbeben … hast du …«
Ich trete abrupt von ihr zurück.
»Nein. Ich …«
»Doch! Das warst du. Du hast es aufhören lassen, hab ich recht?« Sie tritt näher an mich heran. »Wie machst du das? Zeig es mir.«
Verdammt. Ich sollte nicht auffallen. Das war mein oberstes Gebot. Wenn sich herumspricht, dass ein dunkelhaariges, lockiges Mädchen von etwa sechzehn Jahren und mit großen Traumwandlungsfähigkeiten hier war, dann wird es nicht lange dauern, bis Eric unser Versteck entdeckt. Und das darf ich unter keinen Umständen riskieren.
»Ich habe leider gerade keine Zeit. Entschuldigen Sie. Ich muss los«, fasele ich und stolpere fast über zwei am Boden liegende Kartoffeln. Einem plötzlichen Impuls folgend, hebe ich eine davon auf, fingere eine Münze aus meiner Tasche und werfe sie der Verkäuferin zu. Dann ergreife ich, so schnell ich kann, die Flucht.
Sobald ich die Straße vor dem Laden erreiche, lasse ich mich von Leichtigkeit durchströmen, stoße mich ab und schwinge mich in die Luft. Ich will so schnell wie möglich hier weg.
Die Stadt unter mir wird kleiner, die Herbstluft zerrt an meiner Kleidung, und ich richte meinen Blick auf die Berge. In mir brodeln Gefühle, die ich irgendwie in Schach halten muss. Ich habe erwartet, dass der Zustand in der Stadt nicht gut sein würde. Immerhin sind die Welten nun bereits zwei Wochen lang vermischt und die Gesetze der Physik teilweise aufgehoben. Aber dass es so schlimm sein würde … Diese Panik und Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen … Das fast einstürzende Gebäude …
Ich muss hier weg, zurück in unser Versteck.
Ich ziehe meine Jacke enger um mich und blinzele hinauf in den Himmel, in dem der gleißende Ball der Sonne in einem ungetrübten Hellblau hängt. Nein, nicht ungetrübt. Immer wieder ziehen sich sanfte, goldene Schlieren wie Wolken über den Himmel.
Mein Mund wird trocken. Anfangs dachten wir, dass es sich bei den Schlieren schlicht um eine nebensächliche Erscheinung der Vermischung handeln würde. Doch vorgestern hat mir Denise ihre neuste Hypothese erzählt: Ihrer Vermutung nach handelt es sich um nicht weniger als um die Seelenpartikel verstorbener Menschen, die seit der Zerstörung der Tore nun nicht mehr in der Trennung der Welten aufgehen können, sondern als goldene Schwaden am Himmel hängen. Ich schlucke schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe, was Denise damit meinte, aber das, was ich verstanden habe, reicht, um mir eine Gänsehaut zu bescheren. Es ist, als wolle dieser Tag mir keinen Zweifel darüber lassen, wie schlimm es um die Welt wirklich steht.
Ich reiße den Blick vom Himmel los, richte ihn auf die Felder, Wiesen und Wälder unter mir und versuche, mich auf meinen Rückweg zu konzentrieren. Je weiter ich fliege, desto spärlicher sind die Dörfer und Gemeinden gesät, die sich an die Berghänge schmiegen. Und als ich ein Tal erreiche, in das nur eine einzelne, dünne Straße führt, sehe ich mich kurz um. Niemand folgt mir. Gut. Also los.
Dicht über den Baumwipfeln rase ich in das Tal hinab und folge der Bergstraße, bis sie scheinbar grundlos im Wald endet. Nun sind nur noch Wanderwege zu erkennen, die hier und da zwischen den Reihen der Tannen und Kiefern entlangführen. Und dort, wo die Bäume so besonders dicht zu stehen scheinen, obwohl nur wenige Höhenmeter darüber die Baumgrenze anfängt …
Ich blinzele. Und es ist, als würde sich ein Schleier heben, als ich näher komme: Die Bäume lichten sich, und ein schlichtes Häuschen inmitten einer Lichtung kommt zum Vorschein. Die Bergstraße, die weiter unten im Nichts geendet hatte, wird wieder sichtbar und verläuft als dünnes Band direkt bis zu dem Haus. Ich gehe in den Sinkflug und setze sanft auf der Schotterstraße auf. Wenn ich nicht wüsste, dass sich in diesem Haus seit zwei Wochen ein paar der am meisten gesuchten Menschen der Welt verstecken, würde ich es ihm nicht ansehen. Ein breiter, hölzerner Balkon zieht sich einmal rings um das zweistöckige Gebäude, in langen Kästen sprießen Geranien, und braune Fensterläden zieren die kleinen Fenster. Doch so unscheinbar dieses Haus auch wirken mag, es birgt einige strategische Vorteile: Österreich ist mitten im Herzen Europas, und damit können wir schnell überallhin kommen. Trotzdem ist es weit genug weg von Berlin, wo wir vermuten, dass Eric gerade eine seiner neuen Schutzzonen aufbaut. Am wichtigsten ist aber, dass es sehr abgelegen ist – was nicht schlecht ist, wenn man, wie wir, ungebetene Gäste vermeiden möchte. Ich erreiche die Eingangstür, öffne sie und schlüpfe in das Dämmerlicht der Diele.
Noch bevor sich meine Augen an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt haben, höre ich schnelle Schritte auf knarzendem Holz.
»Da bist du ja!«
Mo springt die letzte Stufe der Treppe neben mir herunter und schlingt wenig später ihre Arme um mich.
»Willkommen zurück.«
Ich lächle in ihre Haare hinein, die wie ein seidiger, schwarzer Schleier über mein Gesicht streichen.
»Danke.«
Mo schiebt mich von sich, den aufmerksamen Blick ihrer dunklen Augen prüfend auf mir.
»War’s so schlimm?«
»Sieht man mir das an?«
Ein trauriges Lächeln zupft an Mos Mundwinkeln, dann küsst sie mich.
»Ich sehe es dir an.«
»Es ist einfach …« Ich suche nach den richtigen Worten, finde keine. Also ziehe ich einfach die Kartoffel aus der Hosentasche. »Ich habe eine Kartoffel mitgebracht. Die können wir noch vervielfältigen. Aber Mo … Die Leute da. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass sie das auch machen können. Die bekommen bald Hunger. Die ganzen Versorgungsketten sind zusammengebrochen und … es war schlimm.«
»Ich weiß.« Sanft nimmt Mo mir die Kartoffel ab. »Wie wäre es, wenn du hochgehst in die Stube? Die anderen sind schon da für die Lagebesprechung, und dann kannst du in Ruhe erzählen.«
Ich nicke und blicke dankbar in Mos dunkle Augen. Sobald sie bei mir ist, fühlt sich alles immer ein bisschen weniger schrecklich und ein bisschen mehr machbar an.
»Ich bringe die hier in die Küche und komme dann nach, ja?«
Mo wirft die Kartoffel in die Luft und fängt sie wieder auf.
»Hast du heute Küchendienst?«
»Ne. Ich glaube, Yunus ist heute dran. Mal schauen, was der mit einem Berg Kartoffeln so anstellen kann.«
»Soll ich dir bei der Vervielfältigung helfen?«
Ein trauriges Lächeln legt sich auf Mos Lippen, und ich sehe, wie der eckige Anhänger um ihren Hals aufleuchtet.
»Nein. Das bekomme ich schon noch hin. Alles habe ich nicht verlernt. Auch wenn ich jetzt keine Traumgängerin mehr bin.«
Ich nicke, während mich bei der Erinnerung daran, wie Mo vor ein paar Wochen ihre Traumgängerkräfte verloren hat, ein schmerzhafter Stich durchfährt. Immerhin kann sie jetzt wieder Traumwandlungen machen wie jede andere geübte Träumerin auch. Meine Traumwandlungen als Morphistin sind zwar noch immer stärker als ihre, aber nichtsdestotrotz ist das einer der wenigen positiven Effekte der vermischten Welt.
»Ja. Entschuldige.«
Mo beugt sich zu mir und küsst mich noch einmal.
»Bis gleich.«
Damit verschwindet sie durch eine Tür in der Diele, und ich wende mich der Treppe zu. Die Stufen knarzen unter meinen Füßen, als wollten auch sie mich begrüßen. Wir haben das Haus größtenteils so belassen, wie wir es vorgefunden haben – mit Ausnahme einiger Traumwandlungen, die es äußerlich vor allzu neugierigen Blicken schützen. Hier sind wir sicher.
Und wir können nur hoffen, dass es unsere Familien in Norwegen ebenfalls sind. Wann immer ich an den Fjord denke, den Rias Freunde auf einer Reise letzten Sommer entdeckt haben, zieht sich etwas in mir zusammen. Es ist ein wunderschöner Ort, keine Frage: kilometerweit kaum mehr als eine Handvoll Menschen und atemberaubende Natur. Dort ein kleines Dorf mit allen Annehmlichkeiten zu erschaffen und es vor neugierigen Blicken und unfreiwilligen Traumwandlungen zu schützen, war kein großes Problem. So viele unserer Freunde wie möglich und unsere Familien dorthin zu schaffen, hat uns allerdings vor Herausforderungen gestellt. Es hat uns fast die vollen zwei Wochen seit der Vermischung der Welten gekostet, meine Familie aus Griechenland und Rias Freunde und ihre Familie in Deutschland einzusammeln und in der improvisierten Schutzzone in Norwegen unterzubringen. Und alle haben wir leider nicht aufspüren können.
Trocken schlucke ich und beschleunige meine Schritte die Stufen hinauf. Meine kleine Cousine Eleni hat mich beim Abschied unter Tränen gebeten, bei ihnen zu bleiben. Aber Ria und ich haben unsere Entscheidung getroffen: Mit nur einer Handvoll anderer Leute sind wir in dieses Versteck in Österreich übergesiedelt. Wir können es nicht riskieren, dass wir Aufmerksamkeit auf unsere Liebsten lenken. Und das geht am besten, wenn wir nicht bei ihnen sind. Wir haben alles für ihre Sicherheit getan. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden …
Meine Kehle wird eng, und ich zwinge mich, meine Gedanken wieder ins Hier und Jetzt zu reißen.
Ich erreiche den ersten Stock und gehe den engen Gang entlang. Für meine Körpergröße ist das Haus genau richtig, aber die anderen müssen an einigen Stellen den Kopf einziehen. Vor einer dicken Eichentür, hinter der Stimmen zu hören sind, bleibe ich stehen und öffne sie.
Abrupt fällt der Geräuschpegel ab.
»Hey«, sage ich in die Runde und schiebe meine Hände in die Taschen meiner Jeans.
Sechs Köpfe wenden sich mir zu: Ria, Yunus, Lil, Denise, Paul Erlbach und Joseph Hoggs.
Letzterer nimmt auf seinem Krankenlager eine ganze Ecke des Raumes ein. Er hat sein Bett hierherbringen lassen, um täglich bei den Lagebesprechungen dabei sein zu können. Doch der Bauchschuss, der ihm vor zwei Wochen auf dem Teufelsberg zugefügt wurde, ist noch lange nicht vollständig verheilt. Wann immer wir versuchen, ihm mit Traumwandlungen zu helfen, scheint das seine Schmerzen nur zu vergrößern. Trotzdem hat er sich geweigert, bei den anderen in Norwegen zu bleiben. Paul, der offenbar gerade noch mit Joseph gesprochen hat, lässt sich auf einen Stuhl am Tisch sinken. Neben ihm hockt Denise in einem übergroßen Hoodie und tippt auf einem Tablet herum. Ria und ihre beste Freundin Lil nehmen die andere Seite der Eckbank ein, und an der Fensterbank lehnt Yunus und sieht nachdenklich drein. Das sind sie – meine Verbündeten und vermutlich die letzte Hoffnung, die diese Welt noch hat …
Von jedem einzelnen Brustkorb blinkt mir einer der eckigen Anhänger entgegen. Es sind Shielder – Ketten, die Denise vor ein paar Wochen in Erics Auftrag entwickelt hat, um die Außenwelt vor den Emotionen der Tragenden abzuschirmen. Wenn die Menschen im Dorf sie heute getragen hätten, wäre die Sache mit dem fast einstürzenden Haus gar nicht erst passiert, denke ich säuerlich. Das ist wohl Punkt eins, den ich gleich ansprechen werde.
Ich gehe zur Wand neben dem Tisch und lehne mich dagegen. Yunus, der sich jetzt neben mir befindet, beobachtet mich noch immer.
»Warst du in der Stadt?« Sein schwerer Tonfall passt so gar nicht zu dem Social-Media-Star, als den ich ihn bis vor zwei Wochen kannte.
Ich wende mich zu ihm. Sein Blick ist intensiv, die kurzen dunklen Haare perfekt gestylt … aber irgendwie wirkt er verschlossener als in den unzähligen Videos, die er in den letzten Jahren auf seinem Account gepostet hat.
Ich nicke und hebe die Stimme: »Mo kommt gleich nach. Sie ist noch kurz in der Küche. Aber wir können schon mal anfangen. Wenn es nichts Besonderes gibt, würde ich mit der Schilderung aus der Stadt starten.«
Die anderen sehen mich nur schweigend an. Ich werte das als Zustimmung.
»Es war ehrlich gesagt …«, ich reibe mir über das Gesicht, »nicht so gut. Es sind viel weniger Leute dort als noch vor ein paar Tagen. Es ist schlimmer geworden. Viel schlimmer. Die Leute streiten sich um Lebensmittelvorräte. Da ist eine Verzweiflung und …«, ich suche nach dem richtigen Wort, »… eine Hoffnungslosigkeit. Ich musste ein ganzes Haus vor dem Einsturz bewahren.«
Kurz herrscht Stille im Raum.
»Wir haben jetzt zwei Wochen nichts getan. Wir müssen …«
»Wir haben nicht nichts getan«, fällt mir Ria ins Wort.
»Ja. Wir haben unsere Familien in Sicherheit gebracht, ja. Aber da draußen gibt es noch mehr Menschen!«
Rias Mund wird schmal, doch sie erwidert nichts.
»Also«, sage ich, wieder mit Blick in die Runde. »Wir können uns nicht weiter untätig hier verstecken. Wir müssen endlich etwas tun.«
Paul fährt sich durch die blonden Haare, sieht sich um und sagt dann in unsicherem Tonfall: »Was, wenn wir wirklich Shielder verteilen und eine eigene Schutzzone aufbauen?«
Joseph Hoggs richtet sich auf seiner Liege auf und schüttelt den Kopf. »Das würde sofort Eric Clayton auf den Plan rufen. Wenn wir anfangen, Shielder zu verteilen, würde sich das rumsprechen, die Leute würden davon ausgehen, dass es hier eine neue Schutzzone gibt und zack, haben wir Eric an der Backe.«
Kurz herrscht wieder Stille.
»Früher oder später wird das eh passieren.« Paul zuckt mit den Schultern und sieht zwischen Ria und mir hin und her. »Der will euch beide haben.«
Joseph Hoggs brummt zustimmend. »Ich gehe davon aus, dass Eric mittlerweile viele Mitstreiter hat«, sagt er. »Anders wäre seine Vision gar nicht zu erreichen. Denise, du hast doch gesagt, dass die Satellitenbilder, die du dir angeschaut hast, zeigen, dass etwa dreißigtausend Menschen in der Schutzzone in Japan leben. Und Eric ist stetig dabei, die Zonen auszuweiten. Soweit wir wissen, entsteht in Berlin gerade eine weitere. Noch ist sie wohl nicht fertig, aber lange wird es vermutlich nicht dauern. Das alles kann Eric gar nicht schaffen, ohne einige begabte Traumgänger in seinen Reihen zu haben, die für ihn Traumwandlungen machen. Vielleicht ist sogar Giacomo Laurenti bei ihm.« Joseph macht eine Pause, und ich sehe unwillkürlich Giacomo Laurenti vor mir, den ehemaligen Generalsekretär der Traumunion. Wie er damals auf dem Dach des Gebäudes auf dem Teufelsberg stand und versucht hat, Ria und mich umzubringen, um unsere Fähigkeiten zu übernehmen. Vermutlich hat sich an dieser Entschlossenheit nichts geändert. Aber würde er wirklich noch mit Eric zusammenarbeiten, nach allem, was passiert ist?
Ich schlucke trocken und konzentriere mich auf Josephs weitere Worte: »Wenn ihr mich fragt, hat Eric eine ziemliche Schlagkraft. Mit so mächtigen Mitstreitern wird es nicht lange dauern, bis er uns findet. Denn dass das eine seiner höchsten Prioritäten ist, steht, denke ich, außer Frage. Er kann sich nicht leisten, euch beide mit euren Kräften frei herumlaufen zu lassen. Das Risiko ist viel zu hoch, dass ihr seinen Plänen in die Quere kommt.«
Kurz sehe ich zu Ria. Die versteift sich auf ihrem Platz auf der Bank. Aber natürlich sagt sie mal wieder nichts – wie so oft.
»Und was sollen wir tun?«, schieße ich in Josephs Richtung. Ich hasse es, wenn Leute, die ich nicht mag, recht haben.
Lil sieht sich um, und ihr Pferdeschwanz wippt um ihre Schultern. »Ich bin bei Paul. Ich wäre dafür, eine Schutzzone aufzubauen. Nach dem, was Selena berichtet hat, bin ich auch der Meinung, dass wir endlich etwas tun müssen. Wir müssen versuchen, den Menschen da draußen zu helfen. Und wenn wir eine richtige Zone hätten, genauso eine wie Eric, dann könnten wir kontrollieren, wer reinkommt, und hätten eine Chance, falls er auftaucht.«
Paul lächelt, während Denise neben ihm weiterhin völlig unbeteiligt auf ihrem Tablet tippt.
»Da unterschätzt du Eric aber ziemlich«, geht wieder Joseph Hoggs dazwischen.
Ich fahre mir erschöpft über das Gesicht, als eine neue Version der Diskussion entbrennt, die wir schon unzählige Male zuvor geführt haben: Eigene Schutzzone – ja oder nein? Shielder verteilen – ja oder nein?
Das verzweifelte Gesicht der Verkäuferin tanzt vor meinen Augen. Ich kann nicht mehr länger untätig hier herumsitzen.
Noch einmal sehe ich zu Ria. Sie streicht sich die rötlichen Haare, die aus ihrem Pferdeschwanz gefallen sind, mit einer Hand hinter das Ohr. Doch obwohl sie schweigt, scheint die Diskussion sie nicht kaltzulassen. Ich starre auf das penetrante Blinken des Shielders um ihren Hals. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Ria sich entschieden hat, eines dieser Dinger zu tragen. Sie scheint ihrer eigenen Emotionskontrolle wirklich kein bisschen zu vertrauen. Ich beiße mir auf die Wange, um meine Frustration zu unterdrücken. Ich würde nie einen Shielder tragen. Schließlich muss ich immer bereit sein, Traumwandlungen zu machen, falls wir angegriffen werden. Aber Ria scheint das anders zu sehen. Und ihr Schweigen in diesem Moment lässt mich einmal mehr wünschen, dass ich nicht auf Ria angewiesen wäre, um diese Sache zu lösen. Wenn ich nur einen Weg finden würde, der Welt auf eigene Faust zu helfen. Aber mir fällt nur eine Möglichkeit ein – und dafür brauche ich Ria. Frustriert knirsche ich mit den Zähnen.
»Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen da draußen«, schaltet sich jetzt auch Yunus in das Gespräch ein, und ich muss ihm zustimmen. Aber eine eigene Schutzzone wird nicht genug sein, lange nicht genug! Erkennen die anderen das nicht?
Die Tür öffnet sich, und Mo tritt in den Raum. Mit aller Macht bekomme ich ein Lächeln zustande, und Mo stellt sich neben mich an die Wand. Doch ich kann ihr keine Antwort auf ihren fragenden Gesichtsausdruck geben. Ein Gefühl baut sich in mir auf, wird immer größer und wird bald nicht mehr zu kontrollieren sein, wenn ich nicht bald etwas sage.
»Haltet mal alle die Klappe!«
Meine Stimme war lauter als beabsichtigt, aber wenigstens verstummen die anderen schlagartig.
Ich stoße mich von der Wand ab und mache zwei Schritte in die Mitte des Raumes.
»Das bringt doch hier alles nichts! Ja. Eine eigene Schutzzone würde den Leuten da draußen helfen. Und ich finde, wir schulden ihnen das. Aber diese ganze Diskussion ist so was von nutzlos. Selbst wenn wir annehmen, die Schutzzone funktioniert, und wir könnten uns Eric vom Leib halten. Am Ende wären die Welten noch immer verschmolzen. Die Seelen würden noch immer dort am Himmel hängen, und wir haben keine Ahnung, was das bedeutet.« Ich mache eine wüste Handbewegung zum Fenster hin. »Eric Clayton wäre noch immer fast allmächtig und könnte mit seiner Hälfte der Welt anstellen, was er will. Die Leute in den Städten außerhalb unserer Zone würden sich noch immer in Lebensgefahr befinden. Eine Schutzzone ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eine echte Lösung. Eine endgültige Lösung.«
»Sel …«, beginnt Mo, doch ich gehe sofort dazwischen.
»Nein. Es ist so, und das wisst ihr alle!«
Meine Stimme hallt durch den Raum. Es tut gut, es auszusprechen. Mein Blick findet Rias. Ihre grünen Augen sind geweitet, und ihr Mund öffnet sich, aber es kommen keine Worte heraus. Ihr Shielder blinkt heftig. Der Anblick macht mich rasend.
»Wir wissen, was wir eigentlich tun müssen. Denise hat es uns doch erklärt!«, sage ich in die Stille hinein. Denise hebt den Kopf, auf ihrem Gesicht mildes Interesse. Unter dem Tisch blitzt einer ihrer typischen Löwenkopfhausschuhe hervor. »Wir müssen irgendwie an Eric rankommen und dann mithilfe seiner, Rias und meiner Macht die Welten wieder trennen«, sage ich so bestimmt wie möglich. »So, wie Denise es uns erklärt hat. Nur wir haben die Macht dazu!«
Stille. Einen Herzschlag. Zwei.
»Indem ihr sterbt.«
Der Blick von Rias bester Freundin Lil ist hart. Ich sehe sie an, und mit einem Wirbel aus Emotionen in mir, die ich mit aller Gewalt kontrolliere, nicke ich.
2Ria
Ich starre Selena an. Die steht einfach nur da und sieht in die Runde, als würde sie jeden von uns herausfordern, ihr zu widersprechen. Nach und nach wandern die Blicke der anderen von ihr zu mir, und ich spüre, wie Lil ein wenig näher an mich heranrückt. Stockend hole ich Luft. In Selenas Augen liegt eine Anklage, die ich bereits in den letzten Tagen dort wahrgenommen habe. Sie ist sauer auf mich. Sie will, dass ich mehr tue – oder eher: dass ich genau das tue, was sie für richtig hält. Aber ich kann ihr nicht einfach blindlings nachrennen. Ich kann mich doch nicht einfach so aufgeben … mich opfern für …
»Ich will ja auch den Menschen helfen! Die Welt retten! Den ganzen Kram!«, bricht es aus mir hervor, in die Stille des Raums hinein. »Aber es muss einen anderen Weg geben!« Kurz zuckt mein Blick zu Yunus, aber der hat nur hilflos die Brauen gehoben. »Denise.« Ich hasse es, wie zittrig meine Stimme klingt. »Bist du sicher, dass sich die Welten nur wieder trennen lassen, wenn Eric, Selena und ich sterben?« Ich sehe an Lil vorbei zu der blonden jungen Frau. Wie immer trägt sie einen ihrer übergroßen Hoodies und guckt abwesend auf ihr Tablet. Einen Moment meine ich, dass sie meine Frage gar nicht gehört hat. Doch dann richtet sie sich langsam auf und legt den Kopf so schief, dass ihr unordentlicher Haarknoten vom Scheitel zur Seite kippt.
»Na ja«, sagt sie gedehnt. »Die Welten wurden durch den Tod auseinandergehalten. Die Menschen sind immer durch die Tore in Somna gegangen und haben ihre Energie in die Trennung der Welten gegeben. Ich schätze, dass es sich um eine Art energetische Spaltung der Seelenpartikel handelt und die Seelen sozusagen in allem aufgegangen sind …« Sie bricht ab, als ich ungeduldig mit den Fingern auf die Tischplatte trommle. »Na ja, also der Text aus Erics Buch hat mich damals ja draufgebracht, dass euer Tod den Kreislauf wieder anwerfen könnte. Und meine bisherige Forschung bestätigt das. Wir brauchen eine riesige Menge an Energie, so viel ist klar. Und die habt ihr als Morphisten. Euer Tod könnte die Welten wieder trennen.«
Yunus tritt am Fenster unruhig von einem Bein aufs andere, doch er sieht nicht zu mir, sondern beobachtet weiterhin Denise, die nervös das Tablet auf dem Tisch hin und her schiebt.
»Aber es ist nur eine Hypothese. Das muss ich ganz klar dazusagen. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit.«
»Kannst du noch weiter forschen, um dir wirklich sicher zu sein?«, frage ich.
Ich merke Denise die Zweifel an, noch bevor sie antwortet.
»Na ja, das Forschungslabor, das ihr mir unten erschaffen habt, gibt noch ein paar Möglichkeiten her. Aber es würde eine Weile …«
In diesem Moment poltert Selena dazwischen. »Wir haben keine Zeit mehr. Ihr wart nicht da draußen. Ihr habt nicht gesehen, was aus den Städten geworden ist. Wie verzweifelt die Menschen sind. Vielleicht versteht ihr es deswegen nicht. Wir müssen handeln. Und zwar so schnell und so wirkungsvoll wie möglich. Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet!«
»Hältst du es für Zeitverschwendung, dass wir deine Familie aus Griechenland nach Norwegen in Sicherheit gebracht haben?«, will Paul wissen.
»Natürlich nicht«, murmelt Selena, aber ich kann sie nur fassungslos anstarren. Wie kann es sein, dass sie so vehement für unseren Tod plädiert?
Unwillkürlich schießt mein Blick zu Mo. Mit verkniffenem Mund steht sie an die Wand gelehnt da, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ihr Gesichtsausdruck ist wie so oft unlesbar für mich.
Paul räuspert sich. »Wir wissen ja, dass du die Frau für die radikalen Entscheidungen bist, Selena, aber hier geht es nicht nur um dich.«
Wärme durchflutet mich, doch ich habe kaum Zeit, Paul dankbar für seinen Einwurf zu sein.
Denn Selena wirbelt zu ihm herum. »Nein. Genau. Hier geht es um die ganze Welt, verdammt. Wann checkt ihr das endlich?« Es fehlt gerade noch, dass Selena frustriert mit dem Fuß aufstampft.
Plötzlich wallt auch in mir der Zorn auf. Ich stehe auf. »Nur weil du das mit den Toren verbockt hast, soll ich jetzt dafür sterben?«
Selenas Augen weiten sich, und sie erstarrt.
Da. Ich habe es gesagt. Mir ist bewusst, dass sie es nicht gern hört, aber schließlich ist es die Wahrheit, oder? Zum Glück trage ich den Shielder – sonst könnte ich für nichts garantieren.
Ich spüre, wie sich Yunus am Fenster bewegt, als wolle er auf mich zukommen und mich berühren. Kurz suche ich seinen Blick. Doch dieser ist verhangen. Als wäre Yunus gedanklich nicht ganz hier. So wie so häufig seit seiner Rückkehr. Ich unterdrücke den Stich, der mich bei diesem Gedanken durchfährt, und werde von etwas abgelenkt, das vor dem Fenster vorbeizieht: die goldenen Schwaden am Himmel. Ich muss mich zwingen, ruhig weiterzuatmen, als mir das Gefühl meiner unglaublichen Verantwortung mal wieder die Kehle zuschnürt.
»Verstehst du nicht, dass es hier um viel mehr als um dich oder mich geht?«, haucht Selena, und ich wende mich ihr widerwillig wieder zu.
Doch. Das verstehe ich. Ich verstehe es sogar sehr gut. Und genau dieses Wissen bringt mich nachts um den Schlaf. Aber ich bin nicht so heroisch wie Selena. Immerhin habe ich noch mein ganzes Leben vor mir! Das kann ich doch nicht einfach so aufgeben! Wie Selena das verkraftet, ist mir schleierhaft. Tränen schwemmen meine Augen, und ich blinzele sie heftig weg.
»Wie gesagt«, presse ich so kontrolliert wie möglich hervor. »Ich will den Menschen helfen. Ich finde, wir sollten eine Schutzzone aufbauen. Wir sollten herausfinden, welche Chancen die vermischte Welt birgt und …«
»Welche Chancen die vermischte Welt birgt? Hörst du dir überhaupt zu?«
Selenas Angriff lässt meine mühsam erlangte Selbstkontrolle wieder verpuffen. »Na dann sag doch mal genau: Was schlägst du vor?«, gifte ich zurück. »Dass du und ich zu Eric fliegen, ihn überwältigen, ein Tor erschaffen und uns mit ihm da durch stürzen?«
Selena blinzelt. Offenbar war sie auf diese direkte Frage nicht vorbereitet. Sie sieht zu Denise. »Ja. Würde das reichen? Einfach ein Tor erschaffen, das denen in Somna ähnelt, und dann da durchgehen? Oder müsste man irgendetwas beachten bei der Erschaffung des Tors?«
Denise legt den Kopf in die andere Richtung. »Eigentlich sollte das funktionieren. Das Tor würde aber eben erst durch euren Tod aktiviert werden.«
Selena dreht sich wieder zu mir, schiebt die Hände tiefer in die Taschen ihrer Jeans und zuckt mit den Schultern. »Dann ist das mein Vorschlag.«
Ich lache freudlos auf. »Na, das ist ja mal wieder ein durchdachter Plan.«
»Hast du einen besseren?«
Jetzt bin ich es, die zu Denise sieht. Mein Inneres zieht sich zu einem dichten Knoten zusammen. Etwas sagt mir, dass sie zu keinem anderen Schluss kommen wird, selbst wenn wir ihr noch mehr Zeit für ihre Forschung geben. Mir wird schlecht.
Unwillkürlich drängt sich mir dieser eine Gedanke auf. Dieser Gedanke, der immer und immer wiederkommt und den ich bisher noch nicht wirklich ausgesprochen habe. Zumindest nicht so direkt. Aber jetzt kann ich ihn nicht länger zurückhalten.
»Vielleicht«, beginne ich. »Vielleicht ist das alles ja auch gar nicht so schlecht. Also Erics Vision, meine ich. Die vereinte Welt gibt uns immerhin unerschöpfliche Möglichkeiten. Vielleicht müssen wir die Welten gar nicht wieder trennen. Wir könnten Frieden und Wohlstand erschaffen. Entweder zusammen mit Eric, oder wir tauschen ihn aus. Wer sagt, dass eine vermischte Welt so viel schlechter ist als zwei getrennte?«
Wieder herrscht Stille. Joseph richtet sich weiter auf seinem Lager auf, als wolle er mich besser sehen können. Sämtliche Blicke liegen auf mir. Selenas Mund öffnet sich langsam in einem Ausdruck der Fassungslosigkeit.
»Sag mal, spinnst du jetzt total? Du kannst doch nicht Gott spielen!« Selenas Stimme scheint an den Wänden widerzuhallen. »Dass Eric es versucht, ist schon schlimm genug! Hast du dir die goldenen Schwaden am Himmel mal angeguckt? Was soll denn mit denen passieren?«
Jetzt ist die Feuchtigkeit in meinen Augen wieder da – aber diesmal sind es Wuttränen. Ich mache einen Schritt auf Selena zu. »Ich will Gott spielen? Wer von uns hat denn versucht, den Tod abzuschaffen? Sag’s mir, Selena. Wer von uns war das?« Ich mache noch einen Schritt auf Selena zu, und plötzlich lassen sich die Worte nicht mehr zurückhalten: »Wie kann man nur so heuchlerisch sein?«
In Selenas dunklen Augen lodert es auf, und ich weiß, noch bevor sie es tut, dass sie auf mich zustürmen und mich packen wird. Doch offenbar bin ich nicht die Einzige, die diese Ahnung hat. Als Selena auf mich zuhechtet, tun es ihr meine Freunde nach. Yunus ist in einem Satz da, Lil auch. Kaum einen Moment später werden wir voneinander getrennt. Ich wehre mich nicht, unter den Tränen verschwimmt alles.
»Wie wäre es, wenn wir für heute Schluss machen?«, ruft meine beste Freundin über den Trubel hinweg, und ich spüre ihre Hand auf meiner Schulter. »Lasst uns morgen eine Entscheidung treffen, okay?« Damit zieht sie mich mit sich in Richtung Tür.
Den Tränenschleier wegblinzelnd, folge ich ihr. Erst als wir die Treppe hinunter und in der Diele sind, verstehe ich, dass Lil vorhat, das Haus zu verlassen.
»Wo willst du hin?«
»Du musst hier mal raus«, befindet sie. Dann schiebt sie mich vor sich her aus der Tür.
Schnellen Schrittes entfernen wir uns vom Haus.
»Was ist, bitte, mit der los?«, platzt es aus mir hervor.
Lil sieht mich von der Seite her an, und ihr aschblonder Pferdeschwanz wippt bei jedem energischen Schritt. »Na, das wurde auch mal Zeit, dass die Sache zwischen euch explodiert. Das war schon seit Tagen am Schwelen, oder?«
Ich gehe nicht auf sie ein, sondern poltere: »Ich meine: Warum soll ich jetzt für ihren Fehler sterben?«
Wir nähern uns dem Waldrand, in den ein dünner Wanderpfad führt. Jeder Schritt, den ich darauf zu und damit von Selena weg tue, fühlt sich gut an.
»Wenn sie einen Todeswunsch hat, bitte! Ich halte sie nicht auf. Aber sie kann doch nicht verlangen, dass ich … Sie kann doch nicht verlangen … sie kann doch nicht … Ich will den Leuten ja helfen. Aber Selena blockt alles ab! Für sie gibt es keinen anderen Weg!«
Mit dem Schatten der Bäume senkt sich auch wieder dieses Gefühl der Verantwortung über mich, das mir die Luft für weitere Worte nimmt. Mein Atem geht unregelmäßig, stoßweise. O nein. Werde ich jetzt eine Panikattacke bekommen, wie damals, als ich noch nicht traumgehen konnte? Nein. Ich übersehe eine Wurzel und stolpere. Aber Lil fängt mich auf.
Sie packt mich an beiden Schultern und sucht meinen Blick. »Hör mir zu. Du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst. Es ist nicht fair, was Selena vorhat. Wir finden eine Lösung, okay? Eine, bei der du nicht sterben musst. Vielleicht können wir Eric wirklich einfach austauschen und dann selbst eine gerechte und sichere Welt aufbauen. Wir werden den Leuten da draußen helfen, okay?« In Lils Augen, deren Farbe irgendwo zwischen Blau, Grau und Grün liegt, schimmert die Verzweiflung. Sie will daran glauben, dass es eine Alternative gibt. Und ich will es auch.
Und Lil wäre nicht meine beste Freundin, wenn sie in diesem Moment nicht genau wissen würde, was ich brauche. Sie zieht mich in eine Umarmung und hält mich eng umschlungen. Ich schließe die Augen, rieche ihren vertrauten Duft und höre die Bäume sanft über uns rauschen. Mit jeder Sekunde, die wir so dastehen, verlangsamt sich mein Herzschlag ein wenig. Doch irgendwann merke ich, wie Lil sich versteift. Ich hebe den Kopf und sehe, dass sie über meine Schulter hinweg in Richtung des Hauses späht. Ich wende mich um.
Yunus tritt aus der Tür, blickt sich suchend um und entdeckt uns zwischen den Bäumen. Aus der Ferne kann ich seinen Gesichtsausdruck nicht wirklich deuten, aber ich meine, ein verständnisvolles Lächeln zu erkennen. Er macht keine Anstalten, zu uns zu kommen.
Ich merke, dass Lil mich beobachtet.
»Sag mal, wie ist es eigentlich gerade zwischen Yunus und dir?«
»Lass uns noch ein bisschen spazieren gehen, ja?« Ich winke Yunus zu, dann wende ich mich ab, und stumm setzen wir unseren Weg zwischen den Bäumen fort.
Lil hat es geschafft, mich mit ihrer Frage von meinen anderen Gedanken abzulenken. Ja. Wie ist es gerade zwischen Yunus und mir? Wenn ich an ihn denke, zieht ein Lächeln an meinen Mundwinkeln, und ein Flattern macht sich in meinem Bauch bemerkbar. Wir haben noch nie so viel Zeit zusammen verbracht wie in diesen Tagen. Aber irgendwie ist da ein Gefühl, das ich nicht richtig greifen kann. Ein Gefühl, das mir immer wieder durch die Finger gleitet, so wie Yunus mir immer wieder durch die Finger gleitet. Als wäre da ein Teil von ihm, der anders ist, als ich erwartet hätte – und ich kann nicht mal genau sagen, inwiefern.
»Findest du auch, dass er seltsam ruhig ist in letzter Zeit?«
Obwohl Lil hinter mir geht, kann ich das Schulterzucken in ihrer Antwort hören. »Ich kannte ihn bisher ja gar nicht richtig.« Dann stößt sie mich spielerisch gegen die Schulter. »Auf jeden Fall schaut er dich ziemlich verliebt an.«
Jetzt kann ich das Lächeln auf meinem Gesicht nicht mehr unterdrücken und werfe Lil einen vielsagenden Blick zu.
Die zieht die Brauen in die Höhe. »Habt ihr eigentlich schon …«
»Nein!«, unterbreche ich sie und muss lachen.
»Ach, komm schon! Ein Haus voller Betten. Die Möglichkeit, jede Traumwandlung zu machen, die dir einfällt. Also im Ernst, Ria Maywald. Worauf wartet ihr?«
Ich zucke die Schultern und gehe mit schnellen Schritten weiter. Da ist es wieder, dieses seltsame Gefühl, das sich zwischen das Flattern in meinem Magen drängt. Yunus und ich haben seit unserem Wiedersehen viel Zeit miteinander verbracht, haben uns etliche Male geküsst. Aber trotzdem …
»Da ist etwas an ihm, das ich einfach nicht verstehe. Manchmal sitzt er da und starrt einfach ins Leere. Aber wenn ich ihn frage, woran er denkt, sagt er nur, dass er sich Sorgen um seine Familie macht.«
»Vielleicht stimmt das ja auch? Seine Familie ist noch in Berlin, oder?«
»Ja, davon gehen wir aus. Wir konnten sie nicht früh genug rausholen, genau wie Pauls Familie. Eric hatte die Stadt schon abgeriegelt. Aber vermutlich will er dort eine Schutzzone einrichten. Also sollte es ihnen gut gehen …« Ich kann den Zweifel aus meiner Stimme nicht ganz heraushalten. Wann immer ich an Yunus’ liebevolle Eltern und seine drei kleinen Brüder denke, zieht sich etwas in mir zusammen. Ich kann nur hoffen, dass es ihnen gut geht. »Weißt du … ich habe einfach das Gefühl, dass es bei ihm noch etwas anderes ist. Wir … Wir machen uns schließlich alle um irgendjemanden Sorgen, oder? Aber bei ihm ist es irgendwie … anders. Weißt du, was ich meine?«
Einen Moment ist Lil stumm, dann sagt sie: »Vielleicht macht er sich ja nicht nur Sorgen um seine Familie, sondern auch um dich?«
Ich bleibe stehen und sehe sie an. Da ist es also wieder. Dieses erdrückende Gefühl, das wir gerade für ein paar Momente ausblenden konnten.
Ich suche nach einer Antwort. Irgendetwas, das eine Spur der Leichtigkeit in unser Gespräch zurückbringt. Aber da lässt mich ein Geräusch innehalten. Ein Weinen. Das Weinen eines Kindes. In Lils Gesicht erkenne ich, dass auch sie es gehört hat.
»Das kam von da unten«, sage ich, gerade als der Laut wieder ertönt. Lang gezogen und absolut bemitleidenswert.
»Komm!« Damit hastet Lil den Hang herunter, und ich folge ihr.
Einige Male muss ich meine Geschwindigkeit am Stamm eines Baums abbremsen, aber schließlich kommt wieder ein Wanderweg in Sicht, und darauf stehen zwei Erwachsene, die sich zu einem weinenden Kind herabgebeugt haben. Als sie das Knacken der Zweige vernehmen, heben sie die Blicke und starren uns entgegen. Sie wirken ausgemergelt: die Kleidung und Haare länger nicht gewaschen, in den Augen ein gehetzter Ausdruck.
Ich verlangsame meine Geschwindigkeit und zögere, nur einen winzigen Augenblick. Dann wische ich meine Zweifel beiseite und frage: »Braucht ihr Hilfe?«
Die Überraschung auf den Gesichtern der Familie weicht etwas, das Hoffnung sein muss.
»Ja, bitte!« Die Worte der Frau, hervorgepresst mit einer solchen Verzweiflung, ziehen hart an meinem Inneren.
»Habt ihr euch verlaufen?«, frage ich.
Die drei nicken, und ich fange den Blick des kleinen Jungen auf. Sein Knie blutet, und etwas an ihm lässt mich plötzlich an Kilian denken – meinen kleinen Halbbruder, der jetzt in Norwegen in unserer Sicherheitszone ist. Vermutlich sind die beiden in etwa gleich alt. Aber nicht alle Kinder haben so viel Glück wie mein Bruder.
»Wir sind aus der Stadt geflohen. Wollten eigentlich zu meiner Tante, die hier irgendwo wohnt. Aber jetzt …« Die Frau bricht ab und wischt sich energisch über die Augen.
Ich schlucke.
Verdammt sei Selena. Egal, was sie sagt – ich kann diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und genau damit werde ich heute anfangen.
»Kommt mit. Ihr könnt euch erst mal bei uns ausruhen.«
3Selena
Mir ist heiß. Ich strampele die Decke von meinen Beinen und liege einen Moment bewegungslos da. Nein. Das bringt nichts. Ich wende den Kopf und sehe zu Mo hinüber, die tief atmend neben mir schläft. Wieso nur bin ich aufgewacht? Sobald ich wach bin, ist es mir fast unmöglich, wieder einzuschlafen. So war es bisher jede Nacht in den vergangenen zwei Wochen.
Mein Blick wandert zum Vorhang vor der Balkontür der kleinen Kammer, in der Mo und ich schlafen. Nur das silbrige Licht des Mondes dringt dahinter hervor, also muss es noch mitten in der Nacht sein. Aber was soll’s – vielleicht würde mir frische Luft guttun. Ich richte mich so leise und langsam wie möglich auf, greife nach meinem Pulli auf dem Nachttisch und ziehe ihn über den Kopf. Der verräterische Holzboden knarrt, als ich auf die Balkontür zuschleiche, aber zum Glück wacht Mo nicht auf.
Als ich nach draußen trete, empfängt mich wohltuend die kühle Nachtluft. Sanft ziehe ich die Tür hinter mir zu und atme tief ein. Die Welt mag eine völlig andere sein, aber der Geschmack des Taus, der in diesen frühen Herbsttagen in der Luft hängt, ist noch immer derselbe. Ich trete an das Balkongeländer, an dem die langen Kästen der Geranien hängen, und stehe einen Augenblick einfach so da.
Vor mir erstreckt sich das Bergpanorama – eine Mischung aus mächtigen Schatten und im Vollmond glänzenden Gipfeln. Ganz hinten am Horizont weicht das tiefe Schwarz des Himmels bereits einem Grau und kündigt den nächsten Tag an. Die Szenerie wirkt wie ein Versprechen: Als würde am heutigen Tag alles wieder gut werden. Aber ich weiß ganz genau, dass der Schein trügt. Und schon einen Moment später bestätigt sich meine Vorahnung. Ein entfernter Knall und eine Art Jaulen zerreißen die Luft. Mit hektischem Blick taste ich das Tal und die vereinzelten Almen an den Berghängen ab. Zu sehen ist von hier oben nichts, aber ich bin mir sicher, dass nicht weit von mir entfernt gerade etwas Ungeheuerliches passiert. Meine Hände krallen sich fester um das Holz des Geländers. In den frühen Morgenstunden ist es immer am schlimmsten – das ist mir schon in den letzten Tagen aufgefallen. Dann scheint die Kontrolle der Menschen über ihre Emotionen am geringsten zu sein. Als würden sich all die Gefühle einen Weg aus den Körpern der Menschen herausbahnen müssen – wie früher in den Träumen, nur dass die Traumwandlungen sich heute in der echten Welt manifestieren. Und die meisten Wandlungen, die den Emotionen der Menschen entspringen, sind schrecklich. Ich kann es ihnen nicht verdenken.
Ein weiterer Knall ertönt.
In mir kribbelt der Drang, mich in die Luft zu schwingen und dort unten im Tal nach dem Rechten zu sehen. Aber wäre das nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein? Seit meinem Ausflug in die Stadt und dem Gespräch gestern ist mir klar, dass wir eine endgültige Lösung brauchen. Und so schwer es mir auch fällt, es mir einzugestehen – dafür müssen wir überlegt vorgehen. Was voreilige Rettungsaktionen eindeutig ausschließt. Zumindest damit hatte Ria gestern wohl recht. Trotzdem kostet es mich alle Überwindung, hier auf dem Balkon stehen zu bleiben.
Ich trommele auf dem Holz des Geländers herum und spüre, wie meine Gedanken schon wieder in die mir bereits wohlbekannte Spirale fallen: Die einzige endgültige Lösung, die mir einfällt, ist die erneute Trennung der Welten. Nur: Wie soll das möglich sein, wenn Ria sich querstellt?
Heuchlerisch. So hat Ria mich genannt. In mir brennt die Wut. Mich selbst von der Richtigkeit meiner Idee zu überzeugen, ist schon schwer genug. Wie soll ich das auch noch bei Ria schaffen? Es ist ja nicht so, als würde ich sie nicht verstehen. Ich will ja auch nicht sterben. Ich will weiterleben, noch ganz viel Zeit haben mit meiner Familie und mit Mo. Mo … Vom Gewicht auf meinen Schultern niedergedrückt, senke ich den Kopf und reibe mir mit den Händen über das Gesicht.
»Kannst du nicht schlafen?«
Ich fahre herum. Der Boden knarzt unter Mos Schritten, als sie auf den Balkon tritt. Sie sieht verschlafen aus. Am Hinterkopf stehen ein paar ihrer schwarzen Haare ab, und sie blinzelt mehrfach.
Verdammt. Habe ich nicht versucht, so leise wie möglich zu sein? Ich hätte eine Traumwandlung benutzen sollen, um meine Geräusche zu unterdrücken. »Habe ich dich geweckt?«
Mo lächelt schief und kommt auf mich zu. »Alles gut bei dir?«
Ich atme langsam aus, denn ich kann ihre Frage nicht ehrlich beantworten, und das weiß Mo auch.
Sie hat mich erreicht, und ich strecke die Arme nach ihr aus, fühle die Wärme ihres Körpers, die unter ihrem Schlafshirt hervordringt.
»Wie viel Uhr ist es?«, will sie wissen.
»Keine Ahnung. Vielleicht fünf?«
Mo legt einen Arm um meine Taille, und ich atme tief ihren Duft ein. Gemeinsam sehen wir in das Tal, aus dem schon wieder ein erschreckendes Geräusch dringt.
»Es wird schlimmer. Lange geht das so nicht weiter«, murmele ich.
Mo versteift sich. Dann holt sie tief Luft. »Hör zu, Sel.« Sie lässt mich los, fährt sich über das Gesicht. Enge legt sich um meinen Brustkorb. »Ich muss die ganze Zeit an das Meeting von gestern denken.« Deutlich höre ich das Zittern in ihrer Stimme. »Ich finde es ja wirklich … bewundernswert, dass du bereit bist, dich zu opfern.« Sie schluckt, starrt auf die Geranien.
»Aber du findest es nicht gut«, hauche ich.
Ihr Blick zuckt zu mir. »Natürlich nicht. Was erwartest du von mir?«
Ich hebe die Hand, um Mo zu berühren. »Wir müssen etwas tun, Mo. Wir haben alle in Sicherheit gebracht, die wir lieben. Aber da draußen sind noch so viele andere Menschen. Wir müssen …«
»Ich weiß. Aber hast du auch mal dran gedacht, wie ich mich dabei fühle?«
Das hier sind all die Worte, die sie zurückgehalten hat, als sie gestern einfach nur schweigend ins Bett gegangen ist. Etwas sticht in mein Herz, als ich in ihre schimmernden Augen sehe.
»Mo …« Meine Hand fährt über ihren Arm, aber ihr Körper ist steif unter meiner Berührung.
»Ria hat recht. Wir müssen einen anderen Weg finden«, flüstert sie. »Ich weiß, du willst Sachen immer schnell regeln, und das finde ich so toll an dir, aber in diesem Fall …«
Einem Impuls folgend, schlinge ich beide Arme um sie, halte sie fest und warte, bis ich wieder genug Platz in der Kehle habe, um mit heiserer Stimme zu raunen: »Ich will dich auch nicht verlieren. Auf keinen Fall. Ich will alles dafür tun, dass wir das hier überleben … irgendwie. Aber … In einer vermischten Welt, in der Eric uns jagt, hätten wir keine Zukunft.« Ich schlucke heftig, um meine Gefühle und meine Stimme irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen. »Dieser ganze Mist ist meine Verantwortung. Verstehst du?«
Sie löst sich aus meiner Umarmung und sieht mich an, das Gesicht nur wenige Zentimeter vor meinem. »Du machst immer das, was du für deine Verantwortung hältst. Aber das hat uns doch erst in diese Situation gebracht! Du hast gedacht, dein Vater wollte die Tore zerstören und es wäre deine Verantwortung, seinen Wunsch zu erfüllen. Und jetzt ist es genauso. Du rennst blindlings in dein eigenes Verderben, nur weil du glaubst, dass es das Richtige wäre und irgendjemand es von dir erwarten würde.«
Irgendwo in mir kratzt der Ärger. »Aber das ist es doch auch. Es ist das Richtige. Ich habe einen Fehler begangen, und jetzt muss ich ihn wiedergutmachen. Mein Vater würde wollen, dass ich …«
Sie legt eine Hand auf meine Brust. »Aber was willst du wirklich tun, Selena? Was willst du?«
Ich will dich. Der Satz liegt mir auf der Zunge, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Ich werde Mo verletzen. Das steht fest. Denn das hier – was auch immer es ist – wird kein gutes Ende nehmen. Das ist mir klar, seit Denise in der Flugkapsel verkündet hat, dass Ria und ich sterben müssen. Aber wenn ich Mo jetzt meine wahren Gefühle gestehe, mich vollends auf unsere Liebe einlasse, dann werde ich es nicht nur viel schlimmer für sie machen, sondern auch unmöglich für mich, das zu tun, was ich tun muss.
»Mo …«, flüstere ich.
Ein trauriges Lächeln legt sich auf Mos Gesicht. »Schon gut. Lass uns noch ein bisschen schlafen, ja?« Damit wendet sie sich ab und entzieht sich langsam meinem Griff. »Kommst du?«
»Gleich.« In mir brodeln die Gefühle und drohen die Mauer einzureißen, die ich stets um sie errichtet habe. »Ich komme gleich.«
An der Tür angekommen, sieht Mo sich noch einmal zu mir um. »Weißt du was? Ich glaube nicht, dass dein Vater gewollt hätte, dass du dich opferst. Keine Ahnung, warum. Aber das glaube ich einfach nicht. Ich finde, du solltest Joseph endlich fragen, was er über den Tod deines Vaters weiß. Ich verstehe, dass du sauer auf ihn bist. Aber … Vielleicht würde dir das helfen …« Mit einem letzten schwachen Lächeln verschwindet sie im Zimmer.
Ich atme mehrmals tief ein, um mich wieder unter Kontrolle zu bringen. Ein Vogel segelt am Haus vorbei, und ich folge seiner Flugbahn, bis er nur noch ein kleiner Punkt in der Morgendämmerung ist.
Mit Joseph Hoggs sprechen … Mo hat es in den letzten Tagen immer wieder erwähnt. Ist sie wirklich der Meinung, dass mich das von meinem Plan abbringen würde? Das bezweifle ich stark. Selbst wenn Joseph mir mehr über meinen Vater erzählt – selbst wenn mein Vater wirklich nicht wollen würde, dass ich sterbe … womit Mo vermutlich recht hat. Aber ich denke nicht, dass mein Vater gegen die erneute Trennung der Welten wäre. Und das geht nun mal nur mit meinem Tod …
Wieder vergrabe ich mein Gesicht in den Händen. Aber mit einem liegt Mo auf alle Fälle falsch: Der Grund, weshalb ich noch nicht mit Joseph gesprochen habe, ist nicht, dass ich sauer auf ihn bin. Natürlich nehme ich es ihm übel, dass er es war, der damals meinen Vater im Projekt Morpheus beschützen sollte und sein Versprechen dann gebrochen hat. Aber der wahre Grund ist, dass ich Angst habe vor dem Gespräch. Wenn ich – wie Mo es vorschlägt – mit Joseph über den Tod meines Vaters spreche, dann wird mich das unweigerlich zu der Frage führen, welche Rolle ich dabei gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin …
Ich sehe auf und betrachte einen weiteren Vogel, der sich in der Ferne in die Höhe schwingt. Es ist, als wolle er mich mit seiner Freiheit verhöhnen – während mich das Gefühl der Verantwortung abermals niederdrückt.
4Ria
I
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: