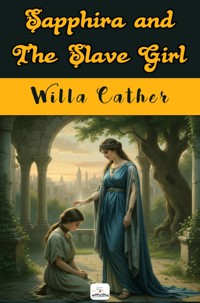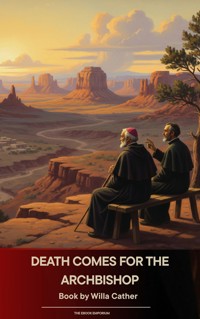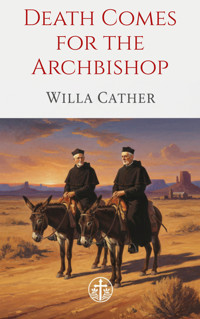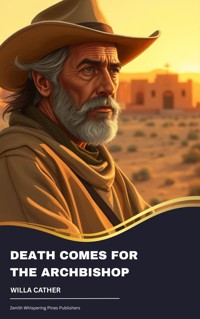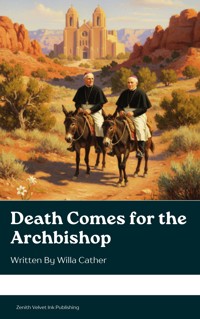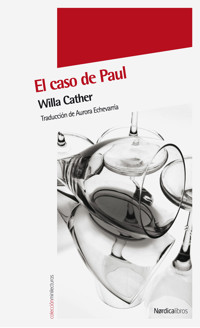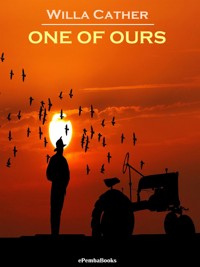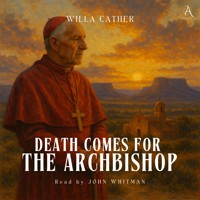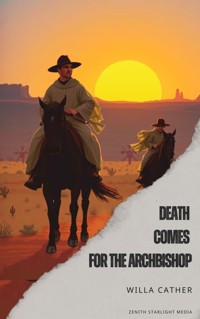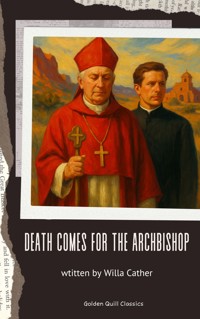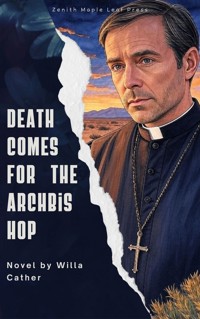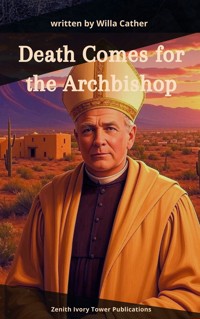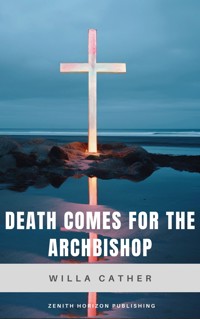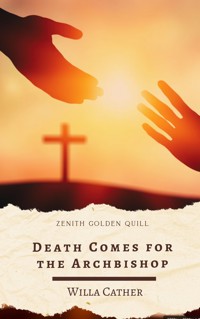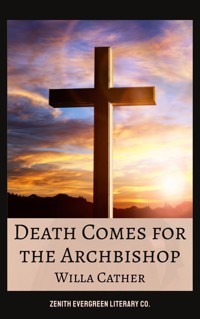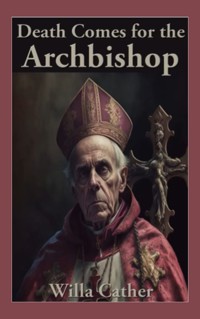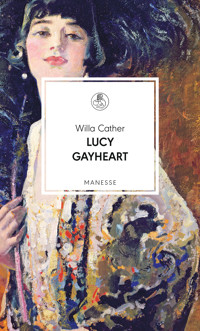
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der Roman «Lucy Gayheart» von 1936 ist das liebevolle Porträt einer jungen Frau, die zu neuen Ufern aufbricht: das erste eigene Zimmer, die erste große Liebe und die ewige Frage, warum man nie den Mann will, den man haben könnte.
Jeder im amerikanischen Städtchen Haverford sagt Lucy Gayheart eine glänzende Zukunft voraus: Sie ist jung, hübsch und musisch hochbegabt – eine ausgezeichnete Klavierspielerin. Doch Lucy wünscht sich mehr als das langweilige Kleinstadtleben und den wohlhabenden, doch allzu bodenständigen Harry, der sich im Geheimen schon als ihr Ehemann sieht. Also zieht sie zum Musikstudium nach Chicago, wo sie das Großstadtleben und ihre neugewonnene Unabhängigkeit fern der Heimat genießt. Mit dem berühmten, schon wesentlich älteren Tenor Sebastian erlebt sie schließlich die Aufregungen und das Glück der ersten Liebe. Als Harry jedoch plötzlich in Chicago auftaucht und Lucy einen Heiratsantrag macht, erfindet sie aus der Not heraus eine Lüge, die ihrer beider Leben für immer verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Willa Cather
LUCY GAYHEART
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Elisabeth Schnack
Für die Neuausgabe durchgesehen von Susanne Ostwald
Nachwort von Alexa Hennig von Lange
MANESSE VERLAG
Erstes Buch
1
In Haverford am Platte-River1 sprechen die Leute noch heute von Lucy Gayheart. Zwar sprechen sie nicht sehr oft von ihr; das Leben geht schließlich weiter, und wir leben in der Gegenwart. Aber wenn sie ihren Namen erwähnen, dann ist stets ein sanftes Leuchten in ihren Gesichtern oder ihrer Stimme, ein vertraulicher Blick in ihren Augen, der sagt: «Ach ja, du erinnerst dich also auch noch an sie?» Und sie sehen sie noch immer als ein zierliches Wesen in ständiger Bewegung, beim Tanzen oder Schlittschuhlaufen – oder in rascher, zielstrebiger Bewegung, wie ein heimwärts fliegender Vogel.
Wenn dichter Schnee fällt, dann schauen die älteren Leute aus dem Fenster und denken daran, wie Lucy stets durch solches Schneegestöber sauste, den Muff an die Wangen gepresst und ihre Glieder bedenkenlos dem Wind aussetzend, als wolle sie mit ihm Schritt halten. In der Sommerhitze lief sie ebenso flink die langen, schattigen Bürgersteige herunter und überquerte die offenen Plätze, die im Sonnenlicht glühten. Und an den atemberaubend grellen Mittagsstunden im August, wenn die Pferde den Kopf hängen ließen und die Arbeiter es «ruhig angehen ließen», ging sie niemals etwas ruhig an. Bei Kälte, so sagte sie immer, lebe sie richtig auf; Hitze schien allerdings den gleichen Einfluss auf sie zu haben.
Die Familie Gayheart wohnte am Stadtrand, eine halbe Meile westlich der Hauptstraße. Die Leute sagten immerzu, «draußen bei den Gayhearts», und im Sommer hielten sie es für einen recht langen Marsch. Doch Lucy legte die Entfernung täglich Dutzende Male zurück, legte sie schnell zurück mit ihrem unverwechselbaren Gang, der wie ein Ausdruck ihrer nicht zu unterdrückenden Unbekümmertheit war. Wenn die alten Frauen, die im Garten arbeiteten, sie in der Ferne erblickten, bloß eine weiße Gestalt im flirrenden Schatten der frühsommerlichen Bäume, dann erkannten sie sie schon an der Art, wie sie sich bewegte. Da kam sie vorbei an Hecken und Fliedergebüsch und Lauben aus grünwolligem Wein und Reihen von Osterglocken, und man spürte, wie sie sich an allem erfreute – an ihrer Sommerkleidung, der Luft und der Sonne und der ganzen blühenden Welt. In ihrem Wesen lag etwas, das ihren Bewegungen glich, etwas Unmittelbares und Rückhaltloses und Fröhliches, und das sprach auch aus ihren braun-goldenen Augen. Es waren keine sanften braunen Augen, denn goldene Funken glommen in ihnen auf, wie bei dem Colorado-Stein, den wir Tigerauge nennen. Ihre Haut war eher dunkel, und die Farbe ihrer Lippen und Wangen war vom Rot dunkler Pfingstrosen – tief und samtig. Ihr Mund war sanft und leidenschaftlich, und jede noch so flüchtige Empfindung zeichnete sich auf ihm ab.
Fotos von Lucy bedeuten ihren alten Freunden gar nichts. Es war ihre Heiterkeit und Anmut, die sie liebten. Das Leben schien bei ihr ganz dicht unter der Oberfläche zu liegen. Sie hatte dieses eigentümliche Strahlen jugendlicher Schönheit: wie ein Blumengarten in den ersten Stunden nach Sonnenaufgang.
Wir in Haverford haben Lucy vermisst, als sie nach Chicago ging, um dort Musik zu studieren. Sie war damals achtzehn; talentiert, aber zu sorglos und leichtherzig, um sich selbst sehr ernst zu nehmen. Sie träumte nie von einer «Karriere». Sie sah die Musik als einen natürlichen Ausdruck der Freude und als ein Mittel, um Geld zu verdienen, damit sie ihrem Vater helfen könne, wenn sie heimkomme. Ihr Vater, Jacob Gayheart, leitete die Stadtkapelle und gab Musikstunden für Klarinette, Flöte und Geige – im Hinterzimmer seines Uhrmacherladens. Lucy hatte seit der zehnten Klasse Anfängern Klavierstunden gegeben. Die Kinder mochten sie, weil sie von ihr nicht wie Kinder behandelt wurden; sie versuchten, sie zufriedenzustellen, vor allem die kleinen Jungen.
Zwar war Jacob Gayheart ein guter Uhrmacher, aber er war kein guter Geschäftsmann. Der Sohn bayerischer Eltern aus der deutschen Kolonie von Belleville, Illinois, hatte sein Handwerk bei seinem Vater erlernt. Er war jung nach Haverford gekommen und hatte eine Amerikanerin geheiratet, die hundertdreißig Hektar guten Farmlandes in die Ehe einbrachte. Nach ihrem Tod nahm er eine Hypothek auf diese Farm auf, um eine zweite zu kaufen, und nun waren beide belastet. Das bereitete seiner älteren Tochter Pauline Sorgen, nicht aber Mr. Gayheart. Er kümmerte sich mehr darum, dass die Jungs aus der Kapelle regelmäßig übten, als um regelmäßige Zinszahlungen. Er galt im Städtchen freilich als kauzig, und die Einwohner machten ihre Scherze über ihn, obwohl sie auf die Kapelle sehr stolz waren. Mr. Gayheart sah aus wie ein unbedeutender deutscher Dichter auf einer alten Daguerreotypie: Er trug Schnurrbart und Ziegenbärtchen und oberhalb der Stirn eine dünne Strähne dunklen Haars, nur an den Seiten ein wenig grau. Seine klugen, haselnussbraunen Augen, mit denen er träge dreinblickte, schienen zu sagen: «Es ist eine sehr angenehme Welt – wozu also sich Sorgen machen?»
Er schaffte es, jeden Tag von Anfang bis Ende zu genießen. Er stand frühmorgens auf und arbeitete eine Stunde lang in seinem Blumengarten. Dann nahm er ein Bad, kleidete sich an und wählte Hemd und Krawatte mit solcher Sorgfalt, als wolle er einen Besuch abstatten. Nach dem Frühstück zündete er sich eine gute Zigarre an und ging in die Stadt, dabei den Geschmack des Tabaks voll auskostend. Meistens steckte er sich eine Blüte ins Knopfloch, ehe er von zu Hause fortging. Niemand hat je größere Befriedigung aus guter Gesundheit, einfachen Vergnügungen und einer blau-goldenen Kapellmeister-Uniform gezogen als Jacob Gayheart. Wahrscheinlich war er der glücklichste Mann von Haverford.
2
Es war gegen Ende der Weihnachtstage, das Weihnachten von 1901, und Lucys dritter Winter in Chicago. Sie verbrachte die Ferien zu Hause. Während der ganzen Weihnachtswoche war wunderbares Schlittschuhwetter gewesen, und sie hatte es ausgiebig genutzt. Sogar am letzten Nachmittag, als sie eigentlich hätte packen sollen, lief sie mit einer Gruppe von Mädchen und Jungs aus Haverford auf der langen Eisbahn nördlich von Duck Island Schlittschuh. Die Insel, fast eine halbe Meile lang, teilte den Fluss in zwei Hälften, oder vielmehr trennte sie einen schmalen, seichten Arm vom Hauptstrom ab. Der eigentliche Platte-River strömte an der Südseite der Insel dahin und fror selten zu; doch der seichte Wasserlauf zwischen der Insel und dem nördlichen Ufer gefror bis auf den Grund, und sein Eis war schön glatt. Es waren die Zeiten vor der landwirtschaftlichen Bewässerung durch den Platte-River, und bei Hochwasser war der Platte ein gewaltiger Strom. Während des Schmelzwasserabflusses im Frühjahr grub er sich manchmal einen neuen Kanal durch das lockere Farmland längs der Ufer und änderte so seinen gesamten Lauf.
Gegen vier Uhr an diesem Dezembernachmittag glitt ein leichter Schlitten mit Schellen und Büffeldecken und voran einem guten Pferd mit großer Geschwindigkeit über die aus der Stadt führende Straße und bog an Bensons Ecke zur Eisbahn ein. Ein groß gewachsener junger Mann sprang heraus, band sein Pferd an den langen Balken, an dem schon eine Reihe Schlitten standen, und lief mit den Schlittschuhen in der Hand zum Ufer. Während er diese anzog, musterte er die Gesellschaft, die sich auf der Eisfläche bewegte. Es war nicht schwer, die Gestalt zu entdecken, nach der er Ausschau gehalten hatte. Sechs der stärksten Läufer hatten die anderen hinter sich gelassen und sausten gegen den Wind auf die Spitze der Insel zu.
Zwei waren den anderen voraus: Jim Hardwick und Lucy Gayheart. Er erkannte sie an ihrer braunen Jacke und Pelzkappe aus Eichhörnchenfell und an ihrem gelassenen Gleiten. Die zwei Enden eines langen roten Schals flatterten hinter ihr im Wind wie zwei schlanke rote Flügel.
Harry Gordon schritt energisch aus, um sie einzuholen. Auch er war ein glänzender Läufer, hochgewachsen, vom Typ eines Schwergewichtsboxers und ebenso leichtfüßig. Trotzdem war er ein wenig außer Atem, als er die Vierergruppe überholte und an Jim Hardwicks Seite entlangschoss.
«Jim», rief er, «gönnst du mir eine Runde mit Lucy, bevor die Sonne untergeht?»
«Na klar, Harry. Ich hab’ sie für dich nur vor Unfug bewahrt.» Der Kerl blieb zurück. Die Jungs von Haverford ließen Harry Gordon stets gutmütig den Vortritt. Er war der reiche junge Mann der Stadt, und er war weder arrogant noch überheblich. Man kannte ihn als gutherzigen Kerl, hart im Geschäft, aber großzügig seiner Baseballmannschaft und der Stadtkapelle gegenüber; «aufs Gemeinwohl bedacht», sagten die Leute.
«Na, Harry, du hast doch gesagt, du könntest nicht kommen!», rief Lucy, als sie seinen Arm nahm.
«Dachte, ich würde es nicht schaffen. Konnte es aber doch einrichten. Habe Flicker auf dem Weg von der Vorstandssitzung hierher schweißnass gehetzt. Das ist jetzt jedenfalls der beste Teil des Nachmittags. Komm mit!» Sie kreuzten die Hände und liefen im Two-Step-Rhythmus geradeaus.
Die Sonne sank allmählich tiefer im Süden, und so weit das Auge reichte, begann das flache, schneebedeckte Land in rosigem Licht zu erglühen, das plötzlich rot und feurig wurde. Das schwarze Weidengestrüpp auf der Insel bildete ein Dickicht wie eine Dornenhecke, und die krummen und knorrigen, langsam wachsenden Straucheichen mit ihren flachen Kronen erglühten in einem Bronzeton, als hätte das schräg einfallende, intensive Strahlen sie in Brand gesetzt.
Als die Sonne sank, wurde der Wind beißender. Sie hatten die anderen Schlittschuhläufer weit hinter sich gelassen. «Sollten wir nicht umkehren?», keuchte Lucy.
«Noch nicht. Ich möchte zu der windgeschützten Inselgabelung. Ich habe etwas Whisky bei mir; der wird dich wärmen.»
«Wie schön! Ich werde langsam müde. Bin schon sehr lange draußen.»
Das Ende der Insel gabelte sich wie ein Fischschwanz. Als sie um eine der beiden Spitzen bogen, schwenkte Harry mit ihr zum Ufer. Sie setzten sich auf einen ausgebleichten Pappelstamm, und das schwarze Weidendickicht hinter ihnen bildete einen Sichtschutz. Die ineinander verflochtenen Äste warfen, Glühdrähten ähnlich, rotes Licht zurück, der Schnee darunter war rosenfarbig. Harry goss Lucy etwas Whisky in den Metallbecher, der über den Korken geschraubt wurde; er selber trank aus der Flasche. Die runde rote Sonne fiel wie ein Bleigewicht, berührte den Horizont und sandte zitternde rote und goldene Fächer über das weite Land. Für einen Moment saßen Lucy und Harry Gordon in einer Flut blendenden Lichtes; es brannte auf ihren Schlittschuhen und auf der Flasche und dem Metallbecher. Ihre Gesichter wurden so strahlend, dass sie sich ansahen und lachen mussten. Einen Augenblick später war das Licht verschwunden; der zugefrorene Fluss und das schneeverhüllte Prärieland wurden unter dem blaugrünen Himmel violett. Wohin man auch blickte, nichts als flaches Land und niedrige Hügel, alle violett und grau. Lucy seufzte tief.
Gordon hob sie vom Stamm, und sie machten sich auf den Weg zurück, mit dem Wind im Rücken. Der Fluss lag jetzt wie ausgestorben vor ihnen, eine verlassene, blaugraue Eisfläche: Alle Schlittschuhläufer waren fort. Harry erkannte an der Art, wie Lucy lief, dass sie sehr müde war. Sie war schon eine geraume Weile auf dem Eis gewesen, ehe er kam, und nur, um mit ihm zu laufen, hatte sie sich noch einmal aufgerafft. Es tat ihm leid, und zugleich war er erfreut. Er führte sie zu einer Stelle am Ufer in einiger Entfernung von seinem Schlitten, kniete nieder und nahm ihr die Schlittschuhe ab, wechselte auch seine Schuhe, und mit einer plötzlichen Bewegung schwang er Lucy hoch und trug sie über den niedergetretenen Schnee zu seinem Einspänner. Als er sie in die Büffelfelle einhüllte, dankte sie ihm. «Der Wind hat mich anscheinend so schläfrig gemacht, Harry. Heute Abend werde ich wohl nicht mehr viel gepackt kriegen. Egal, dann eben morgen. Und das Schlittschuhlaufen war herrlich!»
Auf dem Heimweg überließ Gordon den Schlittenglöckchen (sehr musikalische Schellen – er hatte sie Lucy zuliebe angeschafft) die Unterhaltung. Er wusste, wann man besser schwieg.
Lucy war schläfrig und verträumt und froh darüber, im Warmen zu sein. Der Schlitten war ein so winziger vorüberziehender Fleck in der ruhenden weißen Landschaft, auf die sich Schatten und Stille senkten. Plötzlich fuhr Lucy hoch und kämpfte mit den schweren Decken. Am dunkler werdenden Himmel hatte sie den ersten Stern hervorkommen sehen, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Dieser silberne Lichtpunkt sprach zu ihr wie ein Signal, eröffnete ihr ein anderes Leben und ein anderes Gefühl, die nicht hierher gehörten. Es überwältigte sie. Mit einem bloßen Gedanken hatte sie den Stern erreicht, und er hatte ihr geantwortet, Erkenntnis blitzte auf. Es gab also etwas in dieser ahnungslosen Einöde, das Kenntnis besaß: Es hatte stets gewusst, bis in alle Ewigkeit! Die Freude, etwas zu grüßen, das hoch über einem ist, war etwas Ewiges, und nicht nur etwas, das ihrem törichten Herzen und ihrer Unwissenheit widerfahren war.
Der Erkenntnisblitz währte nur einen Moment. Danach war wieder alles verworren. Lucy schloss die Augen und lehnte sich an Harrys Schulter, um vor dem zu entfliehen, was zu erhaschen sie so weit gegangen war. Es war zu hell und zu klar. Es schmerzte und bewirkte, dass man sich klein und verlassen fühlte.
3
Am folgenden Abend, am Sonntag, kehrten alle Jungs und Mädchen, die für die Feiertage nach Hause gekommen waren, wieder zur Schule zurück. Die meisten machten Halt in Lincoln; Lucy war die Einzige, die bis Chicago durchfuhr. Der aus Westen kommende Zug sollte Haverford um halb acht verlassen, und gegen sieben kamen aus allen Richtungen Schlitten und Wagen und fuhren zum Bahnhof am Südende der Stadt.
Der Bahnsteig war bald übervoll von ruhelosen jungen Menschen, die die Gleise entlangspähten und auf ihre Armbanduhren blickten, als ob sie ihre eigene Stadt keine Sekunde länger ertragen könnten. Gerade flog ein von zwei Pferden gezogener Wagen heran und hielt am Abstellgleis, und die sich wiegende Masse stürzte ihm laut rufend entgegen.
«Da ist sie! Da ist Fairy!»
«Fairy Blair!»
«Hallo, Fairy!»
Heraus sprang ein blondes Mädchen, flink und geschmeidig wie eine junge Katze, einen kleinen grünen Tirolerhut fest über die Locken gezogen. Sie riss sich den grauen Pelzmantel vom Leib, warf ihn in die Luft, damit die Jungs ihn fangen konnten, und lief in ihrem Reisekostüm – einer schwarzen Samtjacke mit roter Weste und einem Rock, der für die Mode der damaligen Zeit wirklich sehr kurz war – den Bahnsteig entlang.
In diesem Augenblick kam ein Mann aus dem Bahnhofsgebäude und rief aus, der Zug habe zwanzig Minuten Verspätung. Stöhnen und Knurren erhoben sich aus der Menge.
«Ach, verdammt!»
«Was, zur Hölle, sollen wir jetzt machen?»
Das grüne Hütchen zuckte mit den Achseln und lachte: «Haltet den Mund. Hört auf zu fluchen. Wir wollen erst mal die Stadt aufwecken.»
Sie fasste zwei Jungs bei den Ellbogen, und zwischen diesen beiden in steife Mäntel eingepackten Gestalten fegte sie auf die stille Straße hinaus, torkelte von links nach rechts, riss die Jungen hin und her, als schüttele sie zwei junge Bäumchen, und vollführte zwischendrin ein paar Hüpfsprünge. Sie hatte ein hübsches, etwas gewöhnliches kleines Gesicht, und ihre Augen leuchteten so unbekümmert, dass man hätte denken können, sie habe getrunken. Ihr frecher kleiner Mund war zwar nicht hässlich, aber doch richtig unverschämt. Sie konnte die Burschen gar nicht schnell genug antreiben; plötzlich sprang sie den beiden steifen Gestalten davon, als sei sie von einer Wurfschleuder abgefeuert worden, und rannte die Straße hinauf, der ganze Haufen ihr auf den Fersen. Sie waren alle ein bisschen übergeschnappt, aber sie war’s am meisten, und deshalb folgten sie ihr. Nun machten sie einen Schlenker, um den Stadtbus vorbeizulassen.
Der Bus hielt vor dem Abstellgleis. Mr. Gayheart stieg aus und reichte seinen beiden Töchtern helfend die Hand. Pauline, die ältere, stieg zuerst aus. Sie war klein und stämmig und blond wie alle Prestons, die Familie ihrer Mutter. Sie war zwölf Jahre älter als Lucy. (Zwei Jungen, zwischen den beiden Töchtern zur Welt gekommen, waren als Kinder gestorben.) Pauline hatte ihre Schwester großgezogen; ihre Mutter war gestorben, als Lucy erst sechs Jahre alt war.
Pauline redete, während sie aus dem Bus stieg, und drängte ihren Vater, den Koffer aufzugeben. «Es sind immer eine Menge Leute am Gepäckschalter, und Bert braucht eine Ewigkeit, um einen Koffer anzunehmen. Und vergiss bloß nicht, ihm zu sagen, der Koffer müsse unbedingt mit diesem Zug befördert werden. Als Mrs. Young nach Minneapolis fuhr, blieb ihr Koffer vierundzwanzig Stunden hier liegen, und sie bekam ihn erst, als …»
Aber Mr. Gayheart ging schon ruhig davon und verpasste den Rest der Geschichte über Mrs. Youngs Koffer. Lucy blieb neben ihrer Schwester stehen, doch auch sie hörte nicht zu. Sie dachte an etwas anderes.
Pauline griff entschlossen nach Lucys Arm, als wäre das jetzt geboten, und einen Augenblick lang schwieg sie. «Schau mal, da kommt Harry Gordons Schlitten, und der kleine Jenks kutschiert. Glaubst du, er fährt heute Abend ostwärts?»
«Er hat gesagt, er müsse vielleicht nach Omaha», erwiderte Lucy gleichgültig.
«Das ist nett. Du wirst also Gesellschaft haben!», rief Pauline mit aufgesetzter Herzlichkeit, die sie oft zeigte, um ihren Ärger zu verhehlen.
Lucy entgegnete nichts darauf, sondern spähte durch ein Fenster zur Bahnhofsuhr. Noch nie hatte sie sich so sehr danach gesehnt, unterwegs und allein zu sein, zu spüren, wie der Zug sanft über die Schienen rollte, und die kleinen Bahnhöfe blitzschnell vorbeiziehen zu sehen.
Fairy Blair in ihrem Tirolerhut kam ganz außer Atem von ihrer Rennerei zurück und stützte sich auf die beiden Jungs. Als sie an den Gayheart-Schwestern vorüberging, rief sie: «Wieder ab in den Osten, Lucy? Ich wünschte, ich könnte mit. Ihr Musiker habt immer euren Spaß!» Als sie mit ihren beiden schwerbemäntelten Stützen zum Stillstand kam, warf sie verstohlene Blicke auf Lucy. Sie beide waren die beliebtesten Mädchen von Haverford, und Fairy fand Lucy furchtbar steif und mädchenhaft. Immer, wenn sie Harry Gordon traf, schüttelte sie den Kopf und warf ihm einen Blick zu, der eindeutig besagte: «Was zur Hölle willst du mit der da?»
Mr. Gayheart kam zurück, gab seiner Tochter den Gepäckschein und schaute in den Himmel. Neben anderen für ihn nutzlosen Zeitvertreiben beschäftigte er sich dann und wann mit Astronomie. Als endlich der schrille Pfiff der Lokomotive durch die stille Winterluft vibrierte, holte Lucy tief Atem und trat einen Schritt vor. Ihr Vater nahm ihren Arm und drückte ihn sanft; es war nicht geraten, seiner jüngeren Tochter gegenüber allzu viel Zärtlichkeit zu bekunden. Eine lange Reihe schwankender Lichter kam aus der Ebene im Westen, und im nächsten Moment strömte das weiße Licht des Scheinwerfers über die Stahlschienen zu ihren Füßen. Die große, mit Raureif überzogene Lokomotive fuhr vorüber und kam schwer schnaufend zum Stehen.
Pauline griff sich ihre Schwester und gab ihr einen unbeholfenen Kuss. Mr. Gayheart nahm Lucys Reisetasche und brachte sie an den richtigen Waggon. Er ging zu ihrem Platz, verstaute ihre Sachen ordentlich, blieb dann vor ihr stehen und schenkte ihr ein anerkennendes, dankbares Lächeln. Er mochte hübsche Mädchen, sogar aus seiner eigenen Familie. Er legte ihr den Arm um die Schultern, und als er ihr einen Kuss gab, flüsterte er ihr ins Ohr: «Was für ein hübsches Mädchen du bist, meine Lucy!» Dann ging er langsam durch den Wagen und stieg aus, gerade als der Schaffner die Stufen einklappte. Pauline war schon ganz in Sorge und überzeugt, dass er bis zur nächsten Station mitfahren müsse.
In Lucys Waggon waren mehrere Studenten, die nach Lincoln an die Universität zurückkehrten. Sie kamen sofort an ihren Platz und fingen an, sich mit ihr zu unterhalten. Als Harry Gordon den Waggon betrat und den Gang entlangkam, wollten sie sich zurückziehen, aber er schüttelte den Kopf.
«Ich geh’ jetzt in den Speisewagen. Komm’ später wieder!»
Lucy zuckte mit den Schultern, während er weiterging. Das sah ihm ähnlich! Natürlich wusste er, dass sie und alle anderen Studenten vor ihrem Aufbruch zu Hause noch ein frühes Abendessen zu sich genommen hatten; trotzdem hätte er sie und die Jungs ja fragen können, ob sie mit ihm in den Speisewagen gehen würden, um einen Nachtisch oder ein Welsh Rabbit2 zu essen. Wieder mal ein Beispiel für die instinktive Knauserigkeit der Gordons, durch die sie so reich geworden waren! Harry konnte gelegentlich wunderbar verschwenderisch sein, doch dann machte er immer gleich eine große Sache daraus; es war das Ergebnis sorgfältiger Überlegung.
Lucy widmete ihre ganze Aufmerksamkeit nun den jungen Männern, die sich darüber sehr freuten. Sie waren alle etwa in ihrem Alter, während Harry acht Jahre älter war. Am anderen Ende des Waggons hielt Fairy Blair Hof, aber selbst diese Entfernung konnte ihr gelegentliches krampfhaftes Lachen nicht dämpfen – es war ein eigentümliches Lachen, wie ein Blöken, und es wirkte wie eine unanständige Gebärde. Während dieser Heiterkeitsausbrüche schauten die Studenten an Lucys Seite entnervt drein und rückten noch näher an sie heran, als wollten sie ihre Gefolgschaft bekunden. Sie bedauerte, dass sie fortgingen, als Harry zurückkehrte. Sie empfing ihn ziemlich kühl, aber das merkte er gar nicht. Er begann sogleich von den neuen Straßenlaternen zu sprechen, die Haverford bekommen sollte; sein Vater und er trugen die Hälfte der Kosten dafür.
Harry lehnte sich behaglich in den bequemen Sitz zurück, ohne sich jedoch zu fläzen. Er saß da wie ein Gentleman. Er war eine stattliche Erscheinung, ob in Bewegung oder in entspannter Haltung. Er war ungeheuer von sich eingenommen, wenn auch nicht aus Verlegenheit oder Aggressivität. Doch es stellte bei ihm keine persönliche Schwäche dar, sondern geriet eher zu einer Stärke. Solche Selbstbeherrschung war für einen sprunghaften und wankelmütigen Menschen wie Lucy sehr beruhigend.
Heute Abend war es aber nun einmal so, dass Lucy lieber allein gewesen wäre; doch sonst war sie meistens froh, wenn sie Harry irgendwo traf, ihm in der Post begegnete oder ihn die Straße entlangkommen sah. Wenn sie auch nur ein paar Worte mit ihm wechselte, wirkten seine Lebhaftigkeit und unerschütterliche Daseinsfreude auf sie ansteckend. Worüber auch immer sie redeten, es war stets unterhaltsam. Sie fühlte sich ihm gegenüber völlig ungezwungen, fand einfach alles an ihm angenehm: seine Stimme, seine ausdrucksvollen blauen Augen, die frische Haut und das strohblonde Haar. Die Leute sagten, er sei ein harter Geschäftsmann und nutze Schuldner in Notlage erbarmungslos aus; aber weder seine Erscheinung noch sein Benehmen deuteten auf solche Eigenschaften hin.
Während er mit ihr vertraulich über die neuen Straßenlaternen plauderte, fiel Harry auf, dass Lucys Hände ruhelos hin und her fuhren und sie im Sitz herumrutschte. «Was ist los, Lucy? Du wirkst kribbelig.»
Sie setzte sich auf und lächelte. «Zu albern, Reisen macht mich immer nervös! Aber ich bin es auch nicht sehr gewöhnt, weißt du.»
«Du hast es eilig zurückzukommen. Das sieht man», sagte er und nickte verständnisvoll. «Wie wär’s mit der Oper im Frühling? Was hältst du davon, wenn ich für eine Woche käme, und wir gingen jeden Abend hin?»
«Ach, das wird großartig! Aber vielleicht nicht jeden Abend. Ich gebe jetzt nämlich Unterricht. Ich habe viel mehr zu tun als letztes Jahr.»
«Das werden wir schon hinkriegen. Ich werde Auerbach mal besuchen. Bin großartig mit ihm ausgekommen. Ich hab’ ihm erzählt, dass ich dich von klein auf kenne.» Harry lachte in sich hinein und lehnte sich etwas vor. «Weißt du, wo ich dich das allererste Mal gesehen hab’, Lucy? Es war auf der alten Rollschuhbahn. Ich schätze, Haverford war die letzte Stadt auf der Erde, die eine Rollschuhbahn besaß.»
«Aber das ist ja Ewigkeiten her! Die alte Rollschuhbahn wurde abgerissen, bevor eure Bank gebaut wurde.»
«Stimmt. Vater und ich wohnten im Hotel. Wir waren hergekommen, um uns in der Stadt umzusehen. Eines Nachmittags lief ich an der Rollschuhbahn vorbei und hörte Klavierspiel, also ging ich rein. Ein alter Mann spielte einen Walzer, ‹Herzen und Blumen› hieß er, glaube ich. Es waren ziemlich viele Leute da, aber du bist mir gleich aufgefallen. Du musst etwa dreizehn gewesen sein, und die Haare trugst du offen. Du hattest einen kurzen Rock und einen hautengen roten Pullover an, und du bist nur so dahingeschossen. Für mich hattest du die schönsten Augen der Welt. Das denke ich übrigens immer noch», sagte er und runzelte die Stirn, als mache er ein ernstes Geständnis.
Lucy lachte. Harry war vorsichtig, sogar wenn er Komplimente machte. «Ach, danke, Harry! Ich hatte immer so viel Spaß auf der alten Rollschuhbahn! Ich habe sie schrecklich vermisst, nachdem sie abgerissen worden war. Pauline ließ mich damals noch nicht zum Tanzen gehen. Aber ich kann mich erst richtig an dich erinnern, als du angefangen hast, für Haverford zu werfen. Alle haben dich für deinen Effet bewundert! Weshalb spielst du eigentlich nicht mehr Baseball?»
«Zu faul, schätze ich.» Er zuckte mit seinen runden Schultern. «Allerdings hab’ ich gern gespielt. Aber jetzt noch mal zur Oper! Hältst du dir die ersten beiden Aprilwochen frei? Ich weiß im Augenblick noch nicht mit Sicherheit, wann ich wegkann.»
Der junge Gordon beobachtete Lucy, während sie sich unterhielten, und er fand, dass er so gut wie fest entschlossen sei. Er überstürzte nichts, und er hatte auch keine Eile. Zwar gefiel ihm die Idee nicht, die Tochter des Uhrmachers zu heiraten, da ihm so viele glänzende Möglichkeiten offenstanden. Aber er hatte sich schon wer weiß wie oft gesagt, dass er den Uhrmacher einfach in Kauf nehmen müsse. Während der zwei Winter, die Lucy in Chicago gewesen war, hatte er in den Städten, in die seines Vaters Geschäfte ihn führten, mit sehr vielen Mädchen angebandelt. Aber es war einfach keine wie sie – jedenfalls nicht für ihn.
Am darauffolgenden Tag musste er sich einer ziemlich heiklen Angelegenheit stellen. Harriet Arkwright, von den in St. Joseph ansässigen Arkwrights, war bei einer Freundin in Omaha zu Besuch, und sie hatte ihn angerufen und gesagt, er solle doch kommen und sie zum Tanzen ausführen. Er hatte die Dinge mit Miss Arkwright ziemlich weit kommen lassen. Ihre Gunst war für einen jungen Mann aus der Kleinstadt sehr schmeichelhaft. In St. Joseph war sie eine Persönlichkeit. Ihr Vater war Präsident der ältesten Bank, und sie verfügte über ein ansehnliches eigenes Vermögen, von ihrer Mutters Seite her. Dass sie mit ihren sechsundzwanzig Jahren noch nicht verheiratet war, lag nicht an einem Mangel an Bewerbern. Sie hatte keine Eile, sich zu binden. Sie verwaltete ihren Besitz mit großem Erfolg, reiste viel und schätzte ihre Unabhängigkeit. Harry hielt sie für eine Dame von Welt, stilvoll, stets ausgeglichen und ausgestattet mit jener Autorität, die Geld und gesellschaftlicher Rang verleihen. Aber sie war unscheinbar, verdammt noch mal! Sie glich den Männern ihrer Familie. Und sie hatte eine harte, nüchterne Stimme, die sich nie für irgendetwas erwärmte; ein bisschen näselnd. Worüber sie auch sprach, sie beraubte es seiner Anmut. Wenn sie ihm für seine herrlichen Rosen dankte, entblätterte ihr Tonfall die Blüten.
Harry spielte gern mit dem Gedanken, wie solch eine Heirat seine Zukunft beeinflussen würde, doch nie hatte er sich einzureden versucht, dass er in Harriet verliebt sei. Es war schon merkwürdig: Das einzige Mädchen, das ihn heftig entflammte, war gerade diese Lucy hier, die in derselben Stadt lebte wie er, arm wie eine Kirchenmaus war, ihm nie schmeichelte und ihn oft auslachte. Das Leben war ein anderes, wenn er mit ihr zusammen war, nur darum ging es.
Und sie wurde jetzt erwachsen, stellte er fest. Während der gesamten Weihnachtsferien hatte er eine gewisse Veränderung an ihr bemerkt. Sie war vielleicht etwas zurückhaltender. Beim Ball am Silvesterabend kam es ihm vor, als hielte sie sich ein ganz klein wenig abseits von ihm – und auch von allen anderen. Sie war nicht abweisend, sie hatte nie zauberhafter ausgesehen, und nie war sie mit ihren alten Freunden so liebevoll neckisch umgegangen. Aber sie war anders als früher. Den ganzen Abend über lag ein besonderer Glanz in ihren Augen, und sie verriet ihm nicht den Grund dafür. Sobald sie gerade mit niemandem sprach, kam dieser Ausdruck zurück. Und bei jedem Walzer schien sie über seine Schulter hinweg etwas zu betrachten – sehr schmeichelhaft! Dabei war es doch nur derselbe alte Haufen, der dort polternd über das Parkett im Freimaurersaal tanzte. Diesen Silvesterball würde er nicht so bald vergessen. Er hatte ihm die Augen geöffnet. Lucy war nicht länger ein argloses, glückliches kleines Landkind; sie machte sich. Er sollte sich besser bald entscheiden. Selbst heute Abend, hier im Zug, wo sie ihm anscheinend ihre ganze Aufmerksamkeit schenkte, tat sie es in Wirklichkeit doch nicht.
Der Schaffner kam, um Gordons Koffer zu holen, und sagte, sie führen in Omaha ein. Lucy ging mit Harry bis zum Ausstieg, und während des Halts sprachen sie leise miteinander. Er hatte ihre Hand ergriffen und sah sie aus seinen blauen Augen mit einer Freundlichkeit an, die so offen und ohne jede Berechnung erschien, bis der Schaffner «Alles einsteigen!» rief. Harry küsste sie auf die Wange und trat auf den Bahnsteig hinunter. Lucy winkte ihm durchs Fenster aus nach, während der Zug abfuhr.
Gordon stieg in eine Pferdedroschke und brach zu seinem Hotel auf. Er hielt das Kinn im Schal vergraben und lächelte ins Licht der Straßenlaternen, an denen die Droschke vorbeiratterte. Ja, sagte er sich, er musste Miss Arkwright gegenüber noch ein wenig länger diplomatisch vorgehen. Ihre Aktien fielen. Er wollte sich den unerhörten Luxus leisten und nach Schönheit heiraten. Er wollte eine Frau haben, um die ihn andere Männer beneideten.
Lucy kleidete sich rasch aus, legte sich in ihre Schlafkoje und schaltete die Lampe aus. Endlich war sie allein, lag still im Dunkeln und konnte sich ganz dem Rütteln des Zugs ergeben, einem Rhythmus, der so viel zu tun hatte mit Flucht, Wechsel, Möglichkeiten, mit vorwärtseilendem Leben. Dieses Gefühl von Befreiung und Hingabe durchflutete ihren ganzen Körper; es war, als aale sie sich darin wie in einem warmen Bad. Morgen Abend um diese Zeit würde sie auf dem Heimweg von Clement Sebastians Konzertabend sein. In nur wenigen Stunden konnte man eine so unermessliche Distanz zurücklegen: von der winterlichen Provinz und vertrauten Nachbarn zur Großstadt hin, wo die Luft vor ungeahnten Möglichkeiten wie eine Stimmgabel erzitterte.
Lucy trug in Gedanken eine ganz spezielle Karte von Chicago mit sich herum: ein verschwommenes Bild aus Rauch und Wind und Lärm, dazwischen blitzte blaues Gewässer auf, und gewisse klare Konturen hoben sich aus dem Durcheinander; ein hohes Gebäude an der Michigan Avenue, in dem Sebastian sein Studio hatte – der Teil des Parks, in dem er nachmittags manchmal spazieren ging – das Tor zur Kathedrale, durch das sie ihn eines Morgens hatte kommen sehen – den Konzertsaal, in dem sie ihn zum ersten Mal hatte singen hören. Diese Stadt ihrer Gefühle erwuchs aus der tatsächlichen Stadt wie eine fest umrissene Anordnung, in sich wunderschön, weil alles andere ausgeblendet war. Die Stufen, die vom Kunstmuseum herab führten, waren für sie immerzu von orangerotem Sonnenlicht überflutet – so hatten sie an einem stürmischen Novembernachmittag dagelegen, als Sebastian um fünf Uhr aus dem Gebäude gekommen und neben einem der Bronzelöwen stehen geblieben war, um den Kragen seines Mantels hochzuschlagen, sich eine Zigarette anzuzünden und unbestimmt nach rechts und links die Chaussee entlangzublicken, bevor er eine Droschke heranrief und wegfuhr.
Wenn sie im Zuge ihrer täglichen Beschäftigungen in Chicago von einem Ort zum nächsten eilte, kam Lucy oft an Orte, die plötzlich ihr Herz höherschlagen ließen und sie mit Glück erfüllten, noch ehe sie wusste, warum. Heute Nacht, als sie so in ihrem Schlafwagenabteil lag, dachte sie, wie glücklich sie war, dorthin zurückzukehren – und es selbst dann wäre, falls Sebastian nicht mehr dort sein würde. Es würde dennoch eine Rückkehr «in die Stadt» sein, an den Ort, an dem sie so viele Erinnerungen und Empfindungen angesammelt hatte, wo jederzeit ein Fenster, ein Türeingang oder eine Straßenecke, aufgeladen mit magischer Bedeutung, aus dem Nebel auftauchen konnte.
4
Am nächsten Morgen war Lucy in Chicago, in ihrem eigenen Zimmer, packte aus und räumte ihre Sachen ein. Sie wohnte etwas seltsam, denn sie hatte ein Zimmer zwei Stockwerke über einer Bäckerei, in einer der vielen schmutzigen Seitenstraßen, die vom Fluss abzweigen.
Als sie damals nach Chicago gekommen war, hatte sie zunächst in einem Studentenheim gewohnt, doch die alles durchdringende Zwanglosigkeit des Ortes hatte ihr nicht gefallen, und ebenso wenig die tief gesunkene Dame aus den Südstaaten, die ihn führte. Sie erklärte ihrem Lehrer, Professor Auerbach, dass sie niemals mit ihren Studien vorankomme, wenn sie nicht irgendwo allein mit ihrem Klavier wohnen könne, ohne fröhlichen Lärm auf dem Flur oder freundliches Klopfen an ihrer Zimmertür. Auerbach nahm sie mit zu sich nach Hause, und sie berieten sich mit seiner Frau. Mrs. Auerbach wusste genau, was zu tun sei. Sie ging mit Lucy zu Mrs. Schneff und ihrer Bäckerei.
Die Bäckerei Schneff war eine alte deutsche Institution in jenem Teil der Stadt. Im Erdgeschoß lagen die Bäckerei und ein heimeliges Restaurant, das sich auf deutsche Spezialitäten spezialisiert hatte und von Mrs. Schneff geführt wurde. Im obersten Stock war eine Handschuhfabrik. Die drei Stockwerke dazwischen wurden von den Schneffs an Leute verpachtet, die keine langfristigen Mietverträge abschließen wollten, an Handlungsreisende, kleine Angestellte und Eisenbahner, die in der Nähe des Bahnhofs unterkommen mussten. Das Essen in der Bäckerei unten war recht gut, und man hatte weder Tischgesellschaft noch Witze während des Essens zu befürchten. Jeder hatte seine eigene kleine Tafel, kümmerte sich um seinen eigenen Kram und las seine Zeitung. Lucy hatte sich sofort ein Zimmer genommen, und zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie frei wie ein junger Mann kommen und gehen, ohne dass jemand sie bemutterte oder überwachte. Natürlich gab es auch Unannehmlichkeiten. Die Mieter kamen und gingen durch das offene Treppenhaus, das unmittelbar von der Straße neben der Restauranttür nach oben führte; durch die Gänge blies der Winterwind, und es hätten sich auch leicht Einbrecher einschleichen können, nur war das bis jetzt noch nicht passiert. Es gab keine Stube, in der Lucy Besucher hätte empfangen können. Wenn sie mit einem von Auerbachs Studenten ausgehen wollte, musste der junge Mann draußen auf der Treppe auf sie warten oder sie unten im Restaurant treffen.