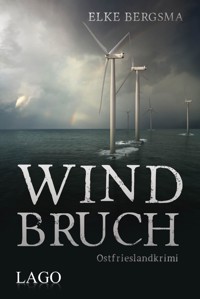Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In der ostfriesischen Stadt Emden wird der junge Musiklehrer Raffael Winter ermordet. Hauptkommissar David Büttner und sein Kollege Sebastian Hasenkrug glauben zunächst an einen relativ einfach gestrickten Fall, stoßen jedoch im Laufe der Ermittlungen im Umfeld des Toten auf ein Geflecht aus Liebe, Sex, Eifersucht und Hass. Der Kreis der Verdächtigen wächst zunehmend, jeder scheint sich gegen jeden verschworen zu haben. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die gottesfürchtige Abiturientin Magdalena, die mit Raffael erstmals die Geheimnisse der körperlichen Liebe entdeckte, dann aber erfahren musste, dass er neben ihr noch zahlreiche andere Affären hatte – Frauen wie auch Männer. Doch nicht nur diese hatten ein Motiv, Raffael zu töten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Bergsma
Lustakkorde
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2014
© 2014 by LAGO, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung nach einer Idee der Autorin
Umschlagabbildung: Fotolia
Satz: Georg Stadler, München
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-006-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-007-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
Für meine Geschwister
Jan-Gerhard, Maike, Maria und Hendrik
1
Behutsam fuhr sie mit ihren Fingern über den nackten Körper. Es war wie ein Zwang. Schon seit Stunden rief sie sich immer wieder zur Ordnung, befahl sich, ihn aus ihren Gedanken zu verbannen, ihn einfach zu ignorieren. Aber so sehr sie es auch versuchte, es gelang ihr nicht. Ganz im Gegenteil schien ihr Verlangen, diesen Körper zu berühren, mit jedem Moment intensiver zu werden. Aber was war das für ein Verlangen? Diese kleine Skulptur rief Gefühle in ihr wach, die sie bisher nicht gekannt hatte. Schwer atmend zog sie ihre Hand zurück. Was nur passierte mit ihr, wenn sie über den kühlen, weißen Marmor strich? Was war es, das ihr Blut in Wallung versetzte, wenn sie mit zittrigen Fingern die Kurven des schlanken, geschmeidigen Körpers entlangfuhr, sich langsam von der sanften Einbuchtung des Schulterblattes bis hinunter zu den wohlgeformten Rundungen des Gesäßes vortastete, bis ihre Hände schließlich eine Zone der Weiblichkeit erreichten, die, so hatte man ihr immer wieder eindringlich gesagt, in höchstem Maße unkeusch und damit für Berührungen jeglicher Art eine unbedingte Tabuzone war? Aber, so dachte sie bei sich, konnte so etwas überirdisch Schönes, wie es hier auf ihrem Schreibtisch vor ihr stand, wirklich etwas Verbotenes sein? Die kleine, glänzende Skulptur schien ihr Ausdruck einer schöpferischen Kraft zu sein, die erhaben war über alles Irdische. Und dennoch war sie von Menschenhand erschaffen worden.
Mit vor Aufregung zitternden Händen hatte sie am Nachmittag das Internet durchforstet auf der Suche nach dem Ursprung dieses göttlichen Geschöpfes. Und schließlich hatte es einen Namen bekommen: Danaide. Erschaffen von Auguste Rodin, einem französischen Künstler des 19. Jahrhunderts. Und je mehr sie sich in die Welt und das Leben des Auguste Rodin eingelesen hatte, desto mehr war ihr bewusst geworden, dass es sich bei ihm wahrlich um keinen Heiligen, sondern vielmehr um einen – wie ihr Vater sagen würde – verruchten Sünder gehandelt hatte, der den menschlichen Körper in seiner ganzen sündigen Nacktheit zur Schau stellte und damit – nichts anderes war vorstellbar – die jungen, unschuldigen Mädchen, die ihm damals Modell standen, der ewigen Verdammnis preisgegeben hatte.
Ihr war nur allzu deutlich bewusst, dass es sich für sie – mit diesem Wissen ausgestattet – geziemt hätte, die Skulptur sofort im nächsten Container zu entsorgen, wollte sie nicht Gefahr laufen, ein weiteres Opfer dieses in höchstem Maße unkeuschen Bildhauers zu werden. Aber irgendetwas in ihr sperrte sich. Still flehte sie zu Gott, er möge ihr die Kraft geben, von dieser kleinen Skulptur zu lassen. Aber so inbrünstig ihr Flehen auch war, führte doch irgendeine dunkle Macht ihre in Demut gefalteten Hände in suchender Bewegung immer wieder zur schönen Danaide zurück und zwang sie, über die sich ihr entgegenstreckende kühle Weiblichkeit zu streichen.
Gerade wollte sie die Skulptur ein weiteres Mal liebkosen, als sie erschrocken innehielt. »Magdalena«, hörte sie ihren Vater unten am Treppenabsatz rufen, »kommst du bitte nach unten, deine Mutter hat das Abendessen gerichtet!« Mit einem tiefen Seufzer ließ das junge Mädchen die Danaide zurück in ihre Tasche gleiten, der sie sie am frühen Nachmittag verstohlen entnommen hatte. »Bis später«, flüsterte sie ihr zu und erschauderte bei dem Gedanken, was passieren würde, wenn ihr Vater die Skulptur bei ihr entdeckte.
»Wie war deine Musikstunde, hast du Fortschritte gemacht?«, fragte ihr Vater, während er sich einen Nachschlag grüner Bohnen nahm. Magdalena nickte stumm. Es war ihr unmöglich, auch nur ein Wort hervorzubringen. Mechanisch kaute sie auf einem Stück Rindfleisch herum, das ihr heute besonders zäh vorkam.
»Du hast so gerötete Wangen, Kind«, sagte ihre Mutter und schaute sie besorgt an, »du bist doch nicht etwa krank?«
Magdalena schüttelte den Kopf. »A-aber nein«, stammelte sie und fühlte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss, »ich … die Hausaufgaben waren ein wenig anstrengend. Sonst ist nichts. Gar nichts.«
Ihr Vater nickte anerkennend. »Du weißt ja, wie stolz ich darauf bin, eine so rechtschaffene Tochter zu haben, Magdalena«, sagte er und tätschelte ihr den Arm. »Du wirst es einmal weit bringen, da bin ich mir ganz sicher. Erst neulich habe ich zu Pastor Eckstein gesagt, wie gut dir das Theologiestudium zu Gesicht stehen wird, und er hat mir aus vollem Herzen zugestimmt. Weißt du, Magdalena, es gibt heutzutage nicht mehr viele Menschen, die ihr Leben in wahrer Gottesfurcht verbringen. Vielmehr herrschen da draußen das Laster und die Sünde.«
»War dein Klavierlehrer zufrieden mit dir?«, griff ihre Mutter das Thema Musikunterricht wieder auf.
»Ja. Ja, ganz bestimmt«, beeilte sich Magdalena zu sagen, »wir haben heute mit einem neuen Stück angefangen. Von Johann Sebastian Bach. Es ist … sehr schön.«
»Wahrlich, ich muss schon sagen«, ließ sich ihr Vater, der soeben dabei war, eine Flasche Rotwein zu entkorken, vernehmen, »dein Musiklehrer … wie heißt er noch gleich?«
»Raffael Winter«, half ihm seine Frau kopfschüttelnd auf die Sprünge. »Dass du dir aber auch nie seinen Namen merken kannst!«
»Raffael Winter. Ja, tatsächlich«, erwiderte ihr Mann, »das ist eigentlich ein Name, den man sich gut merken kann. Raffael. Wie der Erzengel. Da haben wir eine gute Wahl getroffen.« Er nippte genüsslich an seinem Wein, dann fügte er hinzu: »Pastor Eckstein hat ihn mir wärmstens ans Herz gelegt. Winter sei ein gebildeter und gottesfürchtiger Mann, hat er gesagt. Hm. Johann Sebastian Bach. Ja, das ist Musik zur Ehre unseres Herrn. Sehr schön, Magdalena, sehr schön.« Erneut tätschelte er den Arm seiner Tochter.
»Ich müsste dann mal mit den Hausaufgaben weitermachen«, sagte Magdalena, nachdem sie sich gezwungen hatte, ihren Teller leer zu essen. »Darf ich bitte aufstehen?« Das Gerede ihrer Eltern über den Musikunterricht konnte sie an diesem Abend kaum ertragen. Sie liebte es, Klavier zu spielen. Aber heute … Sie war noch nicht lange als Schülerin bei Raffael Winter, seit nunmehr sechs Wochen. Zuvor hatte sie Unterricht bei einer älteren Dame gehabt, die dann aber schwer erkrankt war. Der junge Herr Winter hatte ihr gleich gefallen. Er sah gut aus und hatte eine offene und frische Art, ein wenig wie die Jungen in ihrer Schule, wenn die ihr auch manchmal ein wenig zu forsch waren. Aber bei ihm machte ihr der Unterricht noch deutlich mehr Spaß als zuvor bei der älteren Dame, die ziemlich streng und verknöchert gewesen war. Selbst ihre Fehler nahm Raffael Winter nur mit einem Lachen zur Kenntnis und ermunterte sie mit dem einen oder anderen Hinweis, es einfach noch einmal zu probieren. Ja, mit ihm machte das Klavierspiel Spaß. Umso schlimmer war, dachte sie bei sich, was sie sich heute geleistet hatte. Danaide. Sie hatte sie bei ihm auf dem Kaminsims entdeckt, als er für ein kurzes Telefonat aus dem Zimmer gegangen war und sie sich interessiert in dem großen, ansprechend eingerichteten Raum umgesehen hatte. Wie ein Stromstoß war es ihr beim Anblick der weißen Marmorskulptur durch den Körper gefahren. Wie elektrisiert war sie von ihrer Klavierbank aufgestanden und hatte sich ihr genähert. Ganz vorsichtig hatte sie ihre Hand ausgestreckt, um sie zu berühren. Sie hatte sie nur einmal kurz anfassen wollen, ganz bestimmt. Aber dann … noch ehe sie wusste, wie ihr geschah, hatte sie sie an sich genommen und in ihrer Tasche verschwinden lassen. Sie schämte sich. Aber bereits am morgigen Mittag, gleich nach der Schule, würde sie ihre nächste Klavierstunde haben. Und dann würde sie die Danaide einfach wieder an ihren Platz zurückstellen. Bestimmt hatte er gar nicht bemerkt, dass sie sie genommen hatte. Und wenn doch? Magdalena schluckte schwer. Nun, dann würde sie ihm eine Erklärung geben müssen. Und sie würde sich entschuldigen. Aber nein, beruhigte sie sich im nächsten Moment selbst. Das Musikzimmer war so mit allerlei Krempel voll gestellt, dass er es unmöglich bemerkt haben konnte. Ganz sicher würde sie einen Augenblick alleine im Zimmer sein. Nein, er würde nie erfahren, dass sie eine Diebin war.
»Ja, natürlich kannst du nach oben gehen und deine Hausaufgaben machen«, hörte sie in ihre Gedanken hinein die Stimme ihres Vaters.
»B-bitte?«, stammelte sie verwirrt.
»Ach, Magdalena, wo du nur wieder mit deinen Gedanken bist«, tadelte er sie mit erhobenem Zeigefinger. Aber auf seinem Gesicht zeigte sich auch ein Schmunzeln, und so wusste Magdalena, dass dieser Tadel nicht so ernst gemeint war. Nur gut, dass er nicht wusste, womit sie sich am Nachmittag tatsächlich beschäftigt hatte, dachte sie. Nicht auszudenken, wie er reagiert hätte, wenn er wüsste, dass sie die Skulptur einer nackten Frau vom Kaminsims ihres Musiklehrers gestohlen hatte und oben in ihrem Zimmer immer wieder liebkoste.
»Ich werde mir dann mal die Tagesschau ansehen«, sagte ihr Vater, betupfte sich den Mund mit einer Serviette und erhob sich dann schwerfällig vom Stuhl. Mit seinem Übergewicht fiel ihm jede Bewegung schwer. Schon oft hatte er versucht, wenigstens ein paar Kilogramm abzunehmen. Aber das Essen seiner Frau schmeckte ihm einfach zu gut, als dass er die Diäten hätte konsequent durchhalten können. »Geh du nur nach oben«, wandte er sich erneut an seine Tochter, »ich denke, dass deine Mutter den Abwasch auch alleine schafft.«
»Natürlich«, nickte Magdalenas Mutter ihrer Tochter aufmunternd zu, »wenn du so viel für die Schule zu tun hast und so fleißig bist, da will ich dich nicht von der Arbeit abhalten. Ich komme dann später noch zum Gutenachtsagen.«
Magdalena beeilte sich, nach oben in ihr Zimmer zu kommen. Jeder anderen jungen Frau in ihrem Alter wäre es sicherlich aufgefallen, dass sie sich von ihren Eltern nach wie vor behandeln ließ wie ein kleines Mädchen, obwohl sie seit einem halben Jahr volljährig war. Aber Magdalena machte sich darüber keine Gedanken. Was sicherlich auch daran lag, dass sie keine wirklichen Freunde hatte, mit denen sie sich hätte austauschen können. Mit ihren Klassenkameraden traf sie sich nur, wenn es galt, eine Hausaufgabe als Gruppenarbeit zu erledigen. Aber noch nie war sie von ihnen freiwillig aufgefordert worden, sich ihnen anzuschließen. Vielmehr losten ihre Lehrer die Gruppen aus, und so stieß sie immer nur auf zufällige Weise zu einer Arbeitsgruppe. Magdalena störte sich nicht an den genervten Blicken ihrer Mitschüler, wenn ihre Lehrer ihren Namen deren Gruppe zuordneten. Das kannte sie nicht anders. Schon in der Grundschule war sie immer die Außenseiterin gewesen. Damals hatte es sie noch traurig gemacht, immer alleine zu sein und in ihrer stillen und besonnenen Art von niemandem wirklich gemocht zu werden. Aber irgendwann waren die ständigen Hänseleien ihrer Mitschüler an ihr abgeprallt. Denn sie hatte begriffen, dass der einzige Freund, den man auf dieser Welt brauchte, der Herr Jesus war. Und so hatte sie sich, genau wie ihr Vater, ganz dem Glauben hingegeben und war, statt mit anderen jungen Menschen in die Disco, lieber mit ihm in den Bibelkreis gegangen. So hatte sie gelernt, in Demut und in Ehrfurcht vor Gott durchs Leben zu gehen. Ihm zu Ehren würde sie, wie ihr Vater es für sie vorgesehen hatte, Ende des Jahres, gleich nach dem Abitur, ein Theologiestudium aufnehmen. Ja, ihre Vorsehung war es, die Frohe Botschaft des Herrn in der Welt zu verbreiten. Und darauf freute sie sich.
Als Magdalena ihr Zimmer betrat, war sie fest entschlossen, sich nun tatsächlich ihren Hausaufgaben zu widmen. Es gab viel zu tun. Das Lernen fiel ihr nicht besonders leicht. Aber das, was andere an Intelligenz mitbrachten, hatte sie durch ihren Fleiß wieder wettgemacht. Dadurch hatte sie schon immer zu den besten Schülern ihrer Klasse gezählt, was sie bei den Kameraden nicht eben beliebter machte.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Für ihre Geografiehausaufgabe sollte sie im Internet recherchieren, was … ja was auch noch? Mit gerunzelter Stirn griff Magdalena in ihre Tasche, um ihr Hausaufgabenheft herauszuholen, das sie nach wie vor gewissenhaft führte – und erstarrte. Denn anstelle ihres Heftes spürte sie etwas Kaltes, Hartes. Danaide! Eine seltsame Erregung erfasste sie, als sie die kühle Härte des Marmors erspürte. Das geht nicht, rief sie sich selbst zur Ordnung, das darfst du nicht! Aber es war zu spät. Nur wenig später ließ sie ihre Hände wieder den Rücken der Skulptur hinunterwandern, bis hin zu der Stelle, vor der ihr Vater sie doch so eindringlich gewarnt hatte, da hier jede Berührung Sünde sei.
2
Katharina Eckstein sah ihren Sohn über den Rand ihres Whiskeyglases hinweg mit gerunzelter Stirn an. Er sah übernächtigt aus, hatte tiefe, dunkle Ringe unter den Augen. Seine Haut hatte eine ungesunde Blässe, aus der vereinzelt kleine rote Pusteln wie winzige Feuerbälle hervorstachen. Nervös kaute er auf seiner Unterlippe herum. Es schien ihm mit jedem Tag schlechter zu gehen. Sie seufzte. Niemals würde sie sich an den Gedanken gewöhnen, dass er Pastor geworden war. Damals, als er verkündet hatte, unbedingt Theologie studieren zu wollen, hatte sie das für einen guten Witz gehalten und laut aufgelacht. Doch war ihr das Lachen schnell im Halse stecken geblieben. Denn sein missbilligender Gesichtsausdruck hatte ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass er für diesen Heiterkeitsausbruch keinerlei Verständnis hatte. »Mama«, hatte er fast drohend gesagt, »ich werde mein Leben der Theologie widmen, ob du es nun für gut befindest oder nicht.«
»Für so etwas …«, hatte sie sofort angefangen zu zetern, aber er hatte ihr mit einer harschen Bewegung seiner Hand das Wort abgeschnitten. »Das weiß ich schon«, hatte er genervt gesagt, »ich werde mir mein Studium selber finanzieren. Ich kenne deinen Hass auf jegliche Art von Religion …«
»Auf jegliche Art der christlichen Religion, mein Junge.«
»Ja, der christlichen Religion dann eben. Darum will ich dir auch nicht zumuten, dein mühsam … erwirtschaftetes Geld für meine Ausbildung zum Pastor zu vergeuden.«
Bei seinem beinah gequält herausgequetschten mühsam erwirtschaftetes Geld war sie kurz zusammengezuckt. Er wusste, dass sie in jungen Jahren ihren Körper verkauft hatte, um ihn, Jonathan, und sich über die Runden zu bringen. Nicht, weil sie es unbedingt so gewollt hatte. Nein, vielmehr hatte das Leben ihr keine andere Wahl gelassen. Die Sechzigerjahre waren wilde Zeiten gewesen. Und sie als noch blutjunges Mädchen von 16 Jahren mittendrin. Ja, sie hatte sie genossen, die Freiheit, von der noch wenige Jahre zuvor keiner auch nur ansatzweise zu träumen gewagt hatte. Sie hatte das Leben genossen, die ausgelassenen Partys, die aufgeheizten Demos, die endlosen politischen Diskussionen – den befreienden Gruppensex. Letzterer war nicht ohne Folgen geblieben. Doch auch die Feststellung, dass sie schwanger war, hatte sie noch mit einem fröhlichen Lachen zur Kenntnis genommen. Ein neuer Erdenbürger, umsorgt, behütet und geliebt von der großen Familie, die sich in Hamburg zu einer Kommune zusammengeschlossen hatte – was konnte es Schöneres geben? In den ersten zwei Jahren nach der Geburt des kleinen Jonathan hatte das Leben in der Gemeinschaft auch noch ganz gut funktioniert. Dann aber hatten sich plötzlich ihre Mitbewohner anders orientiert, hatten die Kommune verlassen, sich wieder ihren gelernten Berufen gewidmet, später dann Familien gegründet. Vater, Mutter und zwei Kinder. Sie lebten auf einmal genau das Spießerleben, gegen das sie sich nur wenige Jahre zuvor noch so vehement zur Wehr gesetzt hatten. Und sie, die immer noch blutjunge Katharina? Sie war damals mit Abstand die Jüngste unter den Kommunarden gewesen, ihr um zehn Jahre älterer Cousin hatte sie in diesen Kreis eingeführt. Alle hatten sie herzlich aufgenommen, und sie hatte es damals als Privileg aufgefasst, von den älteren und erfahrenen Männern, die zum Teil ihr vierzigstes Lebensjahr bereits überschritten hatten, in die Geheimnisse der Sexualität eingeführt zu werden. Heute wusste sie natürlich, dass diese Männer dies wohl nicht ganz uneigennützig getan hatten. Heiße Lenden zwischen blutjungen Schenkeln. Die Gelegenheit war günstig gewesen, und diese Männer hatten sie weiß Gott ausgiebig genutzt und genossen; selbst dann noch, als sie schon hochschwanger gewesen war.
Dann aber, praktisch von einem Tag auf den anderen, waren sie gegangen. Und keiner von ihnen hatte sich für Katharina und ihren kleinen Jonathan verantwortlich gefühlt. Es stehe ja schließlich gar nicht fest, wer der Vater ihres kleinen Bastards sei, hatte es geheißen, und daher sehe man sich ihr gegenüber auch zu nichts verpflichtet. Denn: Hatte sie es nicht selbst am allermeisten genossen, dass man sie sexuell begehrte? Hatte sie denn nicht bereitwillig ihre Schenkel geöffnet und mit lustvollem Stöhnen um sexuelle Erfüllung gebettelt? Bestimmt werde sie auch ohne ihre alten Kameraden ihr Leben meistern, schließlich stünden den jungen Leuten doch heutzutage alle Wege offen.
Nun, dies hatte zwar für einen Großteil der jungen Leute auch tatsächlich gegolten. Nicht aber für eine alleinstehende junge Mutter mit Kind, die die Schule abgebrochen und keinerlei Ausbildung vorzuweisen hatte. Nachdem auch ihre Eltern nicht bereit gewesen waren, sie und diesen abscheulichen Bastard wieder bei sich aufzunehmen, war Katharina letztlich nichts anderes geblieben, als das zu machen, was sie konnte: Männern sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Zehn lange Jahre hatte sie es gemacht, bis einer ihrer Freier sie schließlich hatte heiraten wollen. Da sie keine andere Wahl hatte, hatte sie zugestimmt. Sicher, ihr Mann, Dietrich, war ein guter Mann gewesen. Ihr und ihrem Jungen hatte es an nichts gefehlt. Doch hatten sie sich nie geliebt. Sein Interesse hatte ausgefallenen Sexpraktiken gegolten, zu denen sie, wie er am eigenen Leib in ihrer Zeit als Prostituierte mit Entzücken zur Kenntnis genommen hatte, gerne bereit war, solange es dafür eine angemessene Entlohnung gab. Und das war dann auch der Deal gewesen: Sie beschaffte ihm, wann und wie immer er es wollte, sexuelle Befriedigung, im Gegenzug gab er ihr und ihrem Sohn ein gesichertes Dasein. Das hatte bis zu seinem Tod vor fünf Jahren bestens funktioniert. Zwar war sie nach und nach einer Alkoholsucht verfallen, weil sie die von ihm geforderten Praktiken in nüchternem Zustand nur schwer hatte ertragen können. Aber damit konnte sie leben. Und auch ihrem Sohn, so glaubte sie, hatte es nie geschadet. Denn war er nicht eigentlich ein ganz reizender junger Mann geworden? Aber Theologie – nein, das musste doch nun wirklich nicht sein!
Kein Mensch würde ihr glauben, wenn sie der Öffentlichkeit eines Tages erzählen würde, wie viele Priester, Pfarrer und Mönche damals unter ihren Kunden gewesen waren, evangelische wie katholische, verheiratet oder dem Zölibat verpflichtet, kinderreich oder – zumindest offiziell – kinderlos. Bei ihr hatten sie gesucht, was sie zu Hause nicht bekamen. Und sie hatte es ihnen gegeben. Seither wusste sie, dass es wohl kaum eine Berufsgruppe auf dieser Welt gab, die sich so ausgiebig der Heuchelei hingab wie die angeblich so keuschen und gottesfürchtigen Theologen der Christenheit.
Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie die Großstadt verlassen, im ostfriesischen Emden ein kleines Häuschen gekauft und ihre neu gewonnene Freiheit genossen. Hier hatte sie ihre Ruhe, und keiner verlangte von ihr irgendwelche abartigen Dinge. So hätte sie rundherum zufrieden sein können, wenn sie sich nicht ständig über Jonathans Lebenswandel hätte Sorgen machen müssen. Dabei war es ihr geringstes Problem, dass ihr Sohn sich ganz offensichtlich zu Männern hingezogen fühlte. Eigentlich hatte sie damit sogar überhaupt kein Problem. Sollte doch ein jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Allein, er war es nicht. Im Gegenteil schien er sogar ziemlich unglücklich zu sein, weil ihm sein Lover zwar ewige Liebe schwor, ihm deswegen aber noch lange nicht treu war. Jonathan litt ganz furchtbar unter dieser Situation und hatte sogar schon mehrmals damit gedroht, sich etwas anzutun. Und nun saß er erneut hier vor seiner Mutter und weinte bitterliche Tränen.
»Du solltest ein für alle Mal mit diesem Kerl abschließen«, sagte Katharina Eckstein nun zu ihrem Sohn. »Seit du ihn kennst, macht er dich mit jedem Tag unglücklicher. Eine Beziehung aber sollte doch beide Partner bereichern, glücklich machen, Jonathan.«
»Das sagt ja genau die Richtige«, brummte der Pastor, der das verquere Verhältnis seiner Mutter zu Dietrich Eckstein noch gut vor Augen hatte.
»Ja. Eben weil ich in meiner Beziehung nie wirklich glücklich war, weiß ich, wie wichtig das ist. Wie lange willst du denn den Eskapaden deines Freundes noch zusehen? Jeder einzelne seiner Ausrutscher tut dir weh, er aber scheint alleine den Lustgewinn im Auge zu haben. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber deine Gefühle, Jonathan, sind ihm doch völlig egal.«
»Er liebt mich, da bin ich mir ganz sicher.«
»Dann hat er aber eine tolle Art, dir das zu zeigen«, knurrte Katharina und nahm einen großen Schluck von ihrem Whiskey.
»Kannst du nicht mal mit der Sauferei aufhören? Das ist ja widerlich!«, bemerkte Jonathan verärgert und zog die Stirn in Falten.
»Nein«, antwortete seine Mutter knapp und nahm demonstrativ einen weiteren Schluck. »Nicht genug damit, dass er dich betrügt und vor aller Welt zum Affen macht«, fuhr sie unbeeindruckt fort, »nein, du sicherst ihm auch noch sein komfortables Einkommen, in dem du ihm einen Klavierschüler nach dem anderen vermittelst. Das ist doch in höchstem Maße berechnend und niederträchtig von ihm. Ich weiß wirklich nicht, was du dir dabei denkst, mein Junge. Welche Frau hatte er denn diesmal flachgelegt, als du in seinen Unterrichtsraum kamst?«
Jonathan ließ ein verärgertes Grunzen vernehmen. »Drück dich doch bitte nicht so ordinär aus, Mama.«
»Dein Freund Raffael ist ordinär, Jonathan, nicht ich.« Sie seufzte. »Was muss denn noch alles passieren, damit du ihn endlich verlässt?«
»Ich … kann ihn nicht verlassen«, antwortete ihr Sohn gepresst, »ich kann es einfach nicht.«
»Also, wer war es diesmal?« Katharina hatte nicht vor, ihren Sohn zu schonen. Sie würde ihm den Stachel immer weiter ins Fleisch bohren, und zwar so tief und so lange, bis er endlich begriffen hatte, dass ein Leben ohne diesen Raffael Winter für ihn mehr Vor- als Nachteile hatte.
»Sybille.«
»Sybille wer?«
»Sybille Ravensburger.«
»Sybille Ravensburger?«, rief Katharina mit großen Augen. »Die Sybille Ravensburger?« Sie stieß ein heiseres Lachen hervor. »Du lässt es dir gefallen, dass dein Freund es mit dieser … also wirklich, Jonathan, dein Verstand scheint sich wirklich komplett verabschiedet zu haben. Zumindest aus deinem Kopf.«
»Mutter!«
»Mutter!«, äffte Katharina ihren Sohn nach. »Jonathan, diese Sybille ist so ziemlich das unattraktivste Frauenbild, das man sich nur vorstellen kann. Sie hat eine … nein, falsch, sie hat gar keine Figur, strähnige, fettige Haare, einen Überbiss …«
» … und ist zehn Jahre älter als Raffael. Ja, ich weiß das alles, Mama«, unterbrach Jonathan sie gequält.
»Dein Freund ist ein Sexomaniac«, stellte Katharina mit einem mitleidigen Blick auf ihren noch immer schluchzenden Sohn fest. »Er ist krank. Mann, ich hab ja schon vieles erlebt, aber einen, der wirklich alles vögelt, was irgendwo eine Körperöffnung hat … nee, das ist selbst mir noch nicht untergekommen.« Katharina schüttelte verständnislos den Kopf.
»Bestimmt ist das nur eine Phase. Er ist noch jung und muss sich …«
»Papperlapapp!«, fuhr ihm seine Mutter unwirsch in die Parade. »Er ist Ende zwanzig. Gut, das sind rund fünfzehn Jahre weniger, als du auf dem Buckel hast. Aber ich glaube nicht, dass du dich in dem Alter so aufgeführt hast wie der. Oder?«
»Nein«, rief Jonathan empört, »natürlich nicht!«
»Wäre ja auch noch schöner gewesen, schließlich bist du ja ein … Pfaffe.« Das letzte Wort troff vor Verachtung, Katharina hatte es förmlich ausgespuckt. »Und hoffentlich keiner von denen, wie ich sie in allen unheiligen Stellungen dieser Welt erleben durfte.«
»Ach, Mama«, seufzte Jonathan und fuhr sich fahrig durch sein volles Haar, »ich hatte geglaubt, dass du mir vielleicht ein klein wenig zur Seite stehen würdest in meinem Kummer.« Er erhob sich aus seinem Stuhl. Dann wandte er sich, nach einem letzten Blick auf seine Mutter, mit einem Schulterzucken der Haustür zu und ging wortlos hinaus.
»Ich werde dir zur Seite stehen«, sagte Katharina an ihr Whiskeyglas gewandt, »ganz bestimmt werde ich das, mein Junge. Aber ganz bestimmt nicht so, wie du es dir vermutlich vorstellst.«
3
Nun aber schnell. In gespannter Erwartung hatte Magdalena an diesem Tag ihrem Musikunterricht entgegengefiebert. Würde es ihr gelingen, die kleine, etwa dreißig Zentimeter große Skulptur wieder an ihren Platz auf dem Kaminsims zurückzustellen, bevor ihr Klavierlehrer den Verlust bemerkte? Schon den ganzen Vormittag hindurch hatte sie immer wieder in ihre Tasche gegriffen, um zu schauen, ob Danaide noch da war. Zu unwirklich erschien ihr nach wie vor, dass sie sie einfach eingesteckt hatte. Vielmehr aber noch, dass sie in ihr bis zu diesem Zeitpunkt nie gekannte Gefühlsregungen hervorgerufen hatte. Dieses wohlige Kribbeln, diese sinnliche Erregung waren ihr bisher völlig fremd gewesen. Von freudiger Erwartung war sie immer nur befallen worden, wenn sie ihre Bibel zur Hand genommen, wenn sie dem Wort Gottes gelauscht oder, den Kopf an die breite Schulter ihres Vaters gelehnt, versunken der Musik gottesfürchtiger Komponisten gelauscht hatte.
»Danaide«, flüsterte sie ergriffen, während sie mit ihren Fingern über den geschmeidigen Marmor fuhr, »was machst du mit mir?« Sie warf einen Blick auf den Kaminsims. Nichts deutete darauf hin, dass sich irgendetwas verändert hatte. Die Lücke, die die Skulptur hinterlassen hatte, war gar nicht mal so groß. Sie war nur eine unter vielen Dingen, die auf diesem Sims ihren Platz gefunden hatten. Nein, eigentlich war es geradezu unmöglich, den Verlust der Danaide zu bemerken, wenn man nicht ganz bewusst nach ihr Ausschau hielt.
Magdalena hatte Glück. Raffael Winter war noch nicht da gewesen, als sie bei ihm angekommen war. Sie hatte sich extra beeilt, um etwas früher im Unterrichtsraum zu sein. Sie war sich sicher gewesen, dass ihr irgendwer aus dem Mehrfamilienhaus in der Emder Faldernstraße die Eingangstür öffnen würde, wenn sie auf alle Klingelknöpfe drückte. Und so war es auch gewesen. Gleich mehrmals war das Summen des Türöffners erklungen, und sie hatte das Treppenhaus ohne Mühe betreten können. Der Rest war ein Kinderspiel. Denn Raffael Winter hatte ihr verraten, wo er für Notfälle einen Zweitschlüssel für seine Musikräume versteckt hatte. Also hatte sie den Schlüssel aus einer im Treppenhaus stehenden Vase gekramt und die Wohnungstür geöffnet.
»Danaide«, flüsterte sie erneut, als sie sich von der Klavierbank erhob und nach der Skulptur griff, die sie auf dem Instrument abgestellt hatte. Sie zögerte. Nur ein letztes Mal, dachte sie, nur ein allerletztes Mal. Wie auf einen geheimen Befehl hin legte sie die Hand auf das Abbild der auf dem Bauch liegenden jungen Frau, deren wallendes Haar sich über den harten Stein des Sockels ergoss, auf dem sie, die rechte Gesäßseite dem Betrachter entgegengewandt, mit angezogenen, leicht gespreizten Beinen ruhte. Doch gerade als sie, wie so viele Male zuvor, begann, mit geschlossenen Augen ihre Finger vom Kopf der Skulptur, den schlanken Hals hinab bis hin zu den ausladenden Rundungen des Gesäßes wandern zu lassen, spürte sie plötzlich, wie sich eine warme, kräftige Hand auf die ihre legte. Erschrocken fuhr sie zurück, wollte ihre Hand der anderen entwinden, aber je mehr sie zog, desto fester wurde deren Druck.
»Danaide«, flüsterte ihr eine bekannte, etwas heisere Stimme ins Ohr, »gefällt sie dir, Lena?«
Magdalena stand wie erstarrt. Er hatte sie erwischt! Raffael Winter hatte bemerkt, dass die Skulptur fehlte, und indem er ihre Hand festhielt, wollte er es ihr deutlich machen. »Bitte«, flüsterte sie, »bitte, ich …«
»Ja«, hauchte Raffael ihr ins Ohr, »ich weiß. So geht es mir auch. Die schöne Danaide verlangt danach, berührt zu werden. Auf eine ganz besondere Weise berührt zu werden. Von dir, Lena. Und von mir. Von uns gemeinsam.« Der Druck seiner Hand ließ etwas nach, und er schien darauf zu warten, dass Magdalena ihm ihre Hand entzog. Aber so sehr sie es auch wollte, sie konnte es nicht. Wie mit der Skulptur verwachsen ruhte ihre Hand auf deren Rücken, gefangen in der Wärme einer weiteren, einer starken, männlichen Hand. Ein Schaudern durchfuhr ihren Körper, als Raffael ihre Hand mit der seinen umfasste und sie ganz langsam den kühlen Körper der Skulptur hinabfahren ließ. Gleichzeit spürte sie eine weitere Hand die Außenseite ihrer Schenkel hinaufgleiten. Ungewollt stöhnte Magdalena auf, als diese Hand ihre Hüfte und schließlich ihre Taille erreichte. Am Brustansatz machte sie kurz halt, wohl um zu sehen, wie sich die junge Frau, die zum ersten Mal in ihrem Leben in dieser Art berührt wurde, verhalten würde. Aber nichts geschah. Magdalena schien willenlos in dieser Berührung gefangen. Ihr Atem ging schneller. Nein, wollte sie rufen, nein, bitte nicht! Aber ihr Körper gehorchte ihr nicht, sondern streckte sich der starken Hand entgegen. Sie gab ein erregtes Stöhnen von sich, als Raffaels Hand ihre linke Brust umschloss und mit sanften Bewegungen seiner Finger anfing, sie zu kneten. Gleichzeitig erreichte ihre rechte Hand die Scham der Skulptur, die verbotene Zone. Und noch ehe sie sich’s versah, spürte sie den sanften Druck, der zuvor noch auf ihrer Brust gelegen hatte, plötzlich zwischen ihren Schenkeln. Wie im Nebel nahm sie wahr, dass Raffaels Hand Knopf und Reißverschluss ihrer Jeans öffnete, sich in ihren Slip schob und anfing, mit seinem Mittelfinger die empfindlichste Knospe ihres Körpers zu massieren, während sein Mund an ihrem Ohr lustvolle Worte hauchte.
Magdalena glaubte in brennender Erwartung zu vergehen, immer wieder stieß sie kleine Schreie der Lust aus, hörte sein heiseres Lachen, spürte seine fordernden Bewegungen, seinen Unterleib, der sich in drängenden Bewegungen an ihrem Gesäß rieb, während die kreisenden Bewegungen seines Mittelfingers sich wieder und wieder auf der Scham der Danaide wiederholten.Die junge, keusche Magdalena hatte längst aufgehört, sich gegen die ekstatischen Reaktionen ihres Körpers zur Wehr zu setzen. In einer erregten, getriebenen Faszination ersehnte sie den Gipfel der Lust, der sich schließlich in einem befreiten Aufschrei Bahn brach. Und so entging es ihr, dass sich auch Raffaels Lebenssaft im selben Augenblick in seine Hose ergoss.
Wie betäubt ließ sich das junge Mädchen auf die Klavierbank niedersinken. Immer noch schwer atmend zog sie wie in Trance am Reißverschluss ihrer Jeans, dann schloss sie den Knopf. Mit einer fahrigen Bewegung strich sie ein paar widerspenstige dunkle Locken aus der Stirn, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. »Du bist wunderschön, Lena«, sagte in diesem Augenblick Raffael zu ihr, während er aufstand, nach der Danaide griff und sie auf ihren Platz auf den Kaminsims zurückstellte. »Und du bist jederzeit willkommen, unser Duett zu perfektionieren«, fügte er mit einem wissenden Blick auf die völlig verstörte junge Frau hinzu.
»Ich … ich weiß nicht«, stammelte Magdalena und erhob sich. »Es war … ich bin … es tut mir leid … Danaide … ich wollte nicht.« Sie warf einen verwirrten Blick auf die Skulptur.
»Doch, Lena«, sagte Raffael mit einem Lächeln, »du wolltest. Und du hast es bekommen. Ich bringe dich jetzt zur Tür. Und ich verspreche dir, sie nie wieder zu schließen, wenn du hindurchgehen möchtest.« Er legte seinen Arm um Magdalenas Schultern und schob sie zum Eingang. »Ich kann dir helfen, frei zu sein, Lena. Ich kann dir helfen, du selbst zu sein. Ich freue mich auf morgen.«
Magdalena wusste an diesem Abend nicht zu sagen, wie sie nach Hause gekommen war. Dem prüfenden Blick ihrer Mutter entwand sie sich, indem sie ihr nur schnell zurief, sie habe furchtbare Kopfschmerzen und werde sich gleich schlafen legen. Und das tat sie dann auch – nachdem sie ihren Unterleib gründlich gewaschen und dabei erneut den Gipfel der Lust erklommen hatte.
4
Sybille Ravensburger war verwirrt. Und sie war verärgert. In höchstem Maße verärgert. Sie war es durchaus gewohnt, von ihren Mitmenschen schäbig behandelt zu werden. Aber so etwas war ihr ja noch nie passiert! Wütend trat sie zum wiederholten Male gegen ihren Schrank, sodass das Geschirr darin gefährlich schepperte. Aber das scherte sie nicht. Sie war wütend. Wütend auf sich selbst. Aber besonders wütend auf Raffael, ihren Klavierlehrer, dieses Monster. Vor zwei Tagen noch hatte er ihr gesagt, wie wohl er sich mit ihr fühle. Er hatte Empfindungen in ihr geweckt, die sie bis dahin nicht gekannt hatte. Und er hatte ihr versprochen, dass sie es wieder tun würden. Und dann? Sie hatte extra für ihn ihre neuen, sündhaft teuren Dessous angezogen, um so attraktiv wie möglich zu sein. Sie hatte sich für ihn entkleidet, während er nach nebenan gegangen war. Doch als er sie dann so leicht bekleidet gesehen hatte, war nur ein breites, süffisantes Grinsen auf sein Gesicht getreten, und er hatte gesagt: »Komm, zieh dich wieder an, diesen Anblick kann ja kein Mensch ertragen.«
»Bitte, Raffael«, hatte sie gejammert, und Tränen waren ihr in die Augen getreten, »du hast doch gesagt, dass wir wieder miteinander …«
»Ach, Sybille«, hatte der junge Musiklehrer gelacht und ihr in die Wange gekniffen, »du bist doch zu mir gekommen, weil du gerne Klavier spielen möchtest. Nun, und genau das wollte ich jetzt mit dir tun. Und was machst du? Nutzt meine kurze Abwesenheit, ziehst dich bis auf die Unterwäsche aus – was, mit Verlaub gesagt, in deinem Fall wirklich keine gute Idee ist – und schmachtest mir erwartungsvoll entgegen.«
»Aber vorgestern … es war doch so schön«, hatte Sybille mit tränenerstickter Stimme gesagt. »Du hast gesagt, ich gefalle dir. Du hast gesagt, du könntest dir vorstellen, öfter mit mir zusammen zu sein.«
Raffael Winter hatte den Kopf geschüttelt. »Aber du Dummchen, das hatte ich doch aufs Klavierspiel bezogen. Und außerdem hatte ich soeben mein Vergnügen.« Er hatte selbstzufrieden grinsend einen Fingerzeig zur Wohnungstür gemacht. »Hast du sie nicht gehört, die Lustschreie der kleinen Unschuld vom Lande? Ich habe zwischen ihren Beinen Tasten zum Klingen gebracht, dass es die wahre Freude war.«
»Die … du hast …«, hatte Sybille mit einem ungläubigen Blick auf die Tür gestammelt, »dieses kleine Mädchen, das mir gerade entgegenkam … du hast mit ihr geschlafen?«
»Dieses kleine Mädchen, meine liebe Sybille, ist volljährig, auch wenn sie vielleicht nicht so aussieht. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Haare, die elfenbeinfarbene Haut, die großen, dunklen Augen!« Raffael hatte in Erinnerung an das soeben Erlebte ein seliges Lächeln aufgesetzt. »Und sie ist … so herrlich unschuldig. Beim nächsten Mal, ich freu mich schon drauf, da werde ich sie … na ja, du weißt schon, was ich meine.«
Voller Entsetzen hatte Sybille seinen Worten gelauscht. Er hatte es mit Magdalena getrieben? Mit der heiligen Magdalena, wie sie in der Schule nur genannt wurde? Mit ihrer Schülerin Magdalena, die im Unterricht so strebsam war? Deshalb also hatte sie einen so aufgelösten Eindruck gemacht, als sie ihr im Treppenhaus begegnet war. Ja, sie hatte sie nicht einmal gegrüßt, obwohl sie sich doch sonst vor lauter Höflichkeit gar nicht mehr einkriegte, wenn sie ihren Lehrern begegnete. Und diese kleine, biedere, keusche Unschuld vom Lande sollte hier mit Raffael … mit ihrem, Sybilles, Raffael … das war schier unmöglich!
»Du lügst«, hatte sie zu Raffael gesagt, aber der hatte nur laut gelacht und dabei seine so herrlich geraden und weißen Zähne gezeigt.
»Was meinst denn du, warum ich gerade kurz im Nebenraum war und dich nicht an der Tür begrüßt habe, meine liebe Sybille?«, erwiderte er amüsiert. »Wenn du es unbedingt wissen willst, dann zeige ich es dir. Den großen Fleck in meiner Hose, wo sich …«
»Hör auf«, hatte Sybille geschrien und sich die Ohren zugehalten, »hör auf damit!« Dann hatte Raffael ihr lachend ihren Rock und ihre Bluse gereicht, und sie hatte sich beschämt wieder angezogen.
Aber wenn sie gedacht hatte, dass die Demütigungen damit zu Ende waren, dann hatte sie sich getäuscht. Denn kaum, dass sie neben ihm vor dem Klavier gesessen und die ersten Tasten angeschlagen hatte, hatte er seine Hand auf ihr Knie gelegt und sie langsam ihren Schenkel hinaufwandern lassen. »Soll ich dir zeigen, was ich mit der Kleinen gemacht habe?«, hatte er ihr lustvoll keuchend ins Ohr geflüstert. Natürlich hätte sie sofort seine Hand wegschlagen sollen, ja, sie hätte aufstehen müssen und gehen. Aber stattdessen hatte sie bei seiner Berührung das bekannte heiße Brennen wieder eingefangen, das sie schon beim letzten Mal gespürt hatte, und sie hatte es geschehen lassen. Gerade als sie das Gefühl gehabt hatte, in dem von ihm entfachten Feuer zu verbrennen, hatte er ihr ins Ohr geflüstert: »Komm, mache es mir mit dem Mund.« Also hatte sie sich vor ihn gekniet, seine Hose geöffnet und sein pralles Glied in die Hände genommen. Sein Stöhnen hatte sie immer weiter angestachelt, sie hatte ihn mit dem Spiel ihrer Zunge zum Höhepunkt gebracht und seinen Samen mit ihrem Mund aufgenommen. Bereitwillig hatte sie ihm dann ihre gespreizten Schenkel dargeboten, in der Erwartung, jetzt würde er ihr auf die gleiche Art Befriedigung verschaffen. Aber er hatte sie nur ausdruckslos angesehen, hatte seine Hose wieder zugeknöpft, sich in Richtung Klavier gewandt und gesagt: »Komm, Sybille, wir waren mit dem Stück noch nicht ganz durch. Du solltest dich nicht immer ablenken lassen, wenn du lernen willst, Klavier zu spielen.«
Sybille traten bei dieser Erinnerung Tränen der Wut und der Scham in die Augen. Was, wenn er überall herumerzählen würde, wie sehr er sie gedemütigt hatte? Was würde passieren, wenn es jemand in ihrer Schule erfuhr, ihre Kollegen, ihre Schüler? Sie würde nicht nur die Schule, sondern auch die Stadt verlassen müssen. Ja, Raffael Winter war in der Lage, sie zu vernichten. Und selbst wenn sie alles abstritt, dann war da immer noch dieses kleine Flittchen, ihre Schülerin Magdalena Fehnkamp. Magdalena hatte sie gesehen, wie sie den Unterrichtsraum betreten hatte. Und mit Sicherheit würde es ihr ein Vergnügen sein, dies auch überall herumzuerzählen. Ach, sie hörte schon das Getuschel, sah schon die belustigten Blicke, die man ihr in der Schule zuwerfen würde! Und selbst wenn sie es Magdalena mit gleicher Münze heimzahlte, was würde es nützen? Sie war ein junges und bildhübsches Mädchen. Sybille würde alles dafür hergeben, eine solche Figur zu haben. Und diese Haare! Lange, dunkle, glänzende Locken. Ja, die Haare von Magdalena waren ein einziger Traum. Und ein jeder würde Verständnis für Raffael Winter aufbringen, dass er sie begehrenswert fand und ihr den Hof machte. Aber bei ihr, Sybille, würden sie fraglos sofort erkennen, dass sie von dem Musiklehrer zum Narren gehalten worden war. Seht mal an, würden sie sagen, da hat er ihr aber mal gründlich gezeigt, wie unattraktiv sie ist. Mit der würde ich es auch nicht treiben wollen, so fett und nichtssagend, wie die ist. Vermutlich würden sie Magdalena noch auf die Schulter klopfen und sie beglückwünschen, dass nun auch sie es endlich geschafft hatte, ihr Mauerblümchendasein aufzugeben.
»Aber«, hatte Sybille eine plötzliche Eingebung, die ihr ein kehliges Lachen entrang und ihr ein fast dämonisches Grinsen aufs Gesicht zauberte, »die Kleine hat ja auch noch einen Vater.« Und so, wie sie den auf Elternabenden und bei Elternsprechtagen in den letzten Jahren erlebt hatte, würde der sich über die Eskapaden seiner Tochter ganz bestimmt nicht freuen. Er, der sich einbildete, eine Tochter mit angeborenem Heiligenschein in die Welt gesetzt zu haben. Nun, diesem ach so gottesfürchtigen Fatzke würde sie mal anrufen. Mal sehen, was dann passieren würde. Ganz sicher würde die heilige Magdalena ihren Klavierlehrer nie wiedersehen. Ein klarer Punktsieg für sie, Sybille. Aber was würde ihr dieser Sieg nützen, außer der Gewissheit, dass Raffael es nicht mehr mit Magdalena trieb? Schließlich konnte sie selbst sich doch nun auch nicht mehr bei ihm blicken lassen.
Sybilles Blick fiel auf die Sammlung mittelalterlicher Waffen, die an der Wand ihres Wohnzimmers hingen und Erbstücke ihres Vaters waren. Die scharfen Klingen blitzten im Sonnenlicht. Sie schüttelte langsam den Kopf. Nein, es würde nicht reichen, nur die kleine Magdalena auszuschalten. Raffael würde schnell Ersatz finden, und wieder wäre es eine andere Frau, die mit ihm das erleben durfte, was sie, Sybille, sich doch so sehr ersehnte. Also musste eine andere Lösung her. Und ihr war soeben eine Idee gekommen, wie diese aussehen konnte.
5
Magdalena hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Und das lag nicht nur daran, dass sie in Gedanken ständig bei Raffael Winter war. Vielmehr war sie in höchstem Maße irritiert. Soeben hatte sie ihre Deutschklausur zurückbekommen, eine Analyse von Goethes Faust. Eigentlich hatte sie angenommen, dass ihr diese Arbeit sehr gut gelungen war, wie alle anderen Deutschklausuren zuvor auch. Textanalysen fielen ihr gemeinhin leicht, schließlich hatte sie von Kindesbeinen an tagtäglich mit ihrem Vater eine intensive Bibelexegese betrieben und somit schon sehr früh ein Gefühl für die Interpretation von Texten bekommen. Nun aber stand mit nur fünf Punkten erstmals ein Ausreichend unter ihrer Arbeit.
Gedankenverloren blätterte Magdalena in dem Stapel Zettel herum, den ihr die Lehrerin soeben mit einem süffisanten Grinsen auf den Tisch geworfen hatte. Mit gerunzelter Stirn las sie die Anmerkungen durch, die ihre Lehrerin mit rotem Fineliner an den Rand ihrer Ausführungen geschrieben hatte. Der arme Goethe würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er diesen abenteuerlichen Gedankengang zu lesen bekäme stand beispielsweise an einer Stelle und Finden Sie diese Behauptung nicht sehr anmaßend? an einer anderen. Und was sollte eigentlich diese Randbemerkung bedeuten: Die Emotionen zwischen Mann und Frau sind ein Spiel, bei dem man sich leicht die Finger verbrennt, ich mahne zur Vorsicht!
Aber genau darum war es in der Aufgabe doch gegangen, dachte Magdalena und schüttelte den Kopf. Analysieren Sie das emotionale Verhältnis, das sich zwischen Faust und Gretchen entwickelt. Nun, nichts anderes hatte sie doch getan. Schließlich war an der Aufgabe nichts misszuverstehen. Und genau mit solch einer Aufgabenstellung hatte sie auch gerechnet und im Vorfeld der Klausur intensiv darüber im Internet recherchiert. Wo also war das Problem?
»Frau Ravensburger«, wandte sie sich an ihre Lehrerin, die gerade dabei war, den Notenspiegel mit Kreide an die Tafel zu schreiben, »hätten Sie nach dem Unterricht vielleicht noch Zeit, mit mir meine Klausur durchzusprechen? Ich verstehe da so einiges nicht.«
Als sie die Stimme Magdalenas vernahm, hielt Sybille Ravensburger abrupt in ihrer Bewegung inne und drehte sich dann langsam, fast wie in Zeitlupe, zu ihrer Klasse um. Sie schürzte ihre Lippen und sagte dann gedehnt: »Nein, Magdalena, dazu habe ich leider überhaupt keine Zeit. Wenn Sie Fragen haben, dann reichen Sie diese doch bitte schriftlich bei mir ein. Vielleicht kümmere ich mich dann darum.«