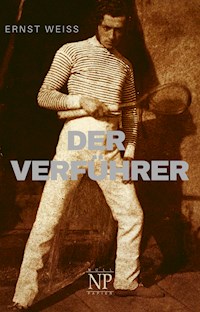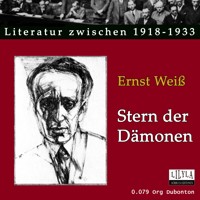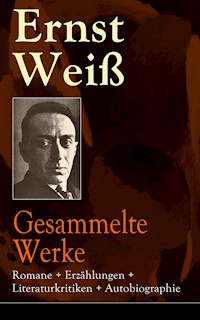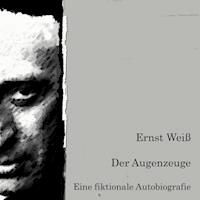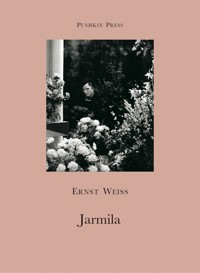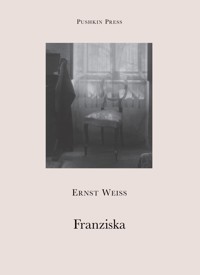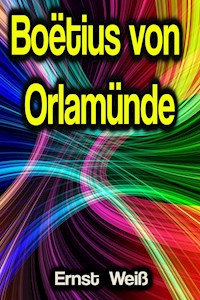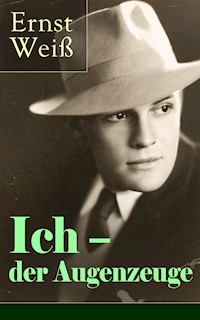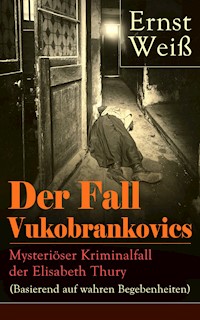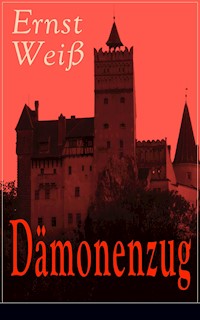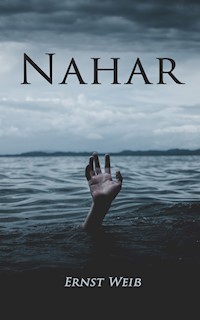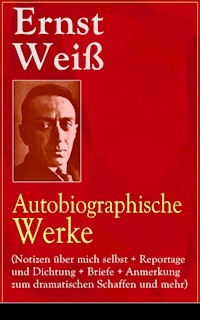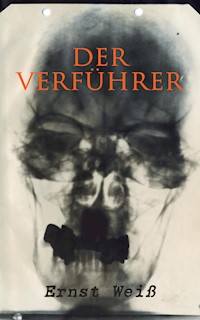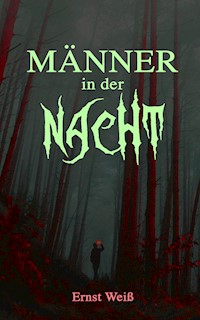
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Männer in der Nacht" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "In diesem Augenblick bemerkte er, immer noch aufrecht stehend und seine großen, schwellend weißen Hände in die goldene Kette verstrickt, welche den Gürtel seiner Arbeitskutte bildete, daß der Brief des Notars, der sich dem geschliffenen Glas des Porträts angeschmiegt hatte und der bis zu dem kleinen, lindenblattförmigen Munde der polnischen Gräfin reichte, nun ebenso goldig durchwölkt schimmerte wie vorhin, als ihn der Diener an die Fensterscheibe bei Sonnenuntergang gelehnt hatte." Ernst Weiß (1882-1940) war ein österreichischer Arzt und Schriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Männer in der Nacht
Erster Teil
I
Am Abend des 3. November 1838 bekam der Dichter Balzac durch die Hand seines alten Dieners François in seinem Landhaus von Les Jardies einen Brief von seinem Jugendfreund, dem Notar Sebastian Peytel in Belley.
Balzac hielt eben nach zwölf Stunden ununterbrochener Arbeit inne; er zog seinen Atem tief, fast rasselnd ein, sein feistes, olivenfarbenes, rot getigertes Antlitz unter dem strotzenden, schwarzen, leicht angegrauten Haupthaar war von Schweiß bedeckt. Sein abwesender, großer Blick streifte über die noch kahlen, am Fußende grauen und feuchten Wände des Zimmers, den halb erloschenen, in die neue Mauer schlecht eingefügten, prächtigen alten Marmorkamin aus cipoliotischem, perlenfarben und blutfarben geädertem Gestein. Das Landhaus von Les Jardies war neu erbaut, nicht bezahlt und noch nicht ausgetrocknet, dennoch mußte es der Dichter bewohnen und konnte es kaum auf eine Stunde im Tage verlassen.
Schon hatte Balzac seine volle Kraft wieder und wollte sich, mit einem wollüstigen Gefühl von Müdigkeit und sinnlichstem Verlangen zugleich, dem Schreiben wieder zuwenden, als er den Diener mit dem Briefe vor sich sah. Er mußte das wiederholte Klopfen und Rufen, womit dieser seinen Eintritt in das verbotene Zimmer entschuldigte, überhört haben. Nun hielt der Alte den bläulichen Umschlag mit den milchweißen Siegeln wie eine Hostie zwischen seinen Greisenhänden. Der Dichter überflog bloß die Aufschrift, der die Worte »Besonders eilig!« »Sehr dringend!« »Persönlich!« beigefügt waren. Da er aber, ohne seine Hände von den Manuskripten fortzunehmen, durch stummes Wegwenden seines mächtigen, löwenartigen Hauptes anzeigte, daß er durch nichts und durch niemand gestört sein wollte, legte der Diener, der sonst im Hause Gärtnerdienst versah, den Brief auf das Fensterbrett. Denn der Arbeitstisch war mit Papieren und Druckfahnen in einer dem Diener nicht verständlichen, aber deshalb nur um so heiligeren Ordnung bis an den Rand überladen.
Die Abendsonne begann mit einem hingehauchten Bronzeton durch das dünne Papier hindurchzuschimmern. Der Dichter, nun doch aus der Ruhe und Sammlung gerissen, langte nach dem Briefe, wollte sich aber durch nichts in der begonnenen Arbeit, die ihn bis Mitternacht festhalten mußte, unterbrechen lassen. Um aber das Schreiben nicht aus den Augen zu verlieren (er war Peytel vor Jahren herzlich zugetan gewesen), lehnte er es an ein kleines, in goldenem Rahmen befindliches Porträt seiner schönen Geliebten, der Gräfin Hanska, und bedachte, daß er unter allen Umständen Zeit finden müsse, binnen jetzt und Mitternacht Peytels Brief zu lesen, zu beantworten und dann, sich selbst zur Freude, der geliebten Frau einen Brief zu schreiben. Denn in ihr lebte sein ganzes Leben.
In diesem Augenblick bemerkte er, immer noch aufrecht stehend und seine großen, schwellend weißen Hände in die goldene Kette verstrickt, welche den Gürtel seiner Arbeitskutte bildete, daß der Brief des Notars, der sich dem geschliffenen Glas des Porträts angeschmiegt hatte und der bis zu dem kleinen, lindenblattförmigen Munde der polnischen Gräfin reichte, nun ebenso goldig durchwölkt schimmerte wie vorhin, als ihn der Diener an die Fensterscheibe bei Sonnenuntergang gelehnt hatte. Aber das Zimmer, der ihm immer noch fremde Raum, war jetzt sonderbar verändert. Nicht mehr Herbstnachmittag, sondern vor den Fenstern und auf dem wie eine Handfläche glatten Gartengelände dunkelste Nacht. Der tiefe Absturz, der bis zu den Schluchten von Sèvres steil abfiel, in völlige Schwärze getaucht. Der einzige Baum des Gartens nicht mehr zu erkennen. Nur ein rötliches Licht am Eisenbahnübergang nach Versailles, sehr fern – und hier: eine Kerze auf silbernem Leuchter auf dem Tisch, die handschriftlichen Blätter auf der einen Seite, die Druckfahnen auf der andern Seite des Leuchterfußes vorsichtig aufgeschichtet und nicht in ihrer Ordnung verrückt. Links von ihm der alte Diener, in seinen abgenutzten, gelbgrünen, nur bis zu den vorstehenden dürren Knien reichenden Gärtnerkittel gehüllt, wie er den zweiten Silberleuchter in der hoch erhobenen, festen, derbknochigen Hand hält und dem Herrn in solcher Ruhe leuchtet, daß die Kerze nicht flackert.
Um vier Uhr nachmittags ging die Sonne unter. Um vier Uhr hatte er den Brief erhalten. Nun mußte es sechs Uhr geworden sein; zwei Stunden war er, ohne sich von der Stelle zu rühren, abwesend gewesen. Er mußte im Stehen geschlafen haben, den Blick geöffnet und nicht im mindesten von dem fremden Briefe, der jetzt im Kerzenschimmer wie vorhin im Herbstsonnenschein mattgolden glänzte, abgewandt.
II
Balzac öffnete den Brief, der von der Hand Charles Lablanches, eines ihm unbekannten Rechtsanwaltes aus Belley im Departement de l’Ain, stammte, und erfuhr durch die ersten Zeilen, daß der Brief auf die Bitte seines lieben Jugendfreundes Peytel geschrieben war. Die Schrift war eng, wie gestochen. Sie bezeugte, daß der Rechtsanwalt erst seit kurzem in seinem Gewerbe tätig war. Balzac selbst hatte zwischen seinem sechzehnten bis zwanzigsten Lebensjahre als Clerk in einem Notariatsbureau gearbeitet und wußte, daß die Schrift eines Rechtsmenschen sich schon in den ersten Jahren seiner beruflichen Tätigkeit so abnützt wie seine Schuhe oder sein Herz. Hier aber sprach eine unverdorbene, wohlmeinende, wenn auch etwas eitle Sinnesart, und was Lablanche in diesen feinen, leicht verschnörkelten Linienzügen von sich selbst und seiner Stellung zu Peytel aussagte, mußte für Lablanche einnehmen.
Peytel war eines todeswürdigen Verbrechens peinlich angeklagt. Man hatte ihn vor einigen Tagen (wieviel Tagen, war nicht deutlich ersichtlich) verhaftet, man hielt ihn allgemein für schuldig, auch Lablanche glaubte an Peytels Unschuld nicht. Der Angeklagte wehrte sich, von der ersten Stunde der Haft angefangen, gegen andere oder gegen sich; denn wozu hätte man ihm sonst Handschellen angelegt? Der Notar Peytel hatte vor kurzem geheiratet und sich dann in Belley in Südfrankreich niedergelassen. Er besaß einen eigenen, schönen Wagen. Sein Diener Louis Rey lenkte das Gefährt, als sich der Notar mit seiner jungen Frau Felice Ende Oktober auf eine Vergnügungsreise nach Macon begab.
Gegen zwei Uhr morgens, am ersten November, wurden die Einwohner des Städtchens Belley durch Lärmen, Pochen, Geschrei erweckt. Peytel war es, der zurückgekommen war. Er pochte an allen Türen, teils mit eisernen Türklopfern, teils indem er, durch die engen, krummen Straßen laufend, Kiesel auflas und, ohne dabei seinen Lauf und sein fast unartikuliertes Geschrei zu unterbrechen, die Steine gegen die verschlossenen Türen, an die hölzernen Fensterläden, an die nachtschwarzen Mauern warf. Der Schlaf einer kleinen Stadt ist fest. Auch war Lärm nachts nichts Ungewohntes, da der Postwagen von Lyon mit großem Gepolter, das dem Geprassel von Steinen nicht unähnlich klingt, achtspännig der hohen Steigung wegen bespannt, täglich gegen Morgen den kleinen Ort passierte.
Trotzdem wurde dem Notar Peytel nach sehr kurzer Zeit geöffnet. Der junge Anwalt Lablanche war es, der den Notar in seinen Armen auffing. Aber der Notar war von einer so furchtbaren körperlichen und seelischen Aufregung ergriffen, daß er seinen Bekannten nicht erkennen konnte oder wollte. Peytel schrie: »Alle Ärzte zu Hilfe! Alle zu Hilf! Alle Ärzte zu Hilfe!«
Aber nicht, wem zu Hilfe. Noch auch den Weg, den die Ärzte zu nehmen hätten, oder die Mittel und Werkzeuge, die sie mitbringen sollten, sondern bloß das eintönige, fast tierische, schauderhafte Gebrüll und sinnlose Rufen nach Hilfe. Der Anwalt und einige herbeigeeilte Bürger, in Nachtmütze und gestrickte Kamisole gehüllt, zitternd vor Kälte, in dem Nebel vermummt, der eben einem sehr starken Regen gefolgt war, die Hände bebend um flackernde Kerzen gespannt, alle umstanden den schreienden Notar.
Er war ein starker, hoher, etwa fünfunddreißigjähriger Mann. Er trug einen Radmantel mit vielen Kragen, dessen Stoff sich unter den krampfhaften Bewegungen spannte und bauschte. Er wurde nicht müde, nach Ärzten zu rufen, ohne den Menschen zu nennen, dem diese Hilfe gelten sollte.
Dann erscholl wieder sein fast tierisches Geheul, das, man weiß es nicht, entweder einem tiefen, für Menschen kaum noch erträglichen Kummer oder aber einem plötzlich ausgebrochenen unheilbaren Wahnsinn entspringen mußte. Aber wie das, da man den Notar doch als vernünftigen, erwerbstüchtigen, gemäßigten Mann kennt, der sogar Beziehungen zum Bischof unterhält? Den Eindruck des Natürlichen macht er nicht. Denn wer sollte von einem klugen, gebildeten Rechtsmenschen das Geheul eines angeschossenen Ebers erwarten, wenn ein solcher sich vor Schmerzen im Eichenlaub wälzt und sein Eberhaupt unter dem Laube zu verbergen sucht, wie gerade jetzt der Notar seinen entblößten Kopf mit den spitzen, weißen, vorstehenden Zähnen in den vielen erdbraunen Kragen seines Mantels?
Endlich bringt man Peytel zur Polizeiwache, die sich der Kirche gegenüber befindet. Im Vorraum der Amtsstube bricht der Mann zusammen. Sein Kopf, seine Haare triefen vom Regen, das sieht man jetzt im Lampenschein der Kanzlei. Er mußte dem Wetter lange ausgesetzt gewesen sein. Die Hände sind blau von Kälte und zittern, aber es gibt kein Blut.
Das düster funkelnde, gelblichgrüne, tiefe Auge weit aufgerissen und dabei doch ohne Ausdruck, ohne menschlichen Ausdruck wenigstens. Die Lippen, sehr stark gefärbt, zucken, wollen sich schließen und können es nicht. So stammelt er Worte, die ihm wider Willen zu entfließen scheinen, die er rasch noch einmal auffangen möchte und vor denen es ihm graut, ihm und den andern, die ihn umgeben.
III
Daß ein großes Unglück dem Notar begegnet, wird schon vor seiner Erzählung allen klar. Die Frauen, von denen einige ältere sich mit den Männern in die Amtsstube geschlichen haben, beginnen zu weinen, ohne zu wissen, warum.
So berichtet Lablanche in seinem langen, mit äußerst feiner Schrift geschriebenen Briefe. Nicht ohne Grund hat Lablanche in den ersten Worten schon den großen Dichter Balzac so ehrfurchtsvoll begrüßt. Auch er, Lablanche, schreibt gern, und wie der Brief mit seiner genauen Schilderung bezeugt, nicht ohne Können und vor allem nicht ohne Schule, die er dem Meister Balzac verdankt.
Nun der Bericht: Die Gattin, die Peytel abwechselnd »meine Frau«, dann »Felice« oder »die Alcazar« nennt, liegt hingestreckt im Reisewagen. Ernsthaft, schwer verwundet. Der Reisewagen hält an der letzten Kehre der Straße, beim Meilenstein vor Belley. Kurz nach dem Passieren der kleinen Brücke hat der schändliche Diener, Louis Rey, nach der Alcazar geschossen. Er, der Notar, hat in der ersten Wut, seiner Sinne nicht mächtig, den Mord durch gerechte Strafe gerächt. Auch den Louis Rey werde man ohne Leben am Wege finden.
Kaum waren diese Worte, mit größerer Deutlichkeit und klarerer Bestimmtheit, als man sie dem tobenden Eber anfangs zugetraut hätte, heraus, als alle Anwesenden, die Frauen voran, durch die schmale, einflügelige Tür des Amtslokals sich drängen, um draußen laufend, an jeder Ecke um andere Neugierige vermehrt, die engen, krummen Straßen zu erfüllen. Sie werden geführt vom eilig dahinschießenden Notar, den von der einen Seite der Anwalt Lablanche, von der andern Seite der Bürgermeister stützt, indem sie seine scheinbar ganz erstarrten Hände durch die Falten des dicken Radmantels hindurch beim Laufen festhalten. So stürmt in immer beschleunigter Eile der Zug durch die Straßen. Der Morgenfrühschein erhellt die Häuser. Es geht bergauf, die Menschen rennen und keuchen. Auch Kinder haben sich eingeschlichen. Pferde hört man wiehern, und wirklich, keine tausend Schritt vor dem Orte steht der Wagen auf der Straße. Die Pferde halten ruhig, es sind derbe, erbsenbraune, gut genährte, stramme Tiere. Das eine scheint, den Kopf tief gesenkt, zu schlafen. Das andere reibt, vielleicht aus Hunger, sein halbgeöffnetes blaßrotes Maul an dem Geschirr, das man schon von weitem mit hellrotem Blute beschmutzt erkennt. Der Gaul versucht, sich von Kinnkette und Nasenriemen freizumachen, schlägt dazu mit dem buschigen Schweif, schon hebt und weitet das Pferd die Brust, um aufzuwiehern wie vorhin, aber angesichts der zahllosen Menschen scheint ihm der Mut dazu zu fehlen. So zittert es bloß mit der feinen, nassen Haut des Rückens und der Flanken. Kann denn die blöde Kreatur Gottes das Menschenblut wittern und davor zurückschaudern? Das übersteigt doch, was man an Vernunft diesen seelenlosen Geschöpfen zutrauen kann.
Die junge Frau, ein zwanzigjähriges, blühendes Wesen, liegt, auf ihrer veilchenfarbenen, verknüllten und feuchtigkeitsgetränkten Seidenmantille gebettet, tief in dem Fuhrwerk. Ohne Zeichen des Lebens. Ihr ganzer Körper trieft vor Nässe, als schwämme er in Wasser. Und Wasser ist es auch. Nicht Blut oder doch nicht Blut allein. Das furchtbarste ist ihr ganz zerbrochenes Gesicht. Das Verdeck der Kutsche ist herabgelassen, man sieht das volle, regungslose Gesicht, das trotz der offenen Knochenhöhlen einen menschlichen Ausdruck bewahrt hat. Um den üppigen und dabei doch zarten Hals ist ein kleines goldenes Kettchen geschlungen. Die Gesichtsfarbe ist wie von der Sonne verbrannt, das kommt von dem Kreolenblut, das die Tote in ihren Adern führte. Ihre schönen Augen waren Kreolenaugen von einem besonders warmen, zärtlichen Braun, doch sind sie jetzt geschlossen. Weit waren die Augenbrauen geschwungen und sehr reich gewachsen. Nun scheinen sie verbrannt, in Zunder aufgelöst. Man könnte die einst so schöne Frau nicht erkennen, wüßte man nicht, wer sie ist. Ihre Beine, schlank und doch voll, sind fast nackt. Es stürmt in den Bäumen. Man müßte kein Mensch sein, wenn nicht dieser Anblick unter dem kalten, stürmischen Himmel jedem ans Herz griffe. Zwischen ihren Strümpfen und den zusammengerafften, dreifach übereinandergeschlagenen Röcken gleißt die feine Haut. Die schreckliche Wunde im Gesicht blutet leise. Dazu beginnt milder Regen, in dem totenähnlichen Schweigen der ungeheuren Menschenmassen ringsum deutlich hörbar, vom grauen Himmel herabzutröpfeln.
Kein Wunder, wenn die Frauen, die sich halb aus Mitleid, halb aus Neugier um den Wagen geschart haben und von denen einige besonders fürwitzige das Verdeck des Wagens herabließen, im Anblick dieser stillen Blutströme nun kreischend den Schauplatz verlassen. Haben denn diese Blutströme nie zu rinnen aufgehört seit der Stunde des Verbrechens? Oder haben sie jetzt im letzten Augenblick zu rinnen erst begonnen, als der Mörder, Peytel, in ihre Nähe trat? Der Postwagen kommt rasselnd die Höhe herab. Die Peitschen knallen, die Bremsen kreischen. Doch man winkt ihm rechtzeitig, und er hält. Der Postillion untersagt den Fahrgästen, den Wagen zu verlassen. Auch schlafen noch die meisten. Inzwischen sind die Weiber bereits in der Nähe der Stadt. Noch haben sie, aneinander dicht gedrängt wie Hühner im Platzregen, zu kreischen nicht aufgehört. Sie haben im schnellen Laufe ihre Röcke hochgehoben und zeigen zwischen den hellen Strümpfen und dem dunklen, nassen Rockrande schmale Streifen silbernen Fleisches.
Bloß Männer umstehen jetzt den Wagen. Der Maire zur Rechten, der Anwalt, ich, zur Linken des im Morgenfrost zitternden Gatten. Und ich flüstere, was alle fühlen: »Arme kleine Frau!« Vor uns dreien, sehr groß, der Polizeikommissar. Er rührt sich nicht von der Stelle. Aber der Gatte will, während er weit ausatmend seufzt und die weißen, schönen, starken, vorstehenden Zähne entblößt, die Hände durch die Falten des Radmantels hindurch von der Stütze oder der Fesselung durch uns freimachen, um nur schnell zu dem Arzte hinzueilen, der im Hintergrunde dieser Gruppe steht, er, eine fast ebenso hohe Gestalt wie der Polizeikommissar. Der Arzt sagt mit kalter Stimme, ohne mehr als einen einzigen flüchtigen Blick auf die Frau zu werfen: »Alle Hilfe kommt zu spät« – wobei er zögernd und in Gedanken hinzufügt: »hier.«
Auf dem Erdboden, unter einer schweren, regengetränkten Decke, liegt noch ein totes Geschöpf, der Diener, und unweit von ihm seine Peitsche. Zwischen ihm und dem Wagen stehen zwei einfach gekleidete Männer: der Schmied und sein Sohn; sie blicken still, aber mit vielsagender Miene umher, als wüßten sie noch viel.
Der Notar regt sich, er bäumt sich hoch auf.
Will der Gatte dem Arzte zu Füßen fallen, ihn anflehen, sein kaltes Wort selbst Lügen zu strafen und doch noch einen Versuch zur Rettung und Belebung der vielleicht nur scheintoten Frau zu unternehmen? Oder will der Notar, von dessen fleischigen, tief roten, wie Korallen purpurn gefärbten Lippen sich nun ein langgezogenes Zischen loslöst, den Namen der oft und oft liebkosten Frau noch einmal formen und kann es nicht?
IV
Der Dichter ist mit der ersten Seite des Briefes zu Ende. Der Diener hat ihn längst verlassen, die Kerze, die er gehalten, steht, bis zur Mitte herabgebrannt, auf dem Marmorkamin. Noch spielt Balzac mit dem Briefumschlag, nähert sich, den Brief entfaltet in der Linken, der Feuerstelle, befühlt mit seinen breiten Daumen die milchweißen, glatten Siegel. Er möchte den Brief gerne vernichten, statt ihn zu Ende zu lesen, doch wagt er es nicht und verbrennt bloß die Hülle im Kamin, wobei die Siegel aufprasseln und aromatisch duften. Er setzt sich an den Tisch, den er mit dem Briefe wie mit einem Tischtuche zum Speisen deckt. Er gönnt sich weder Essen noch Schlaf. Schwer aufatmend erhebt er sich nochmals, nimmt das Bild der Gräfin fort, stellt es vorerst an den Kamin, dann aber, um ihren Blick nicht im Rücken zu haben, lehnt er es an die Fensterscheibe. Draußen ist völlige Nacht, totenstill. Er würde gerne schlafen, ruhen, sich an traumlosem Schlummer sättigen. Er ist gewohnt, von sechs Uhr abends bis zwölf Uhr zu schlafen. Nun kann er es nicht.
Peytel wird, so berichtet der Brief, zum ersten Male verhört und erklärt folgendes:
»Wir verließen am 31. Oktober Macon, es war elf Uhr morgens. In Bourg sind wir angekommen um fünf Uhr abends. Wir waren auf dem Rückwege. Ich hatte eine wichtige Nachricht erfahren, nichts Persönliches, eine Angelegenheit geschäftlicher Natur. Im Gasthofe ›Zur silbernen Sonne‹ haben wir unsere Mahlzeit eingenommen, um sieben machten wir uns auf den Weg, um die Nacht durchzufahren, denn am nächsten Tage, einem Feiertage, mußten wir zu Hause sein. Wir kamen durch Roussillon. Felice und ich saßen im Wagen, vor uns der Diener, der meine Pferde lenkte. Die Wolken standen schon am späten Nachmittag sehr dunkel am Himmel. Meine Frau, aus den Staaten gebürtig, eine Kreolin, war sehr empfindlich gegen Kälte. Der Regen begann zu tröpfeln. Wir passierten Fontenay. Hier geht der Weg vorbei, Sie wissen, vorerst an einem kleinen See. Die Straße hat hier weder Geländer noch Prellsteine am Rande. Schon auf dem Hinwege hatte die Alcazar Angst. Doch gehen meine Pferde, alte, aber noch starke Tiere, vollkommen sicher, sie kennen den Weg, der Diener auch. »Keine Angst!« sag’ ich jetzt. Ich erinnere mich, auf der Hinreise habe ich Felice an dieser Stelle, leicht und zart, wie sie ist, mit meinen Armen aus dem Wagen herausgehoben. Von oben sieht sie, während sie ein wollüstiges und furchtsames, girrendes Lachen nicht unterdrücken kann (ich habe es noch in den Ohren), erst den smaragdfarbenen See, dann weiter in den tiefen grünen Kessel der Berge, wo unter weißem Schaum der Sturzbach rauscht. Die Frau kennt ja Angst nicht, wenn ich bei ihr bin, auch der Diener nicht, der sich, seiner sonstigen mürrischen Gewohnheit entgegen, diensteifrig umwendet und vom Bocke aus fragt, ob er nicht lieber aussteigen und die Pferde bis zu der kleinen Brücke am Zügel führen soll. Vergessen Sie nicht, das war auf dem Hinwege und vom Diener schlau bedacht. Denn hier hat er auf der Rückreise seinen teuflischen Plan ins Werk gesetzt. »Recht so!« sag’ ich, er springt hinab und geht zu Fuß nebenher. Das war am Dienstag. Ich wollte der Alcazar die Zügel geben, doch wagt sie es nicht, sie zu nehmen, sie schmiegt sich tiefer in ihre blaue Mantille, nur ihr Gesicht läßt sie von der schönen Sonne bescheinen und lacht mich an, während ich kutschiere.
Nun sind wir auf dem Heimwege; der Regen gießt in Strömen, wir sehen euren Kirchturm tief unter uns, der Wagen kreischt in den Federn, die Räder knarren, und das ganze Gefährt zittert, da man des hohen Abfalls wegen die Sperrketten eingelegt hat. Der Regen gießt, der Wind schlägt von der Seite herunter und in den Wagen hinein. Louis Rey hebt die Peitsche über dem Handpferd.»Vorsicht!« rufe ich. »Es dauert nicht mehr lange! Sachte voraus! Besser, du kommst herunter, führst die Pferde im Schritt!« Wir zittern im Wagen, der sich kaum vom Schleudern abhalten läßt, da die Sperrkette im Regen glitscht, die Alcazar liegt dicht an mich geschmiegt, hier zwischen dem ersten und zweiten Blatte meines Mantelkragens.« Er zeigt es deutlich, indem er mit beiden Fäusten den Kopf eines Menschen nachbildet. »Hier ist sie, ich fühle es noch, sie schläft und haucht mich mit ihrem warmen Atem an. Auch ich muß wie schlafbetäubt gewesen sein.
Plötzlich höre ich den Knall einer Pistole. Das Aufblitzen des Pulvers habe ich gerade noch, wie ein kleines Feuer im Regen, blau glitzern sehen. Meine Frau schreit auf, während sie den Kopf aus meinem Mantel reißt, oder hat sie den Kopf schon vorher aufgerichtet und weggewendet? Vielleicht da, in dem Augenblick, als ich dem Diener den Befehl gab, herabzusteigen? Sie schreit auf: »Ach, mein armer Mann, nimm deine Pistolen, schnell!« Jetzt wird das Handpferd unruhig. Ich sehe, wie es ausschlägt, wie es mit seinem dicken, nassen Schweif um sich peitscht und die Laternenscheiben zertrümmern will, der Wagen springt klirrend förmlich zur Seite, nun geht es schnell und schneller, der Sperrhaken muß sich gelöst haben, wir rollen den steilen Abhang hinab, ohne Brüstung, ohne Geländer, wir hören den Wind sausen um unsere Ohren, der Kutschbock ist leer, der Mörder wird sich wohl unter dem Vordach verborgen halten oder wird herabgesprungen sein; ich reiße die Pistole aus der Tasche des Wagens, geladen ist sie noch vom vorigen Abend her, auch ein Hammer kommt mir unversehens unter die Hände. Er lag bei dem Gelde, das ich mitführte, in Gold, in sieben schweren Säcken. Ich sehe jetzt eine Gestalt nebenher am Wege laufen, über die Gebüsche springen, die am Straßenende gepflanzt sind, es ist trüb, unsichtig, der Regen strömt, der Sturm heult, ich halte mit der Pistole auf den geldgierigen Diener zu und schieße. Noch weiß ich nicht, warum, wo bleibt die klare Besinnung in solch einem Augenblick? Ich habe nicht das Einschlagen seiner Kugel gehört, ich habe nicht gemerkt, daß Felice getroffen ist, und doch weiß ich es. Was ein Mensch jetzt fühlt, kann ich nicht beschreiben.«
Man labt den Notar, und er fährt fort:
»Der Wagen, an der Wende der Straße angekommen und mit den Rädern ins dürre Gestrüpp verwickelt, fährt langsamer, ich komme über die Gebüsche hin an den keuchenden, dampfenden Rossen vorbei, ich renne aus Leibeskräften dem fliehenden Diener nach. Fast ist mir, als ob die Frau, mit den bloßen Händen ihr Kleid aufschürzend, von der andern Seite aus dem Wagen springt und sich, nun eher wimmernd als schreiend, im Nebel hinter dem Felsen verbirgt.
Mich hält es nicht mehr, ich jage dem Elenden nach, aber meine Hand ist nicht ruhig, ich fehle den Raubmörder wie das erste Mal. Wütend fliege, stürze ich über ihn her, versetze ihm von rückwärts einen Schlag mit dem Hammer. Der Getroffene windet sich wie
V
Peytel fährt nach einer Pause fort: »Ich rufe meine Frau, ich schreie: Felice, Liebste, Felicia, zu mir! Keine Antwort, die Straße leer, verlassen, Nacht und Finsternis. Ich den Weg an der Wende herauf und herab, endlich bis zur Brücke, hier liegt sie im Wasser, Felice, meine Frau. Wie kam sie her? Warum? Um zu trinken? Sich die Wunden zu waschen? Kalt, erstarrt, ohne ein Zeichen des Lebens. Das Gesicht zerrissen, voll Blut, nicht zu beschreiben. Mit allen Kräften ziehe ich sie zu mir, ihre Röcke, ihre blaue Seidenmantille wollen nicht mit. Die Kleider gleiten, von der Feuchtigkeit schwer wie Blei, bis zu ihren Hüften, ich kann nichts ordnen, nur zurück! Nur zu Hilfe! Ins Leben, wie nur immer!«
»Das kann nicht wahr sein«, schreibt hier der Anwalt Lablanche an den Rand.
»Ich spreche, ich rede ihr zu, nur das Erschrecken hat sie fortgetrieben, die Furcht, wer weiß es, der Schuß hat sie betäubt, die Augenwimpern sind versengt, ich sehe es trotz der Finsternis, die Augenbrauen sind nur feuchter Staub, es ist Nacht, es ist Sturm und viel Gewitter am Himmel, ich fasse ihr ins Gesicht, ich greife ins Leere. Wäre es doch einen Tag zuvor oder eine Stunde nur! Ich rede sie an: ›Liebste, einen Augenblick nur hebe den Kopf, sieh mich an, hörst du mich nicht? Kann es denn sein?‹ Ich halte sie umschlungen, sie ist schwer, schwerer als sonst Menschen sind, gerade als ob sie sich mit Gewalt auf den Rücken legte, wie wenn sie mich mit aller Gewalt zu sich auf ihre Brust zöge. Ich falle nieder, wir rollen verschlungen ins Wasser, wir gleiten auf dem spitzen Geröll bis in den eiskalten Bach, mit der letzten Kraft reiße ich sie ans Ufer zurück. Hier hocke ich, keuche, blicke sie an, knöpfe ihr Kleid an der Brust auf – alles ist von dem Eiswasser so versteinert.
In der Nähe muß ein Haus sein, auf dem Hinwege erblickte ich es. Ich stürze nach der Hütte, ich klopfe und rufe.
›Wer ist’s?‹
›Peytel‹, sage ich, ›der Notar.‹
›Was gibt es?‹
›Meine Frau ist verunglückt. Der Diener hat geschossen.‹
›Wer da?‹ ruft die Stimme eines andern Mannes.
›Um Christi willen, nur heraus, meine Frau ist verwundet, ich bin es, der neue Notar.‹
Endlich kommen sie beide, Vater und Sohn, sie fragen:
›Wo?‹
Ich habe die Kraft nicht, stumm deute ich hinunter, dorthin, wo die Alcazar liegt. Die beiden finden den Körper: ›Die Dame ist nicht mehr!‹ ruft der Alte, indem er beide Hände wie Schalltrichter an seinen Mund legt. Sein weißer Bart rüttelt im Winde. ›Keine Hilfe? Keine?‹ schreie ich.
Sie bringen Felice auf den Händen getragen. Ich kann sie nicht sehen, es ist zu furchtbar. ›Nicht zu hart!‹ rufe ich, als ihr kleiner Schuh beim Hinlegen an das Trittbrett des Wagens stößt. (Diese Äußerung hat Peytel nicht getan, bezeugen die Schmiede.) Sie führen, Vater und Sohn, den Wagen mit den Pferden zurück, sie haben die Frau der Länge nach darin gebettet. So hat das Gericht sie gefunden. Sie wollen nicht mit. Der Regen gießt. Ich sitze im Wagen, den Kopf der Frau lege ich auf meine Knie. Sie reichen mir die Zügel. Sie haben die Riemen in einen Knoten geschürzt, da ich mit der linken Hand kutschieren, mit der andern die leidende Frau stützen muß. Ich ergreife die Riemen, ich fahre behutsam die Wende hinab, der Stadt zu. Am Wege habe ich etwas gesehen. Ist es ein Sack? Ein Degen? Ein Sack mit Gold? Des Dieners Peitsche war es. Jetzt scheut das Handpferd. Es hebt sich im Geschirr. Das Gefährt schwankt, das Köpfchen meiner Frau sinkt herab. Die Laternen müssen erloschen sein im Sturm. Hinter mir kommen Schritte, es sind die Schmiede, die mich doch nicht verlassen wollen. Sie packen das böse Pferd bei der Kinnkette. ›Ein toter Mann liegt am Wege‹, schreit der Jüngere.
›Ich weiß es, ich weiß!‹ ruf’ ich. ›Nur zu!‹ und hebe die Peitsche, die ich von dem Älteren bekommen und zwischen meinen Knien festgehalten habe.
›Jesus Maria!‹ heult der Alte.
›Der Wagen soll nur über ihn weg! Hinüber!‹
Aber die andern lassen es nicht zu.
›Man soll Tote nicht schlagen‹, meint der Alte. Ich lasse die Peitsche fallen, man hat sie neben ihm, dem ungetreuen Knecht gefunden.«
Hier bricht das Verhör ab. Der Notar zeigt furchtbare Aufregung, will zu seiner Frau, er will sich von den umgebenden Gerichtspersonen freimachen, schlägt um sich und schreit. Da man Gewalttätigkeiten befürchtet, legt man ihm Handschellen an. Die Leute aus dem Orte, besonders die Frauen, waren furchtbar aufgebracht, sie drohten und rotteten sich vor dem Gerichtsorte zusammen.
Zum Schlusse: Balzac wäre Peytels bester, sein einziger Freund. Peytel bitte um Balzacs Hilfe durch den Mund Lablanches, der ehrfurchtsvoll den großen Meister grüßte.
VI
Was der Dichter will: das Geschehene ungeschehen machen, das Fürchterliche, eben Erlebte vergessen – beides ist unmöglich. Vergebens läutet er jetzt seinem treuen François, der ihm ohne weitere Weisung eine kupferne Kanne mit stärkstem türkischem Kaffee bringt, wie es Balzac um Mitternacht gewohnt ist. Vergebens, daß der Dichter seine breiten Hände vor sein glühendes Gesicht legt, um sich in Dunkel zu hüllen. Vergebens, daß er, um näher, inniger zu sich und seinem Werk zurückzukehren, sich lange in dem geschliffenen Glase des Porträts wie in einem richtigen Spiegel betrachtet.
Er sieht seinen gewaltigen Schädel, die schwarzen, schwer gelockten Haare, mit grauen Strähnen schon vermengt, aber noch hart wie Roßhaar, blank wie Indianerhaar in der herrlichen Freiheit Amerikas, die einem Balzac nie beschieden ist. Sein Hals, wie er aus dem offenen Arbeitshemd und aus dem Silberschimmer der seidenen Kutte auftaucht, ist licht, faltenlos, rund wie eine Marmorsäule oder wie der Hals der geliebten Hanska. Ausgewölbt und breit im Bogen, von düsteren Falten quer durchzogen die Stirne. Die Wangen voll, olivenfarbig, mit roten Flecken getigert, die Nase eckig und hart. Eine tiefe Falte um den Mund, schräg herab. Fleischig, sinnlich und schelmisch zugleich sind die Lippen unter dem hängenden buschigen Barte. Jetzt erblickt der Dichter seine Augen, braun, von goldenen Funken gesprenkelt wie die eines Luchses, aber scharf, ohne Ermüden selbst jetzt nach dieser schweren Nacht. Sein Wille, der sich in dem machtvollen, aufwärts gerichteten Kinn ausspricht, ist nicht zu brechen.
Ruhig, massig, unerschütterlich steht der Dichter da. Sein Plan ist gefaßt, die Entscheidung für Peytel gefallen. Er wird, da er Peytel nicht vergessen, das Erlebte nicht auslöschen kann, dem Unschuldigen helfen, am nächsten Morgen nach Paris fahren, seinen früheren Chef, den Notar Marville, aufsuchen, damit er für Peytel plädiere.
Jetzt kann Balzac bis zum Morgen arbeiten. Er ist sehr glücklich in seiner Arbeit. Gegen 5 Uhr sammelt er sich zu einem Briefe an die Gräfin Hanska. Von Peytel will er schweigen und der sehr geliebten Frau die schrecklichen Bilder ersparen. Dies der Brief:
Les Jardies, 4. November 38
»Seit ich Ihnen zuletzt geschrieben, habe ich wie ein Rasender gearbeitet. Denn in diesen letzten Jahren gilt es siegen oder in unfruchtbarem Erfolg ersticken. Ich hatte für die »Presse« den Anfang der »Torpille« geschrieben, aber die »Presse« wollte es nicht. Ich habe den Anfang vom »Landpfarrer« geschrieben, das religiöse Gegenstück zu dem philosophischen Buch »Der Landarzt«. Ich habe das Vorwort zu den beiden demnächst erscheinenden Bänden, welche »Die ausgezeichnete Frau«, das »Haus Nucingen« und »Die Torpille« enthalten, verfaßt. Ich habe soeben die zwei Oktavbände »Wer Land hat, hat Krieg« vollendet, ferner für den Constitutionel den Schluß vom »Antiquitätenkabinett« unter dem Titel »Provinzrivalitäten« geschrieben. Nicht wahr, Sie verstehen, daß ich Ihnen unter dieser Lawine von Ideen und Arbeiten keine zwei Zeilen schreiben konnte?
Wenn Sie wüßten, daß meine Verleger mir kein Geld geben wollen, daß ich drauf und dran bin, das Geschäft mit ihnen rückgängig zu machen, daß ich, um es rückgängig zu machen, 50 000 Franken brauche, daß aber im ganzen Buchhandel keine 50 000 aufzutreiben sind und daß, nachdem ich geglaubt habe, mein Leben sei nun in ruhige und glatte Bahnen gekommen, es mehr denn je gefährdet ist.
Sie können ja nicht wissen, wie ein derartig ausgefülltes literarisches Leben wie das meine aus der Nähe aussieht. Was man Ihnen auch über mein Schreiben sagen mag oder was Sie davon halten mögen, seien Sie überzeugt, daß ich Tag und Nacht arbeite. Daß meine phänomenale Produktionskraft sich verdoppelt, verdreifacht hat. Daß ich es dahin gebracht habe, mehrere Druckbände in einer Nacht zu korrigieren, nachdem ich sie in zweiundeinemhalben Tag geschrieben habe!
Endlich sind die Manuskripte alle im Druck und die Korrekturbogen im Rollen.
Man wird mir nicht an Schnelligkeit zuvorkommen, denn nicht die mechanische Maschine mit ihren tausend Armen, sondern das Gehirn Ihres armen Freundes eilt voran!«
VII
Am nächsten Morgen hat sich der Dichter in dem Hof des Gerichtspalastes eingefunden. Der alte Notar Marville macht sich aus einer Gruppe von Anwälten los und eilt sofort auf Balzac zu. Nach kurzer Begrüßung sagt Balzac: »Ich komme wegen des Notars Peytel. Mir hat Lablanche in seinem Auftrag, und zwar sehr dringend, geschrieben. Ich bin entschlossen, mich für ihn einzusetzen, und will Sie um das gleiche bitten.«
»Es ist das erste Mal seit Menschengedenken, daß man einen Notar des Mordes beschuldigt. Man kann die Augen nicht vor der Verderbtheit der Mittelklasse schließen. Selbst unsere konservative Zeitung enthält eine genaue Schilderung des Verbrechens.«
»Doch nicht Peytels Verbrechen? Sie trauen diesem armen Jungen doch keinen Mord zu?«
»Balzac zweifelt noch? Ich traue jedem alles zu, das betrachte ich als meinen Beruf. Dies schützt vor Enttäuschungen.«
»Aber hören Sie doch! Er ist mein Freund. War meine einzige Gesellschaft lange Zeit.«
»Nun, ich nehme an, Sie haben Beweise!«
»Gewiß, den stärksten Beweis, mein Gefühl. Kenne ich die Menschen nicht? Mein Blick geht durch sie wie durch Glas. Vor mir hat man keine Geheimnisse.«
»Das bezweifelt ja auch niemand. Aber womit kann ich Ihnen dienen?«
»Übernehmen Sie die Verteidigung!«
»Wüßte ich, daß er unschuldig ist, ich zögerte keinen Augenblick, obwohl jeder Tag Abwesenheit von Paris mich 500 Franken kostet. Ich täte es, sowenig ich mich sonst Ideale kosten lasse, schon der Ehre unseres Standes zuliebe. Aber, lieber Balzac, muß nicht viel gegen ihn sprechen, wenn es so weit gekommen ist? Wir haben das humanste unter allen Gerichtsverfahren Europas. Wird ein Verbrechen in Frankreich begangen, so kommt der Verdächtige zuerst einmal auf die Wache. Klärt sich hier die Angelegenheit nicht völlig auf, dann bittet man ihn zum Polizeikommissar. Dieser unterwirft den Betreffenden dem ersten Verhör. Ich sage ausdrücklich, ›den Betreffenden‹ und nicht ›den Angeklagten‹, denn noch der Polizeikommissar kann einen offenkundigen Irrtum in der Person und in der Sache aufklären, und kein weiteres Verfahren belastet dann den Unschuldigen. Erst wenn auch der Kommissar zur Überzeugung kommt, daß etwas Ernstes vorliegt, verhaftet man den Mann, führt ihn ins Depot der Präfektur. Nun steht er zur Verfügung des Untersuchungsrichters, der je nach der Schwere des Falles mehr oder minder schleunig herbeieilt. Noch ist die Haft provisorisch.«
»Ach ja«, sagt Balzac, »das ist alles sehr schön, erschöpft aber die Sache noch lange nicht. Sie befinden sich hier im Hofe des Justizpalastes. Dort aber, in der Provinz, in Macon, stehen sich Ursache und Wirkung ganz anders gegenüber. Sie lesen das Protokoll, aber welche Intrige den Untergrund bildet, welche Rivalität zwischen zwei Provinzgrößen, das können Sie von hier unmöglich entscheiden.«