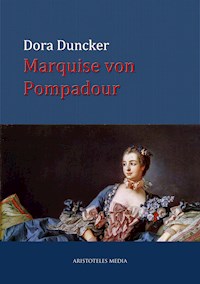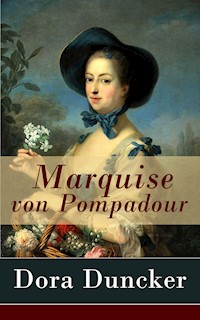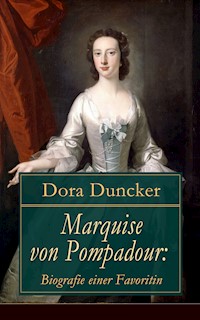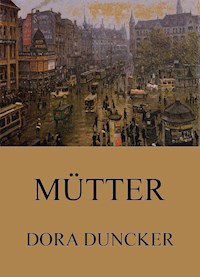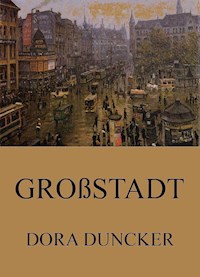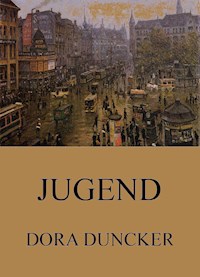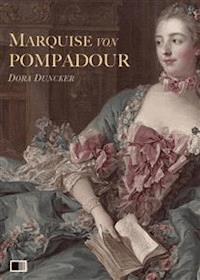Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dora Duncker stellt, gestützt auf umfassendes und zuverlässiges historisches Material, den Werdegang der Madame d'Etoiles dar, die sich durch ihre Schönheit und ihr Zielbewußtsein zur allmächtigen Maitresse Ludwigs XV. aufschwang. Das Ganze erweitert sich zu einem stimmungsvollen Kulturbild und wird eingerahmt von der Kultur des damaligen Frankreich, von der hohen Politik und von der Sittenverderbnis und Pracht des Hofes, dessen Mittelpunkt der Wüstling und Schwächling Ludwig XV. ist. Immer erscheint die Pompadour als die geistige Führerin und Beraterin des Königs, bis dieser verzweifelnd an ihrem Sterbebett steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DORA DUNCKER
MARQUISE VON POMPADOUR
Ein Roman aus galanter Zeit
Reese Verlag
Marquise von Pompadour
1
In dem großen Kamin knisterten die Buchenscheite. Die aufschlagenden Flammen erhellten den kleinen lauschigen Salon mit rubinrotem Licht. Warm und wollig drang es bis in die Falten der schweren, dunkelblauen Brokatvorhänge, die über die zugefrorenen Fensterscheiben fielen.
Auf einem niederen Taburett vor dem Feuer saß ein junges Weib. Die schlanke, ebenmäßige Gestalt im leichten, bequemen Seidengewand war ein wenig vornübergebeugt. Der Widerschein der Flammen, gegen die sie die feinen schönen Hände ausgestreckt hielt, um sie zu erwärmen, umspielte das lichtbraune Haupt und ein Stück des weißen Nackens.
Hinter ihr, die Hände auf die Schultern des jungen Geschöpfes gelegt, stand ein fast fünfzigjähriger Mann, eine stattliche, vornehm gekleidete Erscheinung. Die graue Puderperücke stand eigenartig zu dem frischen Gesicht mit den jungen lebhaften Augen.
„Nun Jeanne, noch immer in Gedanken?“ fragte er, sich ein wenig niederbeugend und mit der Rechten leicht über das reiche weiche Haar des jungen Weibes fahrend. „Sollte man am Ende doch Sehnsucht nach dem auf Reisen geschickten Gatten haben?“
Jeanne d’Étioles sprang lachend auf, daß die weißen Zähne zwischen den ein wenig blassen Lippen schimmerten. In ihren Augen von unbestimmter Farbe spielten tausend lustige Teufelchen.
Sie schob ihren Arm unter den des Mannes.
„Das glauben Sie ja selbst nicht, Onkel Tournehem. Sie wissen ja so gut wie ich, weshalb wir Charles auf Reisen geschickt haben.“
Der große Mann schmunzelte.
„Alle Wetter ja! Ungern genug ist er gegangen, mein immer noch verliebter Herr Neffe! Nun, und die grande affaire? Hat Binet noch nichts von sich hören lassen?“
Jeanne d’Étioles schüttelte den Kopf und schnippte dabei übermütig mit den feinen Fingern.
„Die arme Mama ist in tausend Ängsten. Ganz ohne Grund. Wenn Binet nicht kommt, gehe ich eben ohne Einladung nach Versailles. Aber unbesorgt, er wird kommen!“
Herr Le Normant de Tournehem blickte auf das reizende Geschöpf und war überzeugt, daß es recht behalten würde.
Mit einer raschen Bewegung ließ Jeanne sich wieder auf das Taburett zurückfallen und zog den Onkel ihres Mannes, ihren besten Freund, neben sich in einen der tiefen, dunkelblauen Seidensessel. Sie nahm eine seiner wohlgepflegten ringgeschmückten Hände zwischen die ihren.
„Lieber Onkel“, sagte sie lebhaft, während die Farbe ihr in das zarte Gesicht stieg, „es kann ja nicht fehlen. Alles wird kommen, wie es kommen muß, wie es gar nicht anders kommen kann. Ich fühle es hier und da —“ Sie machte zwei rasche Bewegungen gegen ihr Herz und die weiße kluge Stirn.
„Sie wissen ja, schon bei den Ursulinerinnen in Poissy nannten die Mädchen mich ‚kleine Königin‘ und scharten sich um mich und erwarteten meine Befehle.“
„Frau Lebou nicht zu vergessen“, fiel Tournehem ein, „die dir, als du kaum neun Jahr alt warst, prophezeite, daß du eines Tages die Maitresse unseres geliebten Königs sein würdest.“
Jeanne nickte nur und fuhr dann eifrig fort.
„Die Dinge lagen nicht immer so glücklich wie heute. Aber die Zeiten haben sich geändert, seit Frau von Châteauroux tot ist. Es gibt niemand mehr, der behaupten könnte, der König traure noch um sie, sein Herz sei nicht frei. — Damals freilich ...“
Jeanne lächelte ein wenig spöttisch.
„Im Walde von Sénart, als ich ihm in den Weg ritt, beherrschte ihn die Châteauroux noch vollständig. Der König durfte mir nicht Wort noch Gruß gönnen, obwohl —.“
„Obwohl du ihm schon damals in deinem blau und rosa Amazonenkleid und dem kecken Hütchen nicht übel gefielst, kleine Hexe!“
Jeannes schöne Augen strahlten triumphierend.
„Sie mögen mir’s glauben oder nicht. Onkelchen, der König hat mir neulich bei der Audienz nichts weniger als ein unfreundliches Gesicht gezeigt! Er hat mir die Generalpacht für meinen Mann ohne Umschweife gewährt — nur daß“ — ihr Gesicht senkte sich ein wenig nachdenklich — „wir waren allein — er hätte —.“
Herr Le Normant schüttelte den Kopf.
„Du kennst den König doch nicht so gut, als du dir schmeichelst. Er ist langsam und scheu, wenn ihm nicht gleich sehr viel entgegengebracht wird — und daß dies nicht geschehen, war recht und klug von dir.“
Sie unterbrach ihn rasch. Wieder war sie aufgeschnellt und dehnte und reckte die feine, geschmeidige, übermittelgroße Gestalt. Die Arme gegen die Flammen gebreitet, daß sie wie in Glut getaucht schienen, rief sie mit einer Stimme, die zugleich voller Sehnsucht und Willensstärke war: „Nur heraus aus dieser kleinen engen Welt — herrschen, seine Kräfte spüren, die Zügel in festen Händen halten — sein Ich durchsetzen gegen jeden Widerstand.“
„Und Marie Leszinska, die Königin?“
„Bah, sie ist keine Frau für Louis den Vielgeliebten — um sieben Jahre älter — häßlich — hergenommen von neun Kindbetten — ohne Geist und Willen. Eine Marie Leszinska fürchte ich nicht. Nichts — niemand fürchte ich — denn ich liebe ihn.“
Herr von Tournehem lächelte ungläubig.
„Jeanne, betrüge dich nicht! Wie solltest du dazu kommen, den König zu lieben?“
Sie warf den Kopf in den Nacken. Die Flamme der Buchenscheite wob einen leuchtenden Feuerschein um das lichtbraune Haar.
„Ich liebe ihn, weil ich ihn lieben will. Verstehen Sie das, Onkel Tournehem?“
Herr Le Normant blieb stumm.
In Jeannes Augen stand ein Licht — heiß und stark, beredter noch als ihre Worte —, das jeden Widerspruch im Keim erstickte. Näher trat sie zu ihm hin und legte die Hände zärtlich auf seine Schultern.
„Wenn ich dem König gefalle, ganz gefalle, danke ich’s Ihnen, Onkel Tournehem. Sie haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Sie haben mir den Sinn für alles Schöne und Große erschlossen. Sie haben mich in den strengen Wissenschaften, in allen freien Künsten erziehen lassen, Sie haben mir gezeigt, daß es auch für eine Frau andere Aufgaben gibt, als einen Mann zu nehmen und Kinder zu bekommen.“
„Und Alexandra?“ warf Tournehem mit dem Versuch zu scherzen ein.
Jeanne lächelte ein zärtliches Mutterlächeln.
„Es ist gut, daß sie da ist, die Kleine — um so besser, da ich das erste Kindchen so rasch verlor —, aber sie läßt Raum für vieles andere, Raum und Kraft, die Welt mit meinem Namen zu erfüllen. Und ist es so weit, so sollen Sie mich dankbar finden. Sie, der Vater und die Mutter und Bruder Abel, alle die mir Gutes getan.“
„Und Charles Guillaume, dein Gatte?“
„Er ist ein guter, anständiger Junge — im übrigen —. Wenn er meiner bedarf —. Natürlich —.“ Herr von Tournehem wußte genug.
Hinter einem der dunkelblauen Brokatvorhänge öffnete sich die Tür. Eine noch schöne, kränklich aussehende Frau um Anfang der Vierzig trat ein. Lebhaft, mit gewöhnlichen Bewegungen, die weitab von der vornehmen, rassigen Grazie ihrer Tochter standen, kam sie auf Jeanne und Tournehem zu.
„Was sagt Ihr! Vetter Binet noch nicht hier? Jedenfalls hat er keine Einladungskarte für Jeanne erhalten — und gerade zu den Hochzeitsfeierlichkeiten des Dauphins nicht — es ist — man möchte —“ Madeleine Poisson machte Miene, mit dem Fuß aufzustampfen.
Ein Blick auf Tournehem ließ sie innehalten.
„Meine liebe Madeleine“, sagte er halblaut, „Sie sind nicht mehr so bezaubernd, daß Sie sich dergleichen Extravaganzen noch gestatten dürften. Früher hat man Ihnen auf Konto Ihrer Schönheit mancherlei verziehen. Selbst Herr Poisson ist gegen Ihre allzustürmischen Emotionen empfindlich geworden.“ Sie tat, als habe sie ihn nicht gehört, und ging mit ausgebreiteten Armen auf Jeanne zu, die ernst und nachdenklich in die Flammen blickte.
„Mein armes Kind, haben wir dich dafür so vornehm erzogen, bist du darum so engelschön, daß dieser Esel, dieser Binet — oder hat er vielleicht vergessen, daß das Hôtel des Chèvres in der Rue Croix des Petits Camps liegt?“
Jeanne fuhr der Mutter über das welke, bis vor kurzem noch so schöne Gesicht, das das ihre an Zauber noch übertroffen hatte.
„Beruhigen Sie sich doch, geliebte Mama! Vetter Binet ist kein Esel —.“
„So hat er die Einladung nicht bekommen, was noch schlimmer ist“, schluchzte Madeleine Poisson.
„Er wird sie schon bekommen haben. Sie unterschätzen die Macht des Kammerdieners Sr. Hoheit des Dauphins. Aber vergessen Sie nicht, die Hochzeitsfeierlichkeiten bringen viel Arbeit — und ehe er von Versailles bis zum Hôtel des Chèvres kommt!“ Frau Poisson trocknet ihre Tränen.
„Du magst recht haben, mein Liebling. — Du bist ja klüger als wir alle zusammen, meine geliebte Jeanne.“
Sie herzte und küßte ihr schönes Kind.
„Herr von Tournehem“, sagte sie dann, sich mit gekünsteltem Zeremoniell nach ihm zurückwendend.
Tournehem verneigte sich in gleicher Art mit der leichten liebenswürdigen Ironie, die ihm eigen war.
„Madame Madeleine Poisson?“
„Poisson schrieb mir heute flüchtig und beruft sich auf einen Brief an Sie, den er Ihnen per Kurier, vom Rhein glaube ich, sandte. Er sagte, er habe Ihnen darin den jetzigen Stand seiner Angelegenheiten auseinandergesetzt. Wie liegen die Dinge?“ Auch Jeanne trat vom Feuer fort auf Herrn Le Normant zu.
„Ja, was machen die Angelegenheiten des armen Papa? Man sollte sich wirklich besser anstrengen, seine lange Verbannung wieder gutzumachen. Die Brüder Paris, für die er sich doch im Grunde geopfert, dürften sich mehr für ihn ins Zeug legen.“
„Ta, ta, meine liebe Jeanne, wir dürfen — trotz aller schuldigen Liebe — die Fehler deines Vaters denn doch nicht gar zu gering anschlagen. Er hat als Angestellter der Proviantkommission ein bißchen stark auf eigene Hand gewirtschaftet.“
„Ich muß sehr bitten“, fuhr Madeleine Poisson auf, „François hat sich bei der Verproviantierung von Paris zuschanden gearbeitet. Da können kleine Irrtümer in den Finanzen schon Vorkommen.“
„Das Schatzamt hat 232000 Livres zu Recht von ihm zurückverlangt. Wenn Sie das kleine Irtümer nennen!“
Madeleine fuhr abermals auf.
„Lassen Sie doch die alten Geschichten, Tournehem. Das Urteil wurde vor beiläufig achtzehn Jahren gefällt. Da Seine Eminenz, der Kardinal Fleury, es durchgesetzt hat, daß François nach acht Jahren aus Deutschland zurückkommen durfte, da er vom Staatsrat Entlastung für einen Teil seiner Schulden erhalten, da die Paris ihn mit Freuden wieder in ihre Dienste genommen haben, kann mein Mann doch nicht ganz der Dieb und Räuber sein, zu dem Sie ihn stempeln wollen.“
Tournehem lächelte über den Zorn der Freundin. Sich bequem in den schweren, vergoldeten Armstuhl zurücklehnend, in dem er im Laufe des Gesprächs Platz genommen hatte, meinte er: „Da wären wir ja wieder bei dem alten Streit, der so überflüssig als irgend denkbar ist; denn wir haben alle drei nur Poissons Bestes im Auge, das er, nebenbei gesagt, seiner Begabung und seiner Energie halber vollauf verdient.“
„Ja, das haben wir, Onkelchen, und wenn ich erst da bin, wo ich bald sein werde“, — sie tauschten einen raschen Blick des Einverständnisses — „soll der Vater bald zu hoher Gunst und Ehre gelangen!“
Madeleine Poisson umarmte gerührt ihr schönes Kind.
„Ja, du, du wirst uns alle glücklich machen“, schluchzte sie; dann, fast in demselben Atem, in ihren heftigen Ton zurückfallend, fing sie aufs neue auf Binet zu schelten an: „Wäre nur dieser verdammte Dummkopf erst da!“
Tournehem nahm den Faden wieder auf, ohne des weiteren auf den temperamentvollen Ausbruch Madeleine Poissons zu achten. Vierundzwanzig Jahre hatten genügt, ihn daran zu gewöhnen.
„Im übrigen geht es Poisson nichts weniger als schlecht. Seine Reise an den Rhein, wohin ihn die Paris vorige Woche mit einem geheimen Auftrag geschickt, scheint sich recht einträglich zu gestalten. Klug, ehrgeizig und raffiniert, wie Poisson ist, wird er bald wieder Oberwasser haben.“
„Wollte Gott und die heilige Jungfrau, es wäre so!“ Frau Poisson schlug die Augen fromm gegen die Salondecke auf. „Ich habe heute schon dreimal für ihn im Betstuhl gekniet.“
„Hoffentlich nicht vergebens“, tröstete Le Normant ironisch.
Halblaut fügte er hinzu. „Sie wissen doch, Madeleine, daß dem Himmel die Gebete der Sünder wohlgefälliger sind als die der Gerechten!“
Frau Poisson tat, als habe sie ihn nicht gehört, was sie nicht hinderte, ihm einen koketten Blick aus ihren noch immer bezaubernd schönen Augen zuzuwerfen.
Jeanne, die das Talent hatte, alles zu sehen und zu hören, auch wenn sie mit ganz anderen Dingen beschäftigt schien, war die leise Bemerkung Tournehems und das Augenspiel ihrer Mutter nicht entgangen, obwohl sie seit einer ganzen Weile schon gegen das Fenster lehnte.
Wieder schoß ihr ein Gedanke durch den Kopf, der ihr schon öfter gekommen war: Sollte Tournehem, dieser vornehme Kulturmensch, der ihr in Abwesenheit des Vaters eine so gediegene Erziehung gegeben, mit dem sie soviel kluges Verstehen verband, nicht am Ende ihr eigener Vater sein?
Nachdenklich preßte sie die Stirn gegen die gefrorenen Scheiben. Was nützte das Grübeln? Sie würde die Wahrheit vermutlich nie erfahren. Im übrigen würde diese Wahrheit weder an ihren Gefühlen, noch an ihrer Beurteilung der beiden Männer auch nur das geringste ändern.
Sie hatte sie beide lieb, den begabten, gewalttätigen, grobschlächtigen, im Grunde gutmütigen Poisson sowohl, als den vornehmen, weltmännischen Tournehem.
Sie würde, wenn sich ihres Lebens Ziel erfüllte, an der Zukunft, an dem Glück und dem möglichen Ruhm beider mit gleicher Willenskraft arbeiten.
Als Jeanne d’Étioles sich zu den anderen zurückwandte, hörte sie, daß Tournehem von ihrem Bruder Abel sprach.
„Was nützt ihm seine Schönheit, Madeleine, wenn er faul und ohne Ehrgeiz ist?“
Die Frau, die in einem Stuhl vor dem Feuer kauerte, meinte müde, daß sie nicht wisse, wie ihr einziger Sohn zu diesem Mangel an jeglichem Temperament komme. In der Hauptsache sei Abel scheu und schüchtern über die Maßen, und aus diesem Grunde zu keiner Stellung tauglich.
„Der Effekt bleibt derselbe.“
„Ich werde ihn schon aufrütteln. Wartet’s nur ab!“ rief Jeanne, die wieder zu ihnen getreten war, den schönen Kopf stolz im Nacken.
„Sieh zu, gutzumachen, was dein Vater mit der Knute verschüttet hat!“
„Keine Sorge, Onkel Tournehem, ich weiß schon, wie der Bruder zu nehmen ist.“
„Still!“ rief Frau Poisson, aus ihrem Stuhl aufschnellend. „Es biegt ein Wagen in die Rue Croix des Petits Camps.“
Sie stürzte ans Fenster und versuchte, mit den Nägeln den Frostschleier von dem Glase zu schaben.
Dann, als das Geräusch eines auf dem holprigen Pflaster näher kommenden Wagens stärker wurde, flog sie zur Tür, riß sie weit auf und schrie laut nach der Jungfer.
Nanette legte im Erdgeschoß die letzte Hand an Jeannes Maskenkostüm für das Fest in Versailles. Das Kostüm war bis jetzt für jeden tiefes Geheimnis geblieben.
„Nanette! Nanette!“
Der schwarze Kopf der Gerufenen wurde auf der Treppe sichtbar.
„Rasch öffnen! Es kommt Besuch, mach’ den Wagenschlag auf!“
Herr Binet, Kammerdiener Seiner Hoheit des Dauphins, lächelte mit glatten Mienen, als er den Eifer der hübschen Zofe sah.
„Gemach, gemach, Kleine! Sie reißen mir ja den Mantel in Stücke. Eilt’s denn so sehr?“
Dann rief er dem Kutscher die Weisung zu, in einer Stunde wieder vorzufahren.
Nanette starrte derweilen verzückt auf das kunstvoll gemalte Wappen am Wagenschlag.
Herr Binet schritt ihr mit großen, majestätischen Schritten voraus, die Treppe hinauf.
„Meine schöne Cousine zu Haus?“ fragte er nachlässig zurück.
Auf den oberen Stufen wurde Frau Madeleines scharfe Stimme laut.
„Wir erwarten Sie schon, Vetter. Mit Ungeduld erwarten wie Sie.“
Binet zuckte vornehm die Schultern unter dem dunklen Mantel.
„Hofdienst, meine liebe Madame Poisson, geht vor Frauendienst!“
Auf der obersten Stufe angelangt, küßte er Madeleine galant die Hand.
„Ich grüße Sie, Madame Poisson!“
„Warum so steif, mein lieber Binet, weshalb nicht Cousine — Tante?“
„Weil ich mit den Étioles, nicht mit den Poissons verwandt bin“, gab der Kammerdiener Seiner Hoheit des Dauphins mit Würde und starkem Nachdruck zur Antwort.
Frau Poisson hielt ihren Gast an den weit ausfallenden Spitzen seines Ärmels fest.
„Gleichgültig! Die Hauptsache, bringen Sie die Einladungskarte? “
Wieder zuckte der große Mann die Schultern.
„Wäre ich sonst hier?“
Frau Poisson atmete erleichtert auf und bekreuzigte sich.
„Gott sei Dank! Gott sei Dank!“
Als sie in den blauen Salon traten, in dem die Holzscheite zusammengesunken waren und nur noch schwachen Lichtschein gaben, fanden sie das Zimmer leer.
Während Frau Poisson den vielarmigen Lüster entzündete, fragte Binet ungeduldig nach Madame d’Étioles.
„Mein Auftrag geht an meine schöne Cousine.“
„Sie wird bei der Kleinen sein. Jeanne ist eine zärtliche Mutter!“
„Ein Vorzug mehr“, meinte Binet vieldeutig, mit zynischem Lächeln.
Nanette, die den schon vorher beorderten Muskateller und die kleinen Körbchen mit süßem Kuchen, Binets Lieblingskuchen, vor dem Gast niedersetzte, erhielt den Auftrag, Frau d’ Étioles zu rufen.
Kaum daß Madeleine ausgesprochen hatte, trat Jeanne schon ins Zimmer, strahlend, erwartungsvoll.
Binet küßte die schöne, schlanke Hand länger, als nötig gewesen wäre.
„Alles steht zum besten!“ flüsterte er. „Ich habe Ihnen viel zu sagen.“
Jeanne nickte und ersuchte ihre Mutter, sie mit Herrn Binet allein zu lassen.
Als Madeleine zögerte zu gehen, fragte Binet ungeduldig:
„Darf ich fragen, Madame, wer im Hôtel des Chèvres Herrin ist? Sie, die Sie nur Gast sind, oder Madame d’Étioles, der das Haus gehört?“
Frau Poisson wollte heftig werden. Ein bittender Blick der Tochter besänftigte sie sofort. Schweigend und verärgert verließ sie mit raschen Schritten das Zimmer.
„Und nun erzählen Sie, Vetter“, bat Jeanne mit heißen Wangen. „Hab’ ich dem König wirklich gefallen? Will er mich wirklich beim Fest haben? Seine blauen Augen, bei Gott, die schönsten blauen Augen Frankreichs, wie man sie nennt, sahen mich bei der Audienz sehr gütig an. Haben Sie Seiner Majestät gesagt, daß ich schon um ihn geweint, als er in Metz auf den Tod lag?“
Binet streichelte die schöne Hand seiner Cousine.
„Alles hab’ ich ihm gesagt, direkt oder durch den Herzog von Ayen. Seine Majestät hat die bezaubernde Amazone aus dem Walde von Sénart nicht vergessen. Übrigens dürfen Sie Ayen getrost als Ihren Bundesgenossen betrachten.“
Binet griff in die Tasche.
„Hier die Einladungskarte für die Schlußfeierlichkeiten der Hochzeit. Morgen Maskenball in Versailles, übermorgen Ball im Stadthaus.“
Jeanne wiegte mit triumphierendem Lächeln die Karte in der Hand. Laut las sie ihren Namen und das Datum der Tage.
„Man wird ihn sich merken müssen, diesen 25. Februar 1745, an dem eine gewisse Madame d’Étioles zum erstenmal das Parkett von Versailles betrat“, meinte Binet vielsagend.
Jeanne saß nachdenklich da, das feine Oval ihres Gesichtes in die Hand gestützt.
Nach einer kleinen Pause, während Binet wohlgefällig und seiner Sache gewiß das schöne Geschöpf betrachtete, sagte sie zögernd:
„Wir haben in unserem Optimismus eins nicht bedacht, Binet. Ich gehöre nicht zur Hofgesellschaft, ich bin eine Bürgerliche. Wird der König darüber fortkommen?“
Binet bewegte mit der Miene des Besserwissers den Kopf.
„Gerade darin liegt ein neuer Anreiz für Seine Majestät. Er hat die Mailly, die Vintimille, die Châteauroux gründlich satt. Diese drei Schwestern Nesle haben ihm genug zu raten aufgegeben. Die Zeit der vornehmen Damen ist für ihn vorüber. Sie haben ihm zuviel Ungemach eingetragen.“
„Immerhin, er hat sie geliebt. Seltsam — drei Schwestern — eine hat die andere abgelöst.“ Und bei sich dachte sie: Dieu merci, daß ich keine Schwestern habe!
„Der König liebäugelt mit dem Bürgertum. Er braucht den Bourgeois und will ihn dadurch ehren, daß er keine Frau von Geburt mehr zur Geliebten nimmt. Aber das alles wird Ihnen der Herzog von Ayen oder — der König selbst viel besser erklären, als ich es vermag.“
Er hielt einen Augenblick inne.
„Sie sind sehr klug, Jeanne, und dabei, leugnen Sie es nicht, im Grunde eine kalte Natur. Sie werden, wenn Sie die Gunst Louis des Vielgeliebten erringen — und ich zweifle nicht daran —, sehr bald tiefer und klarer in die Dinge hineinschauen als wir, trotzdem wir seit Jahren am Hofe sind. Nur auf eines möchte ich Sie von vornherein aufmerksam machen: des Königs Gedanken und Sinne bleiben bei keinem Gegenstand, auch bei keiner Frau, lange stehen. Wer ihn halten will, muß es verstehen, ihn dauernd zu beschäftigen und zu amüsieren, mit einem Wort: es verstehen, ihn über sich selbst hinauszubringen, damit er den unwiderstehlichen Anwandlungen der melancholischen Langeweile, die ihn wie eine Krankheit gefangen hält, nicht unterliegt.“
Jeanne nickte verständnisvoll.
„Ich weiß von diesen Anwandlungen. Abbé Bernis und der Herzog von Nivernois, die ich auf den Montagen der Madame Geoffrin kennen lernte, und die dann später in Étioles viel bei mir verkehrten, haben mir öfter davon erzählt. Auch Voltaire weiß ein Lied davon zu singen. Wo mag der alte Spötter stecken?“
„Wie man sagt, in Cirey bei seiner Freundin.“
„Der weisen Marquise von Châtelet!“ lachte Jeanne. „Ich kann sie mir lebhaft vorstellen, die beiden, wie sie in ihrer geliebten Champagne Mathematik und Naturwissenschaften miteinander treiben — anstatt —“ Sie biß sich auf die Lippen und verhielt ein Lachen.
Binet blickte nach der Bouleuhr auf dem Kaminsims.
„Gleich neun! Um zehn hab’ ich Dienst. Übrigens fragt Seine Hoheit, sonst die Präzision in Person, momentan nicht viel nach Pünktlichkeit, so verliebt ist er in die Infantin, seine Braut.“
„Um so besser“, dachte Jeanne. „So wird er sich nicht um andere Dinge kümmern, bei denen man den frommen Herrn ganz und gar nicht brauchen kann.“ —
Binet war aufgestanden, nachdem er den letzten der kleinen, süßen Kuchen zwischen die Lippen geschoben.
„Nur eine Frage noch, schönste Cousine! Haben Sie für ein interessantes Kostüm gesorgt, und was ist es, was Sie tragen werden?“
Jeanne legte den Zeigefinger auf den Mund. „Pst!“ machte sie. „Staatsgeheimnis, Herr Vetter!“
„Oh! Oh! Ich werde es doch erfahren dürfen?“
„Trotz aller schuldigen Dankbarkeit — nein!“
„Wirklich unerbittlich?“
„Unerbittlich!“
Jetzt sah Jeanne auf das Zifferblatt.
„Der Dienst ruft, Herr Vetter. Selbst ein verliebter Dauphin braucht seinen Kammerdiener — Vielleicht erst recht —“
Sie knixte und öffnete ihm die Tür.
„Ein Tausendsassa, diese schöne Frau. Zehn gegen eins, sie gewinnt das Spiel“, dachte Binet, während er die Treppe hinunterstieg.
Kaum war die Tür hinter Binet zugefallen, als Jeanne den kleinen Schreibtisch zwischen den brokatnen Fenstervorhängen aufschloß und ihm eine Rolle entnahm. Sie trug sie zu dem Tisch mit dem vielarmigen Kerzenleuchter und entfaltete sie.
Die Gravüre zeigte das Porträt Athenais von Montespans nach dem berühmten Gemälde von Mignard. Jeanne hatte ihr Kostüm zum morgigen Maskenfest genau nach dem Kostüm anfertigen lassen, das die Geliebte Louis’ XIV. auf diesem Bilde trug.
Nur die Kostbarkeit der Edelsteine und Spitzen hatte sie nicht imitieren lassen können. Dazu reichten die Mittel Herrn d’Étioles, trotz der Freigebigkeit Onkel Tournehems, nicht aus.
Lange und nachdenklich blickte Jeanne auf das Blatt, das sie heimlich einer der Sammlungen des Onkels entnommen hatte.
Würde der König Gedanken und Absicht erkennen, die sie dazu verführt hatten, gerade dies Gewand zu wählen? Aufmerksam betrachtete sie das wundervolle Blau der spitzenverzierten, seidenen Schoßtaille, den reich gestickten Seidenrock, den von den Schultern fallenden, braunroten Samtmantel, die Perlenschnur, die sich durch das gewellte, hoch aufgetürmte Haar, von ähnlicher Farbe wie das ihre, schlang.
Jeanne wußte nicht, sollte sie es wünschen oder fürchten, daß der König ihre Absicht erriet?“
Wie siegesgewiß Mignard dies schöne Weib, das eine La Vallière zu verdrängen imstande gewesen, auf das Blatt gezaubert hatte!
Und doch war dem Sieg die Niederlage gefolgt! Nach der Montespan war eine Maintenon gekommen und hatte ihr das Zepter entrissen.
Jeanne fröstelte und trat näher zu dem Kamin, in dem die schwache Flamme am Erlöschen war.
Ihre Augen blickten mit tiefem Ernst in die sterbende Glut.
Dann warf sie den Kopf in den Nacken und biß mit den weißen Zähnen in die schön geschwungene Unterlippe, daß sie blutete.
Nein, in dem Frankreich Ludwigs XV. durfte es keine Maintenon geben!
2
Durch die eiskalte Februarnacht führte der Wagen Herrn von Tournehems Jeanne d’Étioles nach Versailles.
Die Sterne funkelten strahlend an dem blauschwarzen Himmel. Auf den Wegen lag der Schnee hart und festgefroren.
Wie in weiße, glitzernde Silbertücher gehüllt, standen die Bäume an den Straßenseiten, schimmernde Wegzeichen, die schon von weitem nach dem Königsschloß wiesen, dessen strahlend hell erleuchtete Fassaden weit ins Land hinein funkelten.
Jeanne lehnte aus dem Fenster des Wagens. Ihre Augen öffneten sich weit. Die Flügel ihrer feinen Nase bebten. Sie las aus den Lichtlinien ein Symbol ihrer glänzenden Zukunft. —
Im ganzen Umkreis des Schlosses staute sich die Menge. Die Pariser, immer bereit, zu sehen, dabei zu sein, gutlaunig im furchtbarsten Gedränge auszuhalten, standen zusammengedrängt wie eine Mauer. Die Wagen der Geladenen konnten nur mit Mühe vor das angegebene Portal gelangen.
Jeanne blickte strahlenden Auges auf die lange Reihe goldstrotzender, wappengeschmückter Karossen, mit ihren in Samt- und Seidenlivreen gekleideten Lakaien und Läufern, den Dreispitz auf den gelockten Puderperücken. Kavaliere, die die Zeit nicht erwarten konnten, um in den Ballsaal zu gelangen, sprangen ungeduldig aus den Seidenpolstern ihrer Kaleschen auf. Jeanne sah Wagentüren sich öffnen, im Schein der strahlenden Beleuchtung gold- und silbergestickte Habits, Spitzenjabots, Schärpengürtel mit schimmernden Degenknäufen, weiße Seidenstrümpfe und hohe Lacklederschuhe mit roten Hacken über dem hellen Schnee leuchten.
Den Hut samt dem langen Elfenbeinstock mit dem Goldknopf in der Hand, die große Perücke ohne Puder über Hals und Schulter fallend, schritt die Noblesse gravitätisch einem der Schloßaufgänge zu.
Vorsichtiger waren die Masken. Sie hielten sich geduldig in den Karossen. Nur ab und zu sah Jeanne einen à la Watteau frisierten, gepuderten Frauenkopf, ein mit blaßfarbenen Bändern garniertes Seidenhütchen, einen — der jungen Dauphine zu huldigen — à l’espagnole kostümierten Kavalier, der sich weit aus dem großen Glasfenster seiner Kutsche beugte.
Langsam, Schritt vor Schritt, rückten die beiden Reihen der Karossen vor.
Ganz Paris schien sich auf den Weg nach Versailles gemacht zu haben, um das Hochzeitsfest des Dauphins und der jungen spanischen Infantin mitzufeiern, das wie kein anderer Bund die allgemeine Sympathie der Nation auslöste. —
Der Empfang und das Spiel der Königin in der Spiegelgalerie, das um sechs begonnen hatte, war längst vorüber. Louis und Marie Leszinska hatten um neun Uhr an der Galatafel teilgenommen. Um Mitternacht war der Beginn des Maskenballes angesagt.
Die Massen, die auf das Schloß zudrängten, schienen noch immer zu wachsen. Längst hatten die Wagenreihen sich geteilt. An der großen Marmortreppe sowohl wie am Kapellenhof stiegen die Gäste aus und betraten von beiden Seiten die feenhaft erleuchteten Schloßgemächer.
Endlich war die Reihe auch an Jeanne d’Étioles gekommen. Vorwärts gedrängt und geschoben stand sie, ohne recht zu wissen, wie sie so weit gelangt, in der Tür der von Lichtströmen überrieselten Spiegelgalerie.
Mit weit geöffneten Augen starrte sie hinein.
Höher hob sich die Brust, stärker schlug das Herz des schönen Weibes.
Das war wahrhaft königliche Pracht! Mit hungrigen Augen trank sie den Anblick dieser unzähligen Kerzen, deren Glanz in den Spiegeln tausendfach widerspiegelte und sich über kostbare Seidenmöbel, über goldene und silberne, edelsteingeschmückte Ziergeräte und schwere brokatne Stoffe ergoß.
Unter den Deckengemälden von Lebrun stoben die Masken, sich neckend, miteinander schäkernd, durcheinander. An Jeanne vorüber, die ein wenig zurückgetreten war, um besser beobachten zu können und etwa bekannte Gestalten herauszufinden, zogen Kostüme aller Nationen: Armenier, Türken, Chinesen, Afrikaner.
Zwischendurch trieben Harlekins und Kolombinen, Pilger und Pilgerinnen ihre tollen Kapriolen. Gravitätisch schritten Ärzte und Gelehrte mit hohen Perücken, lange goldknöpfige Stöcke in den Händen, durch die Menge, als seien sie geradeswegs den Komödien Molieres entstiegen.
Frauen in weiten Reifröcken, mit Blumenfestons und einer unzähligen Menge von Volants und Falbalas geschmückt, mit Paniers von einem Umfang, daß die kleinen Frauen wie Kugeln, die großen wie Glocken aussahen, trugen der Mode des Tages mit einem leichten Anflug des Karikaturistischen, wie ein Maskenfest es gestattet, Rechnung.
Männer in kostbar gestickten Röcken aus drap d’argent oder drap d’or stelzten an Jeanne vorbei. Sie trugen die Hoftracht Louis’ XV. und hatten nur Masken vorgelegt und die Perücke leicht gepudert.
Als die Gruppe vorüber war, hörte Jeanne hinter sich sagen:
„Haben Sie die Hofherren gesehen, Komtesse?“
Eine vergnügte junge Stimme gab bewundernd zurück:
„Oh, prachtvoll waren sie. Es müssen sehr reiche Leute sein.“
Der Sprecher dämpfte den Ton, aber Jeannes hellhörige Ohren verstanden ihn doch, als er der kleinen Komtesse antwortete:
„Ein großer Irrtum. Die Herren sind arme Landjunker, vom König zu den Vermählungsfeierlichkeiten befohlen. Da sie die Prachtliebe des Monarchen kennen und Kleider, wie sie sie tragen und tragen müssen — keines ist unter 2000 Livres herzustellen — nicht bezahlen können, haben sie mit einem Pariser Schneider das Abkommen getroffen, Anzüge für die drei Hauptfesttage zu entleihen. Zu einem Extramaskenanzug reichte es dann wohl nicht mehr aus.“
Jeanne hatte aufmerksam zugehört. Ein jedes Wort, das sie über die Verhältnisse am Hof Louis’ XV. aufklärte, war ihr von größter Wichtigkeit.
Jetzt stürmte eine Gesellschaft von Polen an ihr vorüber, schlanke geschmeidige Gestalten, die der Königin zu Ehren die Nationaltracht ihres Geburtslandes angelegt hatten.
Durch eine Verschiebung der Gruppen rückte sie selbst nach und nach mehr in den Vordergrund.
Ihre zierliche, ebenmäßige Gestalt in dem interessanten Kostüm, der reizende Nacken, die Rundung des zarten Kinns, das wundervolle Haar, das in seiner natürlichen Farbe goldbraun im Glanz des Lichtmeers schimmerte, begann aufzufallen.
Zwei Harlekins umtanzten sie mit gewagten Sprüngen und gewagteren Reden.
Einer der Ärzte schritt mit langen Schritten auf sie zu und bestand darauf, ihr den Puls zu fühlen. Ein venezianischer Doge machte sich von seiner Dame, einer rotblonden Kolombine, los und trat rasch auf Jeanne zu.
„Schönste Athenais, darf ich Sie um einen Tanz bitten?“
Jeanne lächelte unter ihrer Maske, aber sie bewegte verneinend den Kopf.
Niemand sollte ihre Aufmerksamkeit ablenken.
Dieses Fest hatte für sie nur ein Ziel — und dieses Ziel hieß der König!
Der Doge ließ sich nicht so ohne weiteres abweisen.
„Der lebendig gewordene Mignard. Die goldene Zeit Ludwigs XIV. wird wieder wach. Seien Sie nicht grausam, schönste Athenais! Die Montespan war es auch nicht — und wenn ich mir leider nicht schmeicheln kann, le roi soleil zu sein —.“
Jeanne wurde aufmerksam. Diese junge Stimme kam ihr plötzlich sehr bekannt vor. Die wundervollen, blendend weißen Zähne, die stattliche, ein wenig zur Fülle neigende Gestalt, die galanten Manieren des Dogen — nein, sie irrte nicht — in dem pomphaften Prunkgewand steckte Abbé Bernis, ihr guter Freund aus d’Étioles.
Es galt doppelte Vorsicht. Bernis hatte ihr stets eine sehr warme Verehrung entgegengebracht, ja beinahe mehr. Sie durfte sich mit keinem Wort, mit keiner Bewegung verraten. Er würde ihr sonst nicht von der Seite gehen.
Nicht Freund noch Feind durfte ihr heut abend in die Karten sehen.
Zu Jeannes Glück entstand gerade in diesem Augenblick eine starke Bewegung unter der noch immer wachsenden Menge der Masken.
All ihre Nerven spannten sich. Sollte der König —?
Binet hatte ihr heute morgen, im letzten Augenblick noch, verraten, welch ein Kostüm der schöne Herrscher tragen würde.
Eine der Spiegeltüren öffnete sich. Jeanne fühlte, daß ihre Hände eiskalt wurden. Dann strömte das Blut ihr wieder zum Herzen zurück. Nein, es war nicht Louis der Vielgeliebte!
Eine Reihe unmaskierter Personen betrat die Galerie.
Jeanne erkannte den Dauphin mit seiner jungen Gemahlin. Dem Paar voran schritt, am Arm eines Kammerherrn, Maria Leszinska, unvorteilhaft wie stets gekleidet. Wie stets schien auch an diesem Tage ein Hauch von Langeweile von ihr auszugehen.
Der Dauphin in der Tracht eines ländlichen Gärtners hielt glückstrahlend die Fingerspitzen seiner Gemahlin, die als Blumenmädchen kam. Beide waren im Stil Watteaus kostümiert. Hinter dem jungen Paar schritten der Herzog und die Herzogin von Chartres.
Eine Weile blickte Jeanne der Gruppe nach, die langsam, von den Masken umdrängt und neugierig betrachtet, durch den Saal schritt und sich dann auf den erhöhten Estraden verlor, auf dem die Königspagen Erfrischungen reichten.
Ringsum begann man unruhig zu murmeln. Wo blieb der König?
Jeanne stand gerade und reglos wie eine Statue. Selbst wenn sie keine Maske getragen, würde niemand ihrem Gesicht angesehen haben, was in ihrer Seele vorging. Ihr Auge hing an einer Gruppe unmaskierter Damen mit ihren Kavalieren, die in ungeduldiger Aufregung lebhaft konversierten, die edelsteingeschmückten Fächer in steter, nervöser Bewegung haltend.
Jeanne hörte dicht hinter sich sagen, daß die reizendste der Frauen die Prinzessin von Rohan sei; die kleinere, ihr zunächst stehende, die Herzogin von Lauraguais. Beide Damen hatten, wie man sich zuraunte, es darauf abgesehen, den schönsten der Monarchen zu fesseln, ihm die Châteauroux zu ersetzen.
Wie eine geheime Parole schien es durch den festlichen Saal zu laufen, daß der König gewillt sei, gerade heute seine Gunst aufs neue zu verschenken.
Madame d’Étioles lächelte nur. Aber niemand sah dies kalte, beinahe grausame Lächeln.
Da plötzlich laute, lachende Zurufe in der lichtüberströmten Galerie. Von der Seite der Königsgemächer kommt ein gar merkwürdiger Zug. Acht Taxusbäume, im Geschmack der Zeit — die noch immer von den Einfällen Le Nôtres zehrte — zugeschnitten, setzten sich langsam, gravitätisch in Bewegung. Eine Gruppe schöner Frauen, die wohl ahnen mochten, wer in einem der Taxusbäume steckte, umschwärmte die dunkelgrünen Wandelgestalten.
Wie Jeanne die Gruppe gewahrt, geht ein Ruck durch ihren schönen Körper. Die große Stunde ihres Lebens ist gekommen. Sie findet Louis den Vielgeliebten auf den ersten Blick an Gang und Haltung zwischen seinen Kavalieren heraus. Ihr scharfes Auge hätte ihn unter Hunderten erkannt.
In der Mitte der Galerie teilt sich die Gruppe der Taxusbäume, laufend, hüpfend, tanzend. Mit dem gravitätischen Gang ist es zu Ende. Minder lebhaft als die anderen schreitet der König, den Jeanne nicht aus den Augen läßt. Er begrüßt die Damen Rohan und Lauraguais mit jener lässigen, ein wenig müden Grazie, die ihm eigen ist.
Eine Gruppe von Kolombinen umhüpft ihn und macht sich dreist an ihn heran.
Augenscheinlich wissen die Übermütigen nicht, an wen sie ihre lockeren Späße richten.
Eine kurze, gebieterische Handbewegung läßt sie erschreckt auseinanderstieben.
Dem Hof auf den Estraden dreht der königliche Taxus wie absichtlich den Rücken. Leises Lachen schüttelt ihn, als er ein leichtlebiges Weibchen, eine lange spanische Seidenmantille um die runden Schultern, nach seinen grotesken und wenig hoffähigen Manieren zu urteilen eine Bürgersfrau, erblickt, die sich an einen Taxus hängt, der ihm selbst an Gestalt und Bewegung am meisten gleicht. Wahrhaftig, die Kleine hat Courage. Kein Zweifel, sie hält den Taxus, den sie umgarnt, für den König. Laut auf lacht Louis. Der Kavalier, Maria Leszinska verschwägert, wird warm. Er läßt sich nicht lange bitten und entführt die Leichtsinnige in die kleinen Kabinette.
Eine Weile sieht der König den beiden Entschwundenen nach, dann seufzt er gepreßt auf.
In ihm gähnt plötzlich wieder jene große qualvolle Leere, der er um alles zu entfliehen trachtet. Was gäbe er um ein Abenteuer, wie es seinem Vetter eben so mühelos in den Schoß gefallen ist! Er weiß, er braucht nur die Hand auszustrecken. Schneeige Nacken, weiße Hände, lockende Augen winken ihm von überallher. Ungezählte schöne Frauen sind bereit, sich auf den ersten Wink hinzugeben, ihm in den heimlichsten Winkel seiner „petits cabinets“ zu folgen.
Aber gerade das langweilt ihn. Irgend etwas, das anders als alles bisher Gewesene ist, schwebt ihm vor. Er hascht danach, er wähnt, es zu greifen, und wenn er es zu halten glaubt, entschwindet es ihm. Er möchte die Maske herunterreißen, die ihm vor einer Stunde noch so lustig schien, und die ihm jetzt unsäglich läppisch scheint. Aber er will das Fest nicht stören, den anderen, die die gleiche Maske tragen, das Glück nicht schmälern, für den König gehalten zu werden.
Er blickt um sich, unschlüssig, matt in der Haltung, beinahe verlegen. Seine Gedanken schweifen ab. Er ist nicht mehr in Versailles, nicht mehr in dem feenhaft strahlenden Festsaal.
Irgendwo klingen Königsfanfaren — ein schattender Wald — die Jagd — die Jagd in den Wäldern von Sénart. Neben ihm reitet die Châteauroux. Aber er sieht sie nicht. Drüben am Waldrand hält ein leichtes Phaeton, ein schlanker Rappe. Ein reizendes junges Weib hält die Zügel. Flimmernde rosa und blaue Seidenstoffe schmiegen sich eng um eine entzückende Gestalt. Die schönsten und pikantesten Augen, Augen voller Rätsel und Tiefe, blicken ihn an. Die Châteauroux spricht ein scharfes Wort, der Zauber ist gebrochen.
Nachdenklich grübelnd steht der König, gegen eine der Spiegeltüren gelehnt.
Irgend jemand hat ihm von dieser reizenden Amazone aus Sénart gesprochen. Wer war es nur? Plötzlich besinnt er sich. Der Herzog von Ayen — und ein anderer noch — der pfiffige Binet muß es gewesen sein. Die Gedankenkette schließt sich. Eine andere Stunde steigt plötzlich auf, da er sie hier in Versailles gesehen und gesprochen, die holde Fee von Sénart, in einer kurzen, ach viel zu kurzen Audienz, die ihm mit der Uhr zugemessen war.
Hat man ihm nicht gesagt, daß diese Frau, wenn er sich recht erinnert die Herrin von Étioles, eine Einladung zu dem Fest in Versailles erhalten hat? Ist sie der Einladung gefolgt? Ist sie hier? Wie soll er sie finden unter den vielen hundert Masken? Weshalb hat ihm dieser Binet nicht gesagt, welche Maske sie tragen wird?
Ein leises „Sire“, hinter ihm geflüstert, unterbricht seine Gedanken. Der Herzog von Ayen ist zu dem König getreten.
Er deutet mit der Hand unauffällig auf ein mit Gold ausgelegtes Konsoltischchen, neben dem eine im Stil der Zeit seines Ahnen gekleidete schlanke Frau steht.
Überrascht halten seine Augen das reizende Bild fest. „Die Montespan, wie sie leibt und lebt! Wissen Sie, Herzog, wer auf den originellen Einfall gekommen ist?“
Der Herzog flüstert ihm etwas zu. Erregt richtet der König sich aus seiner gedrückten Haltung auf. Rücksichtslos durcheilt er die Gruppen, die sich zwischen ihm und Jeanne d’Étioles stauen.
Jetzt steht er vor ihr und verneigt sich tief. Ein paar Augenblicke lang fehlt ihm das Wort. Dann reicht er ihr die Hand und fragt beinahe ehrerbietig: „Darf ich um die Ehre eines Rundganges bitten, schönste Marquise?“
Unter der knisternden Seide ihres blauen Gewandes schlägt Jeannes Herz laut und unregelmäßig, aber keine Bewegung verrät, was in ihr vorgeht. Leicht und graziös bewegt sie zustimmend den Kopf und überläßt ihre Hand der des Königs. Mit leisem Druck umspannt Louis der Vielgeliebte diese schönste Frauenhand, die er je in der seinen gehalten.
Einen Augenblick wartet Jeanne auf eine neue Anrede. Da der König schweigt, sagt sie mit ihrer zarten, wohlklingenden Stimme:
„Welch eine Ehre und Freude, Sire, daß Euer Majestät meine Maske gleich erkannt haben!“
Der König wird lebhaft.
„Meine Gedanken sind so oft, so mit ganzer Seele bei meinem großen Ahnen, daß ich alles, was mich an jene goldene Zeit Frankreichs erinnert, mit Freuden begrüße.“
Er ließ Jeannes Hand einen Augenblick aus der seinen und stellte sich vor sie hin, sie mit entzückten Blicken zu betrachten.
„Sie haben Geschmack, Madame, einen exquisiten Geschmack. Einen künstlerischen und historischen Blick zugleich.“
Jeanne lacht leise mit ihrem verführerischen Lachen und überlegt klug jedes Wort, das sie spricht.
„Wenn es so ist, Sire, wie Sie zu urteilen geruhen, so danke ich es der Erziehung meines Onkels, Herrn Le Normant de Tournehem. Er ist eine Künstlernatur und hat mich ganz nach seinen persönlichen Grundsätzen ausbilden lassen. Jelyotte gab mir Musikunterricht.“
„Das hört man Ihrer Stimme an, Madame; sie klingt wie eitel Musik.“
Der König hat aufs neue ihre Hand ergriffen und führt sie in der Richtung auf die Königsgemächer zu.
„Und was hat dieser treffliche Onkel Sie weiter lernen lassen, Madame?“
„Bei Guibandot tanzen, bei Crébillon dramatischen Unterricht und Deklamation.“
„Das läßt sich hören, Madame. Sie müssen mir gelegentlich einmal vorlesen, wenn meine melancholische oder heftige Laune mich überkommt, so etwa wie David König Saul mit seinem Harfenspiel besänftigte.“
„Es wird mir eine hohe Ehre seine, Sire.“
„Oder ziehen Sie vor, sich dramatisch zu betätigen?“
Lebhaft sagte Jeanne: „Das Theater ist meine Leidenschaft, Sire. Wir haben in Étioles eine große Bühne, die Herr von Tournehem neben dem Schloß erbauen ließ. Es sind dort Aufführungen veranstaltet worden, an denen selbst der gestrenge Herr Voltaire nichts zu tadeln fand, es sei denn, Crébillon lobte sie.“
Der König lachte ein heiteres unbefangenes Lachen, wie man es selten von ihm hörte.
„Haben Sie die beiden Kampfhähne wirklich zusammen bei sich gesehen? Und sind sie nicht mit Furor aneinandergeraten?“
Nun lachte auch Jeanne.
„Ich habe mein möglichstes getan, Sire, sie zu besänftigen.“
Louis streichelte ihre Hand. Leise und bedeutungsvoll sagte er:
„Diese schönste und zarteste Frauenhand kann ja nicht anders, als Frieden und Segen spenden.“
„O Sire, ich fürchte, Sie haben eine zu gute Meinung von mir. Ich bin nichts weniger als eine sanfte Taube.“
„Das vermute ich auch nicht in Ihnen, Madame. Dazu haben Sie viel zu viel Rasse und Verstand. Sie werden ja nicht vergessen haben, wie klug und schlagfertig Sie mich dazu überredeten, Ihrem Gatten die gewünschte Generalpacht zu übergeben.“
„Geruhen Euer Majestät, sich noch daran zu erinnern?“ fragte Jeanne kokett.
„Vergißt man Augen wie die Ihren? Sphinxaugen, unenträtselbare! Damals war ich besser daran als heute. Damals durfte ich ohne Maske in den reizendsten Zügen lesen.“
Louis zog seine Dame gegen die große Spiegeltür, die zu seinen Gemächern führte.
„Legen Sie die Maske ab, Madame“, sagte er warm und drängend, mit den Augen die reizende Gestalt verschlingend.
Jeanne schüttelte den Kopf und machte Miene, sich ihm zu entziehen.
„Seien Sie nicht grausam, Madame! Mein Arbeitsgemach ist jetzt still und leer. Meine Minister sowohl als meine Pagen haben heute Besseres zu tun.“ Aber Jeanne machte keine Miene, ihm zu folgen. Heute noch nicht — nein. Morgen war auch noch ein Tag. Sie sah und fühlte, daß der König in Flammen stand. Sie verlor nichts und konnte nur gewinnen, wenn sie diese Flammen durch ihren Widerstand noch schürte.
„Nur auf einen kurzen Augenblick! Stellen Sie sich vor, Sie seien in Wahrheit Athenais von Montespan und Louis XIV. stände bittend vor Ihnen.“ „Ich stelle mir vor, was Sie wünschen, Sire und gerade deshalb — nein. Die stolze Athenais war nicht so leicht für ein Ja zu gewinnen wie die in Wahrheit sanfte Taube, die La Vallière. Sie ist nicht mein Genre, Sire.“
Der König widersprach lebhaft.
„Sie war liebendes, hingebendes Weib vom Scheitel bis zur Sohle. Gibt es Beglückenderes für einen Mann, der liebt, wie Louis Louise von La Vallière geliebt hat? Nehmen Sie ein Beispiel an ihr!“
Aber Jeanne blieb unerbittlich.
Der König zog sich scheu in sich zurück. Er hatte noch nie, als halber Knabe nicht, um Frauengunst gebettelt. Sollte er es als Mann um die Mitte der Dreißig noch lernen? Das Bewußtsein seiner fast grenzenlosen Macht, die er noch eifriger hütete, als der Sonnenkönig die seine gehütet, kam über ihn. Gleichzeitig aber auch das Bewußtsein aller Qualen, welche seine scheue unruhige Seele ihm bereitete.
Er ergriff die Hand Jeannes, die er hatte fallen lassen, aufs neue. Er hatte sich ja nach etwas anderem als allem bisher Erlebten gesehnt! Hier war es, was er heiß gewünscht. Sollte er es zurückstoßen aus gekränkter Eitelkeit?
„Ich will Sie nicht drängen“, sagte er leise, sich zu Jeanne niederbeugend. „Aber morgen, Sie werden auf dem Stadthausball sein? Dort tanzt man unmaskiert. Dann, nicht wahr, werde ich das Glück haben, Ihr reizendes Gesicht wiederzusehen?“
Jeanne nickte Gewähr. Sie hatte mit ihren scharfen Augen, mit ihren rasch auffassenden Sinnen des Königs Kampf beobachtet, hatte triumphierend ihren Sieg erkannt. Sie wußte, morgen durfte sie gewähren.
Der König flüstert ihr Ort und Stunde des Rendezvous zu.
„Sie werden kommen — bestimmt?!“
„Ich werde kommen — bestimmt!“
Er drückte heiß ihre Hand, daß die kostbaren Ringe, die er trug, sich beinahe schmerzhaft in ihre zarte Haut eingruben. Dann entschwand sie ihm rasch mit den zierlich schnellen Bewegungen einer Gazelle, in dem Gewühl der nächsten Gruppe.
Scheu blickte der König zu Boden. Er kam sich plötzlich mitten im Glanz seines Festes grenzenlos allein und vereinsamt vor.
Zu seinen Füßen liegt ein feines weißes Spitzentuch mit Gold- und Seidenfäden gestickt. Er hebt es auf. Es atmet denselben feinen Rosenduft, der das reizende Geschöpf umschwebt hatte. Er will ihr nach, ihr das Taschentuch zurückstellen; aber schon hat sich ein Wall von Menschen zwischen ihn und Jeanne d’Étioles geschoben.
Geschickt, mit einer groß ausholenden Geste, wirft er ihr das Tuch, über die Köpfe der Masken fort, zu.
Geschickt fängt sie es auf.
Hunderte von Augen haben dem langen, leisen
Gespräch der beiden, dem Spiel mit dem Tuch zugesehen.
Ringsum flüstert es erregt, zustimmend oder voll Neid und Mißgunst:
„Das Taschentuch ist geworfen.“
3
Die Dämmerung brach schon herein, als der König den Herzog von Ayen in sein Arbeitskabinett befahl.
Der Ministerrat und die vielen Audienzen hatten ihn ermüdet. Lang ausgestreckt lag Louis auf dem seidenen Divan im Hintergründe des Kabinetts und träumte mit offenen Augen.
Die Geschehnisse des gestrigen Maskenballes tauchten wieder vor ihm auf, alles überstrahlend die reizende Jeanne d’Étioles mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrem anmutigen Plaudertalent, dem melodischen Fall ihrer zarten Stimme.
Louis’ Phantasie malte ihm ihr körperliches Bild in den lockendsten Farben. Die ebenmäßige, schlanke Gestalt, den reizenden Mund mit den schimmernden Zähnen, den die Maske nicht bedeckt hatte, die zarten, vollendet schönen Arme und Hände, den weißen Nacken, der unter der lichtbraunen Haarfülle aufblühte.
Hochauf loderten die Wünsche, die der Widerstand des schönen Weibes gestern zurückgeschlagen hatte.
Seit dem Tode der Châteauroux hatte Louis’ träger Geist ein solches Chaos von Empfindungen nicht durchstürmt. Er sprang auf und straffte die Glieder.
Ach, das tat gut, Wünsche zu hegen, heiße, lodernde Wünsche, die das Blut in Aufruhr brachten, und ein Ziel für diese Wünsche!
Der Herzog trat ein. Frisch ging der König ihm entgegen. Ayen war überrascht. Die Offiziere vom Dienst hatten ihm im Vorzimmer erzählt, der König sei matt und verstimmt, augenscheinlich wieder von melancholischen Anwandlungen geplagt.
„Ich bin glücklich, Euer Majestät so wohl zu sehen!“
„Ich bin es, lieber Herzog, wohl und froh. Ich freue mich wie ein Kind auf den heutigen Stadthausball und mein Rendezvous. Welch ein bezauberndes Geschöpf! Ich hoffe nur, der Dauphin wird sich nicht allzu lange im Stadthaus aufhalten, damit wir freies Feld haben.“
Der König sprach erregt. Seine Augen brannten wie im Fieber.
Der Herzog konnte ein leises Bedenken nicht unterdrücken. Der König ging ihm allzu scharf ins Zeug. Die schöne Madame d’Étioles schien es ihm wirklich angetan zu haben, während Ayen sie nur für den Zeitvertreib eines Abends geplant hatte, um den König am Fest des Dauphins bei guter Laune zu halten!
Die Freundschaft des Königs gab Ayen ein Recht, bis zu einem gewissen Grade offen zu sein.
„Madame d’Étioles ist in der Tat eine Frau von großen Vorzügen. Schade nur, daß sie nicht von Geburt ist, daß ganz im Gegenteil diese Poissons —.“
Der König fuhr auf.
„Wir sprachen schon einmal davon, Herzog. Haben Sie vergessen, was ich Ihnen vor ein paar
Wochen sagte, als Sie und Richelieu mir wohlwollend rieten — ich denke wenigstens, es war wohlwollend gemeint...“
„Sire!“
„... eine neue Geliebte an die Stelle der armen Châteauroux zu setzen: Ich will keine Frau von Geburt mehr, so habe ich Sie ausdrücklich versichert. Zwei Gründe leiten mich bei diesem Entschluß: Den Hof und seine Frauen kenne ich zur Genüge. Sie langweilen mich. Die Frau, die ich jetzt lieben werde, soll einem Kreise angehören, der mir Neues sagt. Sie soll mir reinere, weniger selbstsüchtige Leidenschaften entgegenbringen, als eine Frau meiner nächsten Umgebung es imstande ist.“
Der König stockte und machte eine lange Pause. Weniger zornig, aber mit ebenso starker Betonung und tiefem Ernst fuhr er fort:
„Zum zweiten, Sie wissen so gut wie ich, Herzog, mutmaßlich besser noch, welchen Lärm meine Beziehungen zu den Schwestern Nesle verursacht haben. Sie kennen die scharfe Opposition der Frommen im Lande, Sie kennen das Echo, das diese Opposition in der öffentlichen Meinung gefunden hat. Sie hat mich, uns alle belehrt, daß ich am Ende aller Enden mit der Moral des Volkes rechnen muß. Vorsicht ist geboten, mehr Vorsicht als bisher. Ich darf einen neuen Ehebruch nicht an die große Glocke hängen, wenn ich mir den Namen des Vielgeliebten, den mir das Volk während meiner schweren Krankheit in Metz geschenkt, nicht preisgeben will. Wie aber könnte ich das bei einer Geliebten, die mitten in den Hofkreisen steht, auf die aller Augen gerichtet sind?“
Ayen machte eine zustimmende Bewegung.
„Und dann“ — ein zynisches Lächeln umspielte den ausdrucksvollen Mund des Königs — „da ist die Königin. Wenn ich auch mit ihren Wünschen nicht rechne, so liegt mir doch daran, die schon so oft verletzten Gefühle Ihrer Majestät zu schonen, allein aus dem Grunde, um mir die Sympathie meiner Töchter nicht zu verscherzen. Mit dem Dauphin rechne ich nicht mehr. Die übertrieben religiösen Anschauungen, die Herr Boyen de Mirepoix ihm beigebracht, die abgöttische Liebe zu seiner Mutter prädestinieren ihn von vornherein zu meinem heftigsten Widersacher. Dieu merci — ich mache mir nichts daraus — ich —.“
Louis brach plötzlich ab und legte dem Herzog die Hand auf die Schulter.
Mit ganz veränderter Stimme sagte er:
„Genug des ernsten Gesprächs! Sacre nom de Dieu, wir feiern heut Hochzeit. Wahrlich ein Grund zum fröhlich sein. Wann können wir zum Stadthaus fahren, Herzog?“
Ayen, der die doppelsinnige Bedeutung des „Hochzeitfeierns“ wohl verstanden hatte, sann einen Augenblick nach. Er fühlte sich bis zu einem gewissen Grade verantwortlich für des Königs rasches Vorgehen und wollte auch seinerseits alles Auffällige vermieden wissen, vor allem einen Zusammenprall mit dem Dauphin.
„Ich würde vorschlagen, Sire, Versailles vor elf Uhr nicht zu verlassen, wenn es Euer Majestät so genehm, zunächst im Domino einen öffentlichen Ball zu besuchen und zwischen zwölf und ein Uhr auf den Stadthausball zu fahren. Da Seine Königliche Hoheit der Dauphin Gastgeber ist, kann man kaum annehmen, daß Seine Hoheit das Fest früher verläßt.“
Der König stimmte zu. Er hatte nur zwei Wünsche für diese Nacht, nicht mit dem Dauphin zusammenzutreffen und die bezaubernde Madame d’Étioles am Platze des Rendezvous zu finden. —