
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe, die tragisch endet. Eine neue Liebe, die tragisch beginnt. Ein Herz, das nicht aufhört zu lieben. Und am Ende der Tränen: das Glück. 400 Tage ist es her. Vor 400 Tagen ist Mias große Liebe bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vor 400 Tagen hat Noah eine zweite Lebenschance bekommen. Als sie einander begegnen, spüren sie beide sofort, dass sie zusammen gehören. Doch nur Mia weiß, dass Noah ihr niemals begegnen wollte. Dass sie gegen seinen ausdrücklichen Willen gehandelt hat, als sie sich auf die Suche nach ihm gemacht hat. Dass Noah niemals wissen wollte, wer vor 400 Tagen ums Leben gekommen ist. Weil es irgendwie nicht richtig ist, dass er weiterleben darf – nur weil jemand anderes gestorben ist. Doch für Mia ist es, als wäre die Welt plötzlich wieder in Ordnung. Als wäre das Leben wieder bunt und schön. Und als hätte sie Noah nicht verschwiegen, dass sie einander nur begegnet sind, weil sie wissen wollte, wer der Mensch ist, der das Spenderherz ihres Freundes bekommen hat. Doch wie glücklich darf sie nach Jacobs Tod eigentlich sein? Und wann wird aus Schweigen … Verrat? Mia muss Noah erzählen, wer sie ist. Aber was bedroht ihre Liebe mehr? Eine Lüge – oder die Wahrheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Jessi Kirby
Mein Herz wird dich finden
Aus dem Amerikanischen von Anne Brauner
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Schwestern, deren Herzen mutig und schön sind
Prolog
Herz, das: muskuläres Hohlorgan, das durch rhythmische Kontraktion und Erweiterung Blut durch das Kreislaufsystem pumpt; der Kern der Individualität, vor allem bezüglich Intuition, Empfinden oder Gefühl; der zentrale, innerste oder lebendigste Teil von etwas – Definition des Wortes Herz
Woher ich wusste, dass es um ihn ging, als ich kurz vor der Morgendämmerung von den Sirenen geweckt wurde – ich weiß es nicht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich aus dem Bett gesprungen bin oder meine Schuhe gebunden habe. Ich weiß nicht mehr, wie meine Beine mich die Einfahrt hinunter und weiter auf den kurvigen Abschnitt der Straße zwischen unseren Häusern getragen haben. Mir ist das Gefühl entfallen, wie meine Füße über den Boden schritten, meine Lunge Luft einatmete und mein Körper versuchte zu verarbeiten, was ich im tiefsten Herzen bereits begriffen hatte.
Doch ich erinnere mich an die kleinste Kleinigkeit danach.
Ich sehe die blauen und roten Blinklichter, die grell vor dem blassen Himmel des Sonnenaufgangs pulsierten. Ich höre die harschen Worte der Sanitäter. Wiederholt übertönt das Wort Schädel-Hirn-Trauma das laute Knistern ihrer Funkgeräte im Hintergrund.
Ich erinnere mich an das tiefe, erstickte Schluchzen einer Frau, die ich nicht kannte und bis heute nicht kenne. An den Winkel, in dem ihr weißer SUV mit der Motorhaube in den umgeknickten Stielen und abgerissenen Blütenblättern der Sonnenblumen steht, die zuvor die Straße säumten. An den Zaun, dessen Holzlatten zersplittert am Boden liegen.
Ich erinnere mich an die Glasscherben, die den Asphalt wie Kies bedeckten.
Und an das Blut. Zu viel Blut.
An seinen Sneaker, der auf der Seite lag, auf der Sohle das Herz, das ich mit schwarzem Filzstift darauf gemalt hatte.
Noch immer spüre ich, wie leer und leicht sein Schuh war, als ich ihn aufhob. Das fehlende Gewicht zwang mich in die Knie. Ich spüre die starken, behandschuhten Hände, die mich hochzogen und festhielten, als ich zu ihm laufen wollte.
Sie ließen mich nicht. Ich durfte ihn nicht sehen. Deshalb stand ich fast die ganze Zeit am Straßenrand, allein, während mich allmählich die Dunkelheit verschlang. Die Morgensonne schien auf die Blütenblätter, die in Gold erstrahlten, obwohl er im Sterben lag.
Eins
»Es kann Spenderfamilien guttun, mit den Empfängern des jeweiligen Transplantats Kontakt aufzunehmen (…). Im Großen und Ganzen können sowohl die Spenderfamilien als auch die Organempfänger sowie ihre jeweiligen Verwandten und Freunde von einem Gedankenaustausch über ihre Erfahrungen mit der Organ- oder Gewebespende (…), dem Geschenk des Lebens (…), profitieren (…). Es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bevor jemand dazu bereit ist, eine Korrespondenz anzuregen oder zu erwidern, und es kommt auch vor, dass man keine Antwort erhält.« – Life Alliance Donor Family Services Program
Vierhundert Tage.
Ich wiederhole die Zahl in Gedanken und gebe mich dem Gefühl der Leere hin. Ich kann diesen Tag nicht einfach vergehen lassen wie jeden anderen. Der vierhundertste Tag, der hat etwas Besonderes verdient, eine Art Anerkennung. Genau wie der dreihundertfünfundsechzigste Tag, an dem ich seiner Mutter Blumen geschenkt habe, statt sie auf sein Grab zu legen, weil ich wusste, dass er es so gewollt hätte. Oder an seinem Geburtstag, das war vier Monate, drei Wochen und einen Tag danach. Am hundertvierundvierzigsten Tag.
Ich hatte diesen Tag ganz allein verbracht, weil ich es nicht ertragen hätte, seine Eltern zu treffen, und weil ich insgeheim irgendwie doch glaubte, wenn ich allein bliebe, würde er vielleicht zurückkommen, achtzehn werden, und wir könnten unser altes Leben fortsetzen. Dann würde er mit mir das letzte Schuljahr absolvieren, sich an denselben Colleges bewerben und die letzten wichtigen Schulfeste mitfeiern. Nach unserem Abschluss würden wir unsere Quastenhüte in die Luft werfen und uns in der Sonne küssen, bevor sie wieder landeten.
Nachdem er nicht zurückgekommen war, hatte ich das Sweatshirt angezogen, das noch ein ganz klein wenig nach ihm roch – oder vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ich schlang meine Arme um den Stoff und wünschte mir etwas. Ich wünschte mir mit aller Inbrunst, dass ich nichts von alldem ohne ihn tun müsste. Der Wunsch ging in Erfüllung. Von unserem letzten Schuljahr bekam ich nichts mit. Ich schickte keine Bewerbungsunterlagen an irgendein College. Ich kaufte mir kein Kleid für die Abschlussparty. Und ich vergaß, dass es überhaupt einen Himmel und eine Sonne gab, unter denen man sich hätte küssen können.
Die Tage vergingen, einer nach dem anderen, wohl dosiert in einem ununterbrochenen, nicht enden wollenden Rhythmus. Scheinbar unendlich, und doch in einem Wimpernschlag vergangen – wie Wellen, die an den Strand branden, wie der Wechsel der Jahreszeiten.
Oder wie der Schlag eines Herzens.
Jacob hatte ein Sportlerherz gehabt: stark und stetig, zehn Schläge langsamer als meins. Früher, wenn wir Brust an Brust lagen, hatte ich versucht, meinen Atem zu verlangsamen, bis er mit seinem übereinstimmte und wir den gleichen Puls hatten. Es hatte nie geklappt. Sogar nach drei Jahren schlug mein Herz immer noch schneller, wenn er nur in der Nähe war. Dennoch schlugen unsere Herzen auf eine Art synchron, weil seins langsam und stetig pochte und meins die Lücken füllte.
Vierhundert Tage und zu viele Herzschläge, um sie zu zählen.
Vierhundert Tage und zu viele Orte und Augenblicke, in denen Jacob nicht mehr lebt. Und noch immer keine Antwort von dem einzigen Ort, an dem er auf eine ganz besondere Weise vielleicht doch lebendig ist.
Hinter mir hupt jemand und reißt mich aus meinen Gedanken und dem mulmigen Gefühl in der Magengrube. Im Rückspiegel sehe ich den Fahrer fluchen, als er mir mit zornig erhobener Hand ausweicht und durch die Windschutzscheibe schreit: Was zum Teufel soll das?
Das habe ich mich beim Einsteigen auch gefragt. Ich weiß nicht genau, was das alles soll, nur, dass ich es tun muss, weil ich ihn mit eigenen Augen sehen muss. Wegen des Gefühls, das ich bei den anderen hatte.
Als Erste hatte Norah Walker Kontakt zu Jacobs Angehörigen aufgenommen; allerdings erfuhren wir ihren Namen erst später. Obwohl die Empfänger über die Vermittlungsstelle nach den Familien der Spender fragen konnten, und umgekehrt, waren wir alle überrascht, als der Brief kam. Jacobs Mutter rief mich an und bat mich rüberzukommen. Wir saßen in ihrem hellen Wohnzimmer in dem Haus, das so viele Erinnerungen barg – angefangen mit dem Tag, an dem ich zum fünften Mal daran vorbeigejoggt war, damit er mich endlich bemerkte.
Als ich seine Schritte hinter mir höre, laufe ich gerade so viel langsamer, dass er mich einholen kann. Seine Stimme zwängt die Worte zwischen die keuchenden Atemzüge.
»Hey!«
Luft holen.
»Warte!«
Luft holen.
Damals waren wir vierzehn und kannten uns nicht. Bis er diese beiden Worte sagte.
Als ich dann mit Jacobs Mutter in ihrem Haus auf dem Sofa saß, auf dem wir so viele Filme gesehen und Popcorn aus derselben Schüssel gegessen hatten, hatten mich die Worte einer Fremden durch ihre Dankbarkeit von dem dunklen einsamen Ort zurückgeholt, an dem ich mich so lange vergraben hatte. An jenem Tag warf ihr krakeliger Brief auf schönem Papier Licht in meine Dunkelheit. Ihr Ton war demütig, es tat ihr so furchtbar leid, dass Jacob gestorben war. Aber Norah Walker war auch zutiefst dankbar für das Leben, das er ihr geschenkt hatte.
Abends war ich nach Hause gegangen und hatte ihr zurückgeschrieben und mich meinerseits für den Augenblick der Leichtigkeit bedankt, den sie mir mit ihren Worten beschert hatte. In der darauffolgenden Nacht schrieb ich dem nächsten Empfänger und dann noch einem, immer so weiter, fünf Briefe insgesamt. Anonyme Briefe an anonyme Menschen, die ich kennenlernen wollte. Als ich sie zur Weiterleitung an die Vermittlungsstelle schickte, hegte ich die leise Hoffnung, dass diese Menschen mir zurückschreiben würden, dass sie mich so wahrnehmen würden, wie er es getan hatte.
Als ich mich umsehe, ist er da und hält mir lächelnd eine Sonnenblume hin, die größer ist als ich. An dem langen Stiel hängen noch Wurzeln und Erde.
»Ich heiße Jacob«, sagt er. »Wir sind gerade eingezogen, ein bisschen weiter unten. Du wohnst in der Nähe, oder? Ich habe dich diese Woche jeden Morgen laufen sehen. Du bist echt schnell.«
Während wir ein wenig weitergehen, beiße ich mir auf die Lippe und muss innerlich lächeln. Ich will jetzt auf keinen Fall gestehen, dass ich jeden Morgen all meine Reserven für das Stück vor seinem Haus mobilisiere – seit ich zufällig gesehen habe, wie er aus dem Möbelwagen gestiegen ist.
»Ich bin Mia«, sage ich.
Luft holen.
Indem ich die Briefe schrieb, bekam ich irgendwie wieder Luft. Ich schrieb über Jacob und was er mir im Leben gegeben hatte: das Gefühl, zu allem fähig zu sein. Glück. Liebe. Durch die Briefe konnte ich ihn würdigen und gleichzeitig hoffen. Darauf, dass eine anonyme Hand durch die Leere griff und eine Verbindung suchte. Eine Antwort.
Ich lache, weil er immer noch außer Atem ist und gar nicht zu merken scheint, dass er die riesige Sonnenblume hinter sich herschleift.
»Oh«, sagt er, als ihm mein Blick auffällt. »Die ist für dich. Ich …« Nervös fährt er sich durchs Haar. »Ich, äh, hab sie da hinten am Zaun gepflückt.«
Er reicht sie mir und lacht. Das möchte ich häufiger hören.
»Danke.« Ich nehme die Blume, sein erstes Geschenk.
Von den Menschen, denen er gespendet hat, habe ich vier Antworten bekommen.
Nach 282 Tagen, zahlreichen Briefen von beiden Seiten, Einverständniserklärungen und Beratungsgesprächen sind seine Mutter und ich zur Betreuungseinrichtung für Spenderfamilien gefahren. Dort haben wir nebeneinander gesessen und gewartet, bis sie kamen und wir sie persönlich kennenlernen konnten.
Norah stellte nicht nur mit Worten den ersten Kontakt her, sondern streckte auch als Erste die Hand aus. Obwohl ich mir diese Begegnung tausendmal vorgestellt hatte, war ich völlig unvorbereitet auf das Gefühl, ihre Hand zu nehmen, ihr in die Augen zu sehen und zu wissen, dass es dort auch etwas von Jacob gab. Etwas, das Norah das Leben gerettet und es ihr ermöglicht hatte, dem kleinen Mädchen mit den Locken, das scheu hinter ihr hervorlugte, weiter eine Mutter zu sein – und ihrem Mann, der weinend neben ihr stand, eine Frau.
Als sie mit Jacobs Lunge tief einatmete und meine Hand an ihre Brust legte, damit ich spüren konnte, wie sie sich ausdehnte und zusammenzog, ging mir das Herz auf.
Bei den anderen war es genauso gewesen – Luke Palmer, der sieben Jahre älter war als ich und uns einen Song auf der Gitarre vorspielte. Das konnte er nur, weil Jacob ihm eine Niere gespendet hatte. John Williamson war ein ruhiger, warmherziger Mann um die Fünfzig, der wunderbar poetische Briefe darüber schrieb, wie sehr sich sein Leben nach der Lebertransplantation zum Guten gewendet hatte. In dem kleinen Besuchszimmer stolperte er in unserem Gespräch mehr als einmal über seine Worte. Dann war da noch Ingrid Stone, deren hellblaue Augen so ganz anders aussahen als die braunen von Jacob, die aber nur durch ihn wieder in leuchtenden Farben sehen konnte.
Angeblich heilt die Zeit alle Wunden, doch die Begegnung mit diesen Menschen – eine Familie aus Fremden, die ein Mensch zusammengeführt hatte – hatte mich an diesem Nachmittag so viel nachhaltiger geheilt als die ganze Zeit in den langen Tagen davor.
Nur deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, nachdem immer mehr Zeit verstrich und keine Antwort von dem letzten Empfänger kam. Nur darum habe ich alle Angaben, die ich hatte, mit Meldungen und Nachrichten über Transplantationen abgeglichen, bis ich ihn so schnell gefunden hatte, dass ich es kaum glauben konnte. Und nur deshalb habe ich auch vor allen anderen so getan, als würde ich verstehen, warum er nicht antwortete. Weil manche Menschen es eben nie tun, wie die Frau bei der Betreuungseinrichtung sagte – und das ist ihr gutes Recht.
Ich habe so getan, als würde ich nicht täglich an ihn und seine Entscheidung denken. Als hätte ich meinen Frieden damit gemacht. Doch wenn ich in den endlosen Stunden bis zum Morgengrauen mit mir allein bin, gestehe ich mir die Wahrheit ein. So ist es nicht, ich verstehe es nicht, und ich weiß auch nicht, ob ich jemals meinen Frieden damit machen kann, wenn ich jetzt nicht tue, was ich mir vorgenommen habe.
Keine Ahnung, was Jacob dazu sagen würde. Was er sagen würde, wenn er es irgendwie merken könnte. Doch vierhundert Tage sind vergangen, und ich hoffe, dass er es verstehen würde. Sein Herz hat so lange mir gehört, dass ich einfach wissen will, wo es jetzt ist.
Zwei
»Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.« – Blaise Pascal
Selbst wenn ich wollte, könnte ich auf dieser Straße nicht umkehren. Sie führt von einem Hügel mit moosbewachsenen Eichen, die aus dem hohen sommergoldenen Gras emporragen, steil nach unten. So windet sich das Sträßchen über Meilen bis zur Küste, wo er die neunzehn Jahre seines Lebens verbracht hat. Sechsunddreißig Meilen von uns entfernt.
Als die Bäume am Stadtrand endlich den Blick auf das weite Blau des Meeres und des Himmels freigeben, zittern meine Hände so stark, dass ich in die Parkbucht an der Aussichtsstelle einbiegen muss. Ein zarter Nebelschleier hängt über der Klippe und schmilzt im morgendlichen Sonnenschein, der über dem Wasser liegt. Ich schalte den Motor aus, aber ich steige nicht aus, sondern kurbele die Fenster herunter und atme tief ein und aus, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen.
Ich bin schon oft nach Shelter Cove gefahren. An unzähligen Frühlings- und Sommertagen, vorbei an dieser Stelle und weiter in den kleinen Küstenort, doch heute fühlt es sich anders an. Von der albernen Vorfreude ist nichts zu spüren, mit der meine Schwester Ryan und ich auf der Rückbank herumhopsten, wenn wir mit unseren Eltern hierher fuhren, den Kofferraum vollgestopft mit Strandhandtüchern, Boogieboards und einer Kühltasche mit lauter ungesundem Zeug, das wir normalerweise nicht essen durften. Auch der Rausch der Freiheit und des Erwachsenseins stellt sich nicht ein, wie damals, als Jacob den Führerschein gemacht hatte und wir mit seinem Pick-up für einen romantischen Tag an den Strand gefahren waren. Heute verspüre ich nur eine grimmige Entschlossenheit und die damit verbundene Anspannung.
Während ich so auf das Meer hinausschaue, kommt mir eine komische Idee. Habe ich Noah Thomas bei einer dieser vielen Gelegenheiten vielleicht schon einmal gesehen? Haben wir uns kurz in die Augen gesehen, zwei Fremde, die zufällig auf der Straße aneinander vorbeigehen? Ohne zu ahnen, dass eines Tages diese Verbindung entstehen würde. Früher, bevor das alles geschehen war. Vor Jacobs Unfall, vor den Briefen und dem Treffen mit den anderen, bevor ich nächtelang auf eine Antwort von Noah Thomas gehofft und gegrübelt habe, warum sie nicht kam.
Der Ort ist klein. So klein, dass wir uns möglicherweise wirklich auf einem meiner vielen Ausflüge dorthin begegnet sind. Oder auch nicht. Wahrscheinlich hat er seine Sommer nicht so verbracht wie wir. Ich habe mir die sorgfältig zusammengestellte Zeittafel im Blog seiner Schwester genau angesehen. Durch ihren Blog bin ich überhaupt erst auf Noah gestoßen. Obwohl sie erst damit begonnen hat, als er auf die Warteliste für Transplantationen kam, weiß ich, dass er vierzehn war, als sein Herz begann, ihn auf qualvolle Weise immer mehr im Stich zu lassen. Mit siebzehn wurde er auf die Warteliste gesetzt und wäre gestorben, wenn er nicht kurz vor seinem neunzehnten Geburtstag den rettenden Anruf erhalten hätte. An Jacobs letztem Tag als Siebzehnjähriger.
Ich verdränge diesen Gedanken und das bedrückende Gefühl und ermahne mich zum hundertsten Mal, die Sache vorsichtig anzugehen. Ich habe schon zu viele geschriebene und ungeschriebene Gesetze gebrochen, Vorschriften, die sowohl die Spenderfamilien als auch die Organempfänger davor schützen sollen, zu viel zu erfahren. Oder zu viel zu erwarten.
Doch als ich Noah gefunden hatte, mit seiner Geschichte, die jeder lesen konnte, habe ich diese Regeln durch neue ersetzt. Ich habe mir diese eigenen Regeln und Versprechungen immer wieder vorgebetet; sie haben mich bis hierher gebracht und treiben mich genügend an, dass ich wieder auf die Straße fahre, während ich sie mir vorsage: Ich respektiere es, dass Noah Thomas keinen Kontakt möchte, obwohl ich es wahrscheinlich niemals verstehen werde. Ich will ihn nur sehen. In Fleisch und Blut. Vielleicht verstehe ich es dann – oder kann wenigstens meinen Frieden damit machen.
Ich will mich nicht in sein Leben einmischen. Ich werde ihn nicht ansprechen und mich nicht einmal bemühen, seine Stimme zu hören. Er wird gar nicht erfahren, dass es mich gibt.
Ich parke gegenüber von Good Clean Fun und schalte den Motor aus, aber ich steige wieder nicht aus. Aufmerksam betrachte ich den Laden in allen Einzelheiten, als könnte ich dort etwas entdecken, das mir mehr über Noah erzählen könnte als alle Posts seiner Schwester. Der Shop sieht genauso aus wie auf den vielen Bildern, die ich gesehen habe: In den Gestellen links und rechts der Tür stapeln sich säuberlich Paddleboards und Kajaks in Gelb und Rot, die den grauen Morgen zum Leuchten bringen. Man kann durchs Schaufenster die Neoprenanzüge und Schwimmwesten sehen, die gut sortiert an der Stange hängen und auf abenteuerlustige Kunden warten. Obwohl mich nichts davon überrascht, gibt es mir einen Stich, dass ich mehrfach an diesem Laden vorbeigegangen sein muss, ohne ihn jemals zu bemerken. Heute dagegen habe ich das Gefühl, ihn bereits gut zu kennen – und die Geschichte, die dahintersteckt und viel weiter reicht als die Ausrüstung, die dort angeboten wird.
Das Geschäft hat noch nicht geöffnet, und auf der Straße ist noch nichts los, doch weiter vorne, wo die Mole in den aufgewühlten Ozean hineinragt, beginnen die Leute mit ihrem Tagewerk. Links und rechts der muschelbewachsenen Pfeiler schnellen die Surfer übers Wasser. Ein Fischer befestigt einen Köder an der Angel und wirft sie über das Geländer aus. Zwei ältere Damen in Jogginganzügen laufen zügig am Wasser entlang. Auf dem Parkplatz neben der Mole lehnen drei Jungs in Shorts und Flipflops am Geländer und begutachten die Wellen, während der Kaffee in ihren Händen träge dampft.
Kaffee fände ich auch nicht schlecht. Vielleicht würden meine Hände weniger zittern, wenn ich mich daran festhalten könnte. Außerdem hätte ich etwas zu tun, statt auf der anderen Straßenseite darauf zu warten, dass der Laden öffnet, und mit jeder Minute mehr an meinem Plan zu zweifeln.
Auf meiner Seite der Straße entdecke ich ein paar Häuser weiter ein vielversprechendes Ladenschild: Geheime Zuflucht. Nach einem letzten flüchtigen Blick auf den geschlossenen Surfverleih steige ich aus und versuche, so lässig und entspannt zum Café zu gehen, als wäre ich dort Stammgast.
Der Morgennebel hängt noch schwer in der Luft, die nach Salzwasser riecht, und obwohl es heute heiß wird, ist es noch kühl genug für eine Gänsehaut. Als ich die Ladentür aufdrücke, duftet es köstlich nach Kaffee, und aus einem kleinen Lautsprecher über der Tür erklingen weiche Töne einer akustischen Gitarre. Meine Schultern entspannen sich ein winziges bisschen. Es fühlt sich fast so an, als könnte ich einfach einen Kaffee bestellen, damit am Strand entlanglaufen und wieder fahren, ohne weitere Grenzen zu überschreiten. Gleichzeitig weiß ich, dass es nicht stimmt. Hier geht es um zu viel und um ihn – es gibt kein Zurück mehr.
Ich zucke zusammen, als jemand hinter der Theke sagt: »Morgen! Bin gleich bei dir.« Eine freundliche Stimme, locker wie ein Lächeln.
»Okay«, antworte ich und merke sofort, wie angespannt meine Stimme im Vergleich klingt. Als wäre ich es nicht mehr gewöhnt, mit anderen zu reden. Kurz denke ich darüber nach, ob ich noch etwas hinzufügen sollte, doch mir fällt nichts ein. Ich trete einen Schritt zurück und nehme das ganze Café in Augenschein. Es ist gemütlich, die Wände sind in einem satten Türkis gestrichen, das die schwarz-weißen Surferfotos hervorhebt. Über meinem Kopf hängen alte bunte Surfbretter an wettergegerbten Seilschlaufen. Neben der Theke lehnt noch ein Surfbrett an der Wand. Darauf hat jemand die Speisekarte geschrieben.
Obwohl ich überhaupt keinen Hunger habe, überfliege ich das Angebot und suche aus Gewohnheit nach einem Frühstücks-Burrito. Den aß Jacob am liebsten, vor allem morgens nach dem Schwimmtraining. Wenn er früh aus dem Wasser kam und wir vor der Schule noch Zeit hatten, gingen wir in die Stadt und teilten uns einen Burrito an unserer eigenen geheimen Zuflucht, einer Bank, die versteckt hinter einem Restaurant stand. Von dort konnte man den Bach sehen. Manchmal unterhielten wir uns – über seinen oder meinen nächsten Wettkampf oder darüber, was wir am Wochenende vorhatten. Doch ich fand es eigentlich am schönsten, wenn das Wasser über die Steine plätscherte und wir einfach nur dasaßen und gemeinsam schwiegen wie Menschen, die einander von Herzen nah sind.
Ein junger Mann mit wuscheligem blondem Haar und knallblauen Augen kommt aus der Küche ins Café und trocknet sich die Hände am Geschirrtuch ab. »Tut mir leid, dass es länger gedauert hat«, sagt er und lächelt mich an. Seine weißen Zähne leuchten in seinem braunen Gesicht. »Unsere Küchenhilfe ist nicht gekommen, keine Ahnung, warum.« Er weist mit dem Kopf auf die Tafel, auf der die heutigen Surfbedingungen stehen: Südliche Dünung, 2 m, ablandige Brise … raus mit euch!
Als er aus dem Fenster zum Strand blickt und die Schultern zuckt, begreife ich, dass es ihm nichts ausmacht.
Ich sage nichts und gebe vor, die Speisekarte zu studieren. »Egal«, sagt er und klatscht in die Hände. »Was kann ich dir bringen?«
Eigentlich möchte ich nichts, aber da ich schon mal da bin, kann ich mich nicht mehr drücken. Außerdem macht er einen netten Eindruck. »Ich nehme einen Mocha«, sage ich zögerlich.
»Das war’s?«, fragt er.
Ich nicke. »Ja.«
»Bist du sicher, dass du nicht noch was nehmen möchtest?«
»Ja. Ich meine, nein danke – ich bin sicher.« Ich senke den Blick, obwohl er mich ansieht, das spüre ich genau.
»Okay«, sagt er nach einer langen Pause. »Der Mocha kommt gleich.« Er zeigt auf die fünf, sechs leeren Tische. »Alles frei, such dir was aus.«
Ich setze mich an einen Tisch vorne in der Ecke und schaue aus dem Fenster. Die Sonne arbeitet sich durch den Frühdunst und hüllt das Wasser in Licht und Farbe.
»Hier, bitte.«
Der Typ stellt mir eine dampfende Kaffeeschale, ein Glas Wasser und einen Teller mit einem gigantischen Muffin hin. »Banane mit Schokosplittern«, sagt er, als ich den Kopf hebe. »Schmeckt nach Glück. Du siehst aus, als könntest du heute Morgen etwas davon gebrauchen. Geht aufs Haus, der Kaffee auch.«
Diesmal lächelt er mit einer gewissen Vorsicht. Das kenne ich, so mitleidig werde ich schon seit einer Weile angelächelt, und ich frage mich, woran er erkennt, dass es angebracht wäre. An meiner Haltung? Meinem Gesichtsausdruck? An meiner Stimme? Nach so langer Zeit kann ich das nur schwer einschätzen.
»Danke«, sage ich. Und dann gebe ich mir Mühe und lächele richtig zurück, um uns beide zu beruhigen.
»Siehst du, wirkt schon.« Er grinst. »Ich bin übrigens Chris. Sag Bescheid, wenn du noch was willst, ja?«
»Danke.« Ich nicke.
Er geht wieder in die Küche, und ich lehne mich zurück, wärme die Hände an der Kaffeeschale. Es geht mir schon besser, obwohl ich den Kajakverleih auf der anderen Seite noch im Blick habe – doch irgendwie aus sicherer Entfernung. Als hätte ich dadurch, dass ich hier bin, noch nichts verbrochen. Als ein Surfer auf dem Bürgersteig vorbeigeht, fällt mein Blick auf nasse Haare und braune Haut. Ich sehe schnell wieder weg und betrachte eingehend den Milchschaum auf meinem Mocha. Der Typ sieht super aus. Ich wundere mich, dass es mir auffällt, und bekomme direkt Schuldgefühle.
Im nächsten Moment geht die Tür auf, und er geht zur Theke, ohne mich in meiner Ecke zu sehen. Dort bimmelt er fünfmal schnell mit der Klingel auf der Theke. »Hey! Ist hier jemand oder seid ihr alle im Wasser?«
Chris kommt aus der Küche und lächelt ihn an, als würde er ihn gut kennen. »Na, wer erweist uns denn da die Ehre?« Sie klatschen sich ab und umarmen sich locker über die Theke hinweg, wie Jungs das eben tun. »Schön dich zu sehen, Mann. Warst du schon draußen?«
»Hab mir vom Wasser aus den Sonnenaufgang angesehen. Bin gerade rausgekommen. War super – wieso warst du nicht auch da?« Er nimmt einen Becher und schenkt sich selbst ein.
»Irgendwer muss den Laden ja aufmachen«, sagt Chris und trinkt einen Schluck aus seiner eigenen Tasse.
»Irgendwer hat seine Prioritäten falsch sortiert«, kontert der andere.
Chris seufzt. »Kann passieren.«
»Ich weiß. Wenn man nicht aufpasst«, erwidert sein Freund gelassen und pustet über seinen Kaffee. »Darum musstest du hier landen, damit du das nicht verpasst.«
»Voll philosophisch, Mann.« Chris lächelt. »Hast du noch mehr Weisheiten auf Lager?«
»Nee. Aber das Wetter hält noch ein Weilchen. Sollen wir morgen zusammen zum Sonnenaufgang raus?«
Chris neigt den Kopf und sortiert seine Prioritäten neu.
»Komm schon.« Sein Freund lächelt. »Das Leben ist kurz. Was spricht dagegen?«
»Einverstanden«, sagt Chris. »Du hast ja recht. Halb sechs. Willst du was essen?«
Als ich hoffe, dass er ja sagt und noch ein bisschen bleibt, merke ich erst, wie atemlos ich dem Gespräch gelauscht habe – und ihm. Verlegen greife ich zu meiner Kaffeeschale, mehr um mich dahinter zu verstecken als um zu trinken, und zwinge mich, wieder auf die Straße zu blicken.
»Keine Zeit, ich muss den Laden aufmachen. Gleich kommt eine achtköpfige Familie, die Kajaks gebucht hat, und ich habe meiner Schwester versprochen, dass ich mich darum kümmere.«
Seine dahingeworfenen Worte treffen mich wie eine Salve spitzer Pfeile: Kajaks, Laden, Schwester. Mein Magen schlägt einen Purzelbaum, als mir klar wird, dass er das sein könnte, dass er ganz in meiner Nähe an der Theke steht. Bei der Vorstellung hole ich scharf Luft und verschlucke mich am Kaffee. Als ich hustend und prustend nach dem Wasserglas greifen will, sehen die beiden Jungs zu mir hinüber. Leider werfe ich auch noch die Kaffeeschale um, die am Boden zerbricht. Der Kaffee spritzt in alle Richtungen.
Der Surfer geht einen Schritt auf mich zu, ich springe auf. Chris wirft ihm einen Putzlappen zu. »Fang, Colt.«
Das Herz springt mir aus der Brust, ich bekomme keine Luft mehr.
Colt.
Wie Noah Thomas.
Drei
»Wissenschaftler haben Nervenzellen identifiziert, die feuern, wenn man eine bestimmte Person wiedererkennt. Insofern kann es bei der Betrachtung eines Menschen, der den Spender nachhaltig beeindruckt hatte, zum Feedback starker Gefühlsbotschaften durch das gespendete Organ kommen, die ein Wiedererkennen signalisieren. Ein derartiges Feedback ereignet sich innerhalb von Millisekunden und kann den Empfänger zu der Annahme verleiten, die Person zu kennen.« – Zellgedächtnis bei Organtransplantationen
Noah Thomas kommt mit dem Lappen auf mich zu und streckt mir die freie Hand über die Kaffeepfütze entgegen. Er hat die dunklen Augenbrauen besorgt zusammengezogen. »Hey, alles in Ordnung mit dir?«
Ich nicke hustend, obwohl ich total durcheinander bin.
»Geh ein Stück zur Seite, ich wisch das auf.« Als er vorsichtig meinen Ellbogen fasst, spannt sich mein ganzer Körper an.
»Sorry«, sagt er und lässt rasch die Hand sinken. »Äh … bist du sicher, dass es dir gutgeht?«
Er steht mit einem Putzlappen in der Hand direkt vor mir und fragt mich, ob es mir gutgeht. Das darf eigentlich alles gar nicht sein. Das hätte nicht passieren dürfen, das –
Ich wende den Blick ab, huste noch einmal, räuspere mich und hole zitternd Luft. Ganz ruhig, ganz ruhig.
»Tut mir leid«, quetsche ich hervor. »Total leid. Ich war nur …«
»Das macht doch nichts«, sagt er, als müsste er sich das Lachen verkneifen. Er blickt über die Schulter zu Chris, der anscheinend bereits frischen Kaffee kocht.
»Ich bring dir gleich einen neuen!«, ruft Chris.
»Siehst du?«, sagt Noah Thomas. »Nichts passiert.« Er zeigt auf den Stuhl neben mir. »Ich habe alles im Griff. Setz dich doch.«
Ich rühre mich nicht vom Fleck und sage auch nichts.
Er bückt sich, um den Kaffee aufzuwischen, doch dann sieht er zu mir hoch und lächelt. Das kommt wie ein Schock, weil dieses Lächeln so ganz anders aussieht als der schwache Versuch auf vielen Bildern seiner Schwester. Weil er nicht so aussieht wie auf den Fotos. Wahrscheinlich hätte ich ihn gar nicht erkannt, nicht mal, wenn er den Laden seiner Eltern betreten hätte.
Der Noah auf den Fotos war krank. Er war blass, hatte dunkle Ringe unter den Augen, dünne Arme und ein aufgedunsenes Gesicht. Sein Lächeln wirkte angestrengt. Der Typ, der vor mir kniet, sprüht vor Leben und Gesundheit, und ausgerechnet er –
Ich will wegsehen, aber es geht nicht. So wie er mich jetzt ansieht …
Seine Hand schwebt über dem klebrigen Boden, als hätte er vergessen, was er tun wollte. Dann steht er plötzlich auf, ohne den Blickkontakt abzubrechen, bis wir ganz nah voreinander stehen. Als er mir in die Augen sieht, fällt mir auf, dass seine dunkelgrün sind.
Schließlich sagt er etwas, aber leiser, zögerlicher. »Bist du … hast du … bin ich –«
Seine Fragen hängen unausgesprochen zwischen uns und fixieren mich einen Augenblick an Ort und Stelle. Dann breche ich in Panik aus.
Als mir klar wird, was ich getan habe – oder kurz davor bin zu tun, stürze ich an ihm vorbei, rempele ihn an und rausche hinaus, bevor er noch einen Ton sagen kann. Bevor wir uns auch nur einen Augenblick länger ansehen können.
Ich sehe mich nicht um. Ich eile auf dem Bürgersteig zu meinem Auto, getrieben von der Erkenntnis, dass ich nicht hätte kommen dürfen und sofort fahren muss. In der Erkenntnis, dass ich etwas Schlimmes getan habe, schwingt die überwältigende Sehnsucht mit, ihn näher kennenzulernen, Noah Thomas, mit den dunkelgrünen Augen und der schönen braunen Haut, der lächelt, als würde er mich kennen. Der so ganz anders ist, als ich ihn mir vorgestellt habe.
Hinter mir geht die Tür, ich höre Schritte, möchte wegrennen.
»Hey«, ruft jemand. »Warte!«
Er.
Diese beiden Worte.
Ich will stehen bleiben, nur um ihn noch ein einziges Mal anzusehen. Doch das tue ich nicht. Im Gegenteil, ich laufe noch schneller – fort von ihm. Das muss ein Irrtum sein, ein Irrtum, EIN IRRTUM. Ich drücke hektisch auf meinem Wagenschlüssel herum. In dem Moment, in dem ich die Tür aufziehen will, bleibt er direkt hinter mir stehen.
»Hey«, sagt er noch mal, »du hast was vergessen.«
Ich erstarre, meine Hand krampft sich um den Türgriff.
Mit rasendem Herzen drehe ich mich langsam zu ihm um.
Er schluckt nervös und hält mir meine Tasche hin. »Hier, bitte.«
Ich nehme sie ihm aus der Hand. »Danke.«
Schwer atmend stehen wir da und überlegen, was wir sagen sollen. Er findet als Erster die Sprache wieder.
»Ich … alles okay? Du siehst irgendwie aus … als wäre gar nichts okay.«
Mir kommen die Tränen, und ich schüttele den Kopf.
»Es tut mir leid«, sagt er und tritt einen Schritt zurück. »Das geht mich gar nichts an. Ich wollte nur …« Er sieht mich forschend an.
Ich mache alles nur noch schlimmer. Nun reiße ich die Wagentür auf, steige rasch ein und ziehe sie zitternd zu. Ich muss sofort hier weg. Ich suche nach dem passenden Schlüssel, aber irgendwie sehen sie alle gleich aus, dabei spüre ich die ganze Zeit seinen Blick, und ich muss los, weg hier, ich hätte nie kommen dürfen und – endlich habe ich den richtigen Schlüssel, ramme ihn ins Zündschloss und drehe ihn. Noah springt vor Schreck auf den Bürgersteig zurück. Ich reiße das Steuer herum und steige aufs Gaspedal.
Der Aufprall kommt aus dem Nichts, sehr laut. Metall und Glas knirschen. Ich knalle mit dem Kinn aufs Lenkrad. Die Hupe kreischt, und als es wieder still ist, kapiere ich, was ich getan habe. Alles, was ich gerade getan habe. Ich schließe die Augen und hoffe fieberhaft, dass es doch nicht geschehen ist. Dass ich es nur geträumt habe, so wie ich von Jacob träume und alles so klar und echt ist, bis ich aufwache und begreife, dass ich allein bin, weil er gestorben ist.
Langsam öffne ich die Augen. Ich habe Angst, etwas anderes zu tun, doch meine Hand bewegt sich wie von selbst und stellt auf P. Dann wird meine Tür wieder aufgerissen.
Noah Thomas ist immer noch da. In seinem Blick lese ich, dass er beunruhigt ist, und noch etwas anderes – keine Ahnung, was. Er beugt sich vor und greift über das Lenkrad, um den Motor auszuschalten.
»Hast du dir weh getan?«, fragt er. Die Sorge ist ihm anzuhören.
Es pocht in meinem Mund, aber ich nicke, meide seinen Blick, verkneife mir die Tränen. Ich schmecke Blut.
»Du bist verletzt«, sagt er.
Er hebt zaghaft die Hand, als wollte er mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht streichen oder das Blut vom Mund wischen, doch er lässt es sein und sieht mich nur an.
»Bitte«, sagt er nach einer Weile. »Ich will dir nur helfen.«
Vier
»Das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern ein ausgesprochen intelligentes Organ mit eigenem Nervensystem, eigener Entscheidungsfähigkeit und eigenen Verbindungen zum Gehirn. Experten sind zu der Erkenntnis gelangt, dass das Herz mit dem Gehirn ›spricht‹ und auf eine Art und Weise mit ihm kommuniziert, die sich darauf auswirkt, wie wir die Welt wahrnehmen und auf sie reagieren.« – Dr. Mimi Guarneri, The Heart Speaks: A Cardiologist Reveals the Secret Language of Healing
Noah steht zwischen meiner Stoßstange und dem blauen VW-Bus, in den ich reingebrettert bin, und begutachtet den Schaden. »Nicht so schlimm«, sagt er und geht zwischen den beiden Stoßstangen in die Hocke. »Das meiste hast du abbekommen.« Er betrachtet das Knäuel aus Papiertaschentüchern, das ich auf meine Unterlippe drücke. »Das muss genäht werden. Wir sollten zu einem Arzt fahren.«
Ich muss noch dringender hier weg als je zuvor und habe alles noch unendlich komplizierter gemacht.
»Ich kann nicht einfach abhauen«, sage ich. »Ich habe einen Auffahrunfall verursacht. Das muss ich zu Protokoll geben oder so. Auf jeden Fall muss ich die Versicherung anrufen. Und meine Eltern. O Gott.« Als ich am Morgen aufgebrochen bin, waren sie schon weg und sie erwarten wahrscheinlich, dass ich da bin, wenn sie zum Mittagessen nach Hause kommen. Von dort habe ich mich nämlich in den letzten Wochen nicht wegbewegt.
Noah steht auf. »Das kannst du alles immer noch machen – erst mal musst du dich verarzten lassen. Schreib doch einfach einen Zettel mit deiner Telefonnummer. Bei uns regen sich die Leute nicht so schnell auf, außerdem hat der Bus kaum einen Kratzer. Keine große Sache, ehrlich.«
Ich will dagegen argumentieren, aber meine Lippe pocht, und mir wird ganz schwindelig, weil die Taschentücher, die ich darauf gedrückt habe, so nass und klebrig sind. »Echt?«
»Echt«, erwidert er und wirft einen Blick über die Schulter. »Warte hier, ich bin gleich wieder da.«
Er läuft locker über die Straße zu seinem Kajakverleih und einer kleinen Gruppe – der Familie wahrscheinlich, von der er im Café gesprochen hat. Die Erwachsenen sehen abwechselnd auf die Uhr und in die Gegend, während zwei Jugendliche am Schaufenster lehnen und mit ihren Handys beschäftigt sind. Die beiden Jüngsten spielen zwischen den aufgestellten Kajaks Fangen. Das ist der beste Moment, um die Biege zu machen. Am besten klemme ich rasch einen Zettel an den VW-Bus und fahre los, bevor das Ganze nicht mehr aufzuhalten ist.
Ich greife nach meiner Handtasche, doch die ruckartige Bewegung verschlimmert die Schmerzen, und mir wird schwindelig. Ich muss tief einatmen und kann erst dann in der Tasche Stift und Zettel suchen.
Vor dem Laden erklärt Noah den Kunden mit einer Miene des Bedauerns und Gesten in meine Richtung offenbar, was passiert ist. Als sie nicken, macht er einen kurzen Anruf mit dem Handy, schüttelt allen die Hand und läuft zu mir zurück. Ich notiere meinen Namen und meine Telefonnummer auf dem Zettel und sehe nicht einmal auf, als er direkt vor mir steht.
»Ich kann dich zum Krankenhaus fahren«, sagt er.
»Vielen Dank, wirklich, aber das ist nicht nötig. Ich kann selbst fahren.«
»Ich weiß nicht«, sagt er. »Glaubst du, das ist eine gute Idee?«
»Alles halb so wild, mir geht’s gut, ich …«
»Also«, sagt er, nimmt mir den Zettel ab und wirft einen kurzen Blick darauf. »Ich steck das kurz an den Bus, dann setzt du dich auf den Beifahrersitz, und ich bringe dich eben hin. Was meinst du?«
Ich reagiere nicht, da ich erstens weiß, dass das gar keine gute Idee ist, und zweitens, weil mir immer noch schwindelig ist.
Noah geht vor mir in die Hocke, so dass ich ihn ansehen muss. »Jetzt hör mal zu, du musst genäht werden, und ich habe mir gerade freigenommen. Ich kann dich nicht einfach so fahren lassen.«
Er wartet meine Antwort gar nicht ab, geht zur Windschutzscheibe des Vorderwagens und klemmt den Zettel unter den Scheibenwischer. Ehe ich mir eine Ausrede einfallen lassen kann, warum er mich nicht fahren soll, kommt er bereits auf der Fahrerseite zurück. Ich sitze immer noch am Steuer.
Dann sehe ich ihn noch mal an, lang genug, um mich zu ermahnen, warum es immer schlimmer werden wird, wenn ich nachgebe.
»Darf ich?«, fragt er. Als er mich mit diesen Wahnsinnsaugen ansieht, zwingt mich etwas in ihnen zu einem Ja.
Schweigend fahren wir die Hauptstraße herunter. Das verschlafene Küstenstädtchen ist mittlerweile zum Leben erwacht, und Strandspaziergänger wieseln mit Flipflops, Sonnenkappen und vollgestopften Strandtaschen über die Bürgersteige. Ich spüre, dass Noah ständig zu mir herüber schaut, und muss mich voll konzentrieren, um ihn nicht anzusehen. Als ich schließlich das Gefühl habe, dass er seinen eigenen Gedanken nachhängt, wage ich einen Blick aus dem Augenwinkel und mustere ihn von oben bis unten. Er trägt blaue Shorts, ein weißes T-Shirt und Flipflops. Ich kann nicht glauben, dass man ihm nichts ansieht.

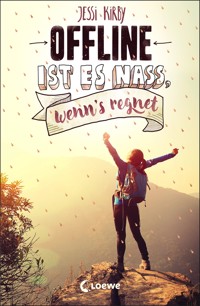













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













