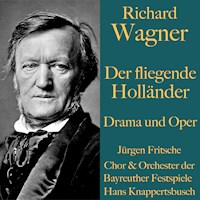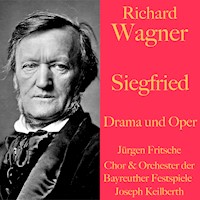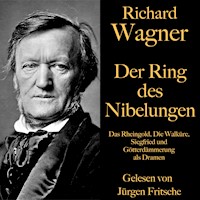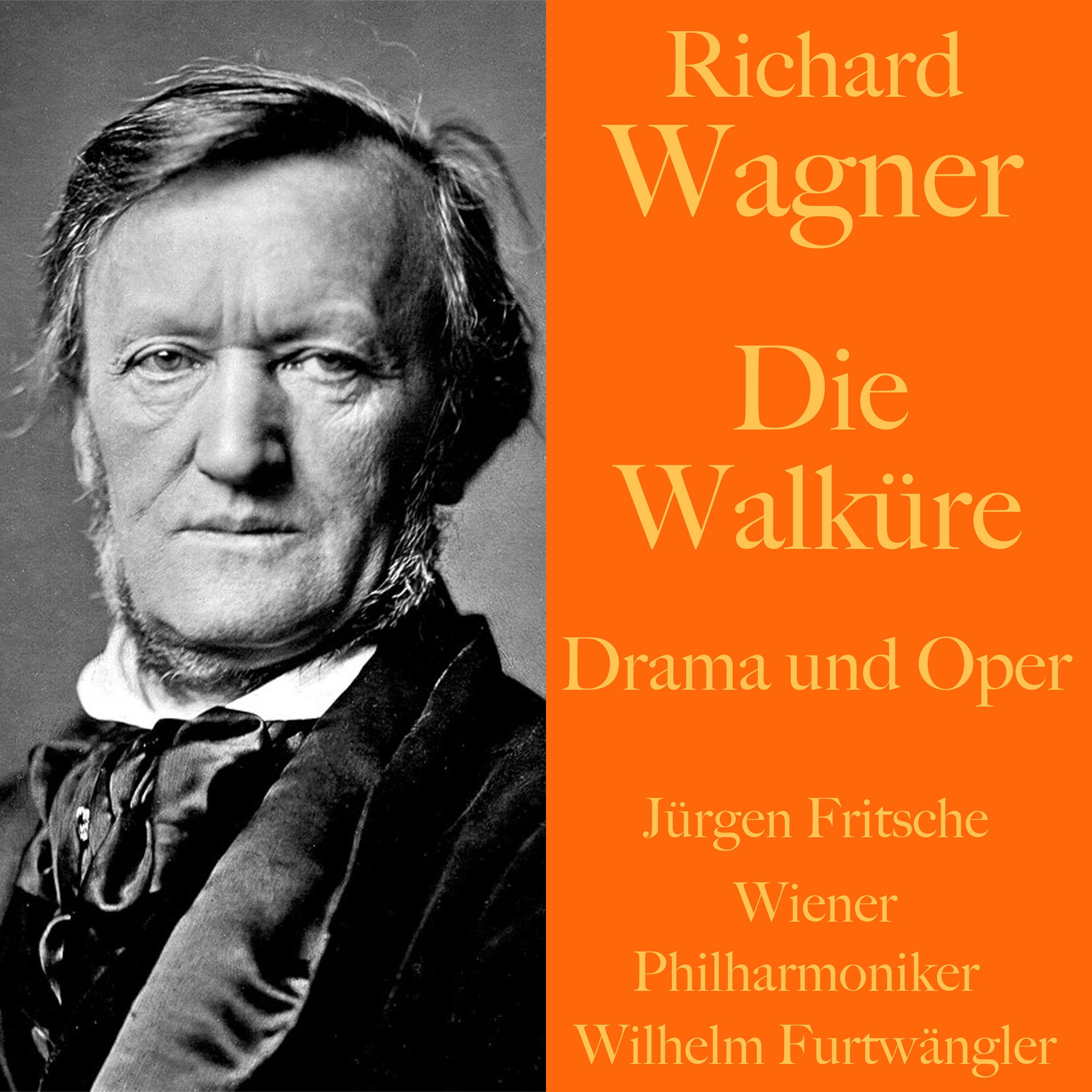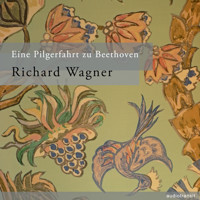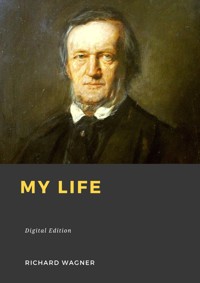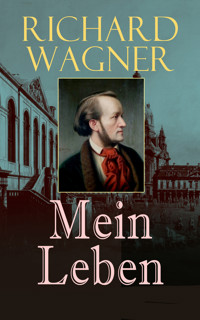Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Richard Wagners autobiografischem Werk 'Mein Leben' taucht der Leser tief in die Gedankenwelt und das Leben des berühmten deutschen Komponisten ein. Wagner offenbart nicht nur seine musikalischen Kreationen, sondern auch seine Gedanken zu Kunst, Politik und Gesellschaft. Der literarische Stil des Buches ist von einer ehrlichen und oft kontroversen Sprache geprägt, die Wagner als kontroversen Künstler widerspiegelt. 'Mein Leben' wird oft als wegweisendes Werk in der Musikliteratur angesehen, da es Einblicke in die kreative Prozesse und die persönlichen Turbulenzen des Komponisten gibt. Wagner nutzt seine Autobiografie, um seinen revolutionären Ansichten über die Zukunft der Musik und Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Mit ausdrucksstarken Beschreibungen und tiefgründigen Gedanken reißt Wagner den Leser mit und regt zum Nachdenken an. Als einer der einflussreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts präsentiert er in 'Mein Leben' nicht nur sein eigenes Schaffen, sondern auch die Zeit, in der er lebte und die Folgen seiner Werke auf die Welt. Richard Wagners 'Mein Leben' bietet nicht nur einen Einblick in das Leben eines legendären Künstlers, sondern auch in die Gedanken und Ideen, die seine revolutionären Musikwerke geprägt haben. Der Leser wird auf eine Reise durch die Welt des Musiktheaters und der revolutionären Kunst mitgenommen und erhält einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit eines der einflussreichsten Komponisten der Musikgeschichte. 'Mein Leben' ist ein Muss für Musikliebhaber und alle, die einen tiefgründigen Einblick in die Welt des 19. Jahrhunderts und die Gedanken eines kontroversen Künstlers erhalten möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1651
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Leben
Books
Inhaltsverzeichnis
Die in diesen Bänden enthaltenen Aufzeichnungen sind im Laufe verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben von mir sich erzählt wünschte, nach meinen Diktaten unmittelbar niedergeschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen über mein Leben unsrer Familie sowie bewährten treuen Freunden zu erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem Untergange zu bewahren, sie auf unsre Kosten in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen zu lassen. Da der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben genau mit Namen und Zahlen begleitet sein mußten, so könnte von einer Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tode die Rede sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen für jetzt schon einzelnen zuverlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vorenthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft erscheinen lassen würde, irgend welche weitere Mitteilungen aus ihnen an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht gestattet sein dürfte.
Richard Wagner
Erster Teil 1813–1842
Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im »Rot und Weißen Löwen«, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft. Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig, mit der Anwartschaft auf die Stelle des Polizeidirektors daselbst, starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen, welche ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der kriegerischen Unruhen und der Schlacht bei Leipzig zuzogen, durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers. Über die Lebensverhältnisse seines Vaters vernahm ich späterhin, daß dieser in dürftiger bürgerlicher Sphäre als Toreinnehmer am Ranstädter Tore sich dadurch vor seinen Standesgenossen auszeichnete, daß er seinen beiden Söhnen eine gelehrte Erziehung gab, indem er den einen – meinen Vater Friedrich – Jurisprudenz, den andern, jüngern – Adolf – Theologie studieren ließ. Mein Oheim gewann später einen nicht unbedeutenden Einfluß auf meine Entwicklung; wir werden ihm in einer entscheidenden Phase meiner Jugendgeschichte wieder begegnen. Über meinen für mich so früh verstorbenen Vater erfuhr ich später, daß er im allgemeinen sehr für Poesie und Literatur eingenommen, namentlich dem damals von den gebildeten Ständen sehr gepflegten Theater eine fast leidenschaftliche Teilnahme zuwendete. Meine Mutter erzählte mir unter anderm, daß er mit ihr zur ersten Aufführung der »Braut von Messina« nach Lauchstädt reiste; dort zeigte er ihr auf der Promenade Schiller und Goethe, sie enthusiastisch ob ihrer Unkenntnis dieser großen Männer zurechtweisend. Er soll selbst nicht frei von galanter Leidenschaftlichkeit für Künstlerinnen des Theaters gewesen sein. Meine Mutter beklagte sich scherzend, daß sie öfters sehr lange mit dem Mittagsessen auf ihn habe warten müssen, während er bei einer damals berühmten Schauspielerin begeisterte Besuche abstattete; von ihr gescholten, behauptete er durch Aktengeschäfte zurückgehalten worden zu sein, und wies zur Bestätigung auf seine angeblich mit Tinte befleckten Finger, welche bei erzwungener näherer Besichtigung sich als vollkommen sauber auswiesen. Von seiner großen Neigung für das Theater zeugte außerdem die Wahl eines innig vertrauten Hausfreundes, des Schauspielers Ludwig Geyer. Hatte ihn bei der Wahl dieses Freundes gewiß hauptsächlich seine Theaterliebe geleitet, so führte er in ihm seiner Familie zugleich den edelsten Wohltäter zu, indem dieser bescheidene Künstler durch innigen Anteil an dem Lose der zahlreichen Nachkommenschaft seines unerwartet schnell verscheidenden Freundes Wagner bewogen, den Rest seines Lebens auf das angestrengteste der Erhaltung und Erziehung dieser Familie widmete. Schon während der Polizeiaktuar seine Abende im Theater verbrachte, vertrat der treffliche Schauspieler meist seine Stelle im Schoße seiner Familie, und es scheint, daß er oft die mit Recht oder Unrecht über Flatterhaftigkeit ihres Gatten klagende Hausmutter zu beschwichtigen hatte. Wie tief das Bedürfnis des heimatlosen, vom Leben hart geprüften und umhergeworfenen Künstlers war, in einem sympathischen Familienverhältnisse sich heimisch zu wissen, bezeugte er dadurch, daß er ein Jahr nach dem Tode seines Freundes dessen Witwe ehelichte, und fortan der sorgsamste Vater der hinterlassenen sieben Kinder ward. Bei diesem schwierigen Unternehmen begünstigte ihn ein unerwartetes Gedeihen seiner äußeren Lage. Als Schauspieler des sogenannten Charakterfaches erhielt er bei dem neu errichteten Dresdener Hoftheater eine vorteilhafte, ehrende und dauernde Anstellung. Das Malertalent, welches ihm einst schon sein Leben zu fristen verholfen hatte, als er, durch äußerste Armut genötigt, seine Universitätsstudien unterbrechen mußte, wurde in seiner Dresdener Stellung von neuem beachtet. Zwar beklagte er, mehr noch als seine Kritiker, von einer regelmäßigen und schulgerechten Ausbildung desselben abgehalten worden zu sein; dennoch erwarb ihm seine außerordentliche Begabung namentlich für Porträtähnlichkeit so bedeutende Aufträge, daß er unter der doppelten Anstrengung als Maler und Schauspieler leider frühzeitig seine Kräfte erschöpfte. Als er einst in München zu einem Gastspiel am Hoftheater eingeladen war, erhielt er, durch vorteilhafte Empfehlung des sächsischen Hofes eingeführt, vom bayerischen Hofe so bedeutende Aufträge für Porträts der Allerhöchsten Familie, daß er darum sein Gastspiel zu unterbrechen und gänzlich aufzugeben für gut hielt. Aber auch dichterisches Talent war ihm zu eigen; nach manchen in oft sehr zierlichen Versen verfaßten Gelegenheitsstücken schrieb er auch mehrere Lustspiele, von denen eines, der Bethlehemitische Kindermord, in gereimten Alexandrinern, häufig gegeben ward, gedruckt erschien und von Goethe freundlichst gelobt wurde. Dieser ausgezeichnete Mann, unter dessen Führung in meinem zweiten Lebensjahre meine Familie nach Dresden übersiedelte, und von dem meine Mutter noch eine Tochter (Cäcilie) gewann, übernahm nun mit größester Sorgfalt und Liebe auch meine Erziehung. Er wünschte mich gänzlich als eigenen Sohn zu adoptieren, und legte mir daher, als ich in die erste Schule aufgenommen ward, seinen Namen bei, so daß ich meinen Dresdener Jugendgenossen bis in mein vierzehntes Jahr unter dem Namen Richard Geyer bekannt geblieben bin. Erst als meine Familie, längere Jahre nach dem Tode des Stiefvaters, sich wieder nach Leipzig wandte, nahm ich dort, am Sitz meiner ursprünglichen Verwandtschaft den Namen Wagner wieder an.
Meine frühesten Jugenderinnerungen haften an diesem Stiefvater, und gleiten von ihm auf das Theater über. Wohl entsinne ich mich, daß mein Vater gern Malertalent sich in mir entwickeln gesehen haben würde; sein Arbeitszimmer mit der Staffelei und den Gemälden darauf ist zwar auf mich nicht ohne Eindruck gewesen; ich entsinne mich, daß ich namentlich ein Porträt des Königs Friedrich August von Sachsen mit kindischem Nachahmungseifer zu kopieren versuchte; sobald es aber von dieser naiven Kleckserei zu ernsteren Zeichnungsstudien übergehen sollte, hielt ich, vielleicht schon durch die pedantische Manier meines Lehrers (eines langweiligen Vetters) abgeschreckt, nicht aus. Nachdem ich in zartester Kindheit durch eine Entwicklungskrankheit so elend geworden war, daß meine Mutter mir später erzählte, sie habe, da ich unrettbar schien, fast meinen Tod gewünscht, scheine ich zum Überraschen meiner Eltern dann gediehen zu sein. Auch bei dieser Gelegenheit ist mir der großmütige Anteil des vortrefflichen Stiefvaters berichtet worden, welcher, nie verzweifelnd trotz der Sorgen und Beschwerden des starken Familienbestandes, geduldig blieb, und nie die Hoffnung, mich durchgebracht zu sehen, aufgab. – Große Gewalt übte nun auf meine Phantasie die Bekanntschaft mit dem Theater, in welches ich nicht nur als kindischer Zuschauer in der heimlichen Theaterloge mit ihrem Eingang über die Bühne, nicht nur durch den Besuch der Garderobe mit ihren phantastischen Kostümen und charakteristischen Verstellungsapparaten, sondern auch durch eigenes Mitspielen eingeführt wurde. Nachdem mich »Die Waise und der Mörder«, »Die beiden Galeerensklaven«, und ähnliche Schauerstücke, in welchen ich meinen Vater die Rollen der Bösewichter spielen sah, mit Entsetzen erfüllt hatten, mußte ich selbst einige Male mit Komödie spielen. Bei einem Gelegenheitsstücke zur Bewillkommnung des aus der Gefangenschaft zurückkehrenden Königs von Sachsen – »Der Weinberg an der Elbe«, mit Musik vom Kapellmeister C.M. von Weber, entsinne ich mich, bei einem lebenden Bilde als Engel ganz in Trikots eingenäht, mit Flügeln auf dem Rücken, in schwierig eingelernter graziöser Stellung figuriert zu haben. Auch erinnere ich mich bei dieser Gelegenheit einer großen Zuckerbrezel, von der mir versichert wurde, daß sie mir der König persönlich bestimmt habe. Endlich entsinne ich mich, in Kotzebues »Menschenhaß und Reue« selbst eine mit wenigen Worten versehene Kinderrolle dargestellt zu haben, welche mir in der Schule, da ich dort meine Aufgabe nicht gelernt hatte, zum Vorwand übermäßiger Beschäftigung dienen mußte, indem ich angab, eine große Rolle in den »Menschen außer der Reihe« zu memorieren gehabt zu haben.
Wie ernst es dagegen mein Vater mit meiner Erziehung nahm, bewies er, als er nach meinem vollbrachten sechsten Jahre mich zu einem Pfarrer auf das Land, nach Possendorf bei Dresden, brachte, wo ich in Gesellschaft anderer Knaben aus guten Familien eine vortreffliche, nüchterne und gesunde Erziehung erhalten sollte. In die kurze Zeit dieses Aufenthaltes fallen manche erste Erinnerungen von den Eindrücken der Welt: des Abends wurde uns Robinson vom Pfarrer erzählt und mit vortrefflichen dialogischen Belehrungen begleitet. Großen Eindruck machte auf mich die Vorlesung einer Biographie Mozarts, wogegen die Zeitungs- und Kalenderberichte über die Vorfälle des gleichzeitigen griechischen Befreiungskampfes drastisch aufregend auf mich wirkten. Meine Liebe für Griechenland, die sich späterhin mit Enthusiasmus auf die Mythologie und Geschichte des alten Hellas warf, ging somit von der begeisterten und schmerzlichen Teilnahme an Vorgängen der unmittelbaren Gegenwart aus. Ich entsinne mich, später in dem Kampf der Hellenen gegen die Perser immer die Eindrücke dieses neuesten griechischen Aufstandes gegen die Türken wiederempfunden zu haben.
Eines Tages, nach kaum einjähriger Dauer dieses ländlichen Aufenthaltes, kam ein Bote aus der Stadt an, welcher den Pfarrer benachrichtigte, er möge mich in das elterliche Haus nach Dresden geleiten, weil dort mein Vater im Sterben liege. Wir legten den dreistündigen Weg zu Fuß zurück; sehr ermüdet ankommend, begriff ich die tränenreiche Haltung meiner Mutter kaum. Des andern Tages ward ich an das Bett meines Vaters geführt; die äußerste Schwäche, mit der er zu mir sprach, alle Vorkehrungen einer letzten verzweifelten Behandlung seiner akuten Brustwassersucht erfüllten mich durchaus nur wie Traumgebilde; ich glaube, die bange Verwunderung war in mir so mächtig, daß ich nicht weinen konnte. In einem anstoßenden Nebenzimmer lud mich die Mutter ein, zu zeigen, was ich auf dem Klavier gelernt habe, in der guten Absicht, es dem Vater zur Zerstreuung zu Gehör zu bringen: ich spielte »Üb' immer Treu' und Redlichkeit«; der Vater hat da die Mutter gefragt: »Sollte er etwa Talent zur Musik haben?« – Am andern Morgen trat beim ersten Tagesgrauen die Mutter in die große Kinderschlafstube, kam zu jedem von uns an das Bett und meldete schluchzend des Vaters Tod, jedem von uns wie zum Segen etwas von ihm sagend; zu mir sagte sie: »Aus dir hat er etwas machen wollen.« Am Nachmittag kam Pastor Wetzel und holte mich wieder auf das Land ab. Wir gingen wieder zu Fuß und erreichten erst in nächtlicher Dämmerung Possendorf; unterwegs frug ich ihn viel nach den Sternen, über die er mir eine erste verständige Auskunft gab. Acht Tage darauf erschien der Bruder des Verstorbenen, welcher aus Eisleben herbeigekommen war, um dem Begräbnis beizuwohnen; er hatte der nun wiederum hilflos gewordenen Familie nach Kräften seine Unterstützung zugesagt und es übernommen, für meine Erziehung fortan zu sorgen. Ich nahm Abschied von meinen Jugendgenossen und von dem liebenswürdigen Pastor, zu dessen eigenem Begräbnis ich nach wenigen Jahren zum erstenmal wieder nach Possendorf zurückkehrte, welches ich dann nur viel später wieder einmal auf einer Exkursion besuchte, wie ich sie oft als Dresdener Kapellmeister weit in das Land hinein zu Fuß unternahm: es ergriff mich sehr, das alte Pfarrhaus nicht mehr zu finden, dafür einen reichlichern modernen Aufbau, der mich so gegen den Ort verstimmte, daß ich späterhin meine Ausflüge nie wieder in diese Gegend richtete.
Mein Oheim brachte mich diesmal im Wagen nach Dresden zurück; ich traf die Mutter und die Schwestern in tiefer Trauerkleidung, und entsinne mich, zum erstenmal mit einer in der Gewohnheit meiner Familie nicht heimischen Zärtlichkeit empfangen und wieder entlassen worden zu sein, als ich nach wenigen Tagen von dem Oheim mit nach Eisleben genommen wurde. Dort war dieser jüngere Bruder meines Stiefvaters als Goldschmied niedergelassen; einer meiner älteren Brüder (Julius), war bereits von ihm in die Lehre aufgenommen; zugleich lebte bei ihm, dem Unverehelichten, noch die alte Großmutter. Man hat dieser, deren baldiges Ende man voraussah, den Tod ihres älteren Sohnes verschwiegen; auch ich wurde dazu angehalten, nichts davon zu verraten. Das Dienstmädchen nahm sorgsam den Trauerflor von meinem Kleide und erklärte, ihn für die Großmutter aufbewahren zu wollen, wenn sie, wie für bald zu erwarten, gestorben sein würde. Ich mußte nun der Großmutter öfter vom Vater erzählen; die Verheimlichung seines Todes glückte mir ohne Anstrengung, da ich selbst kein deutliches Bewußtsein davon hatte. Sie lebte in einer finsteren Hinterstube, auf einen engen Hof hinaus, und hatte gern frei umherflatternde Rotkehlchen bei sich, für welche stets frisch erhaltene grüne Zweige am Ofen ausgesteckt waren. Es glückte mir selbst, ihr im Sprenkel welche einzufangen, als die alten von der Katze getötet worden waren: hierüber freute sie sich sehr und hielt mich sauber und reinlich. Auch ihr vorausgesehener Tod trat bald ein: der aufgesparte Trauerflor wurde nun offen in Eisleben getragen; das Hinterstübchen mit den Rotkehlchen und grünen Büschen hörte für mich auf. – Bei einer Seifensiederfamilie, welcher das Haus gehörte, wurde ich bald heimisch und durch meine Erzählungen, welche ich ihr zum besten gab, beliebt. Ich wurde in eine Privatschule geschickt, welche ein Magister Weiß hielt, der auf mich einen ernsten und würdigen Eindruck hinterlassen hat. Mit Rührung las ich am Ende der fünfziger Jahre in einer musikalischen Zeitung den Bericht über eine in Eisleben stattgefundene Musikaufführung mit Stücken aus dem Tannhäuser, welcher der ehemalige Lehrer des Kindes mit voller Erinnerung an dasselbe beigewohnt hatte.
Die kleine altertümliche Stadt mit dem Wohnhause Luthers und den mannigfachen Erinnerungen an dessen Aufenthalt, ist mir noch in spätesten Zeiten oft im Traume wiedergekehrt; es blieb mir immer der Wunsch, sie wieder zu besuchen, um die Deutlichkeit meiner Erinnerungen bewährt zu finden: sonderbarerweise bin ich nie dazu gekommen. Wir wohnten am Markte, der mir oft eigentümliche Schauspiele gewährte, wie namentlich die Vorstellungen einer Akrobaten-Gesellschaft, bei welchen auf einem von Turm zu Turm über den Platz gespannten Seile gegangen wurde, was in mir lange Zeit die Leidenschaft für ähnliche Kunststücke erweckte. Ich brachte es wirklich dazu, auf zusammengedrehten Stricken, welche ich im Hof ausspannte, mit der Balancierstange mich ziemlich geschickt zu bewegen; noch bis jetzt ist mir eine Neigung, meinen akrobatischen Gelüsten Genüge zu tun, verblieben. – Am wichtigsten wurde mir die Blechmusik eines in Eisleben garnisonierenden Husarenregimentes. Ein von ihr häufig gespieltes Stück erweckte damals als Neuigkeit unerhörtes Aufsehen: es war der »Jägerchor« aus dem Freischütz, welche Oper soeben in Berlin zur Aufführung gekommen war. Onkel und Bruder frugen mich lebhaft nach dem Komponisten, den ich in Dresden als Kapellmeister Weber doch gewiß im Hause der Eltern gesehen haben müßte. Zu gleicher Zeit ward in einer befreundeten Familie von den Töchtern der »Jungfernkranz« eifrig gespielt und gesungen. Diese beiden Stücke verdrängten nun bei mir meine Vorliebe für denYpsilanti-Walzer, der mir bis dahin als das wunderbarste Tonstück galt. – Ich entsinne mich, viele Raufereien mit der autochthonen Knabenbevölkerung, welche ich namentlich durch meine viereckige Mütze zu beständiger Verhöhnung reizte, zu bestehen gehabt zu haben. Außerdem tritt noch der Hang zu abenteuerlichen Streifereien durch die felsigen Uferklippen der Unstrut in meine Erinnerung.
Durch die endliche Verheiratung meines Oheims, welcher nun einen neuen Hausstand sich einrichtete, trat, wie es scheint, auch eine starke Veränderung in seinen Beziehungen zu meiner Familie ein. Nach Verlauf eines Jahres ward ich von ihm nach Leipzig geleitet, wo ich für einige Tage den Verwandten meines Vaters (Wagner) übergeben wurde. Diese waren mein Onkel Adolf und dessen Schwester, meine Tante Friederike Wagner. Der sehr interessante Mann, welcher später immer anregender auf mich einwirkte, tritt mit seiner sonderbaren Umgebung von hier an zuerst deutlich in mein Bewußtsein. Er stand mit meiner Tante zugleich in sehr nahe befreundetem Verhältnisse zu einer wunderlichen alten Jungfer, Jeannette Thomé, der Mitbesitzerin eines großen Hauses am Markte, in welchem, wenn ich nicht irre, seit den Zeiten Augusts des Starken die sächsische Fürstenfamilie die zwei Hauptstockwerke für ihren jeweiligen Aufenthalt in Leipzig gemietet und eingerichtet hatte. Jeannette Thomé fiel, so viel ich weiß, der eigentliche Besitz des zweiten Stockwerkes zu, in welchem sie für sich nur eine unscheinbare Wohnung nach dem Hof hinaus bewohnte. Da jedoch der König höchstens auf wenige Tage im Jahre von den gemieteten Räumen Gebrauch machte, so hielt sich Jeannette mit den Ihrigen für gewöhnlich in den vermieteten Prachtzimmern auf, und in einem dieser Prunkgemächer war es denn auch, wo mir meine Schlafstelle angewiesen wurde. Die Einrichtung dieser Räume war noch aus den Zeiten Augusts des Starken; prächtig aus schweren Seidenstoffen mit reichen Rokoko-Möbeln, alles bereits vom Alter stark abgenutzt. Wohl gefiel ich mir sehr in diesen großen phantastischen Räumen, von wo aus man auf den so belebten Leipziger Markt blickte, unter dessen Bevölkerung mich namentlich die gassenbreit aufziehenden Studenten, in ihrer altdeutschen burschenschaftlichen Tracht, außerordentlich fesselten. Nur an einem Schmuck dieser Räume hatte ich sehr zu leiden: das waren die verschiedenen Porträts, namentlich der vornehmen Damen im Reifrock mit jugendlichen Gesichtern und weißen (gepuderten) Haaren. Diese kamen mir durchaus als gespenstige Wesen vor, die mir, wenn ich allein im Zimmer war, lebendig zu werden schienen und mich mit höchster Furcht erfüllten. Das einsame Schlafen in einem solchen abgelegenen großen Gemach, in dem altertümlichen Prachtbett, in der Nähe eines solchen unheimlichen Bildes, war mir entsetzlich; zwar suchte ich vor der Tante, wenn sie mich des Abends mit einem Licht zu Bett brachte, meine Furcht zu verbergen; doch verging nie eine Nacht, ohne daß ich in Angstschweiß gebadet den schrecklichsten Gespenster-Visionen ausgesetzt war.
Den gespenstischen Eindruck dieses Aufenthaltes in das märchenhaft Sonderbare überzutragen, war die Persönlichkeit der drei Hauptbewohner dieses Stockwerkes vorzüglich geeignet: Jeannette Thomé war sehr klein und dick, trug eine blonde Titusperücke und schien sich in dem Bewußtsein früherer Zierlichkeit zu behagen. Ihre treue Freundin und Pflegerin, meine Tante, welche ebenfalls zur alten Jungfer geworden war, zeichnete sich durch Länge und große Magerkeit aus; das Phantastische ihres sonst sehr freundlichen Gesichtes war durch ihr außerordentlich spitzes Kinn vermehrt. Mein Oheim Adolf hatte sein Studierzimmer ein für allemal in einem finstern Gemach des Hofes aufgeschlagen. Dort traf ich ihn zuerst unter einem großen Wuste von Büchern, in einer unscheinbaren Hauskleidung, deren Charakteristisches in einer hohen spitzen Filzmütze bestand, wie ich sie in Eisleben bei dem Bajazzo der Seiltänzergesellschaft gesehen hatte. Ein großer Hang zur Selbständigkeit hatte ihn in dieses sonderbare Asyl getrieben. Ursprünglich zur Theologie bestimmt, gab er diese bald gänzlich auf, um sich einzig philosophischen und philologischen Studien zu widmen. Bei größter Abneigung gegen eine Wirksamkeit als Professor und Lehrer mit Anstellung, suchte er sich frühzeitig durch literarische Arbeiten dürftig zu erhalten. Mit geselligen Talenten und namentlich einer schönen Tenorstimme begabt, auch seinerseits mit Interesse für das Theater erfüllt, scheint er in seiner Jugend als nicht ungern gesehener Belletrist in Leipzig einem größeren Bekanntenkreis liebgeworden zu sein. Bei einem Ausfluge nach Jena, auf welchem er mit einem Altersgenossen sich selbst bis zu musikalisch-deklamatorischen »Akademien« herbeigelassen zu haben scheint, besuchte er auch Schiller; er hatte sich hierzu mit einem Auftrage der Leipziger Theaterdirektion, welche den kürzlich vollendeten »Wallenstein« akquirieren wollte, versehen. Mir schilderte er späterhin den hinreißenden Eindruck, den Schiller auf ihn hervorbrachte, dessen schlanke hohe Gestalt und unwiderstehlich einnehmendes blaues Auge. Nur beklagte er sich, infolge eines gutgemeinten Streiches, den ihm sein Freund gespielt, in große und beschämende Verlegenheit gebracht worden zu sein. Dieser hatte nämlich ein Heft Gedichte Adolf Wagners zuvor an Schiller zu bringen gewußt; der betroffene junge Poet mußte nun von Schiller freundliche Lobsprüche hinnehmen, von denen er innigst überzeugt war, daß er sie nur der humanen Großmut Schillers zu verdanken hatte. – Später wandte er sich immer mehr nur noch philologischen Studien zu. Als eine der bekanntesten Arbeiten auf diesem Feld ist seine Herausgabe des Parnasso Italiano zu erwähnen, welche er Goethe mit einem italienischen Gedichte widmete, von welchem mir zwar durch Sachkenner versichert worden ist, daß es in einem ungebräuchlichen und schwülstigen Italienisch verfaßt sei, das ihm aber dennoch von Goethe einen anerkennungsvollen schönen Brief und einen silbernen Becher aus des Dichters gebrauchtem Hausgeräte erwarb. – Der Eindruck, den seine Erscheinung in der bezeichneten Umgebung in meinem achten Jahre auf mich machte, war durchaus rätselhafter, befremdender Art. –
Zunächst wurde ich nach wenigen Tagen wieder diesen Einflüssen entzogen, um zu meiner Familie nach Dresden gebracht zu werden. Dort hatte sich währenddem, unter der Leitung der nun alleinstehenden Mutter, meine Familie nach Kräften einzurichten gesucht. Mein ältester Bruder (Albert), ursprünglich zum Studium der Medizin bestimmt, hatte auf den Rat Webers, der seine Tenorstimme rühmte, die theatralische Laufbahn in Breslau ergriffen. Ihm folgte bald meine zweitälteste Schwester (Luise), ebenfalls als Schauspielerin dem Theater sich widmend. Meine älteste Schwester Rosalie war zu einer ehrenvollen Anstellung am Dresdener Hoftheater selbst gelangt und sie bildete nun fortan den Mittelpunkt des zurückgebliebenen jüngeren Teiles der Familie, wie sie die nächste Stütze der von Sorgen beschwerten Mutter blieb. Ich traf sie noch in derselben großen und angenehmen Wohnung, welche der Vater zuletzt eingerichtet hatte; nur waren stets einige überflüssige Zimmer zeitweilig an Fremde vermietet, unter denen einst auch Spohr sich einfand. Der großen Rührigkeit meiner Mutter verdankte, mit Hilfe verschiedener erleichternder Umstände, (unter denen die fortdauernde Geneigtheit des Hofes gegen das Andenken meines Stiefvaters zu erwähnen ist) die Familie ein erträgliches Gedeihen, so daß auch in betreff meiner Erziehung keine Art Vernachlässigung eintrat.
Nachdem auch eine dritte Schwester (Klara) ihrer außerordentlich schönen Stimme zulieb für das Theater bestimmt war, hielt meine Mutter angelegentlich darauf, in mir nicht etwa auch Neigung für das Theater aufkommen zu lassen. Es war ihr stets ein Selbstvorwurf geblieben, daß sie in die theatralische Laufbahn meines ältesten Bruders gewilligt hatte; da mein zweiter Bruder keine weiteren Anlagen verriet als die, welche ihn zum Goldschmied bestimmt hatten, so war ihr nun daran gelegen, an mir die Hoffnungen und Wünsche des Stiefvaters, der »aus mir etwas machen wollte«, in Erfüllung gehen zu sehen. Mit meinem vollbrachten achten Jahre wurde ich auf das Gymnasium der Kreuzschule in Dresden geschickt; ich sollte studieren. Dort trat ich als unterster Schüler der untersten Klasse ein und begann nun unter den bescheidensten Anfängen meine gelehrte Bildung. Die Mutter verfolgte mit großer Teilnahme alle bei mir sich einstellenden Anzeichen von geistiger Lebendigkeit und Begabung.
Diese für alle, die sie kennenlernten, merkwürdig gebliebene Frau stellte ein eigentümliches Gemisch von bürgerlich-häuslicher Rührigkeit und großer geistiger Empfänglichkeit bei durchaus mangelnder gründlicher Erziehung dar. Über ihre Herkunft hat sie sich gegen keines ihrer Kinder umständlich vernehmen lassen. Sie stammte aus Weißenfels, und gab zu, daß ihre Eltern dort Bäcker gewesen seien. Schon in betreff ihres Namens äußerte sie sich aber mit einer sonderbaren Befangenheit, indem sie diesen als »Perthes« angab, während, wie wir wohl herausbekamen, er in Wahrheit »Petz« hieß. Auffallend war, daß sie in einer gewählten Erziehungsanstalt zu Leipzig untergebracht war und dort die Sorge eines von ihr sogenannten »hohen väterlichen Freundes« genoß, als welchen sie uns später einen weimarischen Prinzen nannte, der sich um ihre Familie in Weißenfels Verdienste erworben hatte. Ihre Erziehung scheint in jener Anstalt durch den plötzlichen Tod dieses väterlichen Freundes unterbrochen worden zu sein. Sehr jung lernte sie meinen Vater kennen und heiratete ihn, den ebenfalls sehr früh gereiften und zur Anstellung gelangten, im jugendlichsten Mädchenalter. Ihr Haupt-Charakterzug scheint ein drolliger Humor und gute Laune gewesen zu sein, und es ist wohl nicht zu glauben, daß nur das Pflichtgefühl gegen die Familie eines hinterlassenen Freundes, sondern eine wirklich herzliche Neigung auch zu dessen Witwe den trefflichen Ludwig Geyer bewog, mit der nicht mehr ganz jugendlichen Frau in die Ehe zu treten. Ein Porträt von ihr, welches Geyer noch während ihrer ersten Ehe gemalt, stellt ihr Äußeres sehr vorteilhaft dar. Von da an, wo sie deutlich in meine Erinnerung tritt, war sie bereits durch ein Kopfleiden genötigt, stets eine Haube zu tragen, so daß ich den Eindruck einer jugendlichen und anmutigen Mutter nicht mehr von ihr erhalten habe. Der sorgenvoll aufregende Umgang mit einer zahlreichen Familie (deren siebentes lebendes Glied ich war), die Schwierigkeiten, das Nötige zu beschaffen und bei sehr beschränkten Mitteln eine gewisse Neigung für äußern Anschein zu befriedigen, ließen nicht jenen behaglichen Ton mütterlicher Familienzärtlichkeit bei ihr aufkommen; ich entsinne mich kaum je von ihr geliebkost worden zu sein, wie überhaupt zärtliche Ergießungen in unsrer Familie nicht stattfanden; wogegen sich ein gewisses hastiges, fast heftiges, lautes Wesen sehr natürlich geltend machte. Unter solchen Umständen ist es mir als Epoche machend in der Erinnerung geblieben, daß, als ich eines Abends schläfrig zu Bett gebracht wurde und die Augen weinerlich nach ihr aufschlug, die Mutter mit Wohlgefallen auf mich blickte und gegen einen anwesenden Besuch sich mit einer gewissen Zärtlichkeit über mich äußerte. Was mich hauptsächlich ihrerseits beeinflußte, war der seltsame Eifer, in welchem sie vom Großen und Schönen in der Kunst mit fast pathetischem Tone sprach. Mir gegenüber wollte sie aber hierunter niemals die theatralische Kunst gemeint haben, sondern nur Dichtkunst, Musik und Malerei, wogegen sie mir häufig fast mit ihrem Fluche drohte, wenn auch ich jemals zum Theater gehen wollte. Dabei war sie von sehr religiösem Sinne; sie hielt uns oft mit einem gefühlvollen Pathos längere, Predigt-ähnliche Reden von Gott und dem Göttlichen im Menschen, in denen sie sich gelegentlich wohl auch, mit plötzlich herabgestimmtem Tone, in humoristischer Art durch einen Verweis unterbrach. Namentlich seit dem Tode des Stiefvaters versammelte sie jeden Morgen die übriggebliebene Familie um ihr Bett, in welchem sie den Kaffee trank, jedoch nicht eher, als bis von einem unter uns ein Lied aus dem Gesangbuch vorgelesen worden, wobei in der Wahl es nicht peinlich genau genommen wurde, bis denn einst aus Versehen meine Schwester Klara ein »Gebet in Kriegsnöten« zu so ergreifendem Vortrag brachte, daß die Mutter sie mit den Worten unterbrach: »Na, nun höre auf! Gott verzeih' mir meine Sünde, in Kriegsnöten sind wir doch gerade nicht!«
Trotz aller Beschwerlichkeit des Auskommens ging es dann und wann bei Abendgesellschaften heiter und, wie es mich Knaben dünkte, glänzend her. Aus den Zeiten meines Stiefvaters, welcher in den letzten Jahren seines Lebens durch sein Glück als Porträtmaler seine Einkünfte auf eine – für die damalige Zeit – ziemlich ansehnliche Höhe gesteigert hatte, waren uns angenehme und den besten Ständen angehörende Bekanntschaften verblieben, die sich auch jetzt zuweilen bei uns vereinigten. Namentlich bildeten damals die Mitglieder des Hoftheaters selbst anmutige und geistig belebte Kreise, von denen ich später in Dresden keine lebendigen Erinnerungen mehr vorfand. Besonders beliebt waren gemeinschaftliche Landpartien in die schöne Umgegend Dresdens, bei welchen kollegialische künstlerische Heiterkeit vorherrschte. Ich entsinne mich eines solchen Ausfluges nach Loschwitz, wo eine Art Zigeunerwirtschaft aufgeschlagen wurde, welcher Carl Maria v. Weber in der Funktion eines Koches seinen Beitrag widmete. Auch ward bei uns musiziert; meine Schwester Rosalie spielte Klavier; Klara begann zu singen. Von den verschiedenen Theater-Aufführungen, welche früher an Geburtstagen der Eltern zu gegenseitiger Überraschung oft mit großen Vorbereitungen veranstaltet wurden, blieben mir schon zu jener Zeit nur noch die Erinnerungen, namentlich an Aufführungen von einer Parodie der Grillparzerschen Sappho, in welcher ich selbst im Chor der Gassenbuben vor dem Triumphwagen Phaons mitwirkte. Diese Erinnerungen suchte ich mir durch ein schönes Puppentheater aufzufrischen, welches ich in der Hinterlassenschaft des Vaters auffand, und zu welchem er selbst schöne Dekorationen gemalt hatte. Ich beabsichtigte, die Meinigen durch eine glänzende Aufführung auf diesem Theater zu überraschen. Nachdem ich mir mit größtem Ungeschick verschiedene Puppen geschnitzt, für ihre Kleidung durch Verfertigung von Kostümen aus heimlich entwendeten Kleiderlappen meiner Schwestern notdürftig gesorgt hatte, ging ich auch an die Abfassung eines Ritterstückes, dessen Rollen ich meinen Puppen einstudieren wollte. Als ich die erste Szene entworfen hatte, entdeckten meine Schwestern das Manuskript und gaben es unmäßigem Gelächter preis: die eine Phrase der geängstigten Liebhaberin, »ich höre schon den Ritter trabsen«, ist mir lange zu meinem größten Ärger mit Pathos vorrezitiert worden.
Dem Theater, welchem auch jetzt meine Familie immer wieder naheblieb, wandte auch ich von neuem mich mit Eifer zu. Namentlich wirkte der Freischütz – jedoch vorzüglich seines spukhaften Sujets wegen – äußerst charakteristisch auf meine Phantasie. Die Erregungen des Grausens und der Gespensterfurcht bilden einen ganz besonderen Faktor der Entwicklung meines Gemütslebens. Von zartester Kindheit an übten gewisse unerklärliche und unheimliche Vorgänge auf mich einen übermäßigen Eindruck aus; ich entsinne mich, vor leblosen Gegenständen als Möbeln, wenn ich länger im Zimmer allein war und meine Aufmerksamkeit darauf heftete, plötzlich aus Furcht laut aufgeschrien zu haben, weil sie mir belebt schienen. Keine Nacht verging bis in meine spätesten Knabenjahre, ohne daß ich aus irgendeinem Gespenstertraum mit fürchterlichem Geschrei erwachte, welches nie eher endete, als bis mir eine Menschenstimme Ruhe gebot. Das heftigste Schelten, ja selbst körperliche Züchtigung erschienen mir dann als erlösende Wohltaten. Keines meiner Geschwister wollte mehr in meiner Nähe schlafen; man suchte mich so fern wie möglich von den übrigen zu betten und bedachte nicht, daß meine Gespensterhilferufe nur desto lauter und anhaltender wurden, bis man sich endlich an diese nächtliche Kalamität gewöhnte.
Was mich im Zusammenhang hiermit beim Besuch des Theaters, worunter ich auch die Bühne, die Räume hinter den Kulissen und die Garderobe verstehe, lebhaft anzog, war weniger die Sucht nach Unterhaltung und Zerstreuung, wie beim heutigen Theaterpublikum, sondern das aufreizende Behagen am Umgang mit einem Elemente, welches den Eindrücken des gewöhnlichen Lebens gegenüber eine durchaus andere, rein phantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt darstellte. So war mir eine Theaterdekoration, ja nur eine – etwa ein Gebüsch darstellende – Kulisse, oder ein Theaterkostüm und selbst nur ein charakteristisches Stück desselben, als aus einer andern Welt stammend, in einem gewissen Sinne gespenstisch interessant, und die Berührung damit mochte mir als der Hebel gelten, auf dem ich mich aus der gleichmütigen Realität der täglichen Gewohnheit in jenes reizende Dämonium hinüberschwang. So blieb mir alles, was zu theatralischen Aufführungen diente, geheimnisvoll, bis zur Berauschung anziehend, und während ich mit Altersgenossen Aufführungen des Freischütz nachzuahmen suchte und mit großem Eifer hierbei mich der Herstellung der Kostüme und Gesichtsmasken durch groteske Malerei hingab, übten die zarteren Garderobengegenstände meiner Schwestern, mit deren Herrichtung ich die Familie häufig beschäftigt sah, einen fein erregenden Reiz auf meine Phantasie aus; das Berühren derselben konnte mich bis zu bangem, heftigem Herzschlag aufregen. Trotzdem daß, wie ich erwähnte, in unserem Familienverkehr keine, namentlich in Liebkosungen sich ergehende Zärtlichkeit herrschte, mußte doch die stets nur weibliche Umgebung in der Entwicklung meines Empfindungswesens mich stark beeinflussen. Vielleicht gerade, weil dieser Umgang meist unruhiger, ja heftiger Art war, übten die sonstigen Attribute der Weiblichkeit, namentlich soweit sie mit der phantastischen Theaterwelt zusammenhingen, einen fast sehnsüchtig stimmenden Reiz auf mich aus.
Diesen von dem Grauenhaften bis in das Weichliche sich verlierenden phantastischen Stimmungen wirkte glücklicherweise ergänzend und kräftigend der ernstere Einfluß entgegen, welchen ich in der Schule im Umgang mit Lehrern und Jugendgenossen empfing. Auch hier war es zwar hauptsächlich das Phantastische, was mich zu reger Teilnahme bestimmte. Ob ich für die Studien, wie man sagt, einen hellen Kopf hatte, kann ich nicht beurteilen; ich glaube im ganzen das, was mich lebhaft anzog, fast ohne eigentliches Lernen schnell begriffen zu haben, während ich auf das, was meiner Vorstellung fernlag, kaum versuchte, eigentlichen Fleiß zu verwenden. Am deutlichsten zeigte sich dies im Rechnen und später bei der Mathematik; in beiden Wissenschaften gelang es mir nicht einmal, es nur bis zum eigentlichen Beachten der mir gestellten Aufgaben zu bringen. Auch auf die alten Sprachen vermochte ich nur soweit Fleiß zu verwenden, als es durchaus unerläßlich war, um durch ihre Kenntnis mich der Gegenstände zu bemächtigen, deren charakteristischeste Darstellung mir vorzuführen es mich reizte. Hierin zog mich namentlich das Griechische an, weil die Gegenstände der griechischen Mythologie meine Phantasie so stark fesselten, daß ich die Helden derselben durchaus in ihrer Ursprache sprechend mir vorführen wollte, um meine Sehnsucht nach vollständigster Vertrautheit mit ihnen zu stillen. Daß unter diesen Umständen die eigentliche Grammatik nur als ein beschwerliches Hindernis, nicht aber als ein selbst anreizender Wissenszweig betrachtet wurde, läßt sich leicht denken. Daß ich in meinen Sprachstudien nicht sehr gründlich verfuhr, erhellt mir am besten wohl daraus, daß ich in späterer Zeit das Befassen mit ihnen so schnell aufgeben konnte. Erst weit später gewann mir das Sprachstudium im allgemeinen ein wahrhaftes Interesse ab, seit ich die physiologisch-philosophische Seite der Behandlung desselben kennenlernte, wie sie unseren neueren Germanisten durch Jakob Grimms Vorgang zu eigen geworden ist. Da es nun für mich eben zu spät war, mich gründlicher diesem endlich liebgewordenen Studium hinzugeben, bleibt mir das Bedauern, diese neuere Auffassung des Sprachstudiums nicht schon zu meiner Jugendzeit in unseren Gelehrtenschulen in Geltung angetroffen zu haben. Nichtsdestoweniger erwarben mir meine Erfolge auf dem philologischen Felde die bevorzugende Beachtung eines jungen Lehrers der Kreuzschule, des damaligen Magisters Sillig. Dieser erlaubte mir, ihn öfter zu besuchen und ihm meine Arbeiten, die in metrischen Übersetzungen sowie in eigenen Gedichten bestanden, mitzuteilen. Namentlich schien er bei den Deklamationsübungen mich liebgewonnen zu haben, und was er mir zutraute, mag daraus erhellen, daß er den damals etwa zwölfjährigen Knaben veranlaßte, nicht nur Hektors Abschied aus der Ilias, sondern selbst den berühmten Monolog des Hamlet vom Katheder herab zu rezitieren. – Als einst, da ich noch in Quarta saß, ein Mitschüler namens Starke plötzlich starb, erregte dieser traurige Vorfall so große Teilnahme, daß nicht nur die ganze Klasse zum Begräbnis des Kameraden beschieden, sondern vom Rektor auch die Aufgabe gestellt wurde, durch ein Gedicht, welches gedruckt werden sollte, die Leichenfeier zu erhöhen. Von den verschiedenen Gedichten, unter denen auch ein von mir in Eile verfaßtes sich befand, erschien dem Rektor jedoch keines der beabsichtigten Auszeichnung würdig, so daß er bereits seinen Entschluß ankündigte, durch eine von ihm selbst zu verfassende Rede für das verfehlte einzutreten. Bestürzt suchte ich eilig Magister Sillig auf, um ihn noch zu einer Intervention zugunsten meines Gedichtes zu bewegen: wir gingen dieses nun durch; die achtzeiligen wohlgebauten und -gereimten Stanzen bestimmten ihn, den Inhalt des Gedichtes sorglich zu revidieren. Es fand sich sonderlicher Schwulst in Bildern, die weit über die Vorstellungsweise eines Knaben meines Alters hinausgingen, in dem Gedicht. Ich entsinne mich einer Stelle, auf welche der Monolog aus Addisons Cato, vor dessen Selbstmord, wie ich ihn in einer englischen Grammatik vorgefunden, großen Einfluß geübt hatte. Die Worte »und wenn die Sonne schwarz vor Alter würde, die Sterne müd' zur Erde fielen«, welche jedenfalls unmittelbare Reminiszenzen aus jenem Monolog enthielten, erweckten Silligs mich fast beleidigendes Lächeln. Dennoch verdankte ich der Sorgfalt und der Schnelligkeit, mit welcher er mein Gedicht von derlei Ausschweifungen säuberte, daß dieses schließlich vom Rektor noch zugelassen, wirklich gedruckt und in zahlreichen Exemplaren verteilt wurde.
Der Erfolg dieser Auszeichnung war außerordentlich, sowohl bei meinen Mitschülern, als namentlich auch bei meiner Familie; meine Mutter faltete die Hände andächtig, und in mir ward ich nun einig über meinen Beruf. Ganz unzweifelhaft stand es vor mir, daß ich zum Dichter bestimmt sei. Magister Sillig wollte von mir ein großes episches Gedicht abgefaßt haben, und wies mir als Stoff Die Schlacht am Parnassos, nach Pausanias' Darstellung, zu. Was ihn hierzu vermochte, war die von Pausanias berichtete Sage, daß den verbündeten Griechen gegen den räuberischen Einfall der Gallier im zweiten Jahrhundert vor Chr. die Musen selbst vom Parnassos herab durch Erregung eines panischen Schreckens beigestanden hätten. Wirklich begann ich mein Heldengedicht in Hexametern, kam aber nicht über den ersten Gesang hinaus. – In meinen Studien noch nicht so weit vorgeschritten, um die griechischen Tragiker in der Ursprache selbst bewältigen zu können, beeinflußte mich das Bekanntwerden mit den geistvollen Nachahmungen ihrer Formen, welche mir zufällig in August Apels hieher schlagenden dichterischen Arbeiten, nämlich dessen Polyïdos und Aitolier, bekannt wurden, bei dem Versuche, ebenfalls eine Tragödie nach griechischem Muster zu konstruieren. Ich wählte hierzu als Stoff den Tod des Odysseus nach einer Fabel des Hyginus, nach welcher der alte Held von seinem mit Kalypso erzeugten Sohne erschlagen wird. Auch mit dieser Arbeit blieb ich in den ersten Anfängen stehen.
Aus der somit eingeschlagenen Geistesrichtung geht es hervor, daß die trockneren Schulstudien meinem Eifer ferne blieben. Griechische Mythologie, Sage und endlich Geschichte waren es, was mich einzig anzog. Dem Leben zugewandt, war ich im Verkehr mit meinen Altersgenossen lebhaft und zu abenteuerlichen Streichen aufgelegt. Zu jeder Zeit stand ich in fast leidenschaftlichem Freundschaftsbund zu irgendeinem Erwählten. In diesen häufig wechselnden Beziehungen bestimmte mich meistens das Eingehen des Genossen auf meine phantastischen Liebhabereien. Einmal war es Dichterei und Versemachen, ein anderes Mal waren es theatralische Unternehmungen, mitunter wohl auch die Neigung zum Herumschweifen und zu lustigen Streichen, was mich in der Wahl meiner Freunde bestimmte. Außerdem trug sich nun, wo ich mein dreizehntes Jahr erreicht hatte, eine starke Veränderung in unserer Familie zu: meine Schwester Rosalie, welche zum ernährenden Haupte derselben geworden war, erhielt ein vorteilhaftes Engagement am Theater in Prag, und Mutter und Geschwister siedelten 1826 mit vollkommenem Aufgeben des Dresdener Aufenthaltes nach Prag über. Ich allein ward in Dresden zurückgelassen, um die Kreuzschule bis zu meinem Abgange auf die Universität ohne Unterbrechung besuchen zu können. Ich ward zu diesem Zweck zu einer Familie Böhme, deren Söhne mir von der Schule her befreundet waren und in welcher ich mich bereits heimisch gemacht hatte, in Wohnung und Kost gegeben. Mit dem Aufenthalt in dieser etwas unruhigen, in dürftigen Verhältnissen nicht sonderlich wählsam geleiteten Familie, beginnt mein Eintritt in die Flegeljahre meines Lebens. Stille zur Arbeitsruhe sowie der sanftere phantastische Einfluß des Umganges mit meinen Schwestern ging mir immer merklicher verloren. Dafür stellte sich ein turbulentes Wesen, Balgerei und Raufsucht ein. Nach der zarteren Seite hin trat wiederum der Einfluß des weiblichen Elementes in bisher nicht gekannter Weise hervor; erwachsene Töchter und deren Freundinnen erfüllten oft die dürftigen engen Räume. Meine ersten Erinnerungen an knabenhafte Verliebtheit fallen in diese Zeit. In entsinne mich, daß ein sehr schönes, wohlerzogenes junges Mädchen, wenn ich nicht irre Amalie Hoffmann mit Namen, als sie, wie es ihr nur selten möglich war, des Sonntags in sauberem Putze zum Besuch in das Zimmer trat, mich bis zu lange dauernder Sprachlosigkeit in Erstaunen versetzte. Andere Male entsinne ich mich besinnungslose Schläfrigkeit geheuchelt zu haben, um von den Mädchen unter Bemühungen, welche dieser Zustand nötig zu machen schien, zur Ruhe gebracht zu werden, weil ich einst zu meiner aufregenden Überraschung bemerkt hatte, daß ein ähnlicher Zustand mich in eine mir schmeichelnde unmittelbare Berührung mit dem weiblichen Wesen brachte.
Am mächtigsten wirkte aber in diesem Jahre der Entfernung von meiner Familie ein kurzer Besuch, den ich derselben in Prag abstattete. Es war im vollen Winter, als meine Mutter in Dresden ankam und mich auf acht Tage mit sich nahm. Das Reisen mit der Mutter war von ganz besonderer Art: sie zog bis an ihr Lebensende dem schnelleren Reisen mit der Post die abenteuerlichere Fahrt mit dem Lohnkutscher vor. Von Dresden nach Prag waren wir in großer Kälte volle drei Tage unterwegs. Die Fahrt über das böhmische Gebirge schien oft mit völligen Gefahren verbunden, und nach glücklicher Überstehung der aufregendsten Abenteuer kamen wir endlich in Prag an, wo ich mich plötzlich in ein ganz neues Element versetzt fühlte. Lange Zeit hindurch hat der Besuch Böhmens, und namentlich Prags, von Sachsen aus auf mich einen völlig poetischen Zauber ausgeübt. Die fremdartige Nationalität, das gebrochene Deutsch der Bevölkerung, gewisse Kopftrachten der Frauen, der heimische Wein, die Harfenmädchen und Musikanten, endlich die überall wahrnehmbaren Merkmale des Katholizismus, die vielen Kapellen und Heiligenbilder, machten mir stets einen seltsam berauschenden Eindruck, der vielleicht an die Bedeutung sich anknüpfte, welche bei mir, der bürgerlichen Lebensgewohnheit gegenüber, das Theatralische gewonnen hatte. Vor allem übte die altertümliche Pracht und Schönheit der unvergleichlichen Stadt Prag auf meine Phantasie einen unerlöschlichen Eindruck. Aber auch in dem Umgange meiner Familie fand ich Elemente, welche mir bis dahin fremd geblieben waren. Namentlich meine nur zwei Jahre ältere Schwester Ottilie hatte die leidenschaftliche Freundschaft einer adeligen Familie, der des Grafen Pachta, gewonnen. Zwei Töchter desselben, Jenny und Auguste, welche noch längere Zeit als vorzüglichste Schönheiten Prags gerühmt wurden, hatten sich mit exaltierter Zärtlichkeit dieser meiner Schwester zugewandt. Mir waren solche Wesen und ein solches Verhältnis etwas ganz Neues und Bezauberndes. Außerdem hatten sich einige Schöngeister Prags, unter diesen W. Marsano, ein ausgezeichnet schöner und liebenswürdiger Mann, in unserem Hause eingefunden. Leidenschaftlich unterhielt man sich oft über die Hoffmannschen Erzählungen, welche damals noch ziemlich neu und von großem Eindruck waren. Ich erhielt von hier an durch mein erstes, zunächst nur oberflächliches Bekanntwerden mit diesem Phantastiker eine Anregung, welche sich längere Jahre hindurch bis zur exzentrischen Aufgeregtheit steigerte und mich durch die sonderbarste Anschauungsweise der Welt beherrschte.
Im folgenden Frühjahr 1827 wiederholte ich von Dresden aus einen Besuch in Prag, diesmal aber zu Fuß und in Begleitung meines Genossen Rudolf Böhme. Die Reise war voller Abenteuer; noch eine Stunde Weges vor Teplitz, bis wohin wir am ersten Abend gelangten, mußten wir andern Tages, da wir uns die Füße wund gegangen hatten, auf einem Fuhrwerke uns weiterbefördern lassen, jedoch nur bis Lowositz, weil von nun an das Geld uns vollständig ausging. In glühender Sonnenhitze, halb verschmachtend und mit hungerndem Magen wandernd, durchstreiften wir auf Seitenwegen das wildfremde Land, bis wir am Abend wieder die Hauptstraße erreichten, auf welcher soeben ein eleganter Reisewagen uns begegnete. Ich gewann es über mich, mir das Ansehen eines reisenden Handwerksburschen zu geben und die vornehmen Reisenden um ein Almosen anzusprechen, während mein Freund sich furchtsam in dem Chausseegraben versteckte. Für die Nachtherberge beschlossen wir auf gut Glück in eine freundliche Schenke am Wege einzutreten, und beratschlagten nun, was vorzuziehen sei, ob für das soeben erhaltene Almosen ein Nachtbrot oder ein Nachtlager zu gewinnen: wir entschlossen uns zu dem Abendbrot mit der Absicht, die Nacht unter freiem Himmel zuzubringen. Während wir uns erquickten, trat ein seltsamer Wanderer herein: er trug ein schwarzes Sammetbarett mit einer metallenen Lyra als Kokarde daran, auf dem Rücken eine Harfe. Mit bestem Humor entlud er sich seines Instrumentes, machte es sich bequem und verlangte gute Kost, in der Absicht hier zu übernachten, um des andern Tages nach Prag, wo er zu Haus war und wohin er von Hannover zurückkehrte, weiterzuwandern. Das joviale Wesen des lustigen Menschen, welcher bei jeder Gelegenheit sein Lieblings-Motto »non plus ultra« anbrachte, erweckte mir Gefallen und Vertrauen: sehr schnell war Bekanntschaft geschlossen, und mein Vertrauen ward von seiten des wandernden Musikers durch Bezeigung einer fast zärtlichen Liebe erwidert. Es wurde bestimmt, des andern Tages gemeinschaftlich die Fußreise fortzusetzen; er lieh mir zwei Zwanziger und ließ sich von mir die Prager Wohnung meiner Familie in seine Brieftasche notieren. Dieser persönliche Erfolg hatte für mich etwas Entzückendes. Mein Harfenspieler geriet in leidenschaftliche Lustigkeit: es wurde viel Czernoseker Wein getrunken; er sang und spielte auf seiner Harfe wie rasend, schwor in einem fort sein »non plus ultra« und sank endlich berauscht auf das für uns alle im Wirtzimmer aufgeworfene Strohlager. Als die Sonne hereinschien, war er nicht zu erwecken, und wir mußten uns entschließen, in der Morgenfrische ohne ihn uns auf den Weg zu machen in der Voraussetzung, der rüstige Mann würde uns den Tag über wohl einholen. Jedoch erwarteten wir ihn vergebens auf der Landstraße sowie auch während unseres folgenden Aufenthalts in Prag: erst nach mehreren Wochen fand der wunderliche Mensch sich bei meiner Mutter ein, weniger um sein Darlehen zurückzufordern, als um von seinen jungen Freunden Nachricht zu empfangen, wobei er sich herzlich betrübt zeigte, uns nicht mehr anzutreffen. – Der Rest unserer Wanderung kostete den jungen Gliedern noch große Ermüdung. Unbeschreiblich war meine Freude bei dem endlichen Anblick Prags von einer Anhöhe in einer Stunde Entfernung. Als wir uns den Vorstädten näherten, begegnete uns wiederum eine glänzende Equipage: aus ihr riefen mir die beiden schönen Freundinnen meiner Schwester Ottilie überrascht entgegen; sie hatten mich, trotz der fürchterlichsten Entstellung durch den Sonnenbrand und die blaue Leinwandbluse mit hochroter Kattunmütze, sofort erkannt. Voll Scham und mit hochklopfendem Herzen, vermochte ich wenig Auskunft zu geben und zog schnell weiter, um, in der mütterlichen Wohnung angelangt, vor allen Dingen für die Wiederherstellung meiner verbrannten Gesichtsfarbe zu sorgen. Hierzu opferte ich zwei volle Tage, während welcher ich mein Gesicht in Umschläge von Petersilie hüllte. Nun erst gab ich mich dem Genusse der Welt wieder hin. Als ich bei der Rückreise von der gleichen Anhöhe wieder auf Prag zurückblickte, zerfloß ich in Tränen, warf mich zur Erde und war von meinem staunenden Freunde lange nicht zum Weiterwandern zu bewegen. Ich blieb ernst, und bis zur Heimkehr nach Dresden begegneten uns diesmal keine Abenteuer.
Die Neigung zu größeren Fußreisen befriedigte ich noch im gleichen Jahre durch meinen Anschluß an eine zahlreiche Gesellschaft von Gymnasiasten verschiedener Klassen und gemischten Alters, welche sich in den Sommerferien zu einer gemeinschaftlichen Wanderung nach Leipzig entschlossen hatten. Auch diese Reise tritt aus meinen Jugenderinnerungen durch lebhafte Eindrücke hervor. Der charakteristische Hauptzug der Gesellschaft bestand in einer antizipierenden Tendenz des Studentenwesens; wir gebärdeten und kleideten uns in phantastischer Weise schon ganz nach Studentenart. Nachdem wir bis Meißen auf dem Marktschiff gefahren waren, ging die Wanderung nun von der Hauptstraße ab über mir unbekannt gebliebene Dörfer. In der Schenke eines derselben, wo wir unter den ausgelassensten Abenteuern in einer großen Scheune übernachteten, trafen wir ein großes Puppentheater mit Marionetten von fast menschlicher Größe an. Natürlich pflanzte sich die ganze Wandergesellschaft im Zuschauerraume auf und setzte dadurch die Dirigenten der Aufführung, welche nur auf ein Bauernpublikum gerechnet hatten, in große Verlegenheit. Es wurde »Genovefa« gespielt; das unaufhörliche Witzeln, das stete spaßhafte Hineinreden und höhnische Unterbrechen, was sich die naseweise Zukunfts-Studentenschaft erlaubte, erregte endlich aber selbst das Mißfallen der bäuerlichen Zuschauerschaft, welche durchaus zur Rührung aufgelegt blieb. Ich glaube unter uns der einzige gewesen zu sein, der diesen Übermut peinlich empfand und, trotz unwillkürlichen Lachens über spaßhafte Einfälle meiner Genossen, dennoch für das Stück wie für sein ursprüngliches naives Publikum Partei nahm. Eine populäre Redensart, welche in dem Stücke vorkam, ist mir dennoch unvergeßlich geblieben; Golo trug nämlich dem unvermeidlichen Kaspar auf, den Pfalzgrafen nach seiner Heimkehr »hinten zu kitzeln, daß er es vorne fühle«; Kaspar verriet dem Pfalzgrafen wörtlich den Auftrag Golos, und der Pfalzgraf warf dem entlarvten Bösewicht seine Schuld wiederum mit den im höchsten Pathos ausgesprochenen Worten vor: »O Golo, Golo! Du hast Kaspern gesagt, er solle mich hinten kitzeln, daß ich's vorne fühle!« – Von Grimma aus fuhr die jugendliche Gesellschaft endlich in offenem Wagen in Leipzig ein, jedoch nicht ohne zuvor die Abzeichen des Studententumes sorgsam entfernt zu haben aus Furcht, von den wahrhaften Studenten, denen wir nun begegnen würden, für diese Anmaßung übel behandelt zu werden.
Leipzig hatte ich seit meinem ersten Besuche im achten Jahre, ganz in der ähnlichen Umgebung wie das erste Mal, vorübergehend wiederbesucht; der phantastische Eindruck des Thoméschen Hauses hatte sich wiederholt, nur war diesmal durch meine vorgerückte Schulbildung bereits die Möglichkeit eines bewußteren Umganges mit meinem Onkel Adolf gegeben. Veranlassung hierzu gab mein freudiges Erstaunen, als ich erfuhr, daß der in einem großen Vorsaal stehende Bücherschrank mit einer ziemlich zahlreichen Bibliothek aus der Erbschaft meines Vaters, mir angehöre. Ich ging die Bücher mit meinem Oheim durch, wählte sofort eine Anzahl lateinischer Schriftsteller in der schönen Zweibrücker Ausgabe sowie andere mich anziehende dichterische und schöngeistige Werke aus und sorgte für die Zusendung nach Dresden. Bei meinem neuesten Besuche reizte mich namentlich das Studium des Studentenwesens. Zu den Eindrücken des Theaters und Prags kam nun ein neues phantastisches Element, das sogenannte Renommieren des Studententums. Eine Umwälzung war hiermit vorgegangen. Da ich zuerst als achtjähriger Knabe Studenten zu sehen bekam, hatte sich mir aus ihrem Äußern die altdeutsche Tracht mit dem schwarzen Samtbarette, dem am nackten Hals umgeschlagenen Hemdkragen und dem langen Haar lebhaft eingeprägt. Seitdem war das Burschentum, welchem jene Tracht angehörte, vor den politischen Verfolgungen verschwunden, und dagegen machte sich das nicht minder den Deutschen eigentümliche Landsmannschaftswesen jetzt vorzüglich breit. Die Tracht der Landsmannschafter schloß sich im ganzen der Mode, sogar mit Übertreibung an; dennoch zeichnete sie sich durch Buntheit und namentlich durch das Zurschautragen der landsmannschaftlichen Verbindungsfarben vor der der übrigen Stände aus. Der »Comment«, dieses Kompendium pedantischer Verhaltungsmaßregeln zur Konservierung eines trotzig abgeschlossenen Kastengeistes gegenüber den bürgerlichen Ständen, hatte seine phantastische Seite, wie im Grunde genommen die philisterhaftesten Eigentümlichkeiten der Deutschen sie haben. Für mich wurde derselbe zum Begriff der Emanzipation von Schul- und Familienzwang. Die Sehnsucht, Student zu werden, fiel auf bedenkliche Weise mit meiner wachsenden Abneigung gegen die trockneren Studien und meiner sich steigernden Leidenschaft für das Befassen mit phantastischer Poeterei zusammen. Die Folge hiervon zeigte sich bald durch trotzige Unternehmungen zur Veränderung meiner Lage.
Bereits traf mich der Akt meiner Konfirmation zu Ostern 1827 in ziemlicher Verwilderung nach dieser Seite hin und namentlich mit merklicher Herabstimmung meiner Hochachtung für kirchliche Gebräuche. Der Knabe, der noch vor wenigen Jahren mit schmerzlicher Sehnsucht nach dem Altarblatte der Kreuzkirche geblickt und in ekstatischer Begeisterung sich an die Stelle des Erlösers am Kreuze gewünscht, hatte die Hochachtung vor dem Geistlichen, zu welchem er in die der Konfirmation vorangehenden Vorbereitungsstunden ging, bereits so sehr verloren, daß er zu seiner Verspottung nicht ungern sich gesellte und sogar einen Teil des für ihn bestimmten Beichtgeldes in Übereinstimmung mit einer hierzu verbundenen Genossenschaft vernaschte. Wie es trotzdem mit meinem Gemüte stand, erfuhr ich jedoch fast zu meinem Schrecken, als der Akt der Austeilung des heiligen Abendmahles begann, vom Chor Orgel und Gesang ertönte, und ich im Zuge der Konfirmanden um den Altar wandelte: die Schauer der Empfindung bei Darreichung und Empfang des Brotes und des Weines sind mir in so unvergeßlicher Erinnerung geblieben, daß ich, um der Möglichkeit einer geringeren Stimmung beim gleichen Akte auszuweichen, nie wieder die Veranlassung ergriff, zur Kommunion zu gehen, was mir dadurch ausführbar ward, daß bekanntlich bei den Protestanten kein Zwang hierzu besteht.
Bald aber benutzte ich eine herbeigezogene Veranlassung zu einem Bruch mit der Kreuzschule, um meinen Fortgang nach Leipzig von meiner Familie zu erzwingen. Um mich gegen eine mir ungerecht dünkende Strafe, welche der sonst von mir sehr verehrte Konrektor Baumgarten-Crusius über mich verhängte, zu schützen, gab ich beim Rektor eine plötzlich erhaltene Aufforderung meiner Familie, mit ihr in Leipzig mich zu vereinigen, vor, um sofort meine Entlassung aus der Schule zu erhalten. Bereits seit einem Vierteljahre hatte ich das Böhmesche Haus verlassen und bewohnte für mich allein ein kleines Dachzimmer, in welchem ich von einer Hofsilberwäschers-Witwe bedient wurde, die mich den ganzen Tag über mit dem bekannten dünnen sächsischen Kaffee als fast einzigem Nahrungsmittel versorgte. In dieser Dachkammer habe ich nichts wie Verse gemacht, auch faßte ich dort die ersten Entwürfe zu dem riesigen Trauerspiele, mit welchem ich später meine Familie in Bestürzung versetzte. Die Unordnung, in welche ich durch diese vorzeitige häusliche Unabhängigkeit geriet, veranlaßte namentlich meine besorgte Mutter, ohne Schwierigkeiten in meine Übersiedelung nach Leipzig zu willigen, um so mehr, als wirklich ein Teil meiner zerstreuten Familie sich dorthin gewendet hatte.
Mein Verlangen nach Leipzig, wie es ursprünglich durch die dort empfangenen phantastischen Eindrücke, zuletzt durch meine Schwärmerei für das Studentenwesen erweckt worden war, hatte in neuester Zeit noch eine andere Anregung erhalten. Meine Schwester Luise, damals ein Mädchen von etwa 22 Jahren, war, da sie kurz nach dem Tode unseres Stiefvaters nach Breslau zum Theater gegangen, mir so gut wie unbekannt geworden. Vor kurzem kam sie auf ihrer Reise von dort nach Leipzig, an dessen Theater sie ein Engagement angenommen hatte, auf wenige Tage durch Dresden. Diese Begegnung mit der verwandten Unbekannten, das herzlich zärtliche Bezeugen ihrer Freude mich wiederzusehen sowie ihr aufgewecktes launiges Wesen machten auf mich den angenehmsten Eindruck. Bei ihr, zu der sich nun auch die Mutter mit Ottilien für einige Zeit wandte, zu wohnen, erschien mir reizend. Zum erstenmal war eine Schwester zärtlich gegen mich gewesen. Als ich zu Weihnachten desselben Jahres (1827) in Leipzig ankam und bereits meine Mutter mit Ottilie und Cäcilie (meiner Stiefschwester) vorfand, wähnte ich mich im Himmel. Eine große Veränderung hatte sich jedoch bereits zugetragen: Luise war Braut des angesehenen und vermögenden Buchhändlers Friedrich Brockhaus geworden. Die Anhäufung der Familie der gänzlich vermögenslosen Braut scheint nie dem außerordentlich gutherzigen Bräutigam und baldigen Gemahle lästig gefallen zu sein; dennoch mag wohl die Schwester diesem Umstande eine besorgliche Vorstellung entnommen haben, welche sie mir alsbald in einem entfremdenden Lichte erscheinen ließ. Die Veranlassung, in den höheren bürgerlichen Kreisen sich zu wünschenswerter Geltung zu bringen, führte außerdem von selbst eine merkliche Veränderung in dem Benehmen der sonst so heiteren, zu lustigen Einfällen aufgelegten Schwester herbei, welches im Laufe der Zeit von mir mit solcher Bitterkeit wahrgenommen wurde, daß ich gelegentlich mich später mit ihr einmal vollständig überwarf. Zu dem mich kränkenden Tadel meiner Aufführung gab ich jedoch leider bald wirklichen Anlaß. Der Verfall meiner Studien und mein völliges Abweichen von den Pfaden einer regelmäßigen Schulausbildung schreibt sich von meinem Eintritt in Leipzig her, und vielleicht war der Hochmut des Schulpedantismus daran schuld.
In Leipzig bestehen zwei Gelehrtenschulen; die ältere, Thomas-, und die jüngere, Nikolaischule genannt: die Nikolaischule stand damals in vorzüglicherem Rufe als ihre Schwester; dort mußte ich demnach aufgenommen werden. Nun fand das Lehrerkollegium, dem ich mich zu Neujahr 1828 zur Prüfung vorstellte, es dem Rang ihrer Schule angemessen, mir, der ich zuvor in der Dresdener Kreuzschule bereits in Sekunda gesessen hatte, für einige Zeit Obertertia anzuweisen. Der Mißmut, der mich erfaßte, als ich den Homer, von welchem ich bereits zwölf Gesänge schriftlich übersetzt hatte, wieder beiseite legen mußte, um zu den leichtern griechischen Prosaisten zurückzukehren, war unbeschreiblich und schnitt sich tief in meine ganze Stimmung ein. Ich betrug mich demzufolge so, daß ich mir nie einen der Lehrer dieser Schule befreundete. Der hieraus entstehende unfreundliche Schulzwang stimmte mich um so trotziger, als ich nun an verschiedenen neuen Faktoren meiner Lebensbildung Anhalt zu diesem Trotz gewann. Während zunächst das nun täglich vor meinen Augen sich ausbreitende Studentenleben mich immer mehr mit seinem auflehnungssüchtigen Geiste erfüllte, fand ich von einer anderen, ernsteren Seite her unerwartet eine neue Anregung zur Verachtung des Schulpedantismus. Ich bezeichne hier den ihm längere Zeit unbewußt gebliebenen Einfluß meines Onkels Adolf Wagner, dessen Umgang nun für die eigentümliche Bildung des heranreifenden Jünglings von wichtiger Bedeutung ward.
Daß meinen phantastischen Neigungen nicht eigentlich ein Hang zu oberflächlicher Zerstreuung zugrunde lag, zeigte sich in dem angelegentlichen Eifer, mit welchem ich mich diesem gelehrten Verwandten anschloß. Allerdings war er im Umgang und Gespräch sehr anziehend; die Vielseitigkeit seines Wissens, welches sich vom philologischen Fach über das philosophische und literar-poetische mit gleicher Wärme ausdehnte, vermochte nach dem Bekenntnis vieler, wenn er sich in gesprächlicher Unterhaltung mitteilte, höchst einnehmend zu wirken. Daß ihm hiergegen die Gabe versagt war, ebenso hinreißend, ja selbst nur klar zu schreiben, war eine der sonderbaren Unvollkommenheiten dieses Mannes, die seine Wirksamkeit auf die literarische Welt bedeutend abschwächte, ja ihn sogar oft der Lächerlichkeit aussetzte, indem man ihm bei vorkommender Polemik die unverständlichsten und schwülstigsten Sätze nachweisen konnte. Mich sollte diese Schwäche nicht abschrecken, da ich einerseits in der unklaren Periode meiner eigenen Entwicklung befangen war, in welcher literarischer Schwulst mir um so tiefsinniger erschien, als ich ihn nicht fassen konnte, andrerseits aber ich weniger von meinem Onkel las, als mit ihm mich unterhielt. Auch ihm schien der Umgang mit dem feurig aufhorchenden Jünglinge angenehm. Leider vergaß er im vielleicht nicht ganz unselbstgefälligen Eifer seiner Mitteilung, daß er hierbei, wie in der Wahl seiner Ausdrucksweise, weit über meine jugendliche Fassungskraft hinausging. Täglich holte ich ihn zu den seiner Gesundheit nötigen Nachmittagspromenaden um die Tore der Stadt ab. Ich vermute, oft das Lächeln vorübergehender Bekannter erregt zu haben, welche den tiefsinnigen und oft aufreizenden Diskussionen zwischen mir und meinem Onkel lauschten. Den Gegenstand derselben bildete im Grunde alles Ernste und Erhabene auf dem Gebiete des Wissens. Seine reichhaltige Bibliothek hatte mich fieberhaft nach allen Seiten hin aufgeregt, so daß ich feurig von einem Gebiete der Literatur in das andere übersprang, ohne dazu gelangen zu können, nach irgendeiner Seite hin mich gründlich zu unterrichten. Mein Oheim freute sich, in mir einen höchst willigen Zuhörer von Vorlesungen klassischer Tragödien, von denen er zum Beispiel selbst eine Übersetzung des »König Ödipus« geliefert hatte, zu finden; denn mit Recht schmeichelte er sich nach Tieck, der ihm wahrhaft befreundet war, einer der besten Vorleser zu sein. Ich entsinne mich, daß, als er einsam mit dem Lesepulte vor mir saß und eine griechische Tragödie vorlas, es ihn nicht verdroß, als ich vollkommen einschlief, was er nachträglich gar nicht bemerkt zu haben vorgab. Meine Abende bei ihm zu verbringen, bestimmte mich außerdem die freundlich behagliche Bewirtung, welche mir von seiner Frau zuteil ward. Seit meiner frühesten Bekanntschaft mit meinem Oheim im Thoméschen Hause war nämlich eine große Veränderung in dessen Leben vorgegangen. Das Asyl, welches er mit seiner Schwester Friederike bei seiner Freundin gefunden, schien mit der Zeit für ihn doch unerträgliche Verpflichtungen herbeizuführen. Da seine literarischen Arbeiten ihm ein mäßiges Einkommen sicherten, fand er es endlich seiner Würde entsprechender, einen eigenen Hausstand zu gründen. Eine seinem Alter angemessene Freundin, die Schwester des nicht unrühmlich bekannt gewordenen Ästhetikers Wendt in Leipzig, wurde von ihm bestimmt, seine eigene Häuslichkeit ihm herzurichten. Ohne Jeannette ein Wort zu sagen, war er statt des gewöhnlichen Nachmittagsspazierganges mit seiner Erwählten zur schnellen Abmachung der üblichen Trauungs-Zeremonien in die Kirche gegangen, und meldete nun bei der Heimkehr, daß er ausziehe und noch heute seine Sachen abholen lassen werde. Der großen Bestürzung, vielleicht auch den Vorwürfen seiner älteren Freundin, wußte er mit milder Fassung zu begegnen, und bis an sein Lebensende setzte er seine regelmäßigen täglichen Besuche bei der zu Zeiten zärtlich schmollenden »Mamselle Thomé« fort. Nur die arme Friederike schien die unerwartete Untreue des Bruders mitunter büßen zu müssen.
Was mich an meinem Oheim besonders feurig anzog, war seine schroffe aber doch humoristisch sich äußernde Verachtung des modernen Pedantismus in Staat, Kirche und Schule. Bei großer Mäßigung seiner sonstigen Ansichten über das Leben, machte er auf mich doch die Wirkung des eigentlichen Freigeistes. Völlig begeisternd wirkte auf mich seine Verachtung der Schulpedanterei. Als ich eines Tages mit dem Lehrer-Kollegium der Nikolai-Schule in bedenkliche Konflikte geraten war und der Rektor derselben sich mit einer ernstlichen Beschwerde über mein Betragen an meinen Oheim als den einzigen männlichen Vertreter meiner Verwandtschaft richtete, frug mich dieser beim Spaziergang um die Stadt gelegentlich ruhig und lächelnd, wie einen Altersgenossen, was ich denn mit den Leuten an der Schule gehabt hätte; ich erklärte ihm den Vorfall und berichtete ihm von der mir ungerecht dünkenden Strafe, zu welcher ich verurteilt war. Er beruhigte mich und ermahnte mich zur Geduld, indem ich mit dem spanischen Sprichwort mich trösten sollte: »un rei no puede morír«, welches er dahin erklärte, daß auch ein Schulmonarch notwendig immer recht haben müßte.
Es konnte ihm natürlich nicht erspart bleiben, die Folgen dieser, die Urteilskräfte meines Alters weit überschätzenden Art des Verkehrs mit mir endlich zu seinem Schrecken innezuwerden. Hatte es mich zwar auch verdrossen, eines Tages, als ich den Goetheschen Faust vorzunehmen wünschte, von ihm die ruhige Meinung, daß ich diesen noch nicht verstehen würde, zu vernehmen, so hatten mich doch seine sonstigen Gespräche über unsere großen Dichter, selbst über Shakespeare und Dante, nach meinem Dünken so vertraut mit diesen erhabensten Vorbildern gemacht, daß ich seit längerer Zeit heimlich damit beschäftigt war, mein großes, schon in Dresden konzipiertes Trauerspiel auszuführen. Auf diese Ausführung verwandte ich seit meinem Zerfall mit der Schule alle Arbeitskräfte, welche dieser eigentlich gewidmet sein sollten. Ich gewann mir bei dieser heimlichen Arbeit eine einzige Mitwisserin, meine Schwester Ottilie, welche mit mir jetzt allein bei der Mutter wohnte. Ich entsinne mich des Zagens und Schreckens, welchen die erste vertraute Mitteilung meiner großen dichterischen Unternehmung meiner guten Schwester verursachte; dennoch gab sie sich liebevoll den Peinigungen hin, welche ich ihr zu Zeiten durch geheimnisvolle, aber deshalb nicht affektlose Vorlesung der einzelnen Teile meiner fortschreitenden Arbeit verursachte. Als ich ihr einstmals eine der erschrecklichsten Szenen vorlas, brach ein heftiges Gewitter aus; als ganz in unserer Nähe der Blitz einschlug und der Donner krachte, glaubte meine Schwester in mich dringen zu müssen, mit der Lektüre einzuhalten: sie überzeugte sich bald, daß es unmöglich war, mich dazu zu bewegen, und hielt mit rührender Ergebung aus.