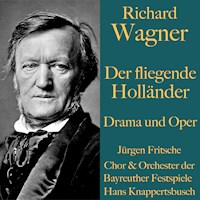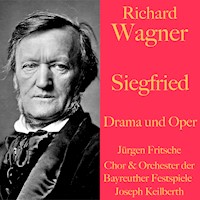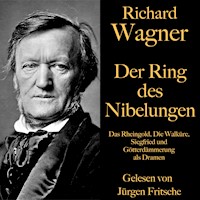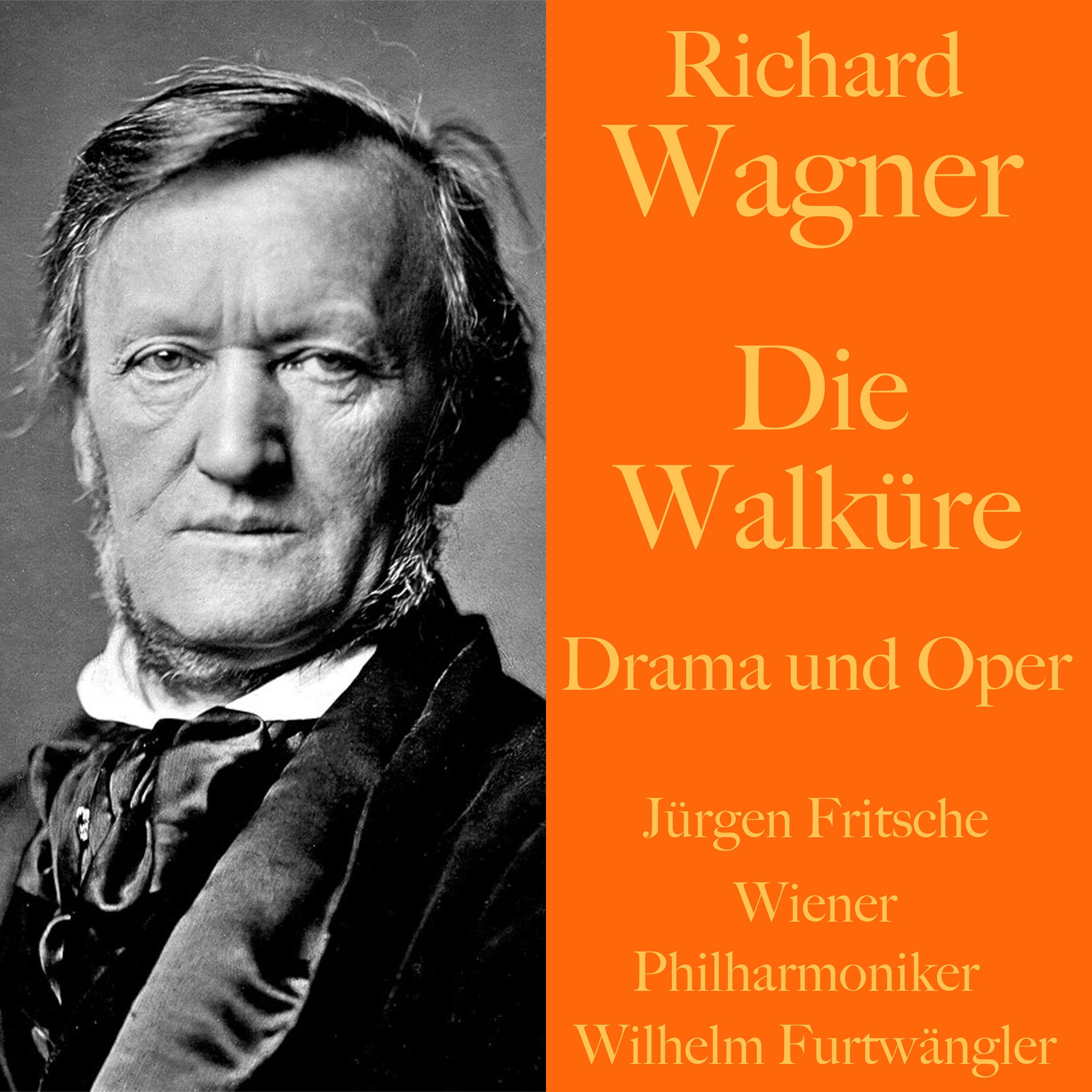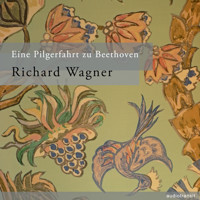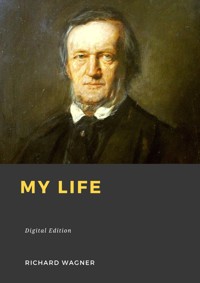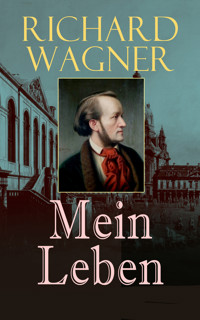Mein Leben – Teil zwei - 2 – Band 231 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Richard Wagner
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Der von 1813 bis 1883 lebende Oper-Komponist Richard Wagner erzählt in diesem Buch aus seinem interessanten Leben. In Leipzig geboren, studierte er auch dort Musik. Er lebte und arbeitete danach in Würzburg, Magdeburg, Königsberg und Riga. Über eine dramatische Seereise kam er nach London und von dort nach Paris, wo er von 1839, total verarmt und verschuldet in elenden Verhältnissen vegetierte. Die triumphale Uraufführung des "Rienzi" am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich-sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Wagner
Mein Leben – Teil zwei - 2 – Band 231 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 231 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Richard Wagner
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
Richard Wagners Vorwort
Erster Teil – 1813 – 1842
Zweiter Band
Dritter Teil – 2 – 1850 – 1861
Karlsruhe
Wien
Vierter Teil – 1861 – 1864
München
Venedig
St. Petersburg
Bieberich
Das weitere Leben Richard Wagners
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannesheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannesschicksal“ weitere.
* * *
Diese Texte in Richard Wagners Autobiographie lesen sich teilweise durch ihre sehr langen und verschachtelten Sätze sehr kompliziert, so dass ich mich bei der Bearbeitung sehr konzentrieren musste.
* * *
2023 Jürgen Ruszkowski
Ruhestandes-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Richard Wagner
Der Autor Richard Wagner
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/wagner.html
Wilhelm Richard Wagner, * 22. Mai 1813 in Leipzig – † 13. Februar 1883 in Venedig, war ein deutscher Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Mit seinen durchkomponierten Musikdramen gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantiköniglichen
* * *
Geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig. Wagner war das jüngste von neun Kindern eines Polizeiaktuarius. Fünf Monate nach seiner Geburt starb der Vater; der Schauspieler und Maler Ludwig Geyer nahm sich der Witwe und der Kinder an (starb aber auch bereits 1821). Wagner begann 1831 an der Universität Leipzig ein Musikstudium, 1833 holte der Sänger Albert Wagner den jüngeren Bruder nach Würzburg, dort wurde er Chor-Einstudierer. Im Sommer 1834 engagierte ihn eine Operntruppe als Dirigenten nach Magdeburg; dort verliebte er sich in die Schauspielerin Minna Planer: er folgte ihr nach Königsberg, wo sie 1836 heirateten, dann nach Riga; vor ihren Gläubigern flüchteten sie über Norwegen und London nach Paris, wo sie von September 1839 bis April 1842 in großer Not lebten. Die triumphale Uraufführung des „Rienzi“ am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich sächsischen Hofkapellmeister ernannt.
1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb.
* * *
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
https://www.projekt-gutenberg.org/wagner/meinleb1/meinleb1.html
* * *
1911 im Verlag F. Bruckmann A-G in München erschienen
* * *
Richard Wagners Vorwort
Richard Wagners Vorwort
Die in diesem Band enthaltenen Aufzeichnungen sind im Lauf verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben von mir sich erzählt wünschte, nach meinen Diktaten unmittelbar niedergeschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen über mein Leben unserer Familie, sowie bewährten treuen Freunden zu erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem Untergang zu bewahren, sie auf unsere Kosten in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen zu lassen. Da der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben genau mit Namen und Zahlen begleitet sein mussten, so könnte von einer Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tod die Rede sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen für jetzt schon einzelnen zuverlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vorenthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft erscheinen lassen würde, irgendwelche weitere Mitteilungen aus ihnen an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht gestaltet sein dürfte.
Richard Wagner
* * *
Erster Teil – 1813 – 1842
Erster Teil – 1813 – 1842
Wagners Geburtshaus in Leipzig
Leipzig Brühl
Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im „rot und weißen Löwen“, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft.
Thomaskirche Leipzig
Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig, mit der Anwartschaft auf die Stelle des Polizeidirektors daselbst, starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen, welche ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der kriegerischen Unruhen und der Schlacht bei Leipzig zuzogen, durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers…
* * *
Band eins endet:
…Frau Taylor hatte sich mit der Klage über den „von mir beabsichtigten Ehebruch“ an meine Frau gewandt, dieser ihr Mitleiden gemeldet und ihre Unterstützung angeboten; die arme Minna, die nun plötzlich meinen Entschluss, von ihr fern zu bleiben, einem bis dahin von ihr nicht geargwöhnten Grund beimessen musste, wendete sich deshalb wieder klagend an Frau Taylor zurück. Hierbei hatte ein merkwürdiges Missverständnis als absichtlich angewandte Lüge mitgespielt: in einem launigen Gespräch hatte mir nämlich einmal Jessie gesagt, sie gehöre keiner anerkannten Konfession an, da ihr Vater einer besonderen Sekte angehört habe, welche weder nach dem protestantischen, noch nach dem katholischen Ritus taufe; worauf ich sie damit tröstete, dass auch ich schon mit wohl weit bedenklicheren Sekten in Berührung gekommen sei, da ich kurz nach meiner Trauung erfahren habe, dass diese in Königsberg von einem Mucker vollzogen worden wäre. Gott weiß, in welchem Sinn dies der würdigen englischen Matrone mitgeteilt worden war, kurz, sie hatte meiner Frau berichtet: ich hätte erklärt, ich sei gar nicht in gültiger Weise mit ihr getraut. Jedenfalls mochten die Rückäußerungen meiner Frau wiederum genügenden Stoff an die Hand gegeben haben, um auch Jessie in dem beabsichtigten Sinn über mich aufzuklären, und der Wirkung hiervon verdankte ich den sonderbaren Brief an meinen jungen Freund. Ich muss gestehen, dass mich nach dieser Einsicht der Dinge zuallernächst nur die Misshandlung meiner Frau empörte, und während ich nach jener Seite zu gänzlich gleichgültig darüber blieb, was man von mir meine, nahm ich sofort das Anerbieten Karls an, nach Zürich zu gehen und meine Frau aufzusuchen, um ihr die nötigen Aufklärungen zu ihrer eigenen Beruhigung zu geben. – Während ich seine Rückkunft erwartete, erhielt ich einen Brief Liszts, welcher mir den großen und auf seine ganze Gesinnung über mich und meine Zukunft entscheidenden Eindruck meldete, welchen das genaue Bekanntwerden mit der Partitur meines „Lohengrin“ auf ihn hervorgebracht. Er zeigte mir zugleich an, dass er, da ich ihm hierzu die Erlaubnis gegeben habe, mit Anspannung aller Kräfte eine Aufführung meines Werkes zur Feier des bevorstehenden Herder-Festes in Weimar in Angriff zu nehmen beabsichtige. Fast gleichzeitig schrieb mir Frau Ritter, welche im Betreff der von ihr vollkommen verstandenen Vorgänge mich wohl bitten zu müssen glaubte, dass ich diese Angelegenheit mir nicht zu sehr zu Herzen nähme. Nun kam auch Karl von Zürich zurück und sprach mit großer Wärme über das Verhalten meiner Frau. Sie habe sich, nachdem sie mich in Paris nicht angetroffen, mit seltener Energie zu fassen gewusst, nach meinem früheren Wunsch eine geräuschlose Wohnung am Züricher See gemietet und geschickt eingerichtet und sei dort verblieben, in der Hoffnung, endlich doch wieder von mir zu hören. Außerdem erzählte er mir einiges Gescheite und Freundschaftliche von Sulzer, welcher mit großer Teilnahme meiner Frau zur Seite gestanden habe. Plötzlich brach Karl aus: „Ach, das wären doch noch Menschen; mit solch einer verrückten Engländerin sei dagegen nichts anzufangen.“ Ich sagte zu alledem kein Wort und fragte ihn endlich nur lächelnd, ob er denn etwa gern nach Zürich übersiedeln möchte? Er sprang auf: „Ach ja! Heute lieber als morgen!“ „Du sollst deinen Willen haben“, sagte ich, „lass uns einpacken; ich sehe doch in allem keinen Sinn, möge es dort oder hier sein.“ Ohne ein Wort weiter über alle diese Dinge zu sprechen, reisten wir anderen Tages nach Zürich ab.
* * *
Zweiter Band
Zweiter Band
* * *
Titel und Einband gezeichnet von Heinrich Wieynk.
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Dritter Teil – 2 – 1850 – 1861
Dritter Teil – 2 – 1850 – 1861
Mit dem Neujahr 1860 trat jetzt eine sehr unerwartete Wendung für die Möglichkeit des Gelingens meiner Unternehmungen ein. Der Kapellmeister Esser in Wien vermittelte an mich den Wunsch des Musikhändlers Schott in Mainz, eine neue Oper von mir für seinen Verlag zu erwerben. Hierfür hatte ich jetzt nichts anderes als das „Rheingold“ anzubieten; die eigentümliche Beschaffenheit dieses nur als Vorspiel zu der großen Nibelungen-Trilogie gedachten Werkes machte es mir schwierig, ohne weitere Andeutungen in diesem Bezug, es einfach nur als „Oper“ anzubieten. Dennoch erschien der Eifer Schotts, jedenfalls ein neues Werk von mir seinem Verlagskatalog einzureihen, so groß, dass ich endlich alle Bedenken überwand und, ohne Verhehlung der Schwierigkeiten für die Verbreitung dieses Werkes, es ihm zur Verfügung stellte, sobald er mir 10.000 Franken dafür zahlen wollte, wogegen ich ihm allerdings die Erwerbung der nachfolgenden drei Hauptstücke, zu dem gleichen Preis für ein jedes derselben, zusicherte. Sogleich fasste ich den Plan, falls Schott auf meine Forderung einginge, die hieraus sich ergebende so unerwartete Einnahme zur Betreibung meiner Pariser Unternehmung zu verwenden. Durch das hartnäckige Schweigen des kaiserlichen Kabinetts ermüdet, gab ich jetzt an meine Agenten den Auftrag, mit Signor Calzado für das italienische Opernhaus zu drei Konzerten abzuschließen, sowie das nötige Orchester und die erforderlichen Gesangskräfte anzuwerben. Als dies im Gange war, ward ich wiederum durch zögernde Gegenanerbietungen von Schott geängstigt; um ihn mir nicht abwendig zu machen, trug ich bereits dem Musikdirektor Schmidt in Frankfurt brieflich auf, die Unterhandlungen mit Schott auf Grund einer bedeutend ermäßigten Forderung meinerseits fortzusetzen. Kaum war dieser Brief abgesandt, als Schotts Schreiben eintraf, in welchem er mir schließlich seine Bereitwilligkeit auf meine Forderung von 10.000 Franken einzugehen, kundgab. Dies veranlasste meinerseits ein Telegramm an Schmidt, durch welches ich den ihm gegebenen Auftrag angelegentlichst zurücknahm.
Mit gutem Mut verfolgten ich und meine Agenten nun die eingeleitete Konzert-Unternehmung, deren Vorbereitung meine ganze Tätigkeit vollauf in Beschlag nahm. Ich hatte für einen Gesangchor zu sorgen und glaubte hierfür das teuer zu bezahlende Personal der italienischen Oper durch einen deutschen Gesangverein verstärken zu müssen, welcher mir unter der Leitung eines gewissen Herrn Ehmant nachgewiesen wurde. Um mir die Mitglieder desselben geneigt zu machen, hatte ich eines Abends ihr Vereinslokal in der rue du Temple aufzusuchen und mich mit guter Laune an den Bierdunst und Tabaksdampf zu gewöhnen, in welchem hier biedere deutsche Kunstbestrebungen sich mir offenbaren sollten. Außerdem wurde ich aber auch mit Herrn Chevé, dem Lehrer und Dirigenten eines französischen Volksgesangsvereins, dessen Übungen in der Ecole de médecine vor sich gingen, in Verbindung gesetzt und traf hier auf einen wunderlichen Enthusiasten, welcher von seiner Methode, Leute ohne Noten Musik singen zu lassen, die Regeneration des französischen Volks-Geistes erwartete. Die peinlichsten Beschwerden verursachte mir aber die Nötigung, den größten Teil der Orchesterstimmen der von mir auszuführenden Fragmente erst kopieren zu lassen. Ich nahm hierfür mehrere arme deutsche Musiker in Sold, welche sich nun von früh bis in die Nacht in meiner Wohnung niederließen, um unter meiner Anleitung und Aufsicht die oft schwierigen Einrichtungen vorzunehmen.
In diesen mit Leidenschaftlichkeit betriebenen Besorgungen traf mich jetzt Hans von Bülow an, welcher, wie es sich namentlich in dem Erfolg erwies, fast weniger um der Betreibung seiner eigenen Angelegenheiten als Konzert-gebender Virtuos, sondern um sich meinen Unternehmungen hilfreich zu erweisen, für längere Zeit in Paris eingetroffen war. Er wohnte bei Liszts Mutter, verbrachte aber die größte Tageszeit bei mir, um überall, wo es Not tat, so jetzt zunächst bei der Anfertigung der Kopien zu helfen. Nach jeder Seite hin war seine Mittätigkeit außerordentlich; namentlich aber schien er es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, seine, bei einem vorjährigen Besuch von Paris unter der Anleitung seiner Frau angeknüpften, gesellschaftlichen Verbindungen für meine Unternehmung nützlich zu machen. Der Erfolg hiervon ergab sich mit der Zeit; für jetzt half er bei der Ausführung der Konzerte selbst, zu welchen nun die Proben begannen.
Die erste dieser Proben fand im Herzschen Saal statt und führte zu einer Aufregung der Musiker gegen mich, welche fast einer Emeute glich. Ich hatte mich beständig mit ihnen zu streiten über Gewohnheiten ihrerseits, welchen nicht nachgeben zu dürfen ich mich meinerseits durch Vernunftgründe zu erweisen bemühte. Besonders empörte sie mein Sechsachtel-Takt, welchen ich ihnen nach dem Schema des Vier-Viertel-Taktes schlug, während sie unter tumultuarischen Protestationen behaupteten, er müsse nach dem des Alla-breve-Taktes geschlagen werden. Infolge eines scharfen Appells meinerseits an die Disziplin eines wohlgeordneten Orchesters, erklärte man mir, man sei keine preußischen Soldaten, sondern freie Männer. Endlich sah ich wohl ein, dass eines der Hauptgebrechen diesmal in der fehlerhaften Aufstellung des Orchesters lag und entwarf nun meinen Plan für die nächste zweite Probe. Nach einer Beratung mit meinen Freunden fand ich mich hierzu am frühesten Morgen im Konzertsaal ein, ordnete selbst eine zweckmäßige Aufstellung der Pulte an und bestellte vor allem ein für alle Musiker ausreichendes Frühstück, zu welchem ich beim Beginn der Probe in folgender Weise einlud: ich sagte den Musikern, dass von dem Erfolg unserer heutigen Zusammenkunft das Zustandekommen meiner Konzerte abhänge; wir dürften den Saal nicht verlassen, ehe wir hierüber nicht ganz im Klaren seien; deshalb ersuchte ich die Herren, zunächst eine Probe von zwei Stunden zu machen, sodann ein im anliegenden Salon bereitetes fraktales Frühstück zu sich zu nehmen, worauf wir dann sofort eine zweite Probe, welche ich ihnen als solche auch bezahlen würde, abhalten sollten. Die Wirkung dieser Proposition war ganz außerordentlich: die vorteilhafte Orchesteraufstellung erleichterte die Unterhaltung der guten Stimmung; der günstige Eindruck, welchen das nun gespielte Vorspiel zu „Lohengrin“ auf alle machte, ließ endlich den Enthusiasmus ausbrechen und bereits am Schluss der ersten Probe war alles, Spieler und Zuhörer, unter denen sich auch Gaspérini befand, zur höchsten Gunst für mich hingerissen. Wahrhaft erfreulich äußerte sich nun dieser gute Geist bei der auf der Bühne der italienischen Oper selbst abgehaltenen Hauptprobe; hier war es mir bereits möglich, einen nachlässigen Trompeter mit harten Ausdrücken aus dem Orchester fortzuweisen, ohne hierbei durch den Geist der Kameraderie im Mindesten behindert zu werden.
Das erste Konzert ging endlich am 25. Januar (1860); die Aufnahme aller Stücke, welche ich aus meinen verschiedenen Opern, bis zu „Tristan und Isolde“, gewählt hatte, war vonseiten des Publikums eine vollständig günstige, ja enthusiastische. Ich erlebte es hier, dass ein Stück, der Marsch aus „Tannhäuser“, durch stürmischen Applaus unterbrochen wurde, und zwar, wie es schien, aus Freude an der Überraschung davon, dass meine Musik, von der man so viel Gegenteiliges behauptet hatte, so lang zusammenhängende Melodien aufwies.
Sehr befriedigt, sowohl von der Ausführung des Konzertes, als der Aufnahme, die es gefunden, hatte ich an den folgenden Tagen die entgegengesetzten Eindrücke zu überwinden, welche durch die Auslassungen der Presse hierüber in mir hervorgerufen wurden. Es zeigte sich jetzt, dass Belloni sehr richtig gesehen hatte und dass gerade unsere durch seine Voraussehungen veranlasste Nicht-Einladung der Presse die Wut der Gegner nur noch verstärkt hatte. Da bei der ganzen Unternehmung es jedoch mehr auf eine Anregung für energische Freunde, als auf das Lob der Rezensenten abgesehen war, so beunruhigte mich das Toben dieser Herren bei weitem weniger, als das Ausbleiben günstiger Anzeichen von jener Seite her. Vor allem beängstigte es mich aber, dass das vollständig gefüllt erscheinende Haus keine größere Einnahme, als es sich fand, abgeworfen hatte. Wir hatten zwischen fünf- und sechstausend Franken eingenommen, aber über 11.000 Franken Unkosten gehabt. Die letzteren hätten nun zum Teil ersetzt werden können, sobald bei dem zweiten, weniger kostbaren Konzert eine möglichst gesteigerte Einnahme erwartet werden durfte. Belloni und Giacomelli hingen aber die Köpfe; sie glaubten sich der Einsicht nicht verschließen zu dürfen, dass das Konzert nicht der Genre des Franzosen sei, welcher durchaus das dramatische Element, d. h. Kostüme, Dekorationen, Ballett und dergleichen verlange, um sich befriedigt zu fühlen. Die geringen Bestellungen zum zweiten Konzert, welches am 1. Februar gegeben wurde, hatten meine Agenten sogar in die Nötigung versetzt, für eine künstliche Anfüllung des Saales Sorge zu tragen, um wenigstens den Anschein zu retten; ich musste sie hierin vollkommen gewähren lassen und war späterhin verwundert zu erfahren, wie sie es angefangen hatten, die ersten Ränge dieses aristokratischen Theaters in einer Weise zu bevölkern, dass alle Welt, selbst unsere Feinde, hierdurch getäuscht wurden. Die wirkliche Einnahme betrug dagegen wenig über 2.000 Franken und nun bedurfte es allerdings meiner Hartnäckigkeit und meiner Verachtung aller Nöten, die mir hieraus entstehen konnten, um das für den 8. Februar angesagte dritte Konzert nicht abzubestellen.
Mein Schottsches Honorar, von welchem ich allerdings einen Teil auf die Bedürfnisse meiner jetzt wiederum erschwerten häuslichen Existenz zu verwenden hatte, war draufgegangen und ich hatte mich nach Subsidien umzusehen. Diese erlangte ich zunächst mit schwerer Mühe durch Gaspérinis Vermittlung von dem Mann, auf dessen Gewinn für mich in einem bei weitem wichtigeren Sinn es eigentlich bei der ganzen Konzertunternehmung abgesehen war. Dies war der bereits erwähnte Generalpächter aus Marseille, Herr Lucy, welcher um die Zeit meiner Konzerte in Paris ankommen sollte und von welchem mein Freund Gaspérini annehmen zu dürfen glaubte, dass ein bedeutender Erfolg meinerseits vor dem Pariser Publikum ihn zu dem großartigen Entschluss anregen würde, sich zur finanziellen Übernahme der Durchführung meines Projektes einer deutschen Oper in Paris zu erklären. Dagegen blieb nun Herr Lucy im ersten Konzert gänzlich aus und stellte sich nur zu einem Teil des zweiten ein, bei dessen Anhörung er einschlief. Dass er nun um einen Vorschuss von mehreren Tausend Franken für das Zustandebringen des dritten Konzertes angegangen wurde, schien ihn ganz natürlich gegen jede weitere Zumutung unsererseits zu schützen, so dass er eine gewisse Befriedigung empfand, um den Preis dieses Darlehens vor allem weiteren Eingehen auf meine Pläne bewahrt zu sein. Musste auch mir nun die Durchführung dieses dritten Konzertes im Grunde nutzlos erscheinen, so erfreute mich dieses doch, sowohl durch den guten Geist der Ausführung selbst, als durch die schöne Aufnahme vonseiten eines Publikums, welchem meine Agenten zwar auch diesmal noch zu einem volleren Anschein hatten verhelfen müssen, das doch aber eine merkliche Zunahme an zahlenden Besuchern in sich schloss.
Mehr als der Unmut über diese, äußerlich betrachtet, verfehlte Konzert-Unternehmung, wirkte jedoch in dieser Zeit die Wahrnehmung des außerordentlichen Eindruckes, welchen ich auf einzelne hervorgebracht, auf meine Stimmung. Unverkennbar hatte mir sowohl dieser Eindruck unmittelbar, als die hierüber sich äußernde Presse mittelbar, ein außerordentliches Interesse zugewendet. Dass ich sämtlichen Journalen keine Einladungen zugestellt hatte, schien von allen Seiten als eine bewundernswürdige Kühnheit aufgefasst zu werden. Die Haltung der Rezensenten war im Allgemeinen von mir bestimmt vorausgesehen worden; nur erweckte es mein Bedauern, dass selbst solche, wie ein Herr Franc-Marie, Berichterstatter für die Partie, welcher sich am Schluss des ersten Konzertes in äußerster Ergriffenheit dankbar an mich gewendet hatte, dem Losungswort der Kameraderie unweigerlich zu folgen sich genötigt sahen und schließlich so weit gebracht wurden, ihre mir in Wahrheit geneigte Gesinnung zu verleugnen. Ein wahrhaft ärgerliches Aufsehen erregte jedoch Berlioz mit einem anfänglich in gewundenen Ausdrücken sich abmühenden, schließlich in offenbar perfide Suppositionen sich ergehenden Artikel im Journal des Débats. Diesem, als meinem alten Freund, entschloss ich mich sein schlechtes Benehmen nicht so leicht hingehen zu lassen und antwortete ihm mit einem Brief, welchen ich mit höchster Mühe in ein gutes Französisch übersetzen, sowie mit einiger Beschwerde in das Journal des Débats einrücken ließ. Es schien nun, dass gerade dieser Brief solche, auf welche mein Konzert selbst bedeutend gewirkt hatte, mir in einem sehr lebhaften Sinn zuwendete.
Émile Perrin, * 19. Januar 1814 – † 8. Oktober 1885
Unter diesen meldete sich bei mir ein Herr Perrin, vormaliger Direktor der Opéra comique, jetzt vermögender Schöngeist und Maler, später jedoch Direktor der großen Oper. Dieser hatte Lohengrin und Tannhäuser in Deutschland gehört und erging sich in Äußerungen, welche mich annehmen ließen, er würde, wenn er hierfür in die Lage komme, es sich zum Ehrenpunkt machen diese Werke nach Frankreich überzusiedeln. – In gleicher Lage der Bekanntschaft mit meinen Opern durch deutsche Aufführungen befand sich ein Graf Foucher de Careil, welcher mit mir ebenfalls in einen auszeichnenden andauernden Verkehr trat. Dieser hatte sich durch verschiedene Publikationen über deutsche Philosophie, namentlich durch eine Herausgabe des Leibnitz in Ansehen gesetzt, und es konnte mir nicht uninteressant sein, durch seine Gesellschaft mit einer ehrenwerten, und von mir bisher durchaus ungekannten Seite des französischen Geistes in Berührung gebracht zu werden.
Louis-Alexandre Foucher de Careil, * 1. Mai 1826 in Paris – † 10. Januar 1891
Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, Алексей Константинович Толстой, * 10. Januar 1883 in Sosnowka – † 10. Oktober 1875, war ein russischer Schriftsteller, Dramatiker und Dichter.
Übergehe ich einige flüchtige Bekanntschaften, welche mir diese Zeit zuführte und unter denen ein russischer Graf Tolstoi sich besonders vorteilhaft auszeichnete, so habe ich nun des vorzüglichen Eindruckes auf mich zu gedenken, welchen der Romancier Champfleury durch eine hinreißend liebenswürdige Broschüre, deren Gegenstand ich und meine Konzerte waren, auf mich machte.
Jules Champfleury, Pseudonym für Jules François Félix Husson, * 17. September 1821 in Laon – † 6. Dezember 1889 in Sèvres.
In anscheinend flüchtig hingeworfenen Aphorismen war hier eine so große Empfindung von meiner Musik und selbst meiner Persönlichkeit ausgesprochen, wie ich sie zuvor ähnlich nur in Liszts Auslassungen über Lohengrin und Tannhäuser, seitdem aber in dieser prägnanten und schwungvollen Art nie wieder erfahren habe. Meine hierauf folgende persönliche Bekanntschaft mit Champfleury führte mir einen sehr einfachen und in einem gewissen Sinn gemütlichen Menschen zu, dessen gleichen sonst nur selten, und zwar als einer aussterbenden Gattung der französischen Bevölkerung zugehörend, angetroffen werden dürfte.
In ihrer Art noch bedeutender war aber die Annäherung des Dichters Baudelaire an mich.
Charles Baudelaire, * 9. April 1821 in Paris – † 31. August 1867 ebenda, war ein französischer Schriftsteller und einer der bedeutendsten Lyriker der französischen Sprache.
Diese eröffnete sich durch einen Brief an mich, worin er mir seine Eindrücke von meiner Musik, als auf einen Menschen der durchaus nur Farben- aber keinen Ton-Sinn gehabt zu haben glaubte, bewirkt hätte. Seine, in der seltsamsten Phantastik mit bewusster Kühnheit sich bewegenden Auslassungen hierüber zeigten mir in ihm sofort im mindesten einen Menschen von sehr ungewöhnlichem Geist, welcher mit ungestümer Energie den von mir empfangenen Eindrücken in ihren weitesten Konsequenzen folgte. Seiner Namens-Unterschrift fügte er die Angabe seiner Wohnung nicht bei, um, wie er erklärte, mich nicht zu dem Gedanken zu verleiten, er wolle etwas von mir. Es versteht sich, dass ich auch ihn aufzufinden wusste und ihn demjenigen Kreis von Bekanntschaften einreihte, welchen ich von jetzt an die Abende des Mittwoch zu ihrem Empfang bei mir ankündigte.
Dies war mir von meinen älteren Pariser Bekannten, unter denen Gaspérini sich fortgesetzt treu erhielt, als den Pariser Gewohnheiten entsprechend angeraten worden; und so kam ich dazu, in meinem kleinen Häuschen der rue Newton ganz nach der Mode „Salon“ zu halten, wobei sich Minna, trotzdem sie sich nur jämmerlich mit einigen französischen Brocken zu helfen vermochte, in einer sehr respektablen Stellung fühlte. Dieser Salon, an welchem auch Olliviers freundschaftlichen Teil nahmen, bevölkerte sich einige Zeit über durch immer zunehmende Affluenz.
Malwida von Meysenbug, * 28. Oktober 1816 in Kassel – † 26. April 1903 in Rom, war eine deutsche Schriftstellerin, die sich auch politisch und als Förderin von Schriftstellern und Künstlern betätigte.
Hier fand sich auch eine ältere Bekannte, Malwida von Meysenbug, wieder zu mir, um fortan für das ganze Leben mir nahe befreundet zu werden. Ich war ihr zuvor ein einziges Mal und zwar während meines Aufenthaltes in London (1855), persönlich begegnet, nachdem sie bereits früher mit enthusiastischer Zustimmung sich mir über mein Buch „das Kunstwerk der Zukunft“ brieflich zu erkennen gegeben hatte. Damals, in London, wo wir uns eines Abends bei einer Familie Althaus zusammenfanden, traf ich sie noch von all den Wünschen und Entwürfen für die Vervollkommnung des menschlichen Geschlechts erfüllt an, zu denen ich durch jenes Buch mich selbst bekannt hatte, von welchen ich aber jetzt, namentlich unter der Anleitung Schopenhauers, durch die Erkenntnis der tiefen Tragik der Welt, sowie der Nichtigkeit ihrer Erscheinungen, in einem fast gereizten Sinn abgewendet worden war. Es war mir peinlich, bei meinen Diskussionen hierüber von der enthusiastischen Freundin nicht verstanden zu werden und ihr geradeswegs als Renegat einer edlen Sache zu erscheinen. Wir schieden in großer Verstimmung. Jetzt erschrak ich fast, Malwida wieder in Paris anzutreffen: gar bald löschte sich aber jede peinliche Erinnerung an jene Londoner Debatten aus, als sie mir sofort mit der Erklärung entgegenkam, dass der damalige zwistige Disput auf sie den entscheidenden Erfolg gehabt hätte, welcher sie bestimmte sich unverzüglich mit der Schopenhauerschen Philosophie bekannt zu machen. Nachdem ihr dies durch das ernstlichste Studium gelungen, sei sie allerdings zu der Einsicht gelangt, dass ihre damals geäußerten und heftig behaupteten Ansichten über Weltbeglückung ihrer Seichtigkeit wegen mich mit großem Verdruss erfüllt haben müssten. Sie erklärte sich jetzt als meine eifrigste Bekennerin und fasste dieses Bekenntnis sogleich im Sinn einer um all mein Wohlergehen allerernstlichst besorgten Freundin auf. Wenn ihr, welche ich dem Anstand gemäß zunächst in die Stellung einer Freundin zu meiner Frau zu bringen hatte, das schreckliche Missbehagen unseres nur noch scheinbar ehelichen Zusammenlebens auf den ersten Blick nicht entgehen konnte und sie gegen die aus dem Wahrgenommenen resultierenden Übelstände mit herzlicher Fürsorge einzuschreiten sich angelegen sein ließ, so blieb es ihr auch alsbald nicht verborgen, in welcher schwierigen Lage ich bei meinen fast ziellosen Unternehmungen bei gänzlich mangelnder materieller Sicherung meiner Existenz, in Paris mich befand. Die großen Unkosten, in welche die gegebenen drei Konzerte mich gebracht, waren endlich niemandem der sich um mich bekümmerte, unbekannt geblieben; auch Malwida hatte bald erraten, in welchen Schwierigkeiten ich mich befand, da sich nach keiner Seite eine Aussicht eröffnen wollte, welche als ein praktischer Erfolg meiner bisherigen Unternehmungen und als ein Ersatz der ihnen gebrachten Opfer angesehen werden konnte. Ganz aus eigenem Antrieb fühlte sie sich verpflichtet, an eine Hilfe für mich zu denken und suchte diese in der mir zu verschaffenden Bekanntschaft einer Madame Schwabe, der Witwe eines reichen englischen Kaufmannes, in deren Haus sie als Erzieherin der älteren Tochter ein Unterkommen gefunden hatte. Sie verhehlte sich und mir nicht, welch' üble Zumutung mir mit der Pflege dieser Bekanntschaft gestellt war; dennoch hielt sie sich an die von ihr angenommene Gutmütigkeit dieser ziemlich grotesken Frau, sowie an die Eitelkeit derselben, welche mir die Auszeichnung des Besuchs meines Salons gewiss zu vergelten suchen werde. In Wahrheit waren alle meine Subsistenz-Mittel zu Ende; und diese schlimme Lage zu verleugnen erhielt ich den Mut einzig durch den Abscheu, den ich empfand, als ich erfuhr, man gehe unter den Deutschen von Paris damit um, durch eine anzustellende Sammlung mich für die Unkosten meiner Konzerte zu entschädigen. Bei der Nachricht hiervon schritt ich sofort mit der Erklärung ein, dass jene Annahme meiner Bedürftigkeit infolge von Verlusten auf einem falschen Gerücht beruhe und ich jede Bemühung in diesem Sinn ablehnen müsse. Madame Schwabe, welche sich regelmäßig in meinen Soireen einfand und ebenso regelmäßig beim Musizieren einschlief, fand sich nun aber veranlasst, durch die sorgsame Meysenbug mir ihre persönliche Hilfe anbieten zu lassen. Diese erstreckte sich auf etwa 3.000 Franken, welche mir in diesem Augenblick allerdings auf das Äußerste nötig waren; da ich das Geld nicht geschenkt annehmen wollte, stellte ich der Dame, welche dies in keiner Weise verlangte, freiwillig über die empfangene Summe einen Wechsel auf ein Jahr aus, welchen sie in der Annahme, einzig meinem Gefühl dadurch Genüge zu tun, nicht aber ihrerseits Rechte auf Wiedererstattung sich zu sichern, gutmütig akzeptierte. Als späterhin wirklich die Zeit der Fälligkeit dieser Wechsel erschien, wendete ich mich, da andererseits meine Lage mir die Einlösung derselben durchaus unmöglich machte, an die in Paris verbliebene Meysenbug, um bei der seitdem wieder auswärts sich befindenden Besitzerin des Papieres sich für die Erneuerung desselben durch Verlängerung auf ein neues Jahr, zu verwenden: diese entgegnete mir nun mit ernstlichster Überzeugung, ich solle mir doch selbst diese geringe Mühe ersparen, da die Schwabe die mir übergebene Summe nie anders als eine freiwillige Beisteuer zum Gelingen meiner Pariser Unternehmung, für welches sie ernstliches Interesse zu empfinden sich geschmeichelt hätte, angesehen habe. Wir werden späterhin erfahren, welche Bewandtnis es damit hatte.
Ebenso überrascht als gerührt war ich, in dieser seltsam aufgeregten Zeit das Huldigungsgeschenk eines Dresdner Bürgers, Richard Weiland zugeschickt zu erhalten; es war eine nicht kunstlose Silber-Arbeit, ein von einem Lorbeerkranz umgebenes Notenblatt darstellend, auf welchem die Anfangstakte von Hauptthemen aus meinen Opern bis zu „Rheingold“ und „Tristan“ eingegraben waren. Der bescheidene Mann besuchte mich später einmal und erklärte mir, dass er fast unausgesetzt den Aufführungen meiner Opern an verschiedenen Orten nachgereist sei, bei welchen Gelegenheiten er von der Prager Aufführung des „Tannhäusers“ im Gedächtnis behalten hatte, dass dort die Ouvertüre zwanzig Minuten gedauert, während sie unter meiner Leitung in Dresden nur zwölf in Anspruch genommen hatte.
Gioachino Rossini, * 29. Februar 1792 in Pesaro, Kirchenstaat, heute Marken – † 13. November 1868 in Passy, Paris, war ein italienischer Komponist.
In einer anderen Weise sehr freundlich anregend erwies sich für mich eine Berührung mit Rossini, welchem ein Witzreißer für die Journale ein Bonmot untergeschoben hatte, wonach er seinem Freund Caraffa, als dieser sich für meine Musik erklärte, bei einem Diner den Fisch ohne Sauce serviert und dies damit erklärt haben sollte, dass ja sein Freund auch die Musik ohne Melodie liebe. Hiergegen protestierte nun Rossini in einem öffentlichen Schreiben sehr förmlich und ernsthaft, erklärte das ihm untergelegte Bonmot für eine „mauvaise blague“ und bezeugte zugleich, dass er derartige Scherze sich nie in Betreff eines Mannes erlauben würde, den er darin begriffen sehe das Gebiet seiner Kunst zu erweitern. Nachdem ich hiervon Kenntnis erhalten, zögerte ich keinen Augenblick Rossini meinen Besuch zu machen und ward von ihm in der Weise freundlich empfangen, wie ich dies später in einem, meinen Erinnerungen an Rossini gewidmeten Aufsatz beschrieben habe. – Nicht minder war ich auch erfreut im Betreff meines alten Bekannten Halévy zu erfahren, dass er in dem Streit über meine Musik freundlich für mich Partei genommen hatte. Über meinen Besuch bei ihm, sowie die bei dieser Gelegenheit gepflogene Unterhaltung, verweise ich auf meinen früheren bereits vorgreifend gegebenen Bericht.
Bei allen diesen, mehrerenteils freundlichen und ermunternden Begegnungen wollte dennoch aber nichts herauskommen, was für die Gestaltung meiner Lage einer sicheren Aussicht geglichen hätte. Immer noch musste ich darauf gespannt bleiben, ob mir auf mein an den Kaiser Napoleon deshalb gerichtetes Gesuch ein Bescheid gegeben und die Mittel der großen Oper zu einer Wiederholung meiner Konzerte mir zugewiesen werden würden. Denn nur hieraus, nämlich wenn ich gar keine Kosten zu tragen hatte, konnte mir auch ein immer nötiger werdender Vorteil erwachsen. Es blieb ausgemacht, dass der Minister Fould mit höchster Leidenschaftlichkeit beim Kaiser mir entgegenstehe. Da ich nun hiergegen die sehr überraschende Erfahrung gemacht, dass der Marschall Magnan meinen sämtlichen drei Konzerten beigewohnt hatte, durfte ich bei diesem Herrn, gegen welchen der Kaiser aus den Zeiten des zweiten Dezembers her besondere Verbindlichkeiten hatte, auf eine nicht ungünstig zu verwertende Teilnahme für mich schließen. Da ich es durchaus darauf absah, dem mir höchst widerwärtig gewordenen Herrn Fould etwas anzuhaben, meldete ich mich daher bei dem Marschall und hatte infolgedessen die große Überraschung, eines Tages einen Husaren an meinem Haus anreiten zu sehen, welcher vom Pferde herab die Klingel anzog und meinem erstaunten Diener das Schreiben Magnans überreichte, in welchem dieser mich zu sich beschied. In der Kommandantur von Paris empfing mich demzufolge der bis zur Verwogenheit stattliche Militär: dieser unterhielt sich sehr verständig mit mir, indem er mir seinen Gefallen an meiner Musik unverhohlen bezeugte und hörte meinen Bericht über die so auffallend zwecklosen Versuche, welche ich beim Kaiser angestellt, sowie auch die Kundgebung meines Verdachtes in Bezug Foulds, mit wahrhaftiger Aufmerksamkeit an.
Bernard-Pierre Magnan, * 7. Dezember 1791 in Paris – † 29. Mai 1865 ebenda, war ein französischer General und Marschall von Frankreich.
Mir ward später berichtet, er habe noch am gleichen Abend in den Tuilerien Fould sehr bestimmt in meinem Betreff zur Rede gestellt.
Jedenfalls bleibt es gewiss, dass ich von jetzt an immer bestimmtere Anzeichen einer Wendung meiner Angelegenheiten von dieser Seite her erfuhr. Das Entscheidende trug sich aber zu, als von einer mir bisher gänzlich unbeachtet gebliebenen Seite her zu meinen Gunsten eine Bewegung sich kundgab. Bülow, welcher von der Teilnahme an dem Ausgang aller dieser Dinge gefesselt, seinen Aufenthalt in Paris immer noch verlängert hatte, war hier mit Empfehlungsbriefen der damaligen Prinzessin-Regentin von Preußen an den Gesandten Grafen Pourtalès angekommen gewesen. Seine Erwartung, von diesem Herrn endlich selbst den Wunsch, dass ich ihm vorgestellt werden möchte, ausgedrückt zu sehen, blieb bisher unerfüllt. Um ihn zur Bekanntschaft mit mir zu nötigen, griff er endlich zu dem Mittel, den preußischen Gesandten nebst seinem Attaché, Grafen Paul Hatzfeld, zu einem Déjeuner in dem vorzüglichen Restaurant Vachette, zu welchem ich ihn begleiten sollte, einzuladen. Der Erfolg dieser Zusammenkunft war allerdings ganz nach Wunsch; namentlich erfreute mich Graf Pourtalès durch große Einfachheit und ungeheuchelte Wärme seiner Unterhaltung, wie seines Benehmens gegen mich. Von jetzt an besuchte mich Graf Hatzfeld, wohnte auch meinen Mittwochs-Empfängen bei und überbrachte endlich Botschaften im Sinn einer am Hof der Tuilerien vorgehenden Bewegung zu meinen Gunsten.
Paul von Hatzfeld, * 8. Oktober 1831 in Düsseldorf – † 22. November 1901 in London, war ein deutscher Beamter im Auswärtigen Dienst.
Endlich ersuchte er mich, mit ihm den Grafen Bacciochi, den Oberstkämmerer des Kaisers, zu besuchen. Von diesem erhielt ich dann die ersten Anzeichen einer Antwort auf mein früheres Gesuch an den Kaiser: es hieß da, warum ich denn auf ein Konzert in der großen Oper bestünde; ein solches interessiere ja niemanden ernstlich und könnte mir keinen weiteren Erfolg bringen; es wäre dagegen vielleicht besser, wenn man dem Direktor dieses kaiserlichen Institutes, Herrn Alphonse Royer, eine Verständigung mit mir über eine für Paris zu komponierende Oper anempfehle. Da ich hiervon nichts hören wollte, blieben mehrere solche Konferenzen fruchtlos; zu einer derselben begleitete mich jedoch Bülow, bei welcher Gelegenheit wir an dem wunderlichen Herrn Grafen, den Belloni in seiner Jugend als Billet-Kontrolleur an der Scala in Mailand fungierend gekannt haben wollte, die lächerliche Bemerkung machten, dass er, vermutlich infolge nicht sehr ehrenwerter körperlicher Gebrechen, gewisse willenlose krampfhafte Bewegungen seiner Hand nur durch beständiges Spielen mit einem Stöckchen zu verbergen bemüht war, welches er mit scheinbarer Künstlichkeit an sich auf und ab springen ließ. Auch nach diesem Beginn eines unmittelbaren Verkehrs mit der kaiserlichen Behörde schien es in meiner Angelegenheit zu fast gar nichts kommen zu wollen, als eines Vormittags Graf Hatzfeld mich mit der Nachricht überraschte, der Kaiser habe am vergangenen Abend den Befehl zur Aufführung meines Tannhäuser erteilt. Die entscheidende Veranlassung hierzu sei von der Fürstin Metternich gegeben worden. Diese sei, als man soeben in der Umgebung des Kaisers über mich sich unterhalten habe, hinzugetreten und, vom Kaiser um ihre Meinung befragt, habe sie, welche die Oper in Dresden gesehen hatte, mit solch herausforderndem Enthusiasmus sich über den „Tannhäuser“ geäußert, dass der Kaiser ihr sofort das Versprechen gegeben habe, den Befehl zur Aufführung desselben zu erteilen. Zwar sei Fould, dem noch am selben Abend der kaiserliche Befehl zuging, in höchste Wut hierüber ausgebrochen; Napoleon habe ihm aber bedeutet, er könne nicht zurück, denn er habe der Fürstin Metternich sein Wort gegeben. Nun wurde ich denn wieder zu Bacciochi geführt, welcher mich diesmal mit sehr ernster Miene empfing, zunächst aber die sonderbare Frage nach dem Sujet meiner Oper an mich richtete. Ich musste ihm dieses in Kürze mitteilen und als ich zu Ende war, fuhr er befriedigt auf: „ah! le pape ne vient pas en scène? C'est bon! On nous avait dit que vous aviez fait paraître le Saint-Père, et ceci, vous comprenez, n'aurait pas pu passer. Du reste, monsieur, on sait à présent que vous avez énormément de génie; l'empereur a donné l'ordre de représenter votre opéra.“ Er versicherte mich des Weiteren, alles würde mir zu Gebote gestellt werden, um meine Wünsche zu befriedigen; ich solle mich fortan hierüber einzig mit dem Direktor Royer in das Vernehmen setzen.
Diese Wendung der Dinge brachte mich in eine dumpfe Verwirrung, da meine innere Stimme zu allernächst mir nur die seltsamen Missverständnisse bezeichnete, welchen ich sie zu verdanken hatte. Allerdings war mir jede Hoffnung geschwunden, meinen ursprünglichen Plan, meine Werke mit einer ausgewählten deutschen Truppe in Paris aufzuführen, verwirklicht zu sehen, und ich durfte mir nicht verbergen, dass ich jetzt auf das gute Glück eines Abenteuers angewiesen war. Einige Unterredungen mit dem Direktor Royer genügten, um mich über den Charakter der mir zugeführten neuen Unternehmung aufzuklären. Er hatte keine angelegentlichere Sorge, als mich von der Notwendigkeit einer Umänderung des zweiten Aktes zu überzeugen, weil hier die Einführung eines großen Balletts unumgänglich sei. Auf diese und ähnliche Zumutungen gab ich so gut wie gar keine Antwort und fragte mich heimkehrend nur, was ich nun anfangen sollte, wenn ich mich entschlösse der Aufführung meines „Tannhäuser“ in der großen Oper geradeswegs zu entsagen.
Hierzu nahmen mich andere, unmittelbar meine Lage berührende, Sorgen drängend genug ein, um ihrer Abhilfe zunächst meine ganze Tätigkeit zuzuwenden. In diesem Sinn beschloss ich ein von Giacomelli eingeleitetes Unternehmen, meine Konzerte in Brüssel zu wiederholen, zu allernächst auszuführen. Mit dem dortigen Théatre de la Monnaie war eine Übereinkunft für drei Konzerte, deren Einnahme nach Abzug aller Kosten zur Hälfte mir überlassen sein sollte, abgeschlossen worden. In Begleitung meines Agenten reiste ich nun am 19. März nach der belgischen Hauptstadt, um zu versuchen, ob es mir gelingen würde, dort einigen Ersatz für mein an den Pariser Konzerten verlorenes Geld zu gewinnen. Unter der Anleitung meines Mentors sah ich mich genötigt, allerhand Zeitungsredaktoren, unter anderen belgischen Sommitäten aber auch Herrn Fétis père aufzusuchen.
François-Joseph Fétis, * 25. März 1784 in Mons – † 26. März 1871 in Brüssel, war ein belgischer Komponist, Musikkritiker und Musikbiograph.
Von diesem wusste ich, dass er sich bereits vor Jahren von Meyerbeer gegen mich hatte erkaufen lassen; es war mir nun unterhaltend, mit diesem autoritätisch sich gerierenden Menschen in eine Art von Diskussion zu geraten, in welcher er sich schließlich gänzlich als gleicher Ansicht mit mir kundgab. – Hier machte ich aber auch die merkwürdige Bekanntschaft des Staatsrats Klindworth (Georg Klindworth, * 16. April 1798 in Göttingen – † Januar 1882 in einem Vorort von Paris, war ein deutscher Diplomat und Geheimagent, der in Diensten mehrerer europäischen Staatsmänner und Fürsten stand.), dessen Tochter oder, wie manche wissen wollten, Gattin, mir schon früher, als ich mich in London aufhielt, von Liszt empfohlen worden war; dort war sie jedoch damals nicht eingetroffen und ich hatte nun das Vergnügen, mich hier in Brüssel zu meiner Überraschung von ihr eingeladen zu sehen. Während sie sich außerordentlich zuvorkommend um mich bemühte, sorgte Herr Klindworth selbst für eine unerschöpfliche Unterhaltung aus den Erfahrungen seiner wunderlichen Laufbahn als diplomatischer Agent in allerhand mir undeutlich gebliebenen Interessen. Ich speiste mehrere Mal bei ihnen und ward dort mit Graf und Gräfin Coudenhoven, letztere die Tochter meiner älteren Freundin, Frau Kalergis, bekannt.
Heinrich Graf von Coudenhoven, * 12. Oktober 1859 in Wien – † 14. Mai 1906 in Ronsperg, Böhmen, war ein österreichischer Diplomat und Weltbürger.