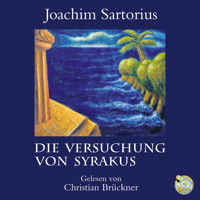Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Meine Insel
- Sprache: Deutsch
Zypern – das ist Weltgeschichte als Inselgeschichte. Aufgrund ihrer strategischen Lage war die Insel stets Objekt der Begierde fremder Mächte. Alle waren hier: Phönizier, Griechen, Römer, Byzantiner, Kreuzritter, Venezianer, Genuesen, Osmanen, Briten. Und alle haben Spuren hinterlassen: Die eindrucksvollsten Denkmäler – nach den römischen und frühbyzantinischen Ruinen von Salamis – stammen aus fränkischer und venezianischer Zeit, wie die Abtei von Bellapais, der befestigte Hafen von Kyrenia, die prächtigen Kathedralen von Nikosia und Famagusta, wo Shakespeares Othello spielt. Drei Jahre hat Joachim Sartorius auf Zypern gelebt – jetzt kehrt er dorthin zurück, zu den Kulturen und Legenden, zu Farben und Licht der Levante. Er spürt den vielen historischen und seelischen Sedimenten nach, der bewegten Geschichte der Insel, ihrer Teilung nach der türkischen Invasion im Jahre 1974 und der schwierigen aktuellen Situation. Und doch ist dieses Buch nicht das eines Historikers oder Politologen, sondern das eines Dichters, der an der Hand guter Freunde – Inselgriechen wie Inseltürken – Zypern zu verstehen sucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Sartorius
Mein Zypern
oder
Die Geckos von Bellapais
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2013 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Simone Hoschack, Petra Koßmann, mareverlag Hamburg
Abbildung Glasierte Kachel, safawidisch, 17. Jahrhundert
Karte Peter Palm, Berlin
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-368-2
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-174-9
www.mare.de
»Womit sind diese Berge miteinander verwoben,
wo wurden diese Berge so meisterhaft geformt,
dieses Meer, dieser Himmel,
wie fanden sie so ihr Wesen,
dass wir uns nur mit ihnen vergleichen,
nur sie als Beispiel nehmen?«
Costas Montis1914–2004
»Selbst aus zerbrochenen Gläsern
konnte ich trinken – und tat es auch!«
Galatopoulos Christodoulos1902–1953
Für Anna und Andrea
Inhalt
Das Sommerhaus des letzten Architekten der Krone
»Herrlich fruchtbar und für seine Zitronen überall gerühmt«
»Die Vögel sind da! Die Schnecken sind da!«
Der Mondstrand
Henna und goldgelbe Münzen
Die Grammatik des Ornaments: Bellapais
Famagusta und Salamis
Diplomatische Runden
Ein Säckchen Salz und ein Terrakotta-Phallus
Wie ein Kiosk im Meer
Zentrum und Peripherie
Im Troodos: Von Erzengel Michael, König Faruk und Arthur Rimbaud
Von den Seidenraupen in Lapithos
Kleine byzantinische Reise
Die Geckos von Bellapais
Die Rückkehr
Vom Elend der Teilung
Die Hälfte von Lambousa
Der Kultstein von Kouklia
»Was weißt du von den Schwierigkeiten, ein Glas zu malen?«
Noch einmal Famagusta
Ich habe keine Geckos mehr gesehen
Anhang
Drei Gedichte von Niki Marangou
Straßenkarte von Nikosia
Den Freunden im Norden
Brief an Dionyssis
Drei Gedichte von Joachim Sartorius
Der Kultstein von Kouklia
Agios Kassianos in Nikosia
Am Hafen von Paphos
Danksagung
Hinweis zum Gebrauch der Ortsnamen
Gedichte-/Zitatnachweis
Literaturverzeichnis (Auswahl)
Das Sommerhaus des letzten Architekten der Krone
Jeder Mensch hat sein Haus« war eine Redensart meines Vaters. Er meinte damit nichts Besonderes, schon gar nicht etwas Metaphysisches, sondern einfach nur, dass jeder Mensch ein Haus hat, das er besonders liebt. Mein Lieblingshaus steht auf Zypern, in Lapithos, an der Nordküste. Ich habe zwei Sommer darin gewohnt und versäumt, es zu kaufen. Ich lehnte damals Eigentum ab, weil es bindet, weil es einen an einen Ort fesselt und man doch weiterziehen will. Später hat es, wie ich erfuhr, ein Tycoon aus Istanbul gekauft, und ich wage mir nicht vorzustellen, wie es heute aussieht, vor allem das Innere. Es war ein Riesenfehler gewesen, nicht auf das Angebot von Mark Harrison einzugehen.
Ich lernte Mark Mitte der Achtzigerjahre in der »Blue Moon Bar« kennen. Sie lag, etwas erhöht, am Rande des hübschen Hafens von Kyrenia, war klein und schummerig. Aber wenn der Winter vorbei war, saß man draußen auf den wackeligen korbgeflochtenen Stühlen, blickte durch das deutliche Gezweig der Feigenbäume auf die schunkelnden Boote im Hafen und bestellte einen Rakı oder einen Gin nach dem anderen. Mark war hier Dauergast. Wir kamen aber erst nach meinem vierten oder fünften Besuch ins Gespräch. Er lallte etwas. Ich schätzte ihn um die vierzig, wie er groß und blond an der Theke lehnte, aber er sah müde aus, ungesund, wie in Alkohol gepökelt. Woher ich sei, wollte er wissen.
»Aus Nikosia«, sagte ich.
»Wie das?«, meinte er. »Kommt man so ohne Weiteres über die Grenze, wenn man drüben wohnt?« Mit »drüben« meinte er den griechischen Teil der Insel.
»Ich habe einen besonderen Pass«, sagte ich, »damit kann ich hin- und herfahren.« Es schien mir zu angeberisch, von einem Diplomatenpass zu sprechen. Orhan, der Wirt, hantierte mit seinen Gläsern, hörte aber mächtig zu. Mark kam ohne Umschweife zur Sache:
»Ich besitze ein schönes Haus in Lapithos. Du kennst vielleicht das Dorf. Ein paar Meilen von hier. Ich brauche Geld, ich würde dieses Haus gerne vermieten, hundert Pfund im Monat.«
Wir verabredeten uns für den nächsten Tag, da es schon dunkel war. Nikosia war im Sommer glühend heiß, die gelbe Hitze der Mesaoria-Ebene sammelte sich hier und machte das Leben unerträglich. Auch wenn die Sonne untergegangen war, strahlten die Mauern noch eine gewaltige Hitze ab. Diesen großen, schattengrellen Backofen in den Sommermonaten gegen ein Haus am Meer einzutauschen schien mir verlockend. Ich war neugierig. Wir trafen uns am Nachmittag vor dem Haus. Es lag etwas abseits vom Zentrum des Dorfes, an einem trapezförmigen Platz, der von drei großen, stattlichen Häusern umgeben war. Ein paar Esel, über und über mit Bündeln frischer Maulbeerzweige beladen, die Last dreimal so groß wie die Tiere, kamen den Hang herab und trotteten, dunkel vor Nässe, über den Platz.
Vor einem der Häuser, schneeweiß gekalkt, abweisend von außen, die Mauern zur Straße ohne Fenster, stand Mark. Er schloss die Tür auf, und fast ohne Übergang, nach einem kleinen Vestibül, kamen wir in einen riesigen Raum, ein Gewölbe, ein veritables Refektorium mit einem Kamin an der Stirnseite und einigen weiß bezogenen Sitzmöbeln, sonst war er streng und nackt. Drei Türen führten auf eine Terrasse, die von einem Vorsprung des Hauses beschattet war und in drei leicht zugespitzten Rundbögen auf Säulen aus gelbem Sandstein ihren Abschluss fand. Die Terrasse und die Arkaden setzten sich an einer Seite fort zu einem nach zwei Seiten offenen, kreuzgangartigen, mit Gras und Schilfbewachsenen Innenhof. In seiner Mitte war ein Goldfischteich, daneben ein mächtiger, gerade blühender Pfefferbaum und zwei Mimosenbäume. Ich dachte unwillkürlich an den Garten Eden. An dieses offene Geviert schloss sich ein weiteres Gebäude an, das wir über die Terrasse und einen weiteren Vorhof mit einem kleinen Springbrunnen erreichten. In diesem Gebäude befanden sich die Schlafzimmer und die Bäder, mit einer Loggia im ersten Stock. Mark bestand darauf, mir alle Räume zu zeigen. Er stieß die Läden auf, und die Zweige eines blau blühenden Jakarandabaumes reichten bis in die Zimmer hinein. Er machte eine Handbewegung zum Meer, das vielleicht zwei Meilen entfernt lag.
»Das Grundstück reicht bis zur Straße am Meer. Hier ist es nicht so gepflegt. Ein gigantischer Zitronenhain bis zur Küste.«
Wir setzten uns an einen rohen Holztisch unter den Bögen auf der ersten Terrasse.
»Du wunderst dich vielleicht, warum dieses Haus so leer ist, so nackt, nur weiße Wände und das Nötigste, Tische und Stühle. Das war nicht immer so. Mein Vater hat sehr viel gesammelt, römische Köpfe, alte Bücher, Vasen, Ikonen. Das Haus war ein kleines Museum. Aber die türkischen Soldaten haben nach der Invasion, das war 1974, also vor zehn Jahren, alles mitgenommen. Wer weiß, wo das Zeug ist.«
Nach und nach erfuhr ich, dass Mark der Sohn des letzten Architekten der Krone, sozusagen des letzten Baumeisters der britischen Kolonialverwaltung auf Zypern war: Sir Austen Harrison. Dies war sein Sommerhaus. Er hatte auf seinen Streifzügen durch Lapithos die antiken Reste eines griechischen Weinkellers gefunden, über den die Römer gebaut hatten. Auf den Fundamenten errichtete Harrison in den frühen Fünfzigerjahren dieses Haus.
Wir wurden schnell handelseinig. Auch wenn Mark es sich noch einmal überlegt und die Miete verdreifacht hätte, wäre ich auf jede Forderung eingegangen. Ich war heillos verliebt in dieses Anwesen, schon als ich von der zentralen Halle unter den Säulen in den ersten der Gärten trat, mit der Hand die herabhängenden Jasminzweige zur Seite schiebend, und die menschlichen Proportionen dieses Hauses wahrnahm. Es war erst sehr viel später, vielleicht im letzten Sommer, bevor ich Zypern verließ, dass ich das Buch Bittere Limonen von Lawrence Durrell noch einmal las und auf die folgende Stelle, die ich vergessen hatte, stieß: »Doch alles löste sich in Verzweiflung und Neid auf, als wir Austen Harrisons Haus betraten und ich seinen romantischen Besitzer ernst an seinem Teich sitzen sah, anscheinend damit beschäftigt, einen Goldfisch zu psychoanalysieren. Mit seinem feingeprägten byzantinischen Imperatorenkopf und der knappen, ruhigen Haltung seiner hohen Gestalt war er eine noble Persönlichkeit. Er repräsentierte jene versunkene Welt, in der Stil nicht nur ein literarisches Gebot, sondern eine angeborene Art war, sich Büchern, Rosen, Statuen und Landschaften zu nähern. Sein Haus war vollkommener Ausdruck seines Wesens. Er hatte ein altes zyprisches Weinlager übernommen und mit einer Zärtlichkeit und Umsicht verwandelt, dass die ganze Komposition zum Klingen kam: der lange gewölbte Raum mit seinen Bücherreihen, in dessen Nischen Ikonen schimmerten, die schattige Terrasse mit ihren Spitzbögen, das Gartenhaus, der Teich. All das war eine Veranschaulichung philosophischer Grundsätze – eine Veranschaulichung dessen, was gutes Leben bedeutet und wie es geführt werden sollte.«
In dieses Haus zog ich im Sommer 1984 ein und verbrachte dort drei Monate. Das Gleiche noch einmal im Sommer 1985. Dann wollte Mark das Haus, das Lawrence Durrell an einer anderen Stelle seines Buches als »das schönste Haus des ganzen östlichen Mittelmeeres« bezeichnete, verkaufen. Er brauchte Geld, und ich griff nicht zu. Aber diese beiden Sommer gehören zu den glücklichsten meines Lebens.
»Herrlich fruchtbar und für seine Zitronen überall gerühmt«
Am Tag des Einzugs saß ich abends auf der Terrasse unter den Bögen. Die Kinder, Anna und Andrea, schliefen schon. Wir hatten nur das Nötigste aus Nikosia mitgenommen, Laken, Handtücher, Flipflops, ein paar Bücher und Taucherbrillen, und am Nachmittag, nach der Ankunft, in Lapithos noch eingekauft. Bei dem Bakkal gab es alles: duftendes Brot, Salat, Gemüse, Kaffee, Kardamom, Pastırma, den von den Türken so geliebten, scharf gewürzten Rinderschinken, dann Kerzen und Baklava, die von Honig troffen, und einen Karton »Lal«, einen Roséwein vom türkischen Festland, dessen frischen, kühlen Biss ich schätzte, vor allem an heißen Sommertagen.
Von dem Haus hatten wir behutsam Besitz genommen. Wir teilten die Schlafzimmer auf. Ein Aquarell von Niki Marangou, einer guten Freundin aus Nikosia, stellte ich auf den Kaminsims. In der Küche verstauten wir unsere Einkäufe. Sie war, gemessen an der Großzügigkeit der anderen Räume, erstaunlich klein und nur mit dem Allernotwendigsten ausgestattet. Unter den Tellern aus hellgrünem Pressglas fand ich einen größeren bemalten Keramikteller, der – wie sich bald herausstellte – der einzige Gegenstand mit einem unmittelbaren Bezug zum Erbauer des Hauses war. Ich besitze diesen Teller noch heute. Sein Durchmesser beträgt 35 Zentimeter. Ein breiter schwarzer Rand ist oben und unten durch Schriftzüge unterbrochen. Oben steht in Versalien: »AUSTEN HARRISON«, und unten: »LAPITHOS«. Die weiße Innenfläche nimmt in der Vertikalen eine hohe, schlanke Figur ein, ohne Zweifel Sir Austen selbst. Diese Figur trägt lange, weite weiße Hosen und eine weiße Tunika Über dem gelbbraunen Fuchsgesicht ein wild zerzauster Haarschopf. In den Händen trägt die Figur einen breiten Zollstock, das Insignium des Architekten. Das Ganze ist leicht hingestrichelt, sehr spielerisch. Der Baumeister tänzelt, eine helle, lichte, einnehmende Gestalt. Dieser Teller verbindet mich, neben einigen Fotografien, am stärksten mit dem Haus. Zu gerne wüsste ich, ob Austen diese Skizze selbst gemacht hat oder, was wahrscheinlicher ist, ein im Zeichnen begabter Freund. Ich müsste in den Archiven des britischen Kolonialministeriums forschen, nach Zeichnungen von Sir Austen suchen und Vergleiche anstellen.
Auf diesen Teller hatte ich gleich an diesem ersten Abend Trauben und Feigen zu einer Pyramide geschichtet und ihn auf den Holztisch unter den Arkaden gestellt. Aus dem Saal holte ich eine wackelige Stehlampe und saß nun an dem Tisch, an dem ich vor ein paar Tagen mit Mark den Mietvertrag abgeschlossen hatte. Der Himmel hatte schon fast alle Farbe verloren. Nur der kleine Teich bewahrte noch einen Rest von Blau. Zwischen den Spitzbögen schossen Fledermäuse hin und her. Zwei Geckos promenierten die Steinwand hoch, hellgrau, fast durchsichtig, mit schwarzen Knopfaugen, auf der Jagd nach Insekten. Im Lichtkegel der Lampe auf dem Boden, neben meinen braunen Zehen, sah ich eine weißliche, eingetrocknete Schleimspur, einen eingebeulten Kreis, von einer Nacktschnecke, die jetzt bei einem der steinernen Pfeiler von großen roten Ameisen zerstückelt wurde. Ich fühlte mich als einen Teil dieser Kleintierwelt, der Geckos, Ameisen, Spinnen, Nachtschwalben und Fledermäuse, mehr aber noch aufgehoben in der großen Natur, die das Haus umgab. Es ging kein Wind. Aber der Pfefferbaum wiegte sich hin und her. Von dem Zitronenhain kam ein dunkelgrüner Duft herüber und vermischte sich mit dem süßlichen des Jasmins. Wenn ich vor die Rundbögen trat, sah ich hinter dem fahlweißen Haus die gezackte pechschwarze Wand der Kyrenia-Berge. Plötzlich schmeckte der »Lal« nach kaltem Schatten, nach einem köstlich kühlen Schatten. Das Mondlicht trat hinter den Bäumen hervor und wurde so hell, dass die Furchen des Ornaments im Kapitell des Pfeilers vor mir klare Schatten warfen. Unwillkürlich musste ich an das Ohrgewinde einer griechischen Göttin denken. Einer der beiden Geckos verschwand in ihm.
Ich hatte mir aus der kleinen Bibliothek der Botschaft ein paar Bücher über Zypern mitgenommen, auch Reprints älterer Reiseberichte. Ich wollte, da ich ein Einwohner von Lapithos geworden war, alles über dieses Dorf in Erfahrung bringen, neben der Hauptstadt Nikosia nun meine Sommerbleibe, mein zweites Domizil.
Einmütig bezeichnen die britischen Reiseschriftsteller vom Anfang des letzten Jahrhunderts Lapithos als eines der schönsten Dörfer der ganzen Insel. Umgeben von Orangen- und Zitronenhainen, wird es aus Quellen, die den nahen Bergen entspringen, ständig bewässert. Einige der Autoren behaupten, die erste Siedlung sei von Lakedämoniern unter Praxander gegründet worden, andere meinen, die Phönizier hätten von Tyros an der libanesischen Küste aus hier eine Stadt errichtet. Im Tagebuch des Italieners Thomaso Porcacchi, der 1572 in Venedig sein Buch L’Isole piu famose del mondo veröffentlichte, fand ich die folgende Eintragung: »Lapethos, zwei Meilen von Cerines [wohl dem heutigen Kyrenia] gelegen, war ebenfalls eine alte Hauptstadt. Ihr letzter König war Pisistratus, ein Gefährte von Alexander dem Großen, gewesen. Jetzt ist es ein Dorf gleichen Namens, herrlich fruchtbar und für seine Zitronen überall gerühmt.« Ach, Porcacchi, ich trinke dir aus einer Entfernung von vierhundert Jahren zu!
Am ausführlichsten schreibt Rupert Gunnis über das alte Lapithos, in seinem 1936 in London veröffentlichten Buch Historic Cyprus. Mit fast schon hysterischer Akribie schildert er in diesem Führer die Ruinen, die Burgen und Klöster, Städte und Dörfer Zyperns, sodass sich vor den Augen des Lesers das Bild einer mit Kirchen und Resten von Ruinen gänzlich überstäubten Insel auftut. In dem Abschnitt über Lapithos beschreibt er zunächst die fünf Kirchen in der Ortschaft selbst, alle jüngeren Datums und alle laut Gunnis uninteressant. Seit der Plünderung durch die türkischen Soldaten im Jahre 1974 waren sie wahrscheinlich zudem in einem lamentablen Zustand. Sein Hauptaugenmerk richtet Gunnis auf die Ruinen von Lambousa, westlich von Lapithos direkt am Meer gelegen. Von der alten, im 8. Jahrhundert vor Christus gegründeten Stadt, die in der römischen und dann der byzantinischen Zeit zu Macht und Einfluss kam und berühmt war für ihre Amphoren und Epheben, gibt es – so Gunnis – nur noch ein paar behauene Felsblöcke, halb zerstörte Mosaikböden und die Überreste eines Leuchtturms. Nach der Plünderung durch die Araber im 7. Jahrhundert gewann die Ortschaft im frühen Mittelalter wieder an Bedeutung, unter der Herrschaft der Kreuzritter. Aus dieser Zeit sind noch zwei Gebäude erhalten – die Kirche des heiligen Evlavios und das Kloster Acheiropoietos, was so viel heißt wie »errichtet ohne Hände«, denn nach einer Legende wurde das Kloster als Ganzes von Kleinasien, wo es in Gefahr war, zerstört zu werden, von der Jungfrau Maria über das Meer hierher gebracht. Seine ältesten Teile, besonders die kreuzförmige Kirche, stammen aus dem 13. Jahrhundert. Gunnis vermutet, dass die Marmorsäulen in den Seitenkapellen aus noch früherer byzantinischer Zeit stammen. Er rühmt die korinthischen Kapitelle, die kunstvollen Böden aus vielfarbigem Marmor und die auf das Jahr 1563 datierte Grabplatte eines Venezianers, eines gewissen Alessandro Flatros, der die Erweiterung des Apsisschiffes finanziert haben soll. Zwischen dieser Kirche und der Kirche des heiligen Evlavios steht inmitten eines früheren Steinbruchs eine ganz aus dem Felsen gehauene Kapelle, die dem heiligen Evlambios geweiht ist. Hier wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts ein einzigartiger Silberschatz aus dem frühen 7. Jahrhundert gefunden. Einen Teil davon kaufte John Pierpont Morgan. Er ist heute im Metropolitan Museum in New York ausgestellt. Der Rest wurde aufgeteilt zwischen dem Archäologischen Museum in Nikosia und dem British Museum in London. Die Gegenstände dort – unter anderen ein kunstvoll getriebener silberner Teller mit dem Bildnis des heiligen Bacchus und ein Vorlegelöffel, in dessen Schale ein Widder in allen kleinsten Details erhaben herausgearbeitet ist – künden von der Raffinesse und dem prachtvollen, verfeinerten Lebensstil der byzantinischen Bewohner von Lambousa.
Nicht zu fassen, sagte ich mir, als ich müde und glücklich das Buch zuschlug, wie viel Archäologie in ein Kompendium im Taschenbuchformat passt. Und es ging ja nicht nur um Ruinen und Archäologie, es ging jenseits der Fakten und Zahlen um nichts weniger als Weltgeschichte als Inselgeschichte. Ich war müde, ja, zugleich aber wie elektrisiert. Auch hier, in Lapithos und seinem antiken Vorläufer Lambousa, war – zwischen dem Meer und der Gebirgskette von Kyrenia – die ganze Geschichte Zyperns wie in einem Brennglas versammelt. Die Phönizier waren hier gelandet und hatten die Ptolemäer abgelöst. Auf die römische folgte die byzantinische Zeit. Nach den Kreuzrittern, nach dem Königreich der Lusignan und ihren romantischen Burgen kam die venezianische Besatzung, bis im Jahre 1571 das Osmanische Reich die Insel annektierte. Am meisten faszinierte mich jetzt der Kloster- und Kirchenkomplex von Lambousa. Ich hatte den Kindern versprochen, am nächsten Tag die Strände östlich von Kyrenia auszukundschaften. Aber dann stand für mich Lambousa auf dem Programm. Plötzlich fiel mir, beflügelt von diesem schönen Plan, ein, dass Mark bei einem unserer Treffen in der »Blue Moon Bar« – wir sprachen über die allzu starke Präsenz des türkischen Militärs hier im Norden – gesagt hatte, der schönste, der älteste Teil hier an der Küste sei Sperrgebiet. Die Türken hätten aus einem Kloster eine Militärakademie gemacht. Hatte er damit Lambousa gemeint? Ich leerte mein Glas »Lal« und sah mich an Verbotsschildern und grimmiger türkischer Soldateska vorbei unbeirrt auf die Kuppeln von Lambousa zuschreiten.
Ich löschte die Lampe, ging auf mein Zimmer, und, mein Meer in der Nähe, schlief ich ein.
»Die Vögel sind da! Die Schnecken sind da!«
Ein paar Tage vor unserem kleinen Umzug nach Lapithos gab Niki Marangou in ihrem Haus in Nikosia ein Fest. Die große Sommerpause stand bevor. Die Schulen hatten gerade ihre Tore geschlossen. Bald würden sich die Nikosianer in alle Richtungen zerstreuen, an die Küsten nach Limassol, Paphos und Akamas, die Betuchten unter ihnen nach Athen, London oder Paris. Es war eine kleine, lustige Runde: der stets muntere, unkonventionelle, schnauzbärtige Bürgermeister Lellos Demetriades, die Choreografin und Tänzerin Arianna Economou mit ihrem deutschen Mann, dem Maler Horst Weierstall, die Galeristin Gloria Kassianides und der Chef der Altertumsverwaltung Vassos Karageorghis, ein steifer Typ, hellenistischer Propagandist von Gnaden, doch ungeheuer kenntnisreich. Später kam noch George Lanitis hinzu, ein Journalist, der sich für einen großen Fotografen hielt und flashy pictures von unerträglich roten Mohnwiesen, knorrigen Olivenbäumen und blau verdunstenden Stränden machte. Er hatte sich zwei Jahre vor der Invasion ein großes Anwesen auf einem Hügel bei Bellapais gebaut mit einem spektakulären Blick über die gesamte Nordküste und konnte nicht verwinden, das alles verloren zu haben.
Wie immer in Nikosia bei solchen Runden drehten sich die Gespräche gleich um Politik. Es war unvermeidlich, eine Art höhere Gewalt, und letztlich lähmend. Die Vereinten Nationen hatten einen neuen Friedensvorschlag gemacht in Richtung Konföderation beider Landesteile, und wie immer lehnten die Zyperngriechen, auch die Mehrheit der hier versammelten liberalen Geister, dieses Ansinnen entrüstet ab. Ich wagte den Freunden gar nicht zu sagen, dass ich ein Haus im Norden angemietet hatte und den Sommer dort zu verbringen gedachte. Denn im Gegensatz zu mir, Angehöriger einer Botschaft und damit für beide Inselteile »zuständig«, konnten sie alle nicht dorthin fahren, würden mich nicht besuchen können. Die innerzyprische Grenze war in diesen Jahren undurchlässig, noch schlimmer und unmenschlicher, als es die deutsch-deutsche Teilung je gewesen war.
»Die Türken sind ein Gletscher, der sich unbeirrbar nach vorne schiebt«, rief Lanitis, sich in den Klimazonen irrend, warnend aus.
Ich musste an den Ausspruch eines deutschen Botschafters in Ankara denken, der die Türkei mit einem gewaltigen Stier auf einer fetten Weide verglichen hatte. Die griechischen Drohungen und Pöbeleien seien Mückenstiche. Der Stier würde mit dem Schwanz wedeln oder sich auf die andere Seite drehen. Mehr wäre nicht. Lellos Demetriades, inspiriert von der westdeutschen Politik der kleinen Schritte, berichtete von einem Treffen mit dem Bürgermeister des türkischen Teils von Nikosia kurz zuvor. Man sei sich einig geworden, im Niemandsland in der Nähe der green line gemeinsam Projekte anzugehen und zu versuchen, dass zumindest Architekten und Stadtplaner beider Seiten sich träfen und über die Zukunft einer irgendwann wiedervereinigten Stadt nachdächten.
Alle hatten sie ihre traurigen Geschichten, die mit dem türkisch besetzten Norden zu tun hatten. Niki, unsere anmutige Gastgeberin, erzählte von ihrem Onkel, der den Holzhandel seines Vaters in Famagusta übernommen hatte, eine Griechin aus Port Said in Ägypten heiratete und eine der allerersten stattlichen Villen direkt am Strand von Famagusta bauen ließ – »mit einer riesigen Terrasse und weißen Säulengängen, die bis zum Meer hinab reichten«. Vor unseren Augen erstand das Anwesen eines griechischen Great Gatsby. Dieser Mitsos sei ein Büchernarr gewesen, ein Bibliophiler, denn er habe, so Niki, die gesamte Reiseliteratur der Welt gesammelt, insbesondere aber Berichte von Reisenden in das Heilige Land, in die Levante und nach Zypern. Die Bibliothek in der Villa sei mit Eichenholz getäfelt gewesen. Vorhänge aus schwerer, orangefarbener Seide hätten das Licht gefiltert. Als junges Mädchen habe sie dort immer Zuflucht gesucht, habe Gedichtbände entdeckt, Gedichte abgeschrieben, verändert, zu den ihren gemacht. Später habe ihr der Onkel die Erstausgabe der Gedichte von Konstantin Kavafis geschenkt, die 1935 in Alexandria erschienen war. Es sei das einzige Buch aus dieser Bibliothek, das überlebt habe.
»Wir haben nichts über das Schicksal der Bilder und Bücher in Erfahrung bringen können«, sagte Niki. »Gewiss ist nur, dass das gesamte Areal abgesperrt ist, unbewohnt seit 1974.«
Ich stellte mir eine von Pflanzen völlig überwucherte Veranda vor und von einer Schicht feinen Sandes bedeckte Bücher.
Seit acht Monaten schon war ich jetzt in Nikosia auf Posten, und fast jeden Tag, jeden Abend hörte ich solche Geschichten. Mein Mitgefühl mit den Traumata, den Verlustgefühlen der Inselgriechen war groß. Man sollte denken, dass in den zehn Jahren seit der türkischen Invasion die Zeit schon einiges geheilt oder gemildert hätte. Das Fatale aber war, dass die Griechen in Nikosia von ihren Wohnungen, von ihren Balkons, blickten sie nach Norden, den Pentadaktylos sahen, jenen fünfzackigen Berg, hinter dem Kyrenia und all ihre Besitzungen lagen. Es gab Tag für Tag kein Entrinnen vom Erinnern.
Und doch vermisste ich die Einsicht, dass diese grausame Teilung nicht ausschließlich auf das Konto der Türken oder der letzten Kolonialherren, der Engländer, ging. Vor fast genau dreißig Jahren, 1954, war der durchgeknallte pensionierte Oberst der griechischen Armee, Georgios Grivas, aus Zypern gebürtig, in einer einsamen Bucht von Akamas gelandet, um einen Guerillakrieg gegen die Briten zu beginnen und den Anschluss der Insel an das Mutterland, an Griechenland, zu erzwingen. Sein starrer Panhellenismus fand einen fantastischen Resonanzboden in der besonderen Verfassung Zyperns, nämlich der tausendjährigen Hegemonie der orthodoxen Kirche. Ihr Bischof war dem Rang nach den Patriarchen von Konstantinopel, Alexandria und Antiochia seit dem 5. Jahrhundert gleichgestellt. Auch unter den Osmanen, ab 1571, war er das unangefochtene Oberhaupt der gesamten griechischen Gemeinschaft auf der Insel. Als 1950 Michael Mouskos, der spätere Erzbischof Makarios III., in allen Kirchen Zyperns ein Plebiszit durchführte, ließ das Ergebnis kaum einen Zweifel an der Stimmung im Volk: 96 Prozent der griechischen Zyprer – das heißt 80 Prozent der Inselbevölkerung – stimmten für die Enosis, für den Anschluss an das Mutterland.
Ich wagte nicht, meinen Freunden zuzurufen, dass dieser vehemente Panhellenismus die türkische Minderheit in die Enge getrieben hatte und viel von der störrischen Haltung erklärte, welche die Inseltürken auch nach der Unabhängigkeit im Jahre 1960 unter ihrem Führer Rauf Denktaş an den Tag legten. Sie waren einfach nervös. Sie fühlten sich am Rande des Belagerungszustandes. Ich wagte auch nicht zu fragen, ob diese Revolte gegen Großbritannien, angeführt von einem Pistolero und einem Prälaten, nicht schon den Keim der späteren Vergiftung in sich trug.
Jetzt fluchte man in der kleinen Runde einmal mehr über die britische Kolonialherrschaft. Da hatte sie recht. Es war die britische Regierung gewesen, die Ankara überhaupt erst animiert hatte, auf Zypern die türkische Karte zu spielen, und als sich die Junta in Athen etablierte, den Killer Nikos Sampson im Juli 1974 an die Stelle des flüchtigen Erzbischofs Makarios setzte und Bülent Ecevit, der damalige türkische Ministerpräsident, in London Premierminister Harold Wilson und Außenminister James Callaghan aufforderte, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, weigerte sich London, auch nur einen Finger zu rühren. Am nächsten Tag bereitete die Türkei die Landung auf Zypern vor. Die türkischen Streitkräfte eroberten einen Brückenkopf bei Kyrenia und setzten landeinwärts Fallschirmspringer ab. Es gab einen Waffenstillstand von einigen Wochen. Die Türkei machte klar, dass sie sich an frühere Verträge nicht mehr gebunden fühlte und die sofortige Teilung der Insel wollte.
»Wenigstens dann«, rief Lanitis, »hätte London doch etwas tun müssen! Es hatte Militärbasen auf der Insel, es hatte starke Luftstreitkräfte. Aber es tat nichts! Warum?« Er fixierte mich, das Rotweinglas wild in der Hand schwenkend, als sei ich Mr. Wilson höchstpersönlich.
»Ich weiß es nicht, George«, sagte ich, »im Zweifel war London immer für die Türkei und gegen Athen. Und vielleicht waren die Briten des schnell wieder eingesetzten Makarios’ müde, der für sie nicht viel besser war als ein Fidel Castro im Talar.«
»Ich verstehe es einfach nicht«, sagte Lanitis, plötzlich bekümmert. »Makarios hatte Charisma. Er war subtil. Er hatte Würde.«