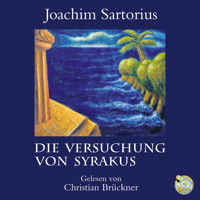Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Meine Insel
- Sprache: Deutsch
Istanbul vorgelagert, entlang der asiatischen Küste des Marmarameers befinden sich die Prinzeninseln: ein Archipel von ungewöhnlicher Schönheit und natürlicher Pracht, der seit jeher als maritimer Vorort der imperialen Metropole am Bosporus galt und geprägt ist durch eine äußerst wechselvolle Geschichte. Mit dem verliebten Blick des Dichters schildert Joachim Sartorius die Landschaft und das besondere Licht der Inseln, mit dem Interesse des politischen Beobachters stellt er das Auf und Ab der Geschichte dieses Mikrokosmos im Schatten von Istanbul-Konstantinopel-Byzanz dar, und mit dem Gespür des Romanautors schließlich gibt er eindringliche Porträts jener Personen, die durch den Reisebericht die roten Fäden legen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Sartorius
Die Prinzeninseln
© 2009 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Simone Hoschack, Petra Koßmann, mareverlagAbbildung The Pepin Press – Agile Rabbit EditionsKarte Peter Palm, Berlin
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, HamburgDatenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-369-9ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-116-9
www.mare.de
»Gibt es eine Reise, die nicht ein Geheimnis birgt, oder einen einzigen Reisenden, der nicht gelogen hat? … Die Reise ist eine anthropologische Struktur des Imaginären.«
Jean-Didier Urbain,Secrets de voyages, 1998
»Neapel hat Capri und Ischia; Konstantinopel hat die Prinzeninseln. Der Neapolitaner kann nicht stolzer auf die strahlenden Eilande sein, die den Schmuck seines Golfes bilden, als der Grieche aus Pera stolz ist auf diese zauberhaften Stätten geruhsamen Sich-Ergehens, deren feenhafte Silhouette am Eingang des Marmarameeres dem Wasser entsteigt. Und wie Capri nicht nur berühmt wurde durch den Reichtum seiner Natur, sondern auch durch die Untaten des Tiberius, so haben die unheilschwangeren Geschichten der Kaiser und Kaiserinnen und all der aus höchsten Ämtern Verbannten, die in den Klöstern von Proti, Antigoni und Prinkipo eingekerkert wurden, diese strahlenden Inseln zu Orten leidumwitterten Scheiterns werden lassen, wie die Alte Welt nur wenige kennt.«
Gustave Schlumberger,Les Îles des Princes, 1884
Für Karin
Inhalt
I. »Stambul mit allen seinen Seevorstädten und Seestraßen«
II. Gelage im Prinkipo
III. Der Balkon der Welt
IV. Die Villa des John Paşa
V. Der heilige Georg und der Rakı
VI. Zimmer mit Fährschiffen
VII. Sait Faiks Insel
VIII. Kristalllüster im Holzkarren
IX. Die Spitze und die Flache
X. Kamariotissa
Danksagung
Literaturverzeichnis
»Stambul mit allen seinen Seevorstädten und Seestraßen«
Selçuk war ein Penner. Ich lernte ihn auf der Galata-Brücke kennen, in einer Teestube im unteren Brückengeschoss. Er verbrachte dort die Sommer und schnorrte Touristen an. Im Winter war er Wächter einer Villa auf Büyük Ada, der größten der Prinzeninseln im Marmarameer, acht Seemeilen vor İstanbul gelegen.
Genervt von der Hitze, dem Verkehr und meiner überlauten Freundin Sezer, hatte ich mich in diese Teestube zurückgezogen, in ihre dunkelste Ecke, und einen şekersiz çay – einen Tee ohne Zucker – bestellt. Er saß auf einem Karton am Eingang und fiel mir sofort auf. Wie konnte man abgerissen und elegant zugleich aussehen? Selçuk schaffte das. Er war groß, hager, um die fünfzig, dachte ich, als er auf mich zukam und mich fragte – es war nicht unangenehm wie sonst in solchen Situationen –, ob er von Diensten sein könne. Er gehörte zur Kaste der gebildeten Penner. Er sprach leidlich Englisch und war der Erste, der mich auf die Dichter Orhan Veli Kanık und Oktay Rıfat hinwies, wofür ich ihm noch heute dankbar bin. Ich bestellte ihm einen Tee und, das wünschte er sich, lokum, jene in gesiebtem Puderzucker gewälzten Gelatinewürfel, die nach müdem Haarwasser schmecken. Wir plauderten. Eigentlich mag ich die untere Etage der Galata-Brücke nicht. Der Blick ist verengt. Es fehlen der über Topkapı unendlich hoch wirkende Himmel, das Wasser, der Zusammenfluss von Bosporus, Goldenem Horn und Marmarameer, all die glitzernden Wasserstraßen, welche meinen Kopf stets heiß und weit machen.
Ich fragte Selçuk über Büyük Ada aus. Ada ist das türkische Wort für Insel, büyük heißt groß. Die Türken sagen meist nur adalar, die Inseln, und meinen damit den ganzen Archipel, den man mit der Fähre in einer knappen Stunde von Kabataş, der Anlegestelle neben dem Dolmabahçe-Palast, erreichen kann. Büyük Ada, die von den Griechen immer noch Prinkipo genannt wird, ist die größte Insel.
Das Fährschiff hält aber, von İstanbul kommend, zunächst auf Kınalı Ada (griechisch: Proti), dann auf Burgaz Ada (Antigoni) und Heybeli Ada (Halki), bevor es die Hauptinsel erreicht und von dort wieder umdreht und Kurs auf die Metropole nimmt. Die weiteren Inseln sind zu klein, zu unbedeutend, überhaupt nicht oder so spärlich bewohnt, dass sie von größeren Schiffen nicht angefahren werden.
Ich kannte nur die Hauptinsel von einigen flüchtigen Besuchen, die aber schon weit zurücklagen. Mein erster Besuch muss fast zwanzig Jahre her sein. Ich hatte in Ankara, wo ich damals arbeitete, den altmodischen Nachtzug, der einmal Teil der geplanten Bagdad-Bahn gewesen war, nach İstanbul genommen. In den Schlafabteilen gab es damals immer noch Messingbehälter mit geschliffenen Wasserkaraffen aus den Zwanzigerjahren. Sie wackelten entsetzlich, wie die Liegen und ich, der auf einer lag. Die Schienen, von den Krupp-Werken bereits in Kaiserzeiten geliefert, taten immer noch ihren Dienst. Am Bahnhof Haydarpaşa nahm mich Sezer um sieben Uhr früh in Empfang. Sie trug eine hellblaue Baskenmütze und sah wie eine merkwürdige, weil füllige Fallschirmspringerin aus.
»Na, durchgeschüttelt?«, sagte sie. »Vergiss İstanbul. Zu heiß, zu laut. Wir nehmen jetzt die erste Fähre und fahren nach Büyük Ada.«
Auf dem Schiff erzählte sie mir, dass sie als Kind geglaubt hatte, ein Zug verändere den Reisenden. Sie habe noch heute diesen Aberglauben. Was, wenn nicht ich, sondern ein Tapir, nicht der Freund, sondern eine Ladung kalten Wassers aus der Zugtür gesprungen wäre? Wir lachten.
Nach der Ankunft nahmen wir eine Pferdedroschke, denn es gibt keine Autos auf der Insel, und fuhren einmal ganz um sie herum. Als die Ortschaft hinter uns lag, auch die Villen und einige hochherrschaftliche Anwesen, ging es grüne Pinienwälder hinauf, die einen harzigen Geruch verströmten. Daran erinnere ich mich jetzt vor allem, an diesen Geruch, und dann später, wieder im Tal, an die Zypressen, Pinien, Platanen, ihre tiefen Schatten und an einen weiteren Geruch, den warmen Körpergeruch der sonnenerhitzten Gärten, der in unsere Droschke strömte. Das erzählte ich Selçuk. Er sagte, die Inseln seien so etwas wie ein Vorort von İstanbul, aber doch ganz, ganz anders. Die Landschaft, die ich ja gerade beschrieben hätte, sei anders. Die Menschen seien anders. Das Leben anders. Aber nicht im Sommer, wenn Horden von İstanbullular kämen und die Ordnung der Insel auf den Kopf stellten.
Wir verließen die Teestube und gingen die Treppe hoch auf die Brücke. Was für ein jäher Glanz. Überall auf dem funkelnden Wasser Fähren und Lotsenschiffe und Kutter und gewaltige rot angestrichene Containerfrachter, die sich aus dem Bosporus in das gleißende Marmarameer schoben. Am Brückengeländer Angler an Angler, so dicht, dass ihre Schnüre in der Sonne wie die Saiten eines riesigen Instruments glitzerten. Selçuk sagte, er würde mir gerne die Villa zeigen, die er im Winter hüte, den konak von John Paşa, und was er sonst noch auf der Insel kenne. Es war Ende September. Mitte Oktober begann sein Job als Winterwächter. Er zeichnete eine kleine Skizze in mein Notizheft. Von der Anlegestelle aus sich immer rechts halten, an den Cafés und Hotels vorbei, dann in die Çankaya Caddesi einbiegen, »die schönste Straße der Welt«. Auf ihr immer weitergehen bis zur Nr. 78, das sei die Villa, die er bewache. Wir verabredeten uns. Ein Tag Ende Oktober, ich müsse nur laut genug an das große eiserne Gartentor klopfen.
Noch am selben Abend, in der Wohnung, die ich in Beyoğlu in der Nähe des Galata-Turms gemietet hatte, beschloss ich, nach Büyük Ada umzuziehen. Ich stellte mir das Marmarameer als Karte vor mit den blassblauen Linien der Schifffahrt, mit kurzen und langen Pfeilen, mit Delfinen und Kompassrosen. Wer war hier nicht alles unterwegs gewesen, Griechen, Barbaren, neue Römer, Seldschuken, Türken, Armenier, Engländer, Deutsche, Russen und Weißrussen. Immer noch tickte die byzantinische Zeit, das Osmanische Reich, sein unaufhörlicher Niedergang, dann die Unruhen des Ersten Weltkrieges, es gab jede Menge Vertriebene, Exilanten, ein Gewimmel von Pfeilen und Verweisen, die ich mir nicht erklären konnte. Ich beschloss, in dieses Gewimmel Ordnung zu bringen. Ich trank Rakı, und mein Beschluss festigte sich. Nach einem weiteren Glas fand ich es schön, nichts zu wissen. Genauer: Ich meinte, es sei schön, so wenig über die Geschichte der Inseln zu wissen. Nur ein paar Splitter. Dass sie weit mehr als ein Jahrtausend lang von Mönchen bewohnt und von Klöstern überzogen waren. Dass sie, besonders in der byzantinischen Zeit, Orte der Verbannung waren. Unliebsame Prinzen und Prinzessinnen, in Ungnade gefallene Mitglieder der kaiserlichen Familie, Berater und Minister wurden aus Byzanz entfernt und oft bis zum Ende ihres Lebens in Mönchszellen gesteckt, wenn ihnen nicht noch Schlimmeres geschah. Die Blendung der Augen war die beliebteste Strafe. Nach der türkischen Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453 trat eine Beruhigung ein. Die griechischen und – später – die armenischen Familien, die die Inseln bewohnten, blieben unter osmanischer Herrschaft weitgehend unbehelligt. In der Spätzeit des Osmanischen Reiches entdeckten dann die reichen Staatsbeamten, Wesire und Botschafter an der Hohen Pforte die Inseln als idealen Rückzugsort während des Sommers. Die wohlhabenden Familien bauten an den Uferstraßen ihre Sommerresidenzen. Es entstanden Hotels, Kasinos und Parks. Die nobelsten Restaurants und Cafés in Pera gründeten Ableger auf Prinkipo und verbreiteten ein levantinisches Flair, bis dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Kosmopolitismus verschwand und nicht nur İstanbul, sondern auch die Inseln »türkifiziert« wurden.
Viel mehr wusste ich nicht. Ich hatte die Landschaft der Inselwelt vor Augen, die seit zweitausend Jahren bewohnt und kultiviert wird. Aber Langlebigkeit, lange Lebensdauer, heißt nicht Kontinuität. Ich sagte mir, an diesem Abend in meiner kleinen Mietkammer in İstanbul, vor meinem vierten Glas Rakı, dass auch die Inseln sicherlich an Gedächtnisstörungen litten, jenen Identitätsproblemen also, die exemplarisch sind für eine imperiale Stadt. Denn diese Metropole hatte unter ihren wechselnden Namen – Byzanz, Konstantinopel, İstanbul – stets auf die Inseln abgefärbt. Die großen Krisen der Kaiserstadt, der Sultansstadt waren auch kleine Krisen der Inseln. Aber wenn man, sagte ich mir, so voll von Erinnerungen ist, dann wird man auch vergesslich. Morgen würde ich in einer Buchhandlung in der İstiklal Caddesi, der Hauptverkehrsader im alten Europäerviertel, nach einer Karte von den Prinzeninseln fahnden, vielleicht gab es auch das eine oder andere Buch. Nach und nach würde ich alle diese Informationen, diese Splitter und Scherben, zusammenfügen, und meine Freunde würden mir dabei helfen. Morgen würde ich als Ersten Ferit anrufen, meinen ältesten türkischen Freund. Er hatte vor ein paar Jahren ein Haus auf Büyük Ada gekauft, er würde mir ein paar Ratschläge geben können. Der Rakı tat gut. Ich schlief ein.
Am nächsten Mittag, bevor die Fähre ging, traf ich Ferit.
Ferit ist Türke, eigentlich Osmane und recht eigentlich Chinese. Er verströmt Gelassenheit, und er weiß Bescheid. Als junger Mann, als seine Augen, leicht schräg, noch nicht unter geschwollenen Lidern lagen, hatte er in Paris Malerei studiert. Er kannte dort die Maler Fikret Moualla, Abidin Dino und Arslan, er verehrte Henri Michaux. In der Türkei hortete er die beste Sammlung von Karalamalar. Niemand wusste, was das war, als er diese Blätter aufstöberte und kaufte, Übungen von Meisterkalligrafen, die – um ihre Finger beweglich zu halten – einen einzigen Buchstaben hundert Mal auf ein Blatt schrieben, dicht an dicht. Ein gutes Karalama sieht wie ein früher Pollock oder ein Mark Tobey in Höchstform aus. Ferit hatte sein Geld mit Kunsthandel gemacht, mit dem Verkauf von Gemälden, von alten Kacheln aus İznik, seldschukischen Gefäßen von tiefstem, unglaubwürdigem Blau. Aber ein Karalama hat er nie verkauft. Er hat Romane geschrieben, erfolgreiche, und eine Werbeagentur gegründet. Auch damit hat er gut verdient, genug, um sich ein stattliches Haus auf Büyük Ada zu kaufen, das von einem armenischen Architekten um 1882 erbaut worden war. Fast jeder köşk und konak auf den Inseln ist aus Holz. Diese Villa, der Meziki Köşkü, war, eine Seltenheit, aus solidem Sandstein. Das erwies sich später, bei Erdbeben zumal, als nützlich. Wir trafen uns im Refik, seinem Lieblingslokal, in einer Gasse, die von der İstiklal Caddesi zum Pera Palas führt, einem alten Hotel, dessen Pracht Agatha Christie und Kemal Atatürk gleichermaßen liebten und die für die Passagiere des Orientexpress erdacht worden war.
Ferit begrüßte mich herzlich. Er hatte für mich immer etwas vom altmodischen türkischen Stil an sich, eine ottomanische Formvollendung, eine Art kontemplative und schwelgerische Trägheit.
»Es ist die Zeit der lüfer«, sagte er, »der Blaubarsche, die im September in großen Schwärmen vom Schwarzen Meer durch den Bosporus in unsere Netze gehen.«
Er bestellte ein opulentes Mahl. Ich fragte ihn nach den Inseln aus. Wie der Hauskauf war.
Warum er, wenn er schon ein Haus am Bosporus hatte, auf der asiatischen Seite, ein weiteres Haus auf der Insel kaufen musste.
»Ein alter Traum«, meinte er, »vielleicht wollte ich es dem Schriftsteller Sait Faik gleichtun, der zwischen Beyoğlu und Burgaz Ada, einer Nachbarinsel von Büyük Ada, hin- und herpendelte und schließlich das einfache Leben vorzog, mit den kleinen Händlern und Fischern Tee trank und aus tausend Inselbeobachtungen seine Erzählungen fügte. Vielleicht war mir das asiatische Ufer am Bosporus auch zu hektisch geworden. Ich wollte weniger arbeiten, mehr auf das Meer starren, mehr kochen und trinken und schreiben.«
Seine Frau habe dann Büyük Ada durchstreift und sei mit einer alten Frau, die vor einem schönen vierstöckigen Steinhaus saß, ins Gespräch gekommen. Eher zufällig. Die Frau war stolz gewesen auf dieses Haus und zeigte es der Fremden, mit Ausnahme des dritten Stocks. Man traf sich wieder. Eines Tages sagte die Frau, sie wolle das Haus verkaufen. Auch ihre Töchter, die in Frankreich lebten, seien einverstanden.
»Als ich mir das Haus anschaute, war ich auf Anhieb begeistert. Die Decken, auch die Wände waren mit raffinierten Fresken übermalt, in immer noch frischen Farben, die Bäder waren aus grauem Marmor, es gab eine kühn geschwungene Treppe. Alles noch von 1882.«
Die Kaufverhandlungen zogen sich hin, am schlimmsten sei die türkische Bürokratie gewesen, die vielen Behördengänge.
»Die Osmanen«, sagte Ferit, »konnten ja nur zwei Dinge, Krieg führen und akribisch verwalten. Aber schließlich hatten wir das Haus.«
»Und was war mit dem dritten Stock?«, fragte ich.
»Es war ein Museum. Die Zeit war vor vierzig Jahren angehalten worden. Die Möbel, die Stoffe, die Vorhänge in allen Zimmern von Staub bedeckt. Auch vom Dreck der Möwen, die durch ein zerbrochenes Fenster hereingekommen waren. In den Schränken gab es die raffinierteste Seidenwäsche aus den Dreißigerjahren, auch ein Ballkleid, das meine Tochter heute noch bei besonderen Anlässen trägt. Erst später haben wir die Geschichte dazu erfahren. Der Vater der Besitzerin, die uns diesen konak verkaufte, hatte eine sehr junge Frau geheiratet, siebzehn Jahre alt. Sie wurde schwanger. Bei der Geburt hatte der Inselarzt befunden, dass die Situation sehr kompliziert sei und nur einer der beiden, die Frau oder das Kind, überleben könne. Der Vater habe sich dann für das Kind entschieden. Die Frau sei gestorben. Es sei ihr Stockwerk gewesen, er habe es versiegelt. Ein Mausoleum, das wir nun öffnen und ausmisten mussten. Es gibt unglückliche Häuser«, sagte Ferit, »das Leben dieses Hauses war ein unglückliches. Ich konnte mich da nie wirklich wohlfühlen, trotz all der Vorfreude, trotz der Pracht des Hauses. Vier Jahre haben wir dort gewohnt. Amelie, meine Frau, hat den Garten bestellt, drei Terrassen angelegt. Am Schluss verpflegte sie fast dreißig Katzen, die sie alle von einem Tierarzt sterilisieren ließ.«
Ferit machte eine Handbewegung, als sei das Frauenblödsinn. Jetzt stehe das Haus wieder zum Verkauf. Aber er habe Sehnsucht nach der Insel, nach dem Blick vom Balkon auf die Jakarandabäume, die Möwen und das Meer.