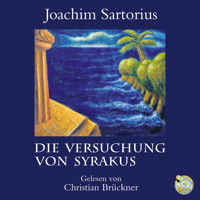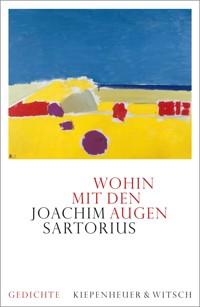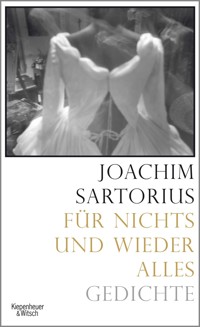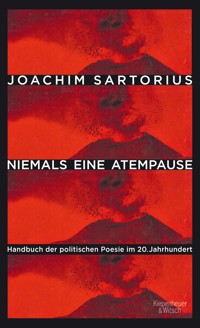
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eine Weltkarte der Katastrophen und Aufbrüche des 20. Jahrhunderts – und der Antworten, die die Lyriker darauf gaben Dies ist ein von Lyrikern verfasstes Geschichtsbuch des 20. Jahrhunderts. Vergesst nicht den Ersten Weltkrieg, sagen sie uns, die Revolutionen, die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, das Elend von Flucht und Vertreibung, die Befreiungskämpfe in den Kolonien, die kubanische Revolution – das sagen sie uns in ihrer eigenen unverwechselbaren Sprache.Mit seinem »Handbuch der politischen Poesie« entwirft Joachim Sartorius eine Weltkarte der Katastrophen und Aufbrüche, die das vergangene Jahrhundert prägten – vom armenischen Genozid bis zum Vietnamkrieg, von der Belagerung Sarajewos bis zur grünen Utopie. Er präsentiert über 100 Lyriker und Lyrikerinnen aus 50 Ländern. Seine Auswahl ist subjektiv und doch vorherbestimmt von den großen Zäsuren der Geschichte.Gerade in dem von extremen Ideologien heimgesuchten 20. Jahrhundert war das Verhältnis von Politik und Poesie besonders prekär. Es gab Dichter, die Mitläufer waren oder Partei für das Schlimmste ergriffen. In einer »Schreckenskammer« am Ende des Buches versammelt der Herausgeber Gedichte von Despoten und schlechte politische Gedichte. Die Dichter aber, um die es ihm geht, sind unbestechlich und können, besser als andere, die Umbrüche der Geschichte nachzeichnen. Ihre Gedichte stehen im denkbar größten Gegensatz zur Macht.Als Herausgeber führt Joachim Sartorius mit einem ausführlichen Vorwort in diese Sammlung ein und stellt jedem einem politischen Ereignis gewidmeten Kapitel einen Text voran.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
TitelMottoVorwort1. DER ARMENISCHE GENOZID (1909 – 1918)2. ERSTER WELTKRIEG (1914 – 1918)3. RUSSISCHE REVOLUTION 1917 UND NOVEMBERREVOLUTION IN DEUTSCHLAND 19184. LOB DES KOMMUNISMUS5. DAS JAHR 19336. DER SPANISCHE BÜRGERKRIEG (1936 – 1939)7. HITLER UND STALIN8. ZWEITER WELTKRIEG (1939 – 1945)9. FLUCHT, EMIGRATION UND EXIL10. DIE TODESLAGER11. DIE STUNDE NULL UND REPRESSION IN MITTEL- UND OSTEUROPA12. UNTERDRÜCKUNG IN AFRIKA UND KAMPF GEGEN DIE APARTHEID13. DIE KUBANISCHE REVOLUTION 1959 UND BEFREIUNGSBEWEGUNGEN IN LATEINAMERIKA14. KRIEG IN KOREA, KAMBODSCHA UND VIETNAM15. KULTURREVOLUTION UND MASSAKER IN CHINA (1965 – 1989)16. ENDE DES KALTEN KRIEGES UND VEREINIGUNG DEUTSCHLANDS 198917. KRIEGE IM NAHEN OSTEN18. BOSNIENKRIEG UND BELAGERUNG SARAJEVOS (1992 – 1995)19. DIE GRÜNE UTOPIEEPILOGANHANGDie SchreckenskammerDANKSAGUNGURHEBERRECHTS- UND QUELLENHINWEISEBuchAutorImpressumUnd die Geschichte ist auch nicht
der zerstörerische Bulldozer wie behauptet wird.
Sie hinterlässt Unterführungen, Grüfte, Löcher
und Verstecke. Manche überleben.
Die Geschichte ist auch wohlwollend: Sie zerstört
so viel sie kann: Würde sie des Guten zu viel tun,
wäre es sicher noch besser, doch die Geschichte geizt
mit Nachrichten, sie stillt nicht alle ihre Rachegelüste.
Die Geschichte schabt den Grund ab
wie ein Schleppnetz
ruckweise und mehr als ein Fisch entwischt.
Manchmal begegnet man dem Ektoplasma
eines Entkommenen, der nicht besonders glücklich wirkt.
Er weiß nicht, dass er draußen ist, niemand hat es ihm gesagt.
Die anderen, im Sack, halten sich
für freier als er.
Eugenio Montale, Die Geschichte, II.
Aus dem Italienischen von
Vorwort
I. Die Maschinenpistole auf der Partitur
Es gab eine Zeit im letzten Jahrhundert – die späten 1950er- und 1960er- Jahre –, als die politische und die ästhetische Avantgarde die gleichen Anliegen hatten. Überall gab es revolutionären Überschwang, der vor allem nach links ausschlug. Susan Sontag spricht in ihrem frühen Tagebuch vom »utopischen Zauber des Kommunismus«, von dem sie erst durch die enge Freundschaft mit dem exilierten russischen Dichter Joseph Brodsky wieder abkommt. Hans Magnus Enzensberger geht nach Kuba. Auf seine Vermittlung erhält Hans Werner Henze eine Einladung des kubanischen Nationalrats. Er folgt ihr und verbringt einen heißen Winter auf der karibischen Insel. Nie fand die Begeisterung für die exotische Revolution einen schöneren Ausdruck als in dieser Notiz in Henzes Tagebuch: »In meiner Garderobe sitzt ein junger Soldat und telefoniert ausführlich mit seinem Mädchen, hat die Maschinenpistole auf meine Partitur gelegt. Ich hoffe auf einen Ölfleck.« Der Ölfleck auf dem Notenpapier – das wäre das Zeichen gewesen, dass endlich auch auf der Kunst revolutionärer Segen ruht. Aber Fidel Castro lässt den Dichter Herberto Padilla einsperren und beschimpft die westlichen Intellektuellen, allesamt Sympathisanten der kubanischen Revolution, als »CIA-Agenten«. Eines von vielen Beispielen, dass Kunst und Macht nicht zusammenfinden und es besser sein mag, für beide, wenn sie getrennte Wege gehen.
II. Poesie und Macht
Zu allen Zeiten gab es politische Schriftsteller, gab es engagierte Literatur. Aber im 20. Jahrhundert sind die Autoren, die sich der einen oder anderen Ideologie verschrieben haben, Legion: Arthur Koestler, Ernst Jünger, André Malraux, Jean-Paul Sartre, um nur einige wenige zu nennen. Es scheint im Rückblick, gerade dieses Jahrhundert war so beschaffen, dass die Intellektuellen, die Künstler, die Schriftsteller Partei ergreifen mussten. Und die Dichter? Sie bewegen sich in einem besonderen Spannungsfeld. Per definitionem ist der Dichter ein Einsamer, auf dem Rückzug, in Betrachtung versunken. Wenn er die Probleme der Epoche nicht aufgreift, scheint sein Werk ohne Nutzen, wie disqualifiziert. Auf der anderen Seite ist die Poesie, die Solidarität übt und sich dem Kollektiven verschreibt, oft hohl, dem Zeitgeist verpflichtet, ohne Dauer. Gleichwohl gibt es einen beachtlichen Corpus von Gedichten, die »politisch« sind, also die großen Kämpfe und Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts widerspiegeln und zugleich gute Gedichte sind.
Es lassen sich an solchen Gedichten die Katastrophen, die Verwerfungen, aber auch die Aufbrüche des letzten Säkulums nachzeichnen. Es geht mir letztlich um Texte, die politische Geschichte schreiben bzw. reflektieren, aber in der ganz eigenen unverwechselbaren Manier des Gedichts. Auf diese Weise soll eine andere, ungewöhnliche Spielart des Geschichtsbuchs entstehen. Im angelsächsischen Sprachraum gibt es solche Anthologien, am bekanntesten The Faber Book of Political Verse, herausgegeben von Tom Paulin, London 1986, und Against Forgetting, herausgegeben von Carolyn Forché, New York 1993.
In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von literaturwissenschaftlichen Aufsätzen und Doktorarbeiten zur politischen Poesie, bisher – meiner Kenntnis nach – aber keine einzige Gedicht-Anthologie, die das 20. Jahrhundert in den Blick bekommen will.
Geschichte wird von den Siegern umgeschrieben. Nicht nur haben sie den Kampf gewonnen, sie entscheiden auch den Kampf der Erinnerung für sich. Dichter sind keine Sieger. Sie schreiben nicht um. Vielleicht ist auf der Welt das Gedicht die eine »Ware«, die am wenigsten mit Macht zu tun hat. Oder, wie es Ijoma Mangold sagte, als Die Zeit Gedichte zu aktuellen politischen Themen veröffentlichte: »Der denkbar größte Gegensatz zur Macht ist das Gedicht. Im besten Fall ist Lyrik die ohnmächtige Wahrheit, um die sich die Politik drückt.«
III. Definitionen
Es gibt politische Gedichte ohne Zahl. Es ist ein Meer. Hängt man der These an, dass jedes Gedicht, auch das bukolische, gesellschaftliche Relevanz hat – quasi ex negativo –, so hat man es mit einem Ozean »politischer« Gedichte zu tun. Bei der Zusammenstellung dieser Anthologie und ihrer Engführung waren daher zwei Definitionen von zentraler Bedeutung: Was ist ein politisches Gedicht? Und wann ist ein politisches Gedicht ein gutes, ein gelungenes Gedicht?
Für mich heißt ein Gedicht dann ein politisches Gedicht, wenn es ein politisches Thema hat, also der Anlass, das Gedicht zu schreiben, ein politischer gewesen ist, oder wenn der Autor mit dem Gedicht eine politische Absicht verfolgen und es in einen politischen Kontext stellen will. Ein politisches Gedicht soll also Nachrichten über politische Realität enthalten. Fast immer überschneiden sich Ethik und Ästhetik in einem politischen Gedicht. Die Moderne – allen voran Baudelaire und Mallarmé – hatte einer autonomen L’art-pour-l’art-Ästhetik das Wort geredet. Im 20. Jahrhundert wurde aber »angesichts des Schreckens, der sich darin abspielte, bald deutlich«, so Matthias Göritz, »dass diese Haltung so nicht mehr einzunehmen ist. Wörter sind nicht unschuldig, gerade die Dichter wissen das.« So wurde eine Richtung immer stärker, die sich sowohl vom hermetischen Text wie vom lyrischen Subjektivismus abgrenzte und versuchte, Fakten sprechen zu lassen, also zu erzählen und zu argumentieren, ohne den dem Gedicht spezifischen Empfindungsgeist und seine Erregungskunst hinter sich zu lassen. In diesem Rahmen gibt es Gedichte mit guter Botschaft und von zweifelhafter Machart, und es gibt gute Gedichte mit zweifelhafter Botschaft. Das Urteil, ob es sich um ein Kunstwerk handelt, muss ästhetisch gefällt werden und ist letztlich ganz subjektiv. Ich habe versucht, Gedichte aufzunehmen, die sich politische Themen vornehmen, keine einfache Moral haben und imstande sind, Komplexität des Nachdenkens und der Gefühle zu erzeugen.
IV. Struktur
Ein Handbuch ist »eine geordnete Zusammenstellung eines Ausschnitts des menschlichen Wissens«. Das Wissensgebiet, das dieses Handbuch durchquert, ist das politische Gedicht im 20. Jahrhundert. Viele Handbücher sind alphabetisch nach Stichwörtern geordnet – man könnte also mit »Afrika, Unabhängigkeitsbewegungen« und »Apartheid, Kampf gegen« beginnen und mit dem »Vietnamkrieg« enden. Ich habe mich hiergegen und für eine chronologische Gliederung entschieden, da sie mir eine leichtere Orientierung zu erlauben scheint.
Die Ausrichtung des Handbuchs ist international, von einem europäischen Standpunkt aus. Von einer Dichterin in Singapur oder einem Lyriker in Buenos Aires zusammengestellt, sähe dieses Handbuch anders aus. Es konnte nicht auf alle wichtigen politischen Ereignisse – zum Beispiel die indischpakistanischen Kriege oder den Kampf um die Bürgerrechte in den USA – eingegangen werden. Der vorgegebene Umfang des Buches erlaubte dies nicht. Er schob der dem Thema inhärenten Uferlosigkeit einen Riegel vor und übte zugleich den heilsamen Zwang aus, sich auch innerhalb der einzelnen historischen Abschnitte auf wenige und wesentliche Gedichte zu beschränken.
Nun hat schon Walter Benjamin gesagt: »Verse sind keine Informationen.« Um den ungeheuren Kreis der politischen Poesie auch lebendig auszumessen, bedarf es der Hinweise. Den einzelnen Abschnitten sind daher knappe historische Einführungen vorangestellt, den Gedichten kurze Biographien der Dichter, die wie Fallgeschichten die Umbrüche der Zeit im Brennspiegel eines Lebens wiedergeben. Einige Gedichte, die ich für besonders wichtig halte, wurden zudem mit kurzen exemplarischen Erläuterungen versehen.
V. Leiden duldet kein Vergessen
Jeder, der sich näher mit politischer Poesie des vergangenen Jahrhunderts befasst, muss sich mit zumindest zwei Thesen auseinandersetzen, die zu Angelpunkten der ästhetischen Diskussion in der Nachkriegszeit wurden.
Die eine These formulierte Theodor W. Adorno in seinem 1949 geschriebenen Essay Kulturkritik und Gesellschaft: »Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.«
Dieses Diktum, eingebettet in ein grundlegendes Misstrauen gegenüber den Möglichkeiten der Kultur nach dem Nationalsozialismus, wurde von vielen als ein genereller Bann gegen jegliche Dichtung nach dem Holocaust aufgefasst und daher heftig und kontrovers diskutiert.
Besonders wurde darauf verwiesen, dass es zum Zeitpunkt von Adornos pointiertem Verdikt bereits Gedichte gab – Paul Celans Todesfuge, In den Wohnungen des Todes von Nelly Sachs oder Armer Christ sieht das Ghetto von Czesław Miłosz –, die dessen Verdikt widerlegten. Das in meinen Augen wichtigste Argument in den Debatten war, dass Leiden kein Vergessen duldet und deshalb die Dichtung Adornos Bann standhalten muss. Adorno relativierte später seine frühere Aussage in bemerkenswerter Weise: »Der Begriff einer nach Auschwitz auferstandenen Kultur ist scheinhaft und widersinnig, und dafür hat jedes Gebilde, das überhaupt noch entsteht, den bitteren Preis zu bezahlen. Weil die Welt jedoch den eigenen Untergang überlebt hat, bedarf sie gleichwohl der Kunst als ihrer bewusstlosen Geschichtsschreibung. Die authentischen Künstler sind die, in deren Werk das äußerste Grauen nachzittert.«
Die weitere These, die eine heftige Diskussion entfachte über das, was überhaupt als politische Lyrik zu gelten habe, wurde von Hans Magnus Enzensberger in seinem 1962 geschriebenen Aufsatz Poesie und Politik aufgestellt: »Dass Politik nicht über das Gedicht verfügen kann: das ist sein politischer Gehalt.« Hintergrund dieser Aussage ist: Das politische Gedicht war, wie Enzensberger am Beispiel des Herrscherlobs demonstriert, von seinen Anfängen her affirmativ. Dann, als die Feudalherrschaft ins Wanken geriet, habe sich das Verhältnis von Poesie und Macht total ins Gegenteil verkehrt. Fortan, so Enzensberger, habe die Poesie ausschließlich die Aufgabe der Kritik. Sie sei per se anarchisch. Daher haben »Kampflieder und Marschlieder, Plakatverse und Hymnen, Propaganda-Choräle und versifizierte Manifeste, gleichgültig wem und welcher Sache sie nützen sollen«, nach Enzensberger »mit politischer Lyrik nichts zu tun«. Denkt man dies zu Ende, so sind nicht mehr nur Poesie und Herrschaft, sondern auch Poesie und politische Poesie unvereinbar.
Diese Meinung – dass der Dichtung der politische Aspekt immanent sei und deshalb die besondere Kennzeichnung »politisches Gedicht« überflüssig und irreführend sei – teile ich nicht und verweise auf meine früheren Überlegungen zur Definition des politischen Gedichts.
VI. Von Kegelspielern und dichtenden Despoten
Viele der Gedichte in diesem Handbuch, von Opfern geschrieben, berichten von unsäglichem Leid, von einem Übermaß an Erlittenem. In den Debatten um das Adorno-Diktum klang als Unterströmung stets auch die irritierende Frage an, inwieweit die künstlerische Umsetzung die Gefahr einer ästhetischen Stilisierung bis hin zum »Genuss« berge. Adorno selbst meinte hierzu: »Es wird verklärt, etwas von dem Grauen weggenommen; damit allein schon widerfährt den Opfern Unrecht, während doch vor der Gerechtigkeit keine Kunst standhielte.« Auch wenn wir jetzt außer Acht lassen, dass Poesie oft in sich selbst verliebt ist, so müssen wir zunächst entgegnen, dass Leid und Qual, Folter und Haft ein Recht auf Ausdruck haben. Die meisten Gedichte in dieser Anthologie entgehen, so meine ich, der Gefahr der ästhetischen Verbrämung. Ein großartiges Beispiel hierfür sind die älteren Dichter in Osteuropa, die eine Diktatur nach der anderen erlebt haben und in deren Körper und Seelen sich diese Geschichte der Gewalt und der Vergeblichkeit eingeschrieben hat. Ihre Erfahrungen sind inkommensurabel mit denen der erst nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen. Deshalb haben ihre Gedichte, wenn wir nur einmal die großen Polen nehmen, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz und Zbigniew Herbert, ein Gewicht oder auch eine Tiefe der Verantwortung, die Fragen nach Stilisierung oder gar Sublimierung erst gar nicht aufkommen lassen.
Mitunter macht die Biographie eines Dichters es schwierig, gegenüber seiner literarischen Arbeit eine objektive Einstellung zu finden. Der guatemaltekische Autor Otto René Castillo kämpfte ein kurzes Leben lang für soziale Gerechtigkeit, wurde verwundet, gefangen genommen, gefoltert, verstümmelt und in einer Kaserne bei lebendigem Leib verbrannt. Setzt man sich – zumal im sicheren Europa, weitab von der Bestialität der guatemaltekischen Militärs – nicht ins Unrecht, wenn man bei der Wertung von Gedichten von ihren Produktionsbedingungen absieht? An José Martí, den Schriftsteller und Helden der kubanischen Unabhängigkeit, sei hier erinnert, dessen Verdikt von den engagierten Dichtern seiner Zeit auch für das letzte Jahrhundert gilt: »Manchmal machten sie schlechte Reime, aber nur Pedanten und Schufte warfen ihnen das vor: denn sie wussten gut zu sterben.«
Es waren schließlich Dichter wie Otto René Castillo, die Südafrikaner Dennis Brutus und Breyten Breytenbach, der Vietnamese Pham Dien Duat, die Chinesen Bei Dao oder Gu Cheng, die mich von meinem früheren Plan, am Ende dieses Buches eine »Schreckenskammer« mit den schlechtesten politischen Gedichten des 20. Jahrhunderts – als abschreckendes Beispiel und als Kontrastmittel zu meinem eigentlichen Anliegen – einzurichten, wieder Abstand nehmen ließen. Es gab einen Moment, da schien mir, dass ich – allein durch die schiere Aufnahme von Gedichten von Gabriele d’Annunzio oder von dem abstoßenden Nazi-Dichter Walter Flex – allen in diesem Buch versammelten Dichtern Unrecht antue, sie beleidige. Übrig geblieben ist eine andere Art von »Schreckenskammer«, nämlich eine knappe Sammlung von Gedichten von Despoten – von Mussolini über Stalin bis Karadžić –, weil sie eine Reihe von Einsichten bereithalten: Dass die Gedichte der Dichter oft brisanter sind als die der dichtenden Diktatoren, dass auch die Diktatoren sich mit dem Erbe der Kunstavantgarden zu Beginn des letzten Jahrhunderts auseinandersetzten und dass im Despoten der Dichter mit dem Krieger verschmelzen konnte. So sprach Karadžić oft stolz davon, dass er den Kampf um Sarajevo viele Jahre vor der tatsächlichen Belagerung in seinen Gedichten vorhergesehen hatte. Er war also kein Dichter. Ein Dichter nützt dem Staat so viel wie ein Kegelspieler.
VII. Aus Resten Poesie
Während der Arbeit an dieser Anthologie stieß ich auf einen Brief von Hans Jürgen von der Wense an Herbert Jäger von 1962. Darin heißt es: »Habe immer wieder erfahren, dass ›politisches Verbrechertum‹ stets im ersten eine extreme Überspannung ist von Dummheit, Beschränktheit, Borniertheit, seelischer Unreife, Leermangel an Lebenseinsicht und ideeller Banalität. Inquisition, Eroberung Mexikos, kommunistischer Terror, 1789, Nazimorde – für mich nur die Gasprotuberanzen der Zentralsonne der menschlichen Dummheit. Jeder Idealismus, wenn er zur Tat schreitet, also von der blinden Menge ausgeübt wird, endet in Unmenschlichkeit und Blutrausch.«
Haben die hier versammelten Dichter das von ihnen erlittene »politische Verbrechertum« ähnlich gesehen? Dichter sind selten Analytiker. Wenn das Tierische im Menschen, der Hang zur Zerstörung, alle die Überspanntheiten und Verrücktheiten, die dem intellektuellen Prekariat eigen sind, unter Dummheit subsumiert werden könnten, dann mögen sie Hans Jürgen von der Wense zustimmen. Es geht ihnen jedoch meist nicht so sehr um die Ursache des Bösen oder die Gründe für eine ins Schlechte abgedriftete Utopie, eher um das, was angerichtet wurde und wie man es nennen und durch Benennung ihm womöglich einen Sinn abgewinnen kann.
In seinem Buch Das Zeugnis der Poesie (1984) schrieb Czesław Miłosz, dass der poetische Akt sich je nach Umfang der alltäglichen Wirklichkeit, die vom Bewusstsein des Dichters umfasst wird, verändert. Für Miłosz ist dieser Alltag mit der Zerbrechlichkeit jener Dinge verbunden, die wir Zivilisation oder Kultur nennen: »Sie könnten genauso gut nicht existieren – und so errichtet der Mensch aus den Resten, die er in Ruinen findet, Poesie.« Was hier ein polnischer Dichter, der während der deutschen Besatzung in Warschau überlebte und sich 1951 vom kommunistischen Regime lossagte, als poetisches Rest-Credo formuliert, könnte auch für den südafrikanischen Dichter Breyten Breytenbach gelten, der in siebenjähriger Haft die Brutalität des weißen Regimes aus nächster Nähe erlebte, für den Griechen Jannis Ritsos, der im Widerstand gegen die deutsche Besatzung kämpfte und als Kommunist in Junta-Zeiten in griechischen KZs einsaß, oder den Türken Nazim Hikmet mit einem ganz ähnlichen Schicksal. Ihr Werk besitzt keinen entpolitisierbaren ästhetischen Kern.
Eric Hobsbawn nannte das vergangene Jahrhundert ein »Zeitalter der Extreme«. Die Ereignisse überstürzten sich. Niemals eine Atempause, eine Gedichtzeile von Nelly Sachs aus ihrem Band Glühende Rätsel, schien mir die überstürzte Folge von Ereignissen am besten zu fassen. Dieses Handbuch soll zeigen: Es gibt keine Aneignung der Geschichte durch Gedichte. Aber Gedichte kommentieren die Zeitläufte, sie zeigen Entsetzen, sie klagen an oder sie rufen auf, sie können »eine Schule für Güte, Sühne, Reue und Vergebung sein« (Zbigniew Herbert in seiner Dankesrede für den Preis der Europäischen Poesie, 1997). Vor allem zeigen sie das Vertrauen ihrer Schöpfer, dass die Worte langfristig auf das Bewusstsein wirken und am Ende Wirklichkeit stärker modellieren als Geschichtsbücher oder politische Entscheidungen.
Einst hatten wir die Welt
Die Geschichte hat uns keine Siegerfanfare geschmettert: Sie hat uns schmutzigen Sand in die Augen gestreut. Weite und blinde Straßen lagen vor uns, bitteres Brot, vergiftete Brunnen.
Unsere Kriegsbeute ist das Wissen von dieser Welt: – Sie ist so groß, dass zwei im Händedruck sie fassen können, so schwer, dass sie mit einem Lächeln sich beschreiben lässt,
1. DER ARMENISCHE GENOZID (1909–1918)
In der Endphase des Osmanischen Reiches hatte die neue Führung der »Jungtürken« eine pantürkische Ideologie und die Vorstellung von einem ethnisch definierten Großreich entwickelt. Die Spannungen zwischen der moslemischen Mehrheit und den christlichen Minderheiten nahmen nach dem Tod von Sultan Abdulhamid II. (1909) erheblich zu. Die der türkischen Armee unter Enver Pascha durch russische Truppen zugefügte Niederlage bei Kars im Winter 1914/15 wurde zum Katalysator der armenischen Tragödie. Man suchte nach Sündenböcken und fand sie in den Armeniern, die als Schuldige und Kollaborateure gebrandmarkt wurden. Mit vorbereiteten Massenverhaftungen in Konstantinopel begann am 24. April 1915 die große Mordkampagne. An jenem Tag ordnete der jungtürkische Innenminister Mehmet Talat Pascha an, Armenier festzunehmen und zu deportieren. Im Mai 1915 folgte die Anordnung, ganze armenische Gemeinden in die syrische Wüste zu deportieren. Sie wurden entweder umgebracht oder starben unterwegs an Erschöpfung, Hunger oder den in den Lagern grassierenden Epidemien. Im Laufe von zwei Jahren fanden etwa eine Million Menschen den Tod.
In den Massakern an den Armeniern und der Vernichtung der ältesten Zivilisation in diesem Teil der Welt zeigten sich bereits alle Formen des militanten Nationalismus – politischer Massenmord, ethnische Säuberung und Genozid –, welche das Jahrhundert prägen sollten. Europäische und amerikanische Zeitungen hatten schon sehr früh über die Massaker berichtet, zwischen 1915 und 1918 wurden 100 Millionen US-Dollar Hilfe für die Armenier allein in den USA
KOMITAS VARDAPET, geb. 8. Oktober 1869 in Kütahya, Osmanisches Reich, gest. 22. Oktober 1935 in Paris. Zum Priester ausgebildet, studierte er in Tiflis und Berlin, wo er an der Humboldt-Universität 1899 in Musikwissenschaften promovierte. Am 24. April 1915 wurde er in Konstantinopel verhaftet und mit Hunderten von armenischen Intellektuellen nach Ostanatolien deportiert. Vermutlich auf Intervention des US-amerikanischen Botschafters ordnete der türkische Innenminister die Rückkehr des inzwischen berühmten Komponisten an. Aber Komitas konnte das Erlebte, die Verwüstung seiner Wohnung und die Zerstörung seiner Sammlung von fast 3000 armenischen Volksliedern nicht verwinden. Er verbrachte den Rest seines Lebens isoliert in Kliniken, zuletzt in der psychiatrischen Anstalt von Villejuif bei Paris. Nach seinem Tod wurden seine sterblichen Überreste nach Jerewan gebracht und dort im Pantheon bestattet. Er gilt heute allgemein als Begründer der modernen klassischen Musik Armeniens. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen Tsirani Tsar (Aprikosenbaum) und Antuni (Ohne Obdach), die Komitas vertont hat. Die Texte sind älter, wurden aber von Komitas neu geschrieben und von den Hörern auf 1915 bezogen.
Aprikosenbaum
Aprikosenbaum, trage keine Früchte, Waj! Reibe deine Äste nicht aneinander, Waj! In deinem Schatten wandere ich immer, rühre nicht an meinen Kummer. In deinem Schatten wandere ich immer, rühre nicht an meinen Kummer. Ja, gebt, gebt zurück! In den Bergen ist kühler Wind aufgekommen. Meines Herzens Freude ist ins Meer gefallen. Geh!, du Schreckensjahr und komme nie wieder. Schwarze Trauer hat sich um meinen Hals gelegt. Kühler, kühler, kühler Wind ist aufgekommen. Meines Herzens Freude ist ins Meer gefallen.
Ohne Obdach
Mein Herz gleicht den verfallenen Häusern. Die Balken gebrochen, wacklig die Stützen. Ihre Nester mögen die wilden Vögel darin bauen. Stürzen werde ich mich in die angeschwollenen Flüsse. Für die Brut der Fische soll ich Futter sein. Ah! Junge ohne Obdach!
Ein schwarzes Meer hab ich gesehen, doch war es weiß umgeben. Es war stürmisch und die Wellen schlugen hoch, aber schwarz und weiß vermischten sich nicht. Wer hat ein Meer mit zwei Gesichtern gesehen?
SIAMANTO, geb. 1878, gest. 1915, wurde als Adom Yarjanian in Ostanatolien geboren, studierte in Istanbul und Paris. Ein Barde und politischer Aktivist, schrieb er Blutige Nachrichten von meinem Freund als Antwort auf das erste armenische Massaker im Jahr 1909. Mit seinem Freund, dem Dichter Daniel Varoujan, und vielen weiteren Künstlern und Intellektuellen wurde er am 24. April 1915 deportiert und hingerichtet.
Der Tanz
In Bardez, der Stadt, in der immer noch Armenier sterben, erzählte mir eine deutsche Frau unter Tränen von dem Entsetzlichen, das sie gesehen hatte:
»Was ich erzähle – ich sah es mit eigenen Augen. Hinter meinem Fenster zur Hölle biss ich die Zähne zusammen und sah mit unbarmherzigen Augen: Wie die Stadt Bardez zu einem Haufen Asche wurde. Leichen, so hoch geschichtet wie Bäume. Vom Wasser, von Quellen, von den Flüssen und der Straße nahm das beharrliche Rauschen eures Bluts Rache an meinem Ohr.
Erschrick nicht. Ich muss dir sagen, was ich sah, nur so werden die Leute die Verbrechen verstehen, die Menschen den Menschen antun. Zwei Tage lang, an der Straße zum Friedhof … Die Herzen der ganzen Welt sollen es wissen. Es war Sonntagmorgen, der erste nutzlose Sonntag, der über den Leichen anbrach. Vom Abend bis zum Morgengrauen in meinem Zimmer, mit einer niedergestochenen jungen Frau, meine Tränen nässten ihren Tod. Plötzlich hörte ich in der Ferne eine dunkle Meute in einem Weinfeld. Sie peitschten zwanzig Bräute aus und sangen dazu schmutzige Lieder.
Ich verließ die halb tote Frau auf ihrem Strohlager und ging zum Balkon, die Meute schien ein undurchdringliches Dickicht. Ein Tier von Mann brüllte: »Tanzen sollt ihr, tanzen zu unseren Trommelwirbeln.« Die Peitschen knallten auf das Fleisch dieser Frauen. Hand in Hand fingen die Bräute im Kreis zu tanzen an. Für einen Augenblick beneidete ich meine verwundete Nachbarin, wie sie mit einem ruhigen Röcheln das Universum verdammte und ihre Seele den Sternen übergab … Vergeblich reckte ich die Fäuste. »Tanzt!«, schrien sie im Delirium, »tanzt, bis ihr tot seid, ihr ungläubigen Schönen, mit euren schwingenden Brüsten tanzt! Ihr seid verlassen, nackte Sklaven jetzt, tanzt wie ein Haufen dreckiger Nutten. Wir wollen es euch besorgen.« Zwanzig anmutige Bräute brachen zusammen. »Los, steht auf!«, schrie die Meute und schwang die Schwerter. Dann brachte einer einen Krug mit Kerosin. Menschliche Gerechtigkeit, ich spucke dir ins Gesicht. Die Bräute wurden mit Öl übergossen. »Tanzt!«, brüllten sie, »hier ist ein Duft, den selbst in Arabien ihr nicht bekommt.«
VAHAN TEKEYAN, geb. 1878, gest. 1945, überlebte den Genozid vom April 1915, weil er zu der Zeit geschäftlich in Jerusalem zu tun hatte. Er ging von Jerusalem nach Kairo und lebte dort im Exil bis zu seinem Tod.
Gebet auf der Schwelle des Morgen
Schau. Neue Sprösslinge kommen durch die Erde. Aber was Dornen ist und was Weizen, weiß ich nicht. Dem Appetit, der gestillt ist, mag alles Spreu sein, während dem Hungrigen alles Getreide ist.
Undeutliche Geräusche in der Ferne, Schläge, Schritte, ein quälender Angriff, mit ihrem Blut zünden die Unterdrückten rote Flammen an. Und die Regenfälle schwitzen und schwellen zur Flut, welche die Wände der ältesten Dämme zerdrückt. Herr, es ist an der Zeit, Deine Weisheit und Güte den Gemarterten zu schicken. Auch wenn sie vergessen haben, sie brauchen Dich, da sie so nah am Abgrund straucheln.
O Gott, der Du den Geist geschmückt und das Öl des Lebens ausgeschüttet hast, lass nicht zu, dass Deine Lampen umgestürzt werden. Lass sie den Pfad zu Deiner Wahrheit erleuchten.
Pflanze Liebe in die Augen der Mächtigen von Heute und Morgen. Lass es nicht zu, dass sie ihre Herzen verschließen.
Und sieh zu, dass die Herzen der Kinder und der Greise empfänglich bleiben für Zärtlichkeit und Hoffnung.
Lass den Kampf unserer Zeit kurz sein. Lass ihn ein gerechtes Ende finden.
Lass die Festung aus Egos, diese gewaltige Barrikade, einstürzen. Und lass jeden Schatz
2. ERSTER WELTKRIEG (1914–1918)
Im Sommer 1914 entflammt in Europa eine bis dahin beispiellose Form der Kriegshysterie. Millionen Männer ziehen singend an die Front. Ganze Divisionen brennen um geringster Geländegewinne willen »bis zur Schlacke aus«, wie es alsbald in der dem industriellen Krieg angepassten Sprache heißt. Von den europäischen Mächten als kurzer Feldzug geplant, artet der Krieg in ein vierjähriges Gemetzel mit über zehn Millionen Toten aus.
Dichter stehen dabei überall in vorderster Linie. Sie nehmen an diesem organisierten Massenmord in der Doppelrolle als Täter und Opfer teil. Viele Briefe und Gedichte spiegeln die labile Gefühlslage einer Generation wider, die der Hoffnung auf Erneuerung der Gesellschaft durch den Krieg zunächst erlag und ihn dann selbst leidvoll erfahren musste. Anfängliche Begeisterung, wie bei Guillaume Apollinaire, schlägt rasch um in Desillusion und Verzweiflung. In vielen Gedichten spüren wir den Drang, ganz jenseits von nationalem Pathos das Grauen des Krieges unbeschönigt auszudrücken und damit auch die chauvinistische Propaganda zu Hause zu entlarven. In der apokalyptischen Radikalität, in brutaler Diktion und harter Syntax gehen die deutschen expressionistischen Dichter, insbesondere Wilhelm Klemm, Franz Richard Behrens und August Stramm, noch weiter als die englischen »trench poets« Wilfred Owen und Siegfried Sassoon. August Stramm stellt die Ordnung der Sprache selbst infrage, Georg Trakl erfindet Bildwelten, die den Surrealismus vorwegnehmen.
WILHELM KLEMM, geb. 1881, gest. 1968. Erlebte den Ersten Weltkrieg als Feldarzt an der Westfront. Die expressionistische Zeitschrift Die Aktion eröffnete ihre Rubrik »Verse vom Schlacht-Feld« mit seinen nüchternen und doch bilderreichen und visionären Versen. Das Erlebnis des Krieges als Trauma und tief greifende Verstörung blieb weit über das Kriegsende hinaus eine Grundstimmung der Lyrik Klemms.
Schnee
Nun ist wieder Schnee gefallen. Das Land liegt weiß wie ein Roman. Seltsam, unwirklich. Ein Leben ohne Hülle Wandern unsre Gedanken. Wach auf, mein Freund!
Hörst du nicht das Schießen? Es ist Krieg, Weltkrieg. Überlege es nur, Weltkrieg! Was in Vorträumen gelb Spukte, ist Wahrheit. Blicke nicht in die Flocken, Die fallen wie immer und je. Nimm Stelzen der Phantasie.
Jage auf Geisterschenkeln über all die Begebnisse Entlang die Wege und Umwege Gottes, Die du nie begreifst. Bis dein atemloses Herz Plötzlich anhält. Und du dich wiederfindest, unter dem Helm.
Die Aktion, 20.3.1915
An der Front
Das Land ist öde. Die Felder sind wie verweint. Auf böser Straße fährt ein grauer Wagen. Von einem Haus ist das Dach herabgerutscht. Tote Pferde verfaulen in Lachen.
Die braunen Striche dahinten sind Schützengräben. Am Horizont gemächlich brennt ein Hof Schüsse platzen, verhallen – pop, pop, pauuu. Reiter verschwinden langsam im kahlen Gehölz,
Schrapnellwolken blühen auf und vergehen. Ein Hohlweg Nimmt uns auf. Dort hält Infanterie, naß und lehmig. Der Tod ist so gleichgültig wie der Regen, der anhebt. Wen kümmert das Gestern, das Heute oder das Morgen?
Und durch ganz Europa ziehen die Drahtverhaue, die Forts schlafen leise. Dörfer und Städte stinken aus schwarzen Ruinen, wie Puppen liegen die Toten zwischen den Fronten.
Gloria!, Frühjahr 1915
Schlacht an der Marne
Langsam beginnen die Steine sich zu bewegen und zu reden. Die Gräser erstarren zu grünem Metall. Die Wälder, Niedrige, dichte Verstecke, fressen ferne Kolonnen. Der Himmel, das kalkweiße Geheimnis, droht zu bersten.
Zwei kolossale Stunden rollen sich auf zu Minuten. Der leere Horizont bläht sich empor. Mein Herz ist so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen, Durchbohrt von allen Geschossen der Welt.
Die Batterie erhebt ihre Löwenstimme Sechsmal hinaus in das Land. Die Granaten heulen. Stille. In der Ferne brodelt das Feuer der Infanterie, Tagelang, wochenlang.
Die Aktion, 24.10.1914
Schlachtenhimmel
Jeden Morgen hebt der Tag die Sonne, Ein blutiges Kind, empor zum Himmel. Das Heer schüttelt sich wie ein großer Vogel. Ins Gelände geduckt, irgendwo südwärts, ist – der Feind.
In der Ferne räuspert Gewehrfeuer. Und jetzt zersprengen die Kanonen den Horizont. Unsichtbare Kolosse der Luft Heulen auf, kreischen verzweifelt, platzen.
Die Schrapnelle flecken den Himmel Wie einen Panther. Riesiges Raubtier, Lauert er über uns, und verspricht doch Wie immer und je die ewige Ruhe.
Die Aktion 21.11.1914
Vormarsch
Die Truppen marschierten, marschierten, mager und wild Vor Anstrengung. Andere schliefen im Graben – Auf dem Felde standen Pferde in schweren Decken Grade gegenüber dem Sonnenuntergang.
Wolken hingen herab, himmlische Eingeweide,
AUGUST STRAMM, geb. 1874 in Münster, gefallen 1.9.1915 in Weißrussland. Postinspektor, Lyriker, Mitglied des »Sturm-Kreises« um Herwarth Walden. In einem Feldpostbrief kurz vor seinem Tod schildert er eindrücklich die Wirkungen des Krieges: »Hast Du schon mal einen Fleischerladen gesehen, in dem geschlachtete Menschen zum Kauf liegen. Und dazu stampfen mit ungeheurem Getöse die Maschinen und schlachten immer neue in sinnreichem Mechanismus. Und Du stumpf darin gottlob stumpf Schlächter und Schlachtvieh.«
Patrouille
Die Steine feinden Fenster grinst Verrat Äste würgen
ALFRED LICHTENSTEIN, geb. 1889 in Berlin, gefallen am 25.9.1914 an der Westfront bei Reims. Jurist, bewegte sich in den expressionistischen Zirkeln in Berlin und publizierte in Der Sturm, ab 1912 auch in der Aktion.
Die Schlacht bei Saarburg
Die Erde verschimmelt im Nebel. Der Abend drückt wie Blei. Rings reißt elektrisches Krachen Und wimmernd bricht alles entzwei.
Wie schlechte Lampen qualmen Die Dörfer am Horizont. Ich liege gottverlassen In der knatternden Schützenfront.
Viel kupferne feindliche Vögelein Surren um Herz und Hirn. Ich stemme mich steil in das Graue Und biete dem Morden die Stirn.
Abschied
kurz vor Abfahrt zum Kriegsschauplatzfür Peter Scher
Vorm Sterben mache ich noch mein Gedicht. Still, Kameraden, stört mich nicht.
Wir ziehn zum Krieg. Der Tod ist unser Kitt. O, heulte mir doch die Geliebte nit.
Was liegt an mir. Ich gehe gerne ein. Die Mutter weint. Man muß aus Eisen sein.
Die Sonne fällt zum Horizont hinab. Bald wirft man mich ins milde Massengrab.
FRANZ RICHARD BEHRENS, geb. 1895, gest. 1977. Dichter, Drehbuchautor und Sportkolumnist. Die 116 in seinem Feldtagebuch vom März 1915 bis zum August 1916 enthaltenen Gedichte belegen seinen Rang als bedeutendster Wortkünstler des Expressionismus neben August Stramm. Sein einziger zu Lebzeiten publizierter Gedichtband Blutblüte erschien im Berliner Verlag Der Sturm.
Ostpreußischer Kinderreim 1915
Dicker gelber Zeppelin Friß die freche Fliegerbien Hängst so fett am Wolkenrand Schenk uns Fried und Heimatland.
Bombenwurf
Herrlichkeit will Schmerz Die wildesten Farben Geilen nun mal eben In zerrissenen Leichen bleiben Schauen klafft Schaudern Gießt ein Silbertropfen ins Blaublank Fließen vier Zähren Stahlplatten klappen Schlüssel poltern hohle Eisenstiegen herab Zackend Heulsekunden Feige bin ich nicht Warum schmeißen sich denn Deine Beine so plötzlich Herum?
GEORG TRAKL, geb. 1887, gest. 1914 in Krakau. Apotheker, wurde 1914 bei Kriegsausbruch eingezogen und erlebte als Sanitätsfähnrich die Schlacht bei Grodek, unter deren Eindruck er zusammenbrach. Im Lazarett in Krakau starb er an einer Überdosis Kokain. Grodek gilt als sein großes Gedicht der Spätzeit. Theodor W. Adorno hat von dem »rotierenden Wahnsinn« der Zeit und der Zeitgenossenschaft gesprochen. Hier, in diesem Gedicht, wird der Wahnsinn ansichtig. In der parataktischen Fügung der ineinandersprechenden Bilder erinnert Grodek an den späten Hölderlin. Die Realität des Krieges in den ersten Verszeilen, die Durchdringung von Lebens- und Persönlichkeitsgeschichte, das geisterhaft auftauchende Bild der Schwester, an die er inzestuös gebunden war, der düstere Kosmos der Natur – all dies ergibt eine unauflösbare Folge von Angst, Paranoia, Schmerz und peinigender Trauer.
Grodek
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düstrer hinrollt; umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossne Blut sich, mondne Kühle; alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter; und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungebornen Enkel.
Im Osten
Den wilden Orgeln des Wintersturms Gleicht des Volkes finstrer Zorn, Die purpurne Woge der Schlacht, Entlaubter Sterne.
Mit zerbrochnen Brauen, silbernen Armen Winkt sterbenden Soldaten die Nacht. Im Schatten der herbstlichen Esche Seufzen die Geister der Erschlagenen.
GUILLAUME APOLLINAIRE, geb. 1880 in Rom, gest. 1918 in Paris. Eng verbunden mit den Futuristen und kubistischen Malern, die er förderte, gilt er mit seinen Gedichtsammlungen Alcools (1913) und Calligrammes (1918) als Schöpfer eines neuen lyrischen Stils und Vorläufer des Surrealismus. Er feiert den Weltkrieg als Beginn einer neuen, glorreichen Epoche, meldet sich als Freiwilliger mit Ausländerstatus und wird im Dezember 1915 endlich für die Armee gemustert und an die Front versetzt. Am 17. März 1916, acht Tage nachdem er Franzose geworden ist, durchbohrt ein Granatsplitter seinen Helm, bricht den Schädel und verletzt sein Gehirn. Mehrere Operationen folgen. Im November 1918 infiziert er sich an der Spanischen Grippe und stirbt zwei Tage vor dem Waffenstillstand. Sein kriegsbegeisterter Optimismus wirkt heute befremdlich, das vitale Bekenntnis zur Moderne in denkbar schärfstem Kontrast zum depressiven und rätselhaften Spätwerk von Georg Trakl.
Krieg
Zentralnerv des KampfesKontakt über Funk Man schießt in Richtung »der vernommenen Geräusche« Die Jungs der Klasse 1915