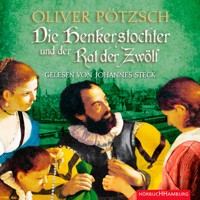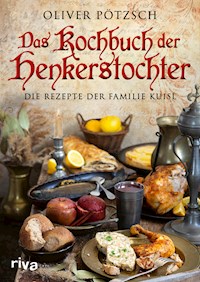11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bad Bichelstein, die Perle deutscher Kurorte Dorthin verschlägt es den erfolgreichen Schriftsteller Oliver Pötzsch nach einer Bypass-Operation. Und er ist absolut nicht vorbereitet auf das, was ihn in der Reha erwartet: beschwingte Country-Abende im Krankenhausfoyer, Gymnastik- und Massageübungen mit stark behaarten Oberpfälzern und Bier-Dealer in Morgenmänteln auf dem Klinikparkplatz wechseln sich ab mit spannenden Gesprächen über Stuhlgang und Blutdruck. Aber auch Ganzkörperrasur und Einlauf gehören zum Klinikpaket. Immer mit von der Partie sind die »Mitgefangenen« Venen-Elli, Hausmeister-Rolf, Roth-Händle-Luigi und Klappen-Axel. Meine Kur hat einen Schatten zeigt die Reha in allen Facetten, von den lustigen und absurden Erlebnissen bis zu den ernsten Seiten. Urkomisch, unterhaltsam und mit viel Galgenhumor im Gepäck – der ideale Lesestoff zum Mutmachen, Lachen und Ablenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
[email protected]
Originalausgabe 1. Auflage 2016
© 2016 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Antje Steinhäuser, München
Umschlaggestaltung: Melanie Melzer, München
Umschlagabbildung: Autor (beide Fotos), Frühstück, Hometrainer: © Oliver Pötzsch; Gymnastikgruppe: Shutterstock/De Visu; Schiefertafel: Shutterstock; Band: © Verlag
Abbildungen im Innenteil: S. 19: Shutterstock / Isantilli; S. 21: Shutterstock / Yuttasak Jannarong; S. 27, 164: Shutterstock / Robert Kneschke; S. 28: Shutterstock / PonomarenkoNataly; S. 35: Shutterstock / Eugenio Marongiu; S. 87: Shutterstock / Tyler Olson; S. 82, 122: © Verlag; S. 44, 51, 69, 76, 110, 131, 138, 139, 140, 142, 183: © Oliver Pötzsch
Bildbearbeitung: Pamela Machleidt, München
Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern
ISBN Print 978-3-86882-663-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-923-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-922-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter:
www.muenchner-verlagsgruppe.de
Inhalt
Willkommen in Bad Bichelstein
Die Diagnose
Tischgespräche
Die Operation
Fitness mit Oberpfälzern
Nachtschwester Heike
Der Bier-Dealer
Die Bettpfanne
Der Ausflug
Der Röchler und der Schnarcher
Ballsport
Von Henkern und Herzen
Der Country-Abend
Götter in Weiß
Fußball
Das Weichei
Entspannungstechniken
Verordneter Spaziergang
Kliniksprache, schwere Sprache
Die Psychotante
Der Junkie
Fronturlaub
Der Kochkurs
Schönheit und Funktion
Tour de Bichelstein
Hypochonder und andere Arten
Horrorshow
Die eine Sache
Domina Stefanie
Ärzte-Bashing
Die Entlassung
Die Zeit danach
Gute Vorsätze
Danke, danke, danke!
Für Klappen-Axel, Hausmeister-Rolf, Roth-Händle-Luigi, Venen-Elli und all die anderen Reha-Patienten von Bad Bichelstein. Hand aufs Herz, wir waren ein super Team!
»They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no!«
(Amy Winehouse,
Willkommen in Bad Bichelstein
Wenn man in einem Rollstuhl sitzt, sieht die ganze Welt um einen herum plötzlich viel größer, stärker und gefährlicher aus.
Das trifft besonders auf den Taxifahrer zu, der sich mir mit federndem Bodybuilderschritt nähert. Er hat das Kreuz eines kanadischen Holzfällers und ein Kinn wie der junge Arnold Schwarzenegger. Mitleidig beugt der Fels sich hinunter zu dem Würmchen in Jogginghosen und Bademantel. Dieses Würmchen bin ich: leicht übergewichtiger Schriftsteller, frisch operierter Herzpatient und gerade mal 41 Jahre alt. Arnold Schwarzenegger schaut mich an, als wäre ich 82.
»Sind Sie der Patient, den ich nach Bad Bichelstein1 fahren soll?«, fragt er ungläubig. »Sie? Nach Bichelstein???« Der Name der Kurklinik klingt aus seinem Mund wie ein püriertes Erbsengericht.
Hinter uns ragt der graue Betonbau der Klinik auf, in der ich die letzten Tage verbracht habe. Mein dritter Krankenhausaufenthalt in knapp drei Wochen. Ein Mann in braunem Bademantel und mit Adiletten an den Füßen schlappt durch den Park, aus einem geöffneten Fenster dringt der Schlager »Herzilein« wie eine Abschiedsmelodie.
Ich nicke dem Taxifahrer zu und deute auf meinen Koffer neben dem Rollstuhl. »Könnten Sie mir den bitte in den Kofferraum heben? Ich bin noch ein wenig … äh, schwach.«
Arnold nimmt den Koffer, als wäre es eine Damenhandtasche, und wirft ihn auf den Rücksitz. Dann wendet er sich mir mit seinen Holzfällerhänden zu. Offenbar will er mich hinterherwerfen.
»Danke, ich kann selber einsteigen«, erwidere ich mit schmalem Lächeln. Mühsam richte ich mich im Rollstuhl auf und schlurfe hinüber zur Beifahrertür, die Arnold mir galant aufhält. Wahrscheinlich hat er das bei Rentnerinnen gelernt, die ihm dafür immer ein dickes Trinkgeld geben. Ich muss plötzlich an meine eigene Großmutter denken, wie sie sich am Rollator früher immer durch den Flur schob, krumm wie ein Fragezeichen, Meter für Meter.
Vielleicht bin ich ja doch 82, denke ich. Vielleicht bin vor drei Wochen in ein Wurmloch gefallen, das mich erst jetzt ausspuckt?
Die Tür wird kraftvoll zugeworfen, und wir fahren los. Die Fahrt verläuft zunächst schweigend, doch ich sehe, wie Arnold immer wieder vorsichtig zu mir hinüberlinst. Schließlich kann er sich nicht mehr beherrschen.
»Darf ich fragen, was Sie …«, beginnt er.
»Herzkranzgefäßverengung«,2 erwidere ich ganz automatisch. Ich habe dieses Wort, von dessen Existenz ich vor Kurzem noch nicht mal wusste, seitdem gefühlte tausend Mal ausgesprochen. Drei Wochen Google-Recherche haben aus mir einen Experten gemacht, der lässig auf jeder Kardiologentagung mithalten könnte. »Eine meiner Herzkranzarterien war zu über 90 Prozent zu«, ergänze ich fachmännisch. »Ich war kurz vor dem Infarkt und bin deshalb operiert worden. Ich habe jetzt einen Bypass, so eine Art Schlauch, alles ist in Ordnung.«
Arnold sieht mich an, als wäre gar nichts in Ordnung. »Aber Sie sind doch noch sehr jung«, hakt er nach.
»Ich weiß, ich bin sogar der jüngste Fall, den sie im Krankenhaus je hatten. Vermutlich ist das genetisch. Mein Vater hat mittlerweile drei Bypässe.«
»Also unheilbar«, fasst Arnold unser Gespräch zusammen.
»Äh, so würde ich das nicht nennen«, versuche ich zu parieren. Aber ich bin noch immer viel zu schwach von den vielen Medikamenten, meine Worte zerbröckeln mir im Mund, werden leiser und leiser. »Schließlich bin ich ja jetzt operiert … und jetzt kommt die Kur, da …«
»Wenn ich eine unheilbare Krankheit hätte, ich glaube, ich würde mich von der Brücke stürzen«, sagt Arnold. Seine Holzfällerhände umklammern das Lenkrad, entschlossen blickt er nach vorne. »Oder erschießen. Aber das ist natürlich schwieriger. Dazu braucht man eine Pistole. Ich meine, woher bekommt man eine Pistole? Gut, ich habe Freunde im Schützenverein, die könnten mir vielleicht eine geben. Hm, oder man wirft sich vor den Zug. Aber da weiß man natürlich nicht, ob das klappt. Ich kannte mal einen, der hatte danach keine Beine und …«
»Könnten wir bitte das Fenster öffnen? Mir ist ein bisschen, äh … übel.«
»Verzeihung, natürlich.« Arnold wirft seinem todgeweihten Fahrgast noch einen letzten mitleidigen Blick zu, dann drückt er auf den Fensterhebeknopf. Warme Frühlingsluft dringt hinein, draußen scheint die Sonne, Vögel zwitschern, das Leben schreit einem entgegen. Gerne würde ich Arnold sagen, dass ich mich eigentlich ganz gut fühle. Ganz gut heißt in meinem Fall, dass ich etwa fünfzig Schritte gehen kann, ohne zu schnaufen und zu kollabieren. Wenn ich mich nah über eine Geburtstagstorte beugen würde, könnte ich vermutlich eine oder zwei Kerzen darauf auspusten – und die Brustschmerzen sind so, dass ich nachts nicht mehr ständig Todesangst habe. Hey, mir geht es prima! Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Arnold würde das nicht verstehen. Also schweige ich.
Nach einer weiteren halben Stunde taucht vor uns ein See auf, eine Allee mit hohen Birken, dahinter eine Auffahrt. Menschen in Jogginganzügen, Morgenmänteln und Krücken bevölkern den Eingang zu einem Bau, der die Fröhlichkeit einer stalinistischen Diktatur verströmt. Vielleicht kommt dieser Eindruck aber auch daher, dass viele der Leute hier seltsamerweise einen Jutebeutel um den Hals tragen und sich vornehmlich in den Farben Grau, Braun und Schlammgrün kleiden. Das Ganze wirkt ein bisschen wie ein Werbefilm für ein Hotel in Nordkorea.
»Bad Bichelstein«, sagt Arnold überflüssigerweise. Er öffnet meine Tür und hilft mir raus. Dann klappt er den Rollstuhl auf und setzt mich hinein mit der Sanftheit eines Riesen, der zum ersten Mal ein zerbrechliches Menschlein berührt. »Viel Glück«, fügt er hinzu und tätschelt meine Schulter.
Als ich auf die Pforte der Kurklinik zurolle, weiß ich, dass ich dieses Glück brauchen werde.
Glück, aber vor allem Dingen viel, viel Humor.
1 Sie werden Bad Bichelstein auf keiner Landkarte finden. Aber wenn Sie selbst schon mal in einer Reha- oder Kurklinik gewesen sind, dann wissen Sie: Bad Bichelstein ist überall. Es heißt bloß immer anders.
2 Bei einer Herzkranzgefäßverengung ist die Durchblutung des Herzmuskels stark eingeschränkt. Die Verengung entsteht normalerweise durch Arteriosklerose, also Arterienverkalkung. Da jeder Mensch im Normalfall nur drei Herzkranzgefäße (Koronararterien) hat, führt die Verkalkung schnell zum Infarkt. Sollten Sie dies lesen und plötzlich einen Stich in der Herzgegend spüren, keine Panik. Das ist rein psychisch. Na ja, jedenfalls meistens.
Die Diagnose
Herzinfarkte kommen meistens ungelegen. Meiner drohte vor einigen Jahren, just vor der Veröffentlichung meines fünften Romans. Es sollte eine größere Pressekonferenz geben, einige Lesungen waren bereits vereinbart, aus den USA winkten ein üppig dotierter Buchvertrag und eine PR-Reise, die mich von New York über Chicago bis nach San Francisco und Seattle bringen würde. Ich fühlte mich wie auf dem Gipfel eines Berges, unbesiegbar, unsterblich, der Höhepunkt meiner Karriere. Vermutlich hatte sich das Schicksal genau diesen Zeitpunkt für die Diagnose aufgehoben, um mir für meinen Größenwahn gehörig in den Hintern zu treten.
Und dieser Tritt tat verdammt weh.
Oft bin ich seitdem gefragt worden, was die ersten Anzeichen für meine lebensbedrohliche Herzkrankheit waren. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. War es der Skiurlaub in der Schweiz, in dem ich mich seltsam kurzatmig fühlte und dies auf die Höhe zurückführte? War es beim sonntäglichen Joggen, als ich plötzlich schon nach einem Kilometer schlappmachte? Allerdings war ich am Abend zuvor auf einem Fest gewesen, hatte viel getrunken und auch einige Zigaretten geraucht … Sicher ließ sich meine mangelnde Kondition also mit einem leichten Kater erklären. Oder fing so etwa Asthma an? Hatte ich, Gott bewahre, Heuschnupfen???
Dass etwas ganz und gar nicht mit mir stimmte, merkte ich schließlich, als ich mit meinem Joggingpartner Dima zu einem einfachen Abendlauf ansetzte, den ich schon nach wenigen Hundert Metern abbrechen musste. Ganz plötzlich fühlte es sich an, als hätte ich nur noch einen halben Lungenflügel. Außerdem war da ein Druck auf meinem Brustkorb, den ich mir nicht erklären konnte, so als würde ein Sack Zement auf mir liegen. Ich machte ein paar Scherze über zu viele Zigaretten, ließ Dima weiterlaufen und schleppte mich wie ein kranker Köter heim.
Dann rief ich meinen Vater an.
Ich habe das Glück, aus einer Arztfamilie zu stammen. Mein Vater war bis vor Kurzem der klassische Landarzt, bis spätabends über Überweisungsformulare gebeugt oder draußen in der Prärie auf Hausbesuch, der einsame Cowboy im weißen Kittel. Meine Brüder, meine Cousine, sogar mein Schwiegervater … ich bin umzingelt von Ärzten, weshalb eine Praxis für mich immer noch eher so etwas wie ein vertrautes Heim ist, in dem es zu Mittag schlabberige Butterbrezen und Kaffee aus Urinbechern gibt.
Der Duft nach Ethanol erinnert mich stets an meine Kindheit, wo ich für die vielen jungen Sprechstundenhilfen als Versuchskaninchen beim Blutabnehmen herhalten musste – jede Kanüle 50 Pfennig. Ich war jung und brauchte das Geld. Außerdem sah ich es als gerechten Ausgleich dafür an, dass ich als Arztkind eigentlich nur ein Attest für die Schule bekam, wenn ich praktisch im Sterben lag. Die Standardantwort meiner Eltern auf alle Formen von leichten Kopfschmerzen, Bauchweh und sogenannter Mathegrippe war: »Reiß dich zusammen und geh früher ins Bett.«
Ich war tatsächlich erstaunlich selten krank.
Das Wartezimmer meines Vaters war für mich und meine zwei Brüder ein Spielzimmer mit zerfledderten Comics, einem zerrupften Kletterelefanten und einem Aquarium, in dem wir in grausamen Tierversuchen Guppys und Putzerfische mästeten. Zu Weihnachten stand das Wohnzimmer dann immer voll mit Dutzenden Malt-Whiskys und Barrique-Grappas – die uralten Opfergaben, um sich die Götter in Weiß gefügig zu machen.
Unser Lieblingsschocker in den Kinderjahren war der Pschyrembel3, jenes bebilderte Nachschlagewerk für Mediziner, in dem Furunkel aussehen wie aufgeplatzte Pestbeulen aus dem Mittelalter und durch das ich zum ersten Mal mit der Bezeichnung »Verbrennung dritten Grades« auf höchst unappetitliche Art und Weise konfrontiert wurde. Später, als pubertierender Heranwachsender, veranstalteten meine Freunde dann mit Papas gut versteckten Medikamenten fröhliche Drogenorgien.4 Einmal mixte sich ein befreundetes Mädchen einen Arzneicocktail, der sie für zwei Tage ins Koma beamte. Ich hatte sturmfrei und betete, dass sie wieder aufwachte – was sie schließlich tat und nach einem Bier verlangte.
Man könnte also sagen, dass ich gegen jede Art von Krankheit bestens gewappnet bin.
Trotzdem konnte auch mein Vater mit all seiner jahrzehntelangen Erfahrung zunächst nichts Gravierendes bei mir feststellen. Vermutlich war die Belastung auf dem Ergometer nicht hoch genug gewesen oder ich wollte mir vor meinem Erzeuger keine Blöße geben und verdrängte die Beschwerden. Doch irgendeine dunkle Vorahnung muss den besorgten Herrn Papa dazu bewegt haben, mich noch am nächsten Tag zu seinem eigenen Kardiologen zu schicken.
Von da an ging alles sehr schnell.
Ich weiß noch, wie ich mit den Gedanken beim nächsten Buch im Wartezimmer saß. Ich erwartete eine Routineuntersuchung, ein paar mahnende Worte zum Thema Rauchen, vielleicht auch bunte Pillen gegen Bluthochdruck. Nichts bereitete mich auf das vor, was nun kam. Wir machten das übliche EKG, dann wechselte ich auf einen Stuhl mit Pedalen, der aussah, als würde er auch in der Astronautenforschung eingesetzt. Ich kippte zur Seite und trat in die Pedale, während der Arzt mein Herz per Ultraschall beobachtete.
Dass sich mein Leben ändern würde, merkte ich als Erstes an der Mimik des Doktors. Von entspannt-lässig wechselte sie plötzlich zu ernst-besorgt, just als ich in einen höheren Gang schaltete.
»Das gefällt mich gar nicht«, sagte der Mann in Weiß mit samtig öligem Bariton. Der berühmte Satz, der in deutschen Arztpraxen immer eine mittlere Katastrophe ankündigt. Er sah sich einige Ultraschallbilder meines Herzens an, schüttelte den Kopf und bat mich dann zu sich an den Tisch. »Ganz und gar nicht«, wiederholte er. »Ich lege mich fast zu hundert Prozent fest. Was Sie da beim Joggen gespürt haben, ist eine Angina Pectoris.«
Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Angina für mich immer eine Art leichte Grippe mit Schnupfennase gewesen. Nun erfuhr ich, dass es sich bei der Angina Pectoris um drückende Schmerzen in der Brust handelt, die einen kommenden Herzinfarkt ankündigen. Der Kardiologe klappte seinen Laptop auf und begann einen Vortrag, wie ihn in schlimmerer Form vermutlich auch Krebspatienten nach der Diagnose zu hören bekommen. Ich war wie in Trance, hörte einzelne Wörter wie Katheter, Stent, Bypass und Herzoperation, wobei ich jedes Mal verständnisvoll nickte. Erst beim letzten Satz wachte ich wieder auf.
»Ich werde gleich morgen versuchen, einen Platz im Krankenhaus für Sie zu bekommen«, sagte der Arzt. »Es muss jetzt sehr schnell gehen.«
Ich sah ihn irritiert an und machte ihn darauf aufmerksam, dass ich leider keine Zeit für einen Krankenhausbesuch, geschweige denn für einen Herzinfarkt hätte. Die Pressekonferenz, die vielen Lesungen, die Reise in die USA … Alles sehr schlecht. Im Juni hätte ich vielleicht wieder ein Zeitfenster für Krankheiten. Ich würde zu Hause noch mal im Terminkalender blättern.
Der Arzt lächelte nur müde. Er bekam so etwas offenbar öfter zu hören. Er schob mir einige Beruhigungspillen zu und fuhr den Laptop runter.
»Übermorgen im Krankenhaus dann«, sagte er. »Und sagen Sie Ihren Kindern erst mal noch nichts. Es reicht, wenn Ihre Frau sich Sorgen macht.«
Spätestens jetzt wusste ich, dass ich ein echtes Problem hatte.
3 Benannt nach Dr. Willibald Pschyrembel (1901–1987), alleiniger Redakteur dieses medizinischen Klassikers. Brächte im Scrabble auf dreifachem Wortfeld 306 Punkte. Spaßbremsen lassen Eigennamen mit elf Buchstaben jedoch leider nicht zu.
4 Mit der Zeit kennt man die Verstecke der Eltern für Fernsehfernbedienungen, FSK-18-DVDs, Schokolade, Kondome und eben auch Arzneien.
Tischgespräche
Drei Wochen später, in Bad Bichelstein, starre ich auf ein beige-graues Tablett, darauf ein Teller mit einem zerflossenen Etwas, das sich »Gemüselasagne« nennt. Früher, in der Kantine des Bayerischen Rundfunks, wo ich lange Jahre als Journalist arbeitete, haben wir dieses Gericht immer »Wochenchronik« genannt. Am Inhalt zwischen den labbrigen Teigscheiben konnte man immer schön erkennen, was von Montag bis Freitag so alles nicht gegessen worden war. Hier in der Reha heißt dieses Gericht »Frühlingsstrudel (Schonkost Herz)«, was auch nicht viel peppiger klingt.
Die berühmt-berüchtigte Gemüselasagne, auch »Wochenchronik« genannt. In Reha-Kliniken oft freitags serviert, zubereitet mit vielen leckeren Beilagen der Wochentage Montag bis Donnerstag (manchmal auch der Vorwoche).
Es ist mein erster Tag in Bad Bichelstein, mein erstes Mittagessen. Es werden noch viele folgen, immer am gleichen Tisch, mit den gleichen Leuten. Nach den stillen Tagen im Krankenhaus fühle ich mich wie ein Kartäusermönch, der plötzlich in die voll besetzte Allianz Arena katapultiert wird. Um mich herum säbeln, kauen und mümmeln etwa dreihundert meist grauhaarige Kurgäste in Jogginghosen, Freizeitblousons und ausgeleierten T-Shirts an ihren cholesterinarmen Speisen. Es riecht nach angebratenen Zwiebeln und Altmännerschweiß.
Dummerweise habe ich mir eine Krankheit ausgesucht, die vor allem ältere, übergewichtige männliche Patienten ereilt. Hätte ich einen Kreuzbandriss, könnte ich jetzt drüben in der Orthopädie mit Sportstudentinnen und Beachvolleyballerinnen schäkern. Allerdings ist die psychosomatische Abteilung gleich nebenan, und das ist ja auch nicht immer ganz einfach.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, was es mit den seltsamen Jutetaschen auf sich hat, die mir schon bei meiner Ankunft aufgefallen sind. Auch ich besitze jetzt nämlich eine. Man erhält sie zur Begrüßung, um seine Krankenakte immer mit sich zu führen, falls man im Kurpark plötzlich zusammenklappt. Dann wissen die Ärzte gleich Bescheid. Die Tasche ist grau-weiß und bedruckt mit dem rätselhaften Aufdruck »Gemeinsam durchs Leben – gemeinsam aktiv«. Von Weitem sehen die Patienten damit alle aus, als würden sie nur mal schnell Vollkornsemmeln beim Biobäcker holen. Wer auf Krücken läuft, hängt sich die Tasche um den Hals, wo sie fröhlich hin und her baumelt. Bei Eseln und Pferden nennt man so was, glaube ich, Futterkorb.
Mit vollem Mund nicke ich meinen Tischnachbarn zu, die ihren Teller schweigend leer schaufeln. Ich bin ziemlich aufgeregt, und das hat mit dem Gespräch zu tun, das ich vorher noch mit Frau Dr. Liebsamen, meiner zuständigen Ärztin, geführt habe. Ich wollte von ihr unter anderem wissen, ob man denn den Tisch wechseln könne, wenn man mit seinen Nachbarn, nun eben … äh, nicht so ganz klarkommt. Schließlich seien drei Wochen Kurklinik ja doch eine ziemlich lange Zeit zusammen … Sie schüttelte nur traurig den Kopf und sagte, das sei aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. Nur einmal, da habe man eine Ausnahme gemacht.
Die Jutetasche ist das Modeaccessoire jedes Reha-Ausflüglers. Vorzugsweise in den Farben Weiß, Grau und Mokkabraun, lässt sie sich sowohl am Arm als auch um den Hals und am Ohr tragen.
»Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Herr Müller war Akademiker. Leider haben wir den Titel ›Doktor‹ mit auf dem Tischkärtchen aufgeführt. Tja, die anderen haben den armen Kerl dermaßen gemobbt, dass wir ihn schließlich wegsetzen mussten.«
»Ich bin auch Akademiker«, murmle ich.
»Na, das müssen Sie denen ja nicht gleich auf die Nase binden«, erwidert sie achselzuckend. »Und das mit der, hm …« Sie blickt in ihre Karten und runzelt die Stirn. »… Schriftstellerei vielleicht auch nicht. Haben Sie nicht irgendetwas Anständiges gelernt?«
Seitdem habe ich keinen Appetit mehr.
Vorher haben wir uns bereits kurz am Tisch vorgestellt. Neben mir sitzt Rolf, von Beruf Hausmeister und der Gesprächigste in der Runde. Er erzählt sehr viel von seinem Wohnwagen und streut ab und zu Witze ein, in denen es entweder um die freiwillige Feuerwehr (Durst löschen!) oder die Orthopädieabteilung nebenan geht. Mir gegenüber blättert ein italienischstämmiger Lastwagenfahrer namens Luigi in der »Bild«-Zeitung. Luigi ist Kettenraucher und hat während einer Fahrt auf der Autobahn einen Infarkt bekommen. Im letzten Moment konnte er rechts ranfahren, seitdem raucht er nur noch eine Packung Roth-Händle am Tag und nicht mehr vier. Allerdings wisse er nicht, ob er das lange durchhalte.
»Weissu, habe super Job«, sagt er mit diesem schwermütigen Schlawinerlächeln, wie es nur Italiener hinbekommen.5 »Aber einsam. Binne einsame Cowboy auf deutsche Autobahn. Eh, und Cowboys rauchen, hehe.«
Ich sage ihm nicht, dass vier der Marlboro-Männer an den Folgen des Rauchens gestorben sind. Er ist ja auch wegen seines Herzens hier.
Dann gibt es Elli, unsere einzige Frau (zwei Zigarettenpackungen, Rollstuhl, Venenleiden), und zwei schwermütige, fast schon philosophisch anmutende Schweiger ohne Namensschildchen, von denen der eine offenbar aus Kroatien stammt, wie Hausmeister-Rolf erzählt, und der andere aus einem fernen Land in Afrika. Über dessen Gesichtsfarbe macht Rolf auch gerne Witze. Ich nenne die beiden Schweiger Helmut und Hans, ihre richtigen Namen werde ich nie erfahren.
Und dann geschieht es.
»Und was machst du so?«, fragt mich Rolf zwischen zwei Gabeln ungesalzener, matschiger Zucchini.
Ich schrecke zusammen und tue so, als müsse ich zuerst hinunterschlucken. Der arme Doktor Müller, geht mir durch den Kopf. Was sie wohl mit ihm gemacht haben? Mit der Jutetasche verprügelt? Mit Hausmeister-Rolf in den Wohnwagen gesperrt, zusammen mit tausend Negerwitzen? Lebenslang Bad Bichelstein?
Ich habe mir bereits einige hilfreiche Verhaltensmuster zurechtgelegt: eher wortkarg, leicht bayerischer Einschlag, ohne anbiedernd zu wirken, auf keinen Fall meinen wahren Beruf erwähnen! Ich weiß aus Erfahrung, dass die Schriftstellerei in gewissen Kreisen oft mit Faulenzen, langem Ausschlafen und schwächlicher körperlicher Verfassung gleichgesetzt wird.6
Ich werde also sagen, dass ich Journalist bin, beim Bayerischen Rundfunk, was ja auch stimmt. Bayerischer Rundfunk, das klingt erdig, nach Blasmusik, Maibaumstehlen und Sigmund Gottlieb.7
Ich setze also zu meiner Antwort an, als etwas völlig Unerwartetes passiert.
Mein Bruder taucht auf.
Er macht eben seine Ausbildung zum Facharzt und kommt direkt aus dem Krankenhaus. Er hat einen weißen Kittel an, ein hochamtliches Namensschildchen daran und dieses professionelle Mutmachergrinsen im Gesicht, das jeden Arzt sofort entlarvt. Jovial hebt er die Hand zum Gruß, blickt in die Runde und sagt:
»Guten Tag, Dr. Pötzsch. Wie ich sehe, sitzt mein Bruder bei Ihnen. Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Die Runde schweigt, und ich nehme noch einen Löffel matschige Gemüselasagne.
5 Auch Pizarro-Lächeln genannt, nach dem langjährigen Werder-Bremen- und FC-Bayern-Spieler Claudio Pizarro. Der ist zwar Peruaner, könnte aber mit seinem öligen Haar und dem Amore-Grinsen auch rostige Fiats auf Sardinien verkaufen.
6 Was durchaus den Tatsachen entspricht.
7 Gottlieb, Sigmund: BR-Chefredakteur. So etwas wie die moralische Instanz aller Linkenfresser. Wenn Sigmund Gottlieb mit ernster Miene einen Kommentar in den »Tagesthemen« spricht, ist die Welt wieder in Ordnung und der Himmel weiß-blau – zumindest in Bayern. Sehr lustig dazu: http://sigmundwillabwechslung.tumblr.com/.
Die Operation
Lange nach meiner Zeit in der Kurklinik sagte mir ein befreundeter Arzt mal, so eine Herzoperation sei wie ein brutaler Autounfall.
»So schlimm?«, fragte ich.
Er wog den Kopf und dachte nach. »Hm, vielleicht auch eher wie eine mittelschwere Schussverletzung.«
Es sind Gespräche wie diese, die mich verstehen lassen, warum weder mein Vater noch die zuständigen Ärzte sehr viel im vornherein von der Operation erzählt haben. Es gibt auf YouTube einige haarsträubende Filme über Bypassoperationen. Sollten Sie jemals in die Verlegenheit kommen, am Herzen operiert zu werden, hier ist mein Rat: Schauen Sie sich diese Filme nicht vorher an!8 Sie werden sonst sehr, sehr schlecht schlafen. Auch heute komme ich nicht über die ersten 30 Sekunden eines solchen Filmchens hinaus. Das ist meist der Moment, in dem die Nahaufnahme einsetzt. Wir sehen einen pumpenden fleischigen Herzmuskel, viel Blut und Schläuche. Der Brustkorb wird aufgeklappt wie bei einem Hähnchen im Wienerwald, es folgt noch mehr Blut … Ich erspare Ihnen weitere Details. Ich kenne Patienten, die sich in einer Art verzweifelten Masochismus Bilder und Filme ihrer eigenen Operation angesehen haben. Jeder Splattermovie ist ein Dreck dagegen – vor allem weil man sich hier mit dem Opfer sehr, sehr gut identifizieren kann.
Um festzustellen, wie verkalkt die Koronararterie denn nun wirklich ist, legt man zunächst einen sogenannten Katheter. Das ist ein winziger Schlauch, der meist über die Leistenvene in den Körper eingeführt wird. Man schiebt den Schlauch bis zum Herzen vor, dort kann dann ein Kontrastmittel gespritzt werden. Nur so lässt sich sehen, was dort drinnen wirklich vor sich geht. Für den lediglich lokal betäubten Patienten ist das ein spannender Moment, kriegt er doch alles mit – auch die besorgten Blicke der Ärzte um den Behandlungstisch, wie in meinem Fall.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich.
Die Ärzte gingen raus und begannen, leise miteinander zu diskutieren, während ich auf dem Rücken lag und zur Decke starrte. Ich interpretierte den Fluchtreflex der Experten als kein besonders gutes Zeichen.
Meine Katheteruntersuchung erfolgte schon zwei Tage nach meinem Besuch beim Kardiologen. Ich war nicht der einzige Patient an diesem Tag. Erstaunt musste ich feststellen, dass außer mir noch ungefähr ein halbes Dutzend überwiegend älterer Männer auf ihre Untersuchung warteten. Alle sahen sie aus wie gestresste Manager mit Bluthochdruck; sie trugen gebügelte Anzüge, tippten hektisch in ihre Handys oder bellten ihren Sekretärinnen letzte Befehle ins Telefon. Das erhabene Bild wurde gestört, als wir uns alle ausziehen mussten und von brummigen Krankenschwestern knielange Nachthemden mit Blümchenmuster verpasst bekamen, die noch dazu hinten offen waren. Wenn Sie also das nächste Mal in einem Businessmeeting stecken, stellen Sie sich das arrogante Arsch Ihnen gegenüber einfach mal im hinten offenen Nachthemd mit Blümchenmuster vor – glauben Sie mir, das hilft.
Bis zur Katheteruntersuchung war ich noch davon ausgegangen, dass ich mit einem Stent davonkomme – also einem Röhrchen, das die verkalkte Stelle offen halten soll. Doch nun zeigte sich: Ich würde wohl einen Bypass brauchen. Statt durch meine Herzkranzarterie würde mein Blut demnächst durch eine Vene laufen, die man an anderer Stelle entnommen hatte. Ich stellte mir das Ganze wie beim Klempner vor – nur mit sehr viel mehr Blut und weniger Schrauben.
Was ich nicht wusste, war, wie gemein und hinterrücks Bruder Angst an einem nagt, wenn man die nächsten Tage und Nächte in einem Krankenhausbett auf seine OP wartet. Es war dies der erste Krankenhausaufenthalt in meinem Leben.9