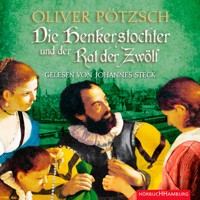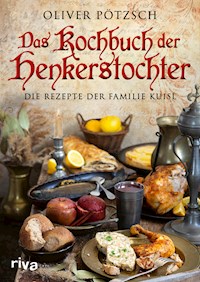Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lago
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Schwarzen Musketiere
- Sprache: Deutsch
Fesselnd bis zum Ende Als Lukas' Mutter als Hexe angeklagt wird und sein Vater beim Versuch, sie zu retten, stirbt, ändert sich alles. Während er selbst vor dem Inquisitor Waldemar von Schönborn fliehen kann, bleibt seine kleine Schwester Elsa zurück. Auf sich allein gestellt, hat der junge Grafensohn nur noch ein Ziel: seine Schwester zu finden und Schönborn zur Rechenschaft zu ziehen. Auf dem Weg durch ein zerstörtes Deutschland findet Lukas neue Freunde und ein neues Ziel: Zusammen wollen sie die sagenhafte Fechttruppe seines Vaters um Hilfe bitten – die Schwarzen Musketiere. Doch um die mutigste Kampftruppe Wallensteins zu finden, müssen sie direkt an die vorderste Kriegslinie … Zwischen Fantasy und Wirklichkeit Die Erzählung spielt vor der Kulisse des Dreißigjährigen Krieges. Gekonnt lässt Oliver Pötzsch Magie und magische Elemente in den historischen Hintergrund miteinfließen und erschafft eine Welt zwischen Fantasy und Wirklichkeit. Geschichtliche Kontexte treffen auf Hexen und furchteinflößende Traumgestalten. Von internationalem Bestsellerautor Oliver Pötzsch überzeugt mit seinen spannenden Romanen. Auch seine 2022 erschienenen Bücher Das Mädchen und der Totengräber und Die Henkerstochter und die schwarze Madonna sicherten sich wieder Plätze auf der Spiegel-Bestsellerliste. Auch international feiert der Autor große Erfolge. Seine Henkerstochter-Serie wurde bisher in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Nun überzeugt er mit der Neuauflage seiner Jugendbuchserie Die Schwarzen Musketiere in neuem Gewand auch junge Leser*innen ab 14.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Buchvorderseite
Oliver Pötzsch
DIE SCHWARZEN MUSKETIERE
Das Buch der Nacht
Titelseite
Oliver Pötzsch
DIE SCHWARZEN MUSKETIERE
Das Buch der Nacht
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2023
© 2023 by LAGO Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
HINWEIS:
Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf konsequente Mehrfachbezeichnung wurde aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet.
Dieses Buch erschien 2016 zuerst bei bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH. Dies ist eine Neuausgabe.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).
Redaktion: Martina Kuscheck
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/AcantStudio, EAKARAT BUANOI, Nadine.de.trevile
Satz: Christiane Schuster | www.kapazunder.de
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95761-227-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-95762-344-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95762-345-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.lago-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für den Jungen, der ich einmal war.
Ich glaube, diese Geschichte hätte ihm gefallen.
INHALT
PROLOG
1: ELF JAHRE SPÄTER ...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EPILOG
LEXIKON
KLEINES WÖRTERBUCH DER FECHTKUNDE
DANKE
ÜBER DEN AUTOR
PROLOG
8. November, im Jahre des Herrn 1620, nahe Prag in Böhmen
Als die Tür der Kirche krachend aufflog, wusste die alte Nonne, dass der Tod gekommen war, um sie zu holen.
Durch die zersplitterten Fenster drang Schlachtenlärm herein – das ohrenbetäubende Krachen der Musketen und Kanonen, das Wiehern verängstigter Pferde, die Schreie sterbender Männer.
Vieler sterbender Männer.
Die Schlacht am Weißen Berg dauerte nun schon über eine Stunde. Das Heer der böhmischen Rebellen hatte sich oben auf dem vermeintlich uneinnehmbaren Hügel verschanzt. Doch die kaiserlichen Soldaten stürmten wie die Berserker gegen den Berg an und ihr vielstimmiger Kampfruf »Santa Maria« war bis ins nahe gelegene Prag zu hören. Fast dreißigtausend Landsknechte führte der legendäre Feldherr Tilly gegen die Aufständischen, die sich gegen den Deutschen Kaiser gewendet und ihren eigenen neuen König gewählt hatten. Mit Piken, Lanzen und Säbeln wehrten sie sich tapfer und wurden doch einer nach dem anderen niedergemacht.
An dem zerkratzten Brustpanzer und dem schief ins unrasierte Gesicht hängenden Helm erkannte die alte Nonne, dass der Mann, der nun grinsend auf sie zukam, ein spanischer Söldner war, der im Dienst der kaiserlichen Truppen stand. Er ließ den Säbel durch die Luft zischen, in seinen Augen glitzerte Mordlust.
»Wo ist es?«, zischte er, während er die Waffe in einer plötzlichen Bewegung nach vorne schnellen ließ und erst knapp vor der Kehle der alten Frau abrupt innehielt.
»Wo ist was?«, erwiderte die Nonne mit ruhiger Stimme.
Als Äbtissin des ältesten Klosters in ganz Böhmen war die hochwürdige Mutter Agathe ebenso weise wie tapfer. Selbstverständlich wusste sie, was der Mann von ihr wollte. Immer wieder hatte es Versuche gegeben, ihr den mächtigen Gegenstand zu entwenden. Doch das Kloster Sankt Georg gleich neben der Prager Burg war bislang ein zu sicherer, zu gut bewachter Ort für jeden Dieb gewesen. Leider waren diese Zeiten nun vorbei, jetzt herrschten Chaos und Krieg in Böhmen. Und eine der schlimmsten Ausgeburten des Krieges stand mit erhobenem Säbel vor Mutter Agathe. Ein über sechs Fuß großer, breitschultriger Söldner, der über Leichen gehen würde, um der Äbtissin ihr wertvollstes Gut zu rauben.
Ein menschgewordener Dämon, über dessen rechte Wange sich eine wulstige Narbe zog.
»Melo das!«, zischte der Mann auf Spanisch und kam noch einen Schritt näher, doch Mutter Agathe wich keine Handbreit zurück. Wenn sie jetzt aufgab, war alles vergebens – sie musste stark bleiben, bis zum bitteren Ende. Das Geheimnis zu hüten, war die letzte Aufgabe, die ihr Gott übertragen hatte.
Als immer klarer wurde, dass die böhmischen Aufständischen den Krieg gegen den Kaiser verlieren würden, hatte die Äbtissin den mächtigen Gegenstand kurzerhand aus der Stadt gebracht. Gemeinsam mit ihrer treuesten Dienerin war sie durch ein kleines verstecktes Tor entkommen und in die nahe gelegenen Wälder geeilt. Doch jemand hatte sie offenbar bemerkt. Die Landsknechte waren plötzlich überall gewesen, sie hatten sie gejagt wie die Tiere. Hier in der Kirche schien Mutter Agathes Flucht nun zu Ende zu gehen. Ohne den Blick von dem Söldner zu wenden, bereitete sie sich auf ihren baldigen Tod vor.
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, sagte sie mit fester Stimme.
»Das weißt du ganz genau, Alte«, knurrte der Spanier, nun wieder in gebrochenem Deutsch. »Wir haben dich beobachtet, schon lange. Hast wohl geglaubt, du könntest uns entwischen, was?« Die Spitze des Säbels befand sich nun direkt an ihrer Kehle. »Also, wo ist es? Spuck’s schon aus! Und wo ist die junge Nonne, die dich bis eben noch begleitet hat?«
Mutter Agathe lächelte, während sie mit ihren dürren Händen auf das zerstörte Innere der Kirche wies. »Habt ihr wirklich gedacht, ich wäre so dumm, in diese Mausefalle zu fliehen, wenn ich vorher nicht einen Plan gehabt hätte? Blind vor Hass seid ihr mir gefolgt, du und deine Bluthunde. Ha, das Mädchen ist längst über alle Berge!« Sie presste kurz die Lippen aufeinander. »Das Mädchen und auch das, was du so dringend suchst. Du kannst deinem Herrn also ausrichten, dass er es niemals bekommen wird. Niemals wird er damit Unheil über die Menschheit bringen! Es ist gut versteckt!«
»Du … du Teufelin! Bruja!«
Ohne nachzudenken, stieß der Söldner mit dem Säbel zu. Stöhnend brach die alte Äbtissin zusammen.
»Dein Herr ist der Teufel, nicht … nicht ich«, stieß sie noch hervor. »Ihr … ihr habt versagt.«
Ihre Augen brachen und auf ihrem Gesicht breitete sich mit einem Mal ein friedliches Lächeln aus.
»Maldito!« Der Spanier stieß noch einmal mit der Stiefelspitze gegen den leblosen Körper, dann wandte er sich ab. Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte. Die Alte hätte ihm erzählen müssen, wo diese andere Nonne war. Jetzt würde er vielleicht niemals das finden, wonach er ausgeschickt worden war.
Sein Herr würde sehr, sehr böse sein.
Der Söldner trat hinaus in den Novembernebel, der noch immer wie Pulverdampf über der verlassenen Kirche hing. Draußen warteten bereits seine Mitstreiter, die ihn von ihren klapprigen Gäulen aus mit neugierigen Augen musterten.
»Sucht dieses junge Weib!«, befahl er. »Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und, zum Henker, bringt mir die Frau lebend! Sie ist die Einzige, die uns jetzt noch sagen kann, wo wir suchen müssen.« Er spuckte zu Boden und steckte den blutigen Säbel zurück in die Scheide.
Aus dem Nebel war plötzlich ein infernalischer Lärm zu hören. Das Blitzen der Kanonen oben auf dem Berg sah aus wie fernes Wetterleuchten, dazwischen ertönte der vielstimmige Schrei der Landsknechte, wie aus der Kehle eines riesigen tausendköpfigen Monstrums.
»Santa Maria!«
Die Kaiserlichen hatten die Schlacht gewonnen.
1ELF JAHRE SPÄTER ...
Am 25. September, im Jahre des Herrn 1631,
Burg Lohenstein bei Heidelberg in der Pfalz
Der Schlag erwischte Lukas seitlich an der Schläfe. Er taumelte, wankte ein paar Schritte zurück, bis er hinter sich glücklicherweise den mächtigen Stamm einer Eiche spürte. Wenige Augenblicke später straffte er sich wieder und ging seinerseits zum Angriff über. Seine Hiebe kamen präzise – Finte, Attacke, Parade, Oberhau, schneller Rückzug, ein zweiter Ausfall und dann ein plötzlicher Stoß nach vorne, der seinen Gegner ins Stolpern brachte. Schon war dieser kurz davor, nach hinten umzufallen.
Eben wollte Lukas zum letzten entscheidenden Hieb ansetzen, als ihn die Waffe des anderen blitzschnell an der Schwerthand traf. Mit einem überraschten Aufschrei ließ Lukas seinen Stock fallen, während ihm Tränen des Schmerzes in die Augen stiegen.
»Du … du hast gemogelt, Vater!«, brachte er keuchend hervor. »Du hast nur so getan, als würdest du umfallen!«
Lachend warf Friedrich von Lohenstein seinen geschnitzten Eschenholzprügel in die Büsche und klopfte Lukas auf die Schulter.
»Im Kampf geht es niemals fair zu«, sagte er schließlich schmunzelnd. »Das musst du noch lernen. Es geht nur darum, wer gewinnt.«
»Aber wir sind doch Ritter!«, protestierte Lukas.
»Du ein Ritter?« Sein Vater lachte dröhnend. »Ich fürchte, bevor du ein Ritter wirst, musst du noch die eine oder andere Hirschkeule essen. Zurzeit sehe ich vor mir nur einen zwölfjährigen, ziemlich schmächtigen Knirps.«
Lukas biss die Lippen zusammen. Er hasste es, wenn ihn der Vater wegen seiner geringen Körpergröße aufzog. Tatsächlich war er unter Gleichaltrigen meist der kleinste, dafür konnte er aber am geschicktesten mit dem Stock und dem stumpfen Florett umgehen. Es war lange her, dass es jemand von seinen Freunden gewagt hatte, ihn einen Knirps zu nennen. Denn Lukas’ Jähzorn war berüchtigt – ebenso wie sein Können. Sooft sein Vater etwas Zeit fand, übte er mit Lukas im Burghof oder in den Wäldern nahe der Burg, auch heute an seinem Geburtstag.
»Ich bin heute dreizehn geworden!«, wandte er sich entrüstet an seinen Vater. »Hast du das etwa schon vergessen?«
Friedrich von Lohenstein hob entschuldigend die Hände. »Verzeihung, du hast recht.« Er verbeugte sich. »Nun, edler Herr Ritter Lukas von Lohenstein. Darf ich Euch nach diesem Schaukampf zu einem Becher Apfelsaft auf meine armselige Burg einladen?«
Lukas lachte, während sein Vater ein paar weitere komische Bücklinge machte. Der Zorn war verflogen. Den ganzen Tag über waren sie beide schon im Wald unterwegs gewesen. Zunächst hatten sie mit ein paar von Vaters Untergebenen Hirsche und Rehe gejagt, doch dann hatte ihn Friedrich von Lohenstein auf eine einsame Lichtung geführt und ihm dort ein paar weitere Tricks und Kniffe im Degenkampf beigebracht. Über zwei Stunden lang hatten sie Angriff und Versetzen geübt, wie zwei Tänzer waren sie in endlosen Abfolgen aufeinandergeprallt und hatten sich wieder gelöst, bis Lukas der Schweiß übers Gesicht gelaufen und ihm jeder einzelne Muskel wehgetan hatte.
Das war sein schönstes Geburtstagsgeschenk gewesen.
Es kam nicht oft vor, dass sich sein Vater einen halben Tag lang für ihn Zeit nahm. Meist hatte Friedrich mit der Verwaltung der ihm vom Kaiser übertragenen Burg zu tun, die einen Tagesritt von Heidelberg entfernt etwas abseits im Odenwaldgebirge lag. Oder aber er war weit weg, wo er für den Feldherrn Tilly und dessen Katholische Liga gegen die verfluchten Protestanten kämpfte.
Solange Lukas denken konnte, herrschte irgendwo im Deutschen Reich Krieg. Angefangen hatte wohl alles vor langer Zeit im fernen Böhmen, wo sich die Protestanten gegen den katholischen Kaiser erhoben und dessen Abgesandten aus einem Fenster der Prager Burg geworfen hatten. Die Protestanten waren damals in der Schlacht am Weißen Berg geschlagen worden. Doch seitdem fraß sich der Krieg durch das Deutsche Reich, wie ein Brand, der nicht zu löschen war. Seine Mutter hatte Lukas einmal erzählt, dass der Krieg fast ebenso alt war wie er selbst, und manchmal bekam Lukas den Eindruck, dass das Kämpfen niemals aufhören würde. Solange er lebte.
»Du hast wirklich gute Fortschritte im Degenfechten gemacht«, sagte sein Vater, während sie gemeinsam durch den Wald schritten. Es war Spätsommer und die Blätter an den Buchen und Eichen leuchteten in allen Farben. »Vor allem die Finten, aber auch die Unterhaue gelingen dir immer besser. Ich bin vorhin tatsächlich kurz ins Stolpern gekommen.« Friedrich von Lohenstein schüttelte den Kopf. »Verrat es bloß nicht weiter. Wenn sich herumspricht, dass mich mein eigener dreizehnjähriger Sohn austanzt, nimmt mich Tilly auf keinen Feldzug mehr mit.«
»Umso besser, dann bleibst du immer bei uns auf der Burg«, erwiderte Lukas grinsend. »Bei mir, der Mutter und der Elsa. Und du kannst mir noch mehr Kniffe beibringen.«
Sein Vater seufzte. »Ich fürchte, das geht nicht, Junge. Jetzt da die Schweden ins Reich eingefallen sind, werde ich wohl bald wieder in den Krieg ziehen müssen.«
»Dann nimm mich mit!«, bat Lukas ihn aufgeregt. Er straffte sich, sodass er ein wenig größer wirkte. »Du hast selbst gesagt, dass ich ein guter Degenfechter bin, sogar ein sehr guter. Ich ... ich könnte bei den Schwarzen Musketieren kämpfen, so wie du früher. Ich fange als einfacher Trossjunge an, und dann ...«
»Schluss jetzt mit diesem Unsinn!«, unterbrach ihn sein Vater barsch. »Der Krieg ist kein Kinderspiel. Sei froh, dass du bislang davon verschont geblieben bist. Ja, du magst ein guter Fechter mit dem Stock und dem stumpfen Florett sein, aber wirkliches Kämpfen ist etwas ganz anderes. Da fließt Blut, und ich will nicht, dass es das Blut meines Sohnes ist. Und damit genug!«
Während sie schweigend durch den dicht belaubten Wald stapften und den vielen Vögeln lauschten, dachte Lukas daran, was er bislang von den Erzählungen der Erwachsenen über den Krieg aufgeschnappt hatte. Schon lange hatte Lukas aufgehört zu begreifen, wer eigentlich die Bösen und wer die Guten in diesem ewigen Ringen waren. Katholiken kämpften gegen Protestanten, einzelne deutsche Kurfürsten gegen den Kaiser, aber auch ausländische Mächte wie die Dänen, Spanier oder neuerdings die Schweden waren auf Beute im Reich aus. Die Pfalz, in der Lukas und seine Eltern lebten, war mittlerweile in der Hand des bayerischen Kurfürsten. Nur Friedrich von Lohenstein hatten die Soldaten bislang verschont, weil er auf der Seite des Kaisers und damit der bayerischen Katholiken stand.
Für viele Pfälzer war Lukas’ Vater deshalb ein Verräter. Lukas hatte schon viele Kämpfe mit Gleichaltrigen und auch Größeren bestritten, die seinen Vater hinterrücks verfluchten und verspotteten. Alle hatten sie ihre Sprüche später bereut.
»Wenn ich schon nicht mit dir in den Krieg ziehen darf, dann erzähl mir wenigstens von den Schwarzen Musketieren«, murrte Lukas nach einer Weile, während zwischen den Zweigen ihr Zuhause auftauchte. Burg Lohenstein war ein düsterer Bau mit hohen Mauern, der sich auf einem Felssporn über dem Neckartal befand. Auf den wenigen Feldern ringsum duckten sich einige ärmliche Bauernhäuser, von weiter unten war das Rauschen des wilden Flusses zu hören.
»Also gut«, brummte sein Vater. »Damit du endlich Ruhe gibst. Auch wenn du die Geschichte schon tausendmal gehört hast.« Seine Stimme klang tief und beruhigend, sie erinnerte Lukas an die vielen Male, bei denen ihm sein Vater vor dem Zubettgehen noch etwas erzählt hatte. »Die Schwarzen Musketiere waren die besten Kämpfer im Reich«, begann er. »Ausgebildet in sämtlichen Waffengattungen, von allen gefürchtet. Sie bildeten die Leibgarde des kaiserlichen Feldherrn Wallenstein …«
»Für den du gegen die Dänen gekämpft hast«, unterbrach ihn Lukas. »Du warst selbst einer der Schwarzen, nicht wahr?«
»Zum Teufel, wer erzählt hier? Ich oder du?« Grimmig presste sein Vater die Lippen aufeinander, bevor er weitersprach. »Ja, ich war einer. Wir fochten und schossen wie die Teufel, mit Degen, Piken, Dolchen, Musketen und Pistolen. Wir haben die Dänen und ihre Verbündeten zurück über die Elbe getrieben. Weiß Gott, ich sah nie wieder bessere Kämpfer als diese Haudegen. Ganz in Schwarz gekleidet waren wir, Schatten in der Nacht und Phantome am Tag. Aber der Kaiser hat Wallenstein entlassen und die Schwarzen Musketiere wurden in alle Winde verstreut. Es gibt sie nicht mehr. Sie sind Vergangenheit.« Abrupt klatschte er in die Hände. »So, und nun lass uns sehen, ob die Diener schon das Wildschwein über dem Spieß gebraten haben. Ich sterbe nämlich vor Hunger. Und du solltest auch etwas essen.« Er zwinkerte Lukas zu. »Wenn du irgendwann ein ebenso gefürchteter Kämpfer wie die Schwarzen Musketiere werden willst, dann brauchst du noch ordentlich Speck auf den Rippen.«
Während sein Vater in der Küche verschwand, begab sich Lukas über eine ausgetretene Steintreppe hinauf in den ersten Stock des Palas. Dort, im sogenannten Rittersaal, dem einzigen geheizten großen Raum der Burg, kam ihm seine kleine Schwester Elsa entgegen. An ihren funkelnden Augen erkannte er sofort, dass sie aus irgendeinem Grund böse auf ihn war.
Im Gegensatz zum dunklen Haarschopf, den Lukas von seinem Vater geerbt hatte, hatte Elsa Sommersprossen und strohblonde Haare, die immer ein wenig zerzaust aussahen. Mit ihren neun Jahren war sie ein frecher Wirbelwind, der Lukas gelegentlich den letzten Nerv raubte. Nicht selten wünschte er sich deshalb einen Bruder, mit dem er Stockfechten üben oder zum Fischen an den nahe gelegenen Fluss verschwinden könnte.
»Die Mutter hat gesagt, dass ich morgen mit dir und Vater auf die Jagd darf«, empfing sie ihn trotzig. »Und ich darf auch einmal mit der Armbrust schießen.«
»Du willst schießen?«, erwiderte Lukas lachend. »Wenn du durch den Wald trampelst, läuft das Wild bis nach Heidelberg. Bleib lieber zu Haus und steck deine Nase in Bücher oder stick was.«
»Das könnte dir so passen! Ich soll brav hierbleiben, während Vater und du den größten Spaß haben? Na warte, das … das erzähl ich der Mutter!«
Tränen des Zorns glitzerten in Elsas Augen und Lukas seufzte leise. Der Vater hatte ihm versprochen, dass er ihn morgen auf die große Treibjagd mitnehmen würde. Die Vorstellung, dass Elsa während der gesamten Hatz an seinem Hemdsärmel hängen würde, dämpfte seine Laune spürbar.
»Und wenn ich dir dafür heute Abend eine schöne Geschichte vorlese?«, schlug er in versöhnlichem Ton vor.
»Du kannst doch gar nicht lesen«, erwiderte Elsa spöttisch. »Du tust immer nur so. Ich hab’s das letzte Mal genau gesehen.«
Lukas errötete. Tatsächlich war er im Stock- und Degenkampf wesentlich besser als in Latein, Grammatik und Schönschreiben. Ganz im Gegensatz zu seiner Schwester, die schon jetzt fehlerfrei den römischen Dichter Ovid aufsagen konnte.
»Und wenn schon«, blaffte er. »Du kommst nicht mit auf die Jagd. Das ist was für Männer.«
»Ich wusste gar nicht, dass du schon ein Mann bist«, erklang eine weiche Stimme hinter ihm. Lukas sah sich um und entdeckte seine Mutter, die lächelnd in der Türöffnung stand. »Oder hast du etwa auch schon ein Weib, das du zur Frau nehmen willst?«
»Ich hab ihn mit der Tochter des Schankwirts in der Scheune gesehen!«, krähte Elsa. »Sie haben sich geküsst!«
»Das ist nicht wahr!«
Lukas fiel über sie her, und schon bald balgten sie sich unter dem großen Tisch in der Mitte des Saals.
»Sofort aufhören, ihr zwei!«, befahl seine Mutter. Sie zog Lukas sanft zu sich heran. »Es ist wohl nicht zu viel verlangt, wenn Elsa einmal auf die Jagd mitkommen darf. Nun sei schon vernünftig.«
Lukas schlüpfte aus ihrer Umarmung. »Immer bist du auf ihrer Seite«, presste er hervor. »Sogar an meinem Geburtstag.«
»Aber das stimmt doch nicht«, warf seine Mutter milde ein. »Ihr seid beide meine Kinder und ich habe euch beide gleich lieb. Eben jedes auf seine Art«, fügte sie zögernd hinzu.
Sophia von Lohenstein hatte freundliche kluge Augen, die sie älter wirken ließen als ihre etwa dreißig Jahre. Trotz ihrer Stellung als Burgherrin trug sie meist ein schlichtes Leinenkleid, das ihr ein wenig das Aussehen einer Bäuerin gab. Ihr Gatte tadelte sie manchmal deshalb, aber Sophia war gerne unter dem einfachen Volk. Oft war sie unterwegs in den Dörfern, wo sie als erfahrene Heilerin bekannt war. Es gab einige Leute, die raunten, sie habe magische Fähigkeiten. Von wundersamen Heilungen sprach man, aber auch von blühenden Blumen im Winter und Suppe, die plötzlich in einem leeren Kessel auftauchte.
Einmal, als Lukas noch sehr klein gewesen war, war es deshalb fast zu einem Prozess gekommen, weil man die Burgherrin der Hexerei verdächtigte. Aber das war natürlich Unsinn, wie Lukas wusste.
»Elsa kann dich ja bei deinem nächsten Ausflug in die Dörfer begleiten«, schlug Lukas seiner Mutter vor. »Sie wird bestimmt einmal eine ebenso gute Heilerin wie du. Und ich werde eben ein guter Kämpfer und Jäger wie Vater.«
»Oho, höre ich da etwa heraus, dass einer seine Lateinübungen nicht machen möchte?«, entgegnete Sophia von Lohenstein und drohte ihrem Sohn spielerisch mit dem Finger. »Bevor die nicht erledigt sind, gehst du nirgendwo hin, junger Mann.«
Lukas verdrehte die Augen und seine Mutter gab ihm einen Kuss. »Nun, wir werden sehen, was morgen geschieht«, beruhigte sie ihn. »Jetzt wollen wir erst mal essen.«
Plötzlich merkte Lukas, wie hungrig er war. Er hatte seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Schon kurz darauf brachten die Diener Platten mit dampfenden Hirschschlegeln, Wildschweinkeulen und warmem, duftendem Brot herein. Auch der Vater setzte sich zu Tisch. Gemeinsam fassten sie sich an den Händen und sprachen ein Dankesgebet, während Lukas schon ganz in Gedanken bei der morgigen Treibjagd war. Ob er wohl mit der Armbrust einen Keiler erlegen würde? Oder vielleicht sogar einen kapitalen Hirsch?
Erst nach einer Weile fiel ihm auf, wie betrübt sein Vater wirkte. Schweigend nippte der große Mann an seinem Weinkelch. Etwas schien ihn zu beschäftigen.
»Was hast du?«, fragte seine Frau und schob ihrem Gatten ein besonders großes Stück Fleisch zu. »Gibt es schlechte Neuigkeiten?«
Friedrich nickte. »In der Tat. Die verfluchten Schweden haben Tillys Armee drüben in Sachsen eine verheerende Niederlage beigebracht. Ein Bote kam gerade mit der Nachricht. Es heißt, wir haben über zwölftausend Mann verloren.«
»Wird Tilly den Krieg denn verlieren?«, fragte Lukas zaghaft zwischen zwei Bissen. Eine leise Angst überkam ihn. Neben dem katholischen Kaiser war es bislang der Feldherr Tilly gewesen, der seine Hand über Burg Lohenstein und seine Bewohner gehalten hatte. Wenn er geschlagen oder sogar tot war, was geschah dann mit ihnen?
»Tilly ist ein zäher Hund«, entgegnete sein Vater. »Aber ich fürchte, ich werde schon bald wieder in den Krieg ziehen müssen. Das Heer braucht jetzt jeden Mann.«
»Dann gehst du wieder von uns weg?«, fragte Elsa leise.
»Irgendwann ja.« Friedrich seufzte, doch dann erschien plötzlich ein Lächeln auf seinem Gesicht. »Aber nicht heute. Und auch nicht morgen.« Er hob das Glas mit Rotwein, während er seinen Kindern den Krug mit süßem Apfelmost hinüberschob. »Und nun lasst uns gemeinsam anstoßen. Auf die verflucht besten Kinder und die beste Ehefrau, die in der ganzen Pfalz zu finden sind.«
Die Becher und Gläser klirrten und Lukas’ Angst verschwand mit jedem weiteren köstlichen Bissen. Der Vater würde sie beschützen, so wie er es immer getan hatte. Sie waren die Familie Lohenstein, treue Freunde des Kaisers. Wer konnte ihnen schon etwas anhaben? Hier auf ihrer Burg waren sie sicher.
Die Augen seiner Mutter leuchteten, während sie den Nachtisch austeilte – Quarkkrapfen mit heißen Himbeeren, seine Leibspeise.
»Alles Gute zum Geburtstag, Lukas«, sagte die Mutter lächelnd.
Lukas löffelte das warme, honigsüße Kompott, hinter ihm flackerte ein Feuer im Kamin und er fühlte sich warm und geborgen. Er wusste nicht, dass dies der letzte Abend war, den er im Kreise seiner Familie verbringen würde.
Kurze Zeit später wälzte sich Lukas in seinem Bett und blickte auf die flackernden Schatten, die die Talgkerze an die Wand warf.
Im zweiten Bett der Kammer lag Elsa. Gebannt blätterte sie in einem zerfledderten Buch, das sie aus der Burgbibliothek mitgenommen hatte. Auf bunten Zeichnungen waren dort die seltsamsten Tiere zu sehen: Drachen mit drei Köpfen, Seeschlangen mit weit geöffnetem Maul und Löwen mit dem Schwanz eines Skorpions.
»Was um Himmels willen ist das?«, fragte Lukas nach einer Weile gähnend. Der Tag war lang und anstrengend gewesen, er hatte Mühe, die Augen offen zu halten.
»Das? Ein Buch über die Tiere im fernen Afrika«, erklärte Elsa belehrend. »Es ist ziemlich spannend und man kann einiges daraus lernen.«
»Aber es ist in Latein!«, entgegnete Lukas kopfschüttelnd. »Wie kann etwas spannend sein, wenn es in Latein geschrieben ist?«
»Es ist gar nicht so schwierig. Die meisten Wörter kenne ich schon aus unseren Schulbüchern. Leo zum Beispiel, das heißt Löwe. Und ein Mantikor ist …«
»Hör bloß auf damit«, unterbrach sie Lukas. »Mir reicht es schon, dass mich die Mutter damit quält. Da muss es nicht auch noch meine kleine Schwester sein.«
»Selber schuld. Dann bleib eben dumm. Aber bitte mich nicht um Hilfe, wenn dich mal so ein grausiger Mantikor angreift.«
Elsa vertiefte sich wieder in ihr Buch, während Lukas über eine schlagfertige Antwort nachdachte. Doch ihm fiel keine ein. Manchmal brachte ihn seine Schwester wirklich zur Weißglut. Aber dann gab es wieder Momente, in denen er sie mehr liebte als alles auf der Welt. Lukas konnte sich noch erinnern, wie er Elsa als Säugling in den Armen gehalten hatte. So winzig und zerbrechlich war sie gewesen! Er hatte sie geführt, als sie ihre ersten Schritte gemacht hatte, er hatte sie gefüttert und in den Schlaf gesungen. Über all die Jahre war ein Band zwischen ihnen gewachsen, das sich auch durch gelegentliche Streitereien nicht zerstören ließ.
Trotzdem ärgerte es ihn maßlos, dass Elsa morgen bei der Treibjagd mit dabei sein sollte. Wer war er denn? Ihre Amme? Kämpfen und Jagen war etwas für Männer, da hatten Mädchen nichts zu suchen! Vor allem dann nicht, wenn sie ihn mit lateinischen Fremdwörtern quälten.
Im gleichen Augenblick fiel Lukas ein, dass er seine Lateinübungen noch nicht gemacht hatte. Die Mutter hatte vorhin deutlich gesagt, dass er ohne die Übungen nicht auf die Jagd gehen durfte!
»Elsa?«, begann er zaghaft. »Äh, ich mache dir einen Vorschlag. Du darfst morgen mit auf die Jagd, aber dafür …«
»Dafür helfe ich dir vor dem Frühstück noch bei deinen Lateinübungen«, unterbrach ihn Elsa gähnend. »Ist es das, was du sagen wolltest?«
Lukas zuckte zusammen. Manchmal schien Elsa tatsächlich Hellseherin zu sein. Eine Gabe, die sie vermutlich von ihrer Mutter hatte.
»Ähm, ja«, antwortete er. »Würdest du das für mich tun?«
»In Ordnung, aber nur unter einer Bedingung. Nämlich, dass ich noch kurz unter deine Decke schlüpfen darf.« Elsa legte das Buch zur Seite und sah ängstlich zu ihm herüber. »Diese Geschichten von Mantikoren und Feuer speienden Drachen sind doch gruseliger, als ich dachte.«
Lukas nickte lächelnd, und Elsa kroch zu ihm ins Bett, wo sie schon bald darauf friedlich einschlief, den kleinen Körper zart an den seinen geschmiegt. Er spürte noch ihre warme Haut auf seinem Hemd, dann fielen auch ihm endlich die Augen zu.
Kleine Schwestern mochten ja manchmal eine Plage sein, aber ohne sie ging es eben auch nicht.
2
Als Lukas am nächsten Morgen erwachte, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte.
Der Vater stand kerzengerade an seinem Bett, sein Blick war düster und angespannt. Er starrte durch das kleine Fenster, das von der Kammer hinaus in den Hof führte, ganz so, als würde dort etwas unendlich Böses lauern. Draußen herrschte graues Zwielicht, der Tag war noch nicht ganz angebrochen.
»Schnell, weck deine Schwester und dann geht ihr hinüber in den Bergfried«, befahl Friedrich von Lohenstein. »Ich will, dass ihr euch unten im Kerker versteckt. Dort ist es am sichersten.«
»Im Kerker?«, erwiderte Lukas verdutzt und rieb sich die müden Augen. »Aber warum …«
»Frag nicht, sondern tu einfach, was ich dir sage«, unterbrach ihn der Vater harsch. »Ihr bleibt dort unten, bis ihr von mir etwas anderes hört.« Ohne ein weiteres Wort wandte er sich um und verließ die Kammer.
Von einem Augenblick auf den anderen war Lukas hellwach. Noch nie hatte er seinen Vater so erlebt. Es schien fast, als hätte der sonst so tapfere Kämpfer vor etwas große Angst. Als Lukas zum Fenster eilte, sah er im Dämmerlicht draußen vor der Burg einen Trupp von etwa zwei Dutzend unbekannten Reitern. Konnte es sich dabei um feindliche Soldaten handeln? Waren das etwa bereits die Schweden, von denen sein Vater gesprochen hatte?
Schnell zog Lukas Hemd, Lederwams und Hose an, dann weckte er Elsa, die noch immer tief und fest neben ihm schlief.
Doch seine Schwester drehte sich nur murrend zur Seite. »Nur noch bis zum nächsten Hahnenschrei«, murmelte sie. »Es ist ja nicht mal richtig hell.«
Lukas biss sich auf die Lippen. Der Vater hatte ihm befohlen, mit Elsa auf schnellstem Weg in den Bergfried zu gehen. Wenn er sich jetzt auf lange Diskussionen einließ, war es vielleicht zu spät. Also beschloss er, eine List anzuwenden.
»Komm, wir spielen ein Spiel«, lockte er und versuchte dabei, ruhig und fröhlich zu klingen. »Wir verstecken uns im Kerker. Und der Vater muss uns suchen. Na, was hältst du davon?«
»Im Kerker verstecken?« Verschlafen und mit verstrubbelten Haaren richtete sich Elsa im Bett auf. Nun war sie doch neugierig geworden. »Ich dachte, wir gehen heute auf die Jagd?«
»Äh, ja. Aber noch nicht gleich. Wir warten noch auf die Treiber aus dem Dorf.«
Elsa verzog angeekelt das Gesicht. »Bäh, im Kerker stinkt es und es gibt dort Ratten. Ich will nicht da runter.«
»Aber es ist das beste Versteck auf der ganzen Burg«, raunte Lukas. »Vater wird uns dort nie finden. Komm, sei kein Angsthase.«
»Also gut.« Sie musterte ihn misstrauisch. »Aber glaub nur nicht, dass du mich dort unten einsperren und allein mit dem Vater auf die Jagd gehen kannst. So blöd bin ich nicht.«
Widerwillig und noch immer müde ließ sich Elsa im Nachthemd aus der Kammer führen. Unten auf dem Hof waren im Dämmerlicht bereits einige aufgeregte Bedienstete zusammengelaufen, Friedrich von Lohenstein stand zwischen ihnen und gab knappe Befehle, die Lukas aber nicht verstehen konnte. Zwei Burgmannen waren eben dabei, die Zugbrücke herunterzulassen und das Tor zu öffnen.
Offenbar sind die Männer vor der Burg doch nicht die Schweden, dachte Lukas. Warum aber dann diese Aufregung?
»Was machen die Diener denn da?«, wollte Elsa wissen.
»Sie lassen die Treiber herein. Und nun komm schon, bevor uns der Vater sieht.«
Nur wenige Augenblicke später hatten Lukas und Elsa den Bergfried erreicht. Der Turm mit seinen meterdicken Steinwänden war der sicherste Teil der Burg. Hierher zogen sich die Burgbewohner bei einer Belagerung zurück. Eine steile Holztreppe führte an der Außenwand entlang zu einer massiven Tür, etwa zehn Schritt über dem Hof. Im Inneren des Turms gab es eine Falltür und eine Leiter, die hinab in den stinkenden Kerker führte. Der noch brennende Stumpf einer Fackel hing in einer Halterung nahe der geöffneten Falltür.
»Dort runter«, befahl Lukas seiner Schwester und griff nach der Fackel. »Schnell!«
Er kletterte mit Elsa die Leiter hinunter und schloss geschwind die Luke über ihnen. Das trübe Licht der Fackel reichte nur ein, zwei Schritt weit, von irgendwoher war das Fiepen von Ratten zu hören. Außerdem stank es abscheulich nach Kot und Fäulnis.
»Das ist ein blödes Versteck«, murrte Elsa. »Ich will wieder nach oben und mich für die Jagd anziehen.«
»Das … das geht jetzt nicht«, stotterte Lukas, bemüht um eine Ausrede. »Vater würde uns sonst sehen und wir hätten das Spiel verloren. Wir müssen wohl oder übel noch ein wenig hier warten.«
»Wenn’s denn unbedingt sein muss. Dafür lässt du mich nachher aber an die Armbrust. Versprochen?«
Lukas nickte geistesabwesend. Gemeinsam kauerten sie auf dem feuchten Stroh im Zwielicht der Fackel. Nach einer Weile drangen gedämpfte Stimmen zu ihnen herunter, offenbar hatten die fremden Männer nun den Burghof erreicht. Doch außer gelegentlichen Wortfetzen war nichts zu verstehen.
Irgendwann hielt Lukas es nicht mehr aus. Er musste erfahren, was dort oben vor sich ging! Auch wenn er seinem Vater versprochen hatte, mit Elsa im Kerker zu bleiben.
»Hör zu«, sagte er zu seiner Schwester. »Ich werde mal nachschauen, wo der Vater steckt. Vielleicht können wir ihn ja überraschen.«
»Ich will aber hier nicht allein bleiben«, jammerte Elsa. »Ich hab Angst und es ist kalt! Du willst mich nur hier unten einsperren, gib’s zu!«
»Ich lass die Luke auf, in Ordnung?«, schlug Lukas vor. »Und die Fackel bleibt auch hier. Aber dafür musst du mir versprechen, dass du hier bleibst. Sonst …« Er drohte mit dem Finger. »Sonst lass ich dich nachher nicht an die Armbrust, verstanden?«
Elsa nickte zögernd. Erst dann kletterte Lukas die Leiter nach oben und klappte so leise wie möglich die Falltür auf. Noch immer konnte er nichts Genaues verstehen. Also beschloss er, die Tür des Bergfrieds einen winzigen Spalt weit zu öffnen.
Durch den Schlitz erblickte er einige fremdländisch aussehende Männer auf Pferden. Sie trugen schwarze Pluderhosen, Brustpanzer und Helme mit hohem Kamm, wie sie bei spanischen Söldnern üblich waren. Die Spanier waren Verbündete des Kaisers, so viel wusste Lukas. Wer aber war der hagere, vornehm wirkende Mönch auf dem frisch gestriegelten Rappen? Er trug eine schneeweiße Kutte mit dünnem schwarzem Umhang darüber, eine seidene Kappe zierte sein schütteres, fahlblondes Haar. Die Nase stach aus dem blassen Gesicht hervor wie der Schnabel eines Raubvogels. Eben sprach er von oben herab zu Friedrich von Lohenstein, der mit verschränkten Armen vor dem tänzelnden Pferd des Geistlichen stand.
»… häufen sich die Beweise gegen Eure Frau Gemahlin«, sagte der Mönch gerade. »Wir werden sie also nach Heidelberg mitnehmen, um sie dort eingehend zu befragen.«
»Niemand nimmt meine Sophia mit«, erwiderte Friedrich von Lohenstein und trat einen Schritt vor. »Ihr habt schon einmal versucht, meine Gattin der Hexerei anzuklagen, von Schönborn. Ich werde kein weiteres Mal zulassen, dass Ihr sie mir wegnehmt.«
Unwillkürlich zuckte Lukas zusammen. Diese Männer waren keine feindlichen Söldner, aber sie waren auch keine Verbündeten. Sie waren gekommen, um seine Mutter als Hexe anzuklagen! Lukas wusste, was man mit Hexen machte. Sie wurden gefoltert und schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, damit nichts von ihrem bösen Fleisch auf Erden zurückblieb.
»Ihr vergesst, dass ich ein Reichsritter bin, von Schönborn«, fuhr sein Vater eben fort. »Der Kaiser und Tilly stehen beide hinter mir. Wollt Ihr Euch wirklich mit ihnen anlegen? Ihr habt es schon mal versucht und seid gescheitert.«
Der Mönch winkte ab. »Der Kaiser ist weit weg und Tilly hat genug mit den Schweden zu tun. Außerdem haben sich die Zeiten seit unserem letzten Treffen geändert.« Mit einem triumphierenden Lächeln zog er ein Dokument hervor, das ein großes rotes Siegel trug. »Seht selbst. Kein Geringerer als der Papst hat mich zum Inquisitor ernannt. Das heißt, ich habe die Erlaubnis der Kirche, ketzerischen Umtrieben Einhalt zu gebieten und Hexen aufzuspüren. Also, redet schon. Wo ist die Hexe?«
»Wenn Ihr damit meine Frau meint, die ist nicht hier«, erwiderte Friedrich von Lohenstein trotzig. »Sie besucht Verwandte am Rhein.«
»Soso, Verwandtenbesuche … Wie überaus höflich.« Der Mönch lachte leise. »Dann werdet Ihr sicher nichts dagegen haben, wenn wir Eure Burg durchsuchen.« Er wandte sich an die spanischen Söldner. »Dreht jeden Stein hier um.«
Entsetzt beobachtete Lukas, wie ein besonders groß gewachsener Landsknecht sich mit einer geladenen Armbrust dem Bergfried näherte. Schon knarrten die Treppenstufen, als der Hüne sich nach oben zur Tür begab. Eine wulstige Narbe zog sich quer über seine rechte Wange.
In diesem Augenblick trat Sophia von Lohenstein auf den Balkon des Palas.
»Ihr könnt Euch die Mühe sparen, Waldemar von Schönborn«, sagte sie und funkelte den Inquisitor dabei zornig an. »Hier bin ich, nehmt mich mit. Ich habe ein reines Gewissen.«
Lukas presste die Hand auf den Mund, um nicht laut aufzuheulen. Warum hatte seine Mutter das getan? Warum hatte sie sich nicht ebenso versteckt wie er und Elsa? Nun war alles verloren!
Der Mönch lächelte grimmig, dann gab er seinen Schergen ein Zeichen. »Packt die Hexe!«
»Neeeeiiiin!«
Es war Friedrich von Lohenstein, der geschrien hatte. Zornig brüllend rannte er mit gezogenem Schwert auf den Inquisitor zu. Im gleichen Augenblick richtete der große Söldner auf der Treppe zum Bergfried seine Armbrust auf den Reichsritter. Ein leises Klicken war zu hören, dann steckte ein Pfeil in Friedrichs Brust. Friedrich taumelte noch einige Schritte, bevor er direkt vor dem Pferd des Mönchs zusammenbrach.
»Du … du Hund …«, stöhnte er. »Gott … verfluche dich …«
Als der Ritter sich noch einmal erheben wollte, bohrte sich ein weiterer Pfeil in seine Halsbeuge. Ein letztes Zittern ging durch seinen muskulösen Körper, schließlich rührte er sich nicht mehr. Rotes Blut vermischte sich mit dem Staub des Burghofs.
»So wird es allen Feinden des wahren Glaubens ergehen!«, rief der Inquisitor und wandte sich an die Burgbediensteten, die starr vor Angst auf dem Hof verharrten. »Lasst euch das eine Lehre sein.«
Mittlerweile hatten die Söldner den Balkon des Palas erreicht, wo sich Sophia von Lohenstein ohne Gegenwehr abführen ließ. Ihr Blick verharrte noch einmal kurz auf dem Bergfried, wie ein letzter Gruß an ihre beiden Kinder.
Im gleichen Moment ertönte direkt hinter Lukas ein leises Jammern. Er drehte sich um und bemerkte entsetzt Elsa, die unbemerkt die Kerkerleiter hochgeklettert war und nun direkt hinter ihm stand.
»Was geht hier vor?«, fragte sie ängstlich. »Wo sind die Eltern?«
Lukas konnte ihr nicht antworten. Er brachte nur ein ersticktes Schluchzen hervor. Nun fing Elsa auch noch an zu weinen, zuerst leise, dann immer lauter. Offenbar hatte sie mittlerweile den leblosen Vater auf dem Burghof entdeckt. Die immer größer werdende Blutlache neben Friedrich von Lohensteins Hals ließ keinen Zweifel daran, dass er tot war.
»Ich … will … zur … Mutter, ich … will … zur … Mutter«, wiederholte Elsa wie eine Beschwörungsformel. »Ich … will …«
»Still!«, keuchte Lukas. »Sie werden uns hören! Du musst …«
Doch es war zu spät. Der Blick des Mönchs richtete sich bereits auf den Bergfried. »Die Kinder!«, rief er. »Sie sind da drin! Bringt mir das Mädchen lebend, schnell! Den Jungen tötet!«
Einen Augenblick verharrte Lukas wie versteinert, dann sah er sich panisch nach einem Fluchtweg um. Eine steinerne Treppe führte in den ersten Stock des Bergfrieds, dort gab es ein größeres Fenster, durch das er und seine Schwester vielleicht klettern konnten. Er riss die weinende Elsa mit sich, und gemeinsam rannten sie die Stufen nach oben, während unter ihnen bereits das Poltern schwerer Söldnerstiefel zu hören war.
Das Fenster ging zur Westseite und lag etwa zwei Schritt über einem Schuppendach. Wenn Lukas sich geschickt anstellte, konnte er auf das schräge Dach springen und von dort aus die Burgmauer erreichen. Aber was war mit Elsa? Konnte sie es schaffen?
»Wir müssen da runter, Elsa!«, befahl er und deutete auf das Dach, auf dem ein paar lose Schindeln lagen. »Komm schon, spring!«
Doch Elsa schüttelte nur den Kopf. Der Anblick des toten Vaters hatte ihr offenbar einen Schock versetzt. »Das ist ein dummes Spiel«, jammerte sie. »Ich … ich will nicht mehr spielen.«
»Verdammt, das ist kein Spiel mehr!«, schrie Lukas. »Es geht um unser Leben. Und jetzt spring endlich!«
Aber Elsa schüttelte weiter den Kopf und weinte. Unter ihnen stiegen die ersten Männer nun die Steintreppe empor. Lukas erinnerte sich, was der Inquisitor eben noch gesagt hatte. Aus irgendeinem Grund sollte nur er getötet werden, nicht aber Elsa. Warum? Was hatten diese Ungeheuer mit Elsa vor? Zum weiteren Nachdenken blieb keine Zeit mehr. Er musste eine Entscheidung treffen. Wenn er hierblieb, würden sie ihn erschlagen wie einen tollen Hund. Wenn er weglief, war er ein Feigling. Doch tot nutzte er keinem mehr etwas. Außerdem hatte dieser grausame Inquisitor offenbar nicht vor, Elsa sofort zu töten – warum auch immer.
Lukas drückte seiner Schwester einen letzten Kuss auf die von Tränen nasse Wange. »Ich … ich komme zurück, Elsa«, flüsterte er. »Ich lass dich nicht allein, versprochen.«
Als er noch einmal hinunter zum Burghof blickte, sah er seine Mutter, die sich von ihren Wächtern losgerissen hatte und auf den Bergfried zurannte.
»Flieht, Kinder, flieht!«, schrie sie. »Sie dürfen euch niemals …« Doch da hatten die beiden Söldner sie bereits eingeholt und warfen sich auf sie.
»Ich werde dich nicht im Stich lassen, Elsa«, hauchte Lukas ein letztes Mal. »Das schwöre ich, bei meinem Leben.« Dann sprang er auf das Dach des Schuppens.
Er rutschte auf einer der Schindeln aus und drohte über die schräge Fläche zu rutschen. Doch kurz vor dem Abgrund hatte er sich wieder gefangen. Keuchend richtete er sich auf und hastete über das Dach, während um ihn herum die ersten Armbrustbolzen zischten. Irgendwo hinter ihm schrie seine Schwester. Lukas rannte auf die Burgmauer zu, die direkt an den Schuppen grenzte. Ein Stück weiter links kannte er eine alte knorrige Eiche, die nah genug an der Mauer stand, sodass er sie mit einem Sprung vielleicht erreichen konnte.
Er nahm kurz Anlauf, hechtete sich hinüber zu der Eiche und erwischte ein paar dünne Zweige. Krachend fiel er einige Schritt nach unten durch das Blattwerk, bis er sich endlich an einem dickeren Ast festhalten konnte.
»Lukas, hilf mir!«, schrie Elsa von irgendwo hinter der Burgmauer. »Geh nicht weg!« Doch es klang bereits weit entfernt.
Lukas war eben die letzten Meter nach unten geklettert, als er bemerkte, dass auch vor dem Burgtor ein einzelner spanischer Wachposten stand. Der Mann versuchte, ihm den Weg abzuschneiden, während weitere Armbrustbolzen Lukas wie zornige Wespen umschwirrten. Grinsend stellte sich ihm der Söldner in den Weg und zog seinen Degen.
»Hier endet deine Reise, Lausebengel«, knurrte der Mann.
Lukas dachte daran, was ihm sein Vater gestern noch in ihrem Übungskampf gesagt hatte.
Im Kampf geht es niemals fair zu … Es geht nur darum, wer gewinnt.
Vermutlich hatte der Vater genau solche Situationen gemeint. Lukas deutete eine Bewegung nach links an, die seinen Gegner dazu verleitete, einen Ausfallschritt zu machen. Im gleichen Augenblick trat ihm Lukas mit voller Wucht zwischen die Beine.
»Maleficio!«, fluchte der Söldner. Er ließ den Säbel fallen und ging stöhnend in die Knie. Im Fallen versuchte er noch, nach Lukas zu greifen, doch dieser war schon an ihm vorbeigerannt, wobei er dem Mann mit der Faust einen weiteren Hieb gegen den Nacken verpasste.
So schnell er konnte, lief Lukas hinüber in die Büsche, die den Wald von der Burg abgrenzten. Ein letzter Bolzen schlug sirrend neben ihm in einen Baumstamm ein, dann verschluckten ihn die Buchen und Eichen.
»Das wirst du mir büßen!«, schrie ihm der Mann noch hinterher. »Ich werde dich aufschlitzen wie ein Stück Vieh!«
Erst eine ganze Weile später hörte Lukas auf zu laufen. An einem schlammigen Bachbett brach er schließlich keuchend zusammen. Ein Weinkrampf schüttelte ihn, und er wünschte sich, er wäre tot. Von einem Augenblick auf den anderen war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war.
Die Familie Lohenstein existierte nicht mehr.
3
Die nächsten Stunden verbrachte Lukas in der ständigen Angst, von seinen Häschern entdeckt zu werden. Dies und das Entsetzen über den Tod seines Vaters und die verschleppten Familienangehörigen machten es ihm fast unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Nachdem er zunächst ziellos umhergeirrt war, begann er schließlich, seine Spuren mit Ästen zu verwischen, wie es ihn der Vater einst auf ihren gemeinsamen Ausflügen gelehrt hatte. Immer wieder wurde er dabei von Weinkrämpfen geschüttelt. Fast blind vor Tränen stapfte Lukas durch schlammige Bachläufe, um etwaige Hunde von seiner Fährte abzulenken, und benutzte einsame, überwachsene Wildwechsel, die nur ihm bekannt waren. Dabei lauschte er immer wieder, ob die Verfolger irgendwo in seiner Nähe waren. Doch außer dem Klopfen eines einzelnen Spechts oder dem zornigen Ruf eines Eichelhähers war nichts zu hören.
Gegen Nachmittag versiegten seine Tränen langsam. Die Trauer wich einer Leere, die es ihm immerhin ermöglichte, über seine weitere Flucht nachzudenken.
Lukas kannte eine kleine Höhle unterhalb eines einzeln stehenden Felsens, die er gelegentlich als Unterschlupf nutzte. Er beschloss, sich dort zu verstecken, bis er sich darüber klar wurde, was er weiter unternehmen sollte. Nach Sonnenuntergang wickelte er sich fröstelnd in eine alte Wolldecke, die er zusammen mit einem trockenen Laib Brot und ein paar Dörrpflaumen schon vor längerer Zeit in der Höhle für Notfälle verwahrt hatte. Ein Feuer zu entfachen, wagte er nicht. Zu groß war die Gefahr, die spanischen Söldner könnten den Rauch sehen.
Es wurde dunkel und kalt, irgendwo in der Nähe brach ein großes Tier durchs Dickicht, vermutlich ein Keiler oder ein Hirsch, vielleicht aber auch ein Bär.
Lukas zitterte, er schloss die Augen und versuchte, seine Angst wenigstens für einige Minuten zu vergessen. Doch es gelang ihm nicht. Er fühlte sich so einsam, als wäre er der letzte Mensch auf der Welt. Sein Vater war tot, die Mutter und die Schwester gefangen und er selbst ein namenloser Flüchtling, ohne Heim und Zukunft.
Denn eines war ihm klar: Nie mehr konnte er nach Burg Lohenstein zurückkehren. Der Befehl des Inquisitors war deutlich genug gewesen: Lukas sollte getötet werden. Warum aber hatten die Söldner Elsa verschont? Diese eine bohrende Frage half ihm, seine dunklen Gedanken für eine Weile beiseitezuschieben.
Die Mutter hatte den Namen des Inquisitors genannt, einen Namen, den Lukas nie mehr vergessen würde: Waldemar von Schönborn. Er war derjenige, der schon einmal versucht hatte, die Mutter der Hexerei anzuklagen. Gab es vielleicht irgendein Geheimnis, das Schönborn mit seinen Eltern verband?
Die Erinnerung an seine Familie trieb Lukas erneut die Tränen in die Augen. Er hätte mit Elsa unten im Kerker bleiben sollen. Dann hätten die Häscher sie vermutlich nie gefunden! Und was fast noch schlimmer war: Lukas glaubte nun zu wissen, warum sich seine Mutter so kampflos hatte abführen lassen. Sie hatte ihre Kinder schützen wollen, indem sie Schönborn keinen Anlass zum Suchen gab.
Etwas knurrte laut, und Lukas brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass dies kein Bär, sondern sein Magen war. Er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen. Also kramte er den harten Laib Brot und das Dörrobst hervor und begann sein karges Abendmahl.
Während er an den trockenen Bissen kaute, kam Lukas’ Lebensmut langsam wieder zurück. Sein Vater hatte ihn gelehrt, sich niemals unterkriegen zu lassen. Er war der Sohn eines Ritters! Also würde er weiterkämpfen, wenn nötig, bis zum bitteren Ende. Und vielleicht war ja doch noch nicht alles verloren. Er musste unbedingt erfahren, was mit seiner Mutter und Elsa geschehen war, dann konnte er ihnen womöglich noch helfen. Aber dazu würde er bis zum nächsten Morgen warten müssen.
Nach einer unruhigen, beinahe schlaflosen Nacht machte Lukas sich noch vor Morgengrauen wieder auf den Weg zurück zur Burg. Mit klopfendem Herzen näherte er sich dem Ort, der noch bis vor Kurzem sein Zuhause gewesen war. Dabei mied er die bekannten Wege und schlich auf Wildwechseln durch den schattigen Wald, bis er sich ganz in der Nähe von Lohenstein befand. Schließlich bog er scharf ab und ging einen steilen Pfad hinunter zum Fluss.
Es gab dort einen kleinen, von der Burg aus nicht einsehbaren Kiesstrand mit einem tiefen Wasserloch, das die Bediensteten seines Vaters gelegentlich nutzten, um Wäsche zu waschen. Lukas legte sich hinter einigen Felsen auf die Lauer, und tatsächlich, er hatte Glück.
Es dauerte keine halbe Stunde, bis eine alte Magd mit einem Korb Wäsche in den Händen den Pfad herabstieg. Als Lukas sie erkannte, wurde ihm leicht ums Herz. Es war die gute Agnes, die seit vielen Jahren für die Lohensteinfamilie arbeitete und in früheren Jahren seine Amme gewesen war.
Eben war die Alte unten angelangt, da tauchte Lukas auch schon wie ein Geist aus seinem Versteck zwischen den Felsen auf. Mit einem erstickten Schrei ließ Agnes den Korb fallen.
»Junger Herr, dem Himmel sei Dank, Ihr lebt!«, brachte sie keuchend hervor. »Ihr müsst schleunigst verschwinden! Sie sind immer noch auf der Suche nach Euch. Wenn sie Euch finden …«
»Ich muss wissen, was mit der Mutter und der Elsa ist«, unterbrach Lukas sie rasch. »Was ist seit gestern geschehen?«
»Nach dem Tod Eures Vaters haben ein paar dieser spanischen Söldner die Herrschaft über die Burg übernommen«, erwiderte die Magd leise und sah sich dabei vorsichtig um. »Eure Mutter und Elsa sind von dem hohen geistlichen Herrn bereits gestern früh weggebracht worden. Wie es heißt, nach Heidelberg. Dort will man Eurer Mutter den Prozess wegen Hexerei machen. Oh Gott, oh Gott!« Sie rieb sich ihre verweinten Augen. »Es ist alles so furchtbar! Man sagt, dieser Waldemar von Schönborn ist ein direkter Gesandter des Papstes. Er hat die Macht, jeden in der Pfalz der Zauberei zu bezichtigen. Wer ihm einmal in die Finger gerät, der ist verloren!«
Lukas biss die Zähne zusammen und versuchte, trotz seiner Angst in Ruhe nachzudenken. Vermutlich hatte Schönborn seine Mutter und Schwester mit Pferden weggebracht. Bis nach Heidelberg waren es über dreißig Meilen. Wenn er noch irgendetwas für seine Mutter erreichen wollte, musste er schnell handeln. Doch die Pferde seines Vaters gehörten jetzt den Spaniern, sie standen für ihn unerreichbar im Burgstall. Er würde also wohl oder übel zu Fuß gehen müssen.
»Da ist noch etwas, das Ihr wissen solltet, junger Herr«, sagte Agnes und senkte erneut ihre Stimme. »Diese Spanier haben die Burg vom Keller bis hoch zum Speicher durchsucht. Jede einzelne Truhe haben sie durchwühlt, nicht einmal die Burgkapelle war ihnen heilig. Dabei sind sie doch wie wir gläubige Katholiken! Könnt Ihr Euch vorstellen, was sie gesucht haben?«
Lukas schüttelte schweigend den Kopf. Waren die Söldner am Ende gar nicht seiner Mutter wegen hier gewesen, sondern wegen etwas ganz anderem? War ihre Festnahme nur ein Vorwand?
»Leb wohl, Agnes«, sagte er nach einer Weile leise und drückte die Hand der Magd, die ihm früher immer Lieder gesungen hatte, wenn er nicht schlafen konnte. Nachdenklich musterte die Alte seine schmutzigen, von der Flucht durchs Dickicht zerfetzten Kleider.
»So könnt Ihr nicht weiter«, murmelte sie. »Diese gottverfluchten Spanier wissen, wie Ihr ausseht. Hier, nehmt das.« Sie griff in den Korb und zog ein paar verschlissene Kleider und eine verbeulte, viel zu große Filzkappe hervor. »Sie gehören meinem Enkel und müssten Euch passen. Vielleicht nicht ganz das Richtige für einen jungen vornehmen Herrn, aber damit wird Euch wenigstens keiner erkennen.« Sie drückte Lukas fest an ihren großen Busen und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Und nun geht mit Gott, mein Junge. Von mir wird keiner etwas erfahren.«
Lukas wandte sich ab und stieg den Pfad vom Fluss hoch. Als er sich noch einmal umdrehte, sah er, dass die alte Magd ihm ein letztes Mal zuwinkte. Im Hintergrund waren im Morgenrot die Mauern und Zinnen von Burg Lohenstein zu erkennen, seine alte Heimat, die er nun wohl nie wiedersehen würde.
Kurz stellte er sich vor, wie ihm sein Vater vom Himmel aus gerade zusah. Nach dessen Tod war er jetzt der Mann in der Familie. An ihm, Lukas, lag es nun, seine Mutter und seine Schwester vielleicht doch noch zu retten.
Er würde den Vater nicht enttäuschen.
Nach einem letzten Blick wandte er sich um und folgte dem Pfad, der ihn schon bald zu einer breiten staubigen Landstraße brachte. Wenn er der Straße nur lange genug folgte, so viel wusste er, würde sie ihn irgendwann nach Heidelberg bringen. Mit seinen Eltern war er schon ein paar Mal dort gewesen, allerdings zu Pferde und mit einem halben Dutzend Bediensteten. Gemeinsam waren sie dann immer in einer vornehmen Gaststube abgestiegen. Einmal hatten er, Elsa und seine Mutter sogar oben das Heidelberger Schloss und dessen berühmten Garten besucht. Doch diese Zeiten waren vorbei.
Je länger Lukas die von Radfurchen durchzogene Straße entlangmarschierte, umso zahlreicher wurden die Karren, Fuhrwerke, Wanderer und einzelnen Reiter, die der Stadt zustrebten. Mittlerweile führte der Weg unten am Neckar entlang. Zweimal marschierte ein Trupp Landsknechte mit Trommelschlag und Flötenspiel an Lukas vorbei, doch es waren glücklicherweise keine spanischen Söldner darunter. Überhaupt schien keiner von dem kleinen Jungen mit dem viel zu großen Filzhut Notiz zu nehmen.
Es ging bereits auf den Nachmittag zu und noch immer brannte die Spätsommersonne vom Himmel. Der Schweiß tropfte Lukas von der Stirn. Nur einmal, gegen Mittag, hatte er kurz Rast gemacht und den Rest Brot und das Dörrobst aufgegessen. Gegen Abend wurde ihm schließlich klar, dass er Heidelberg zu Fuß niemals an einem Tag erreichen würde. Die Straße wurde nun im Dämmerlicht merklich einsamer. Lukas setzte seinen Weg bis Sonnenuntergang fort und wollte sich gerade nach einer verlassenen Scheune für die Nacht umsehen, als er hinter sich auf der Straße Pferdegetrappel und Wiehern hörte. Die Gräuelgeschichten von Mördern und Wegelagerern gingen ihm durch den Kopf. Jetzt, bei Einbruch der Nacht, trieb sich sicherlich allerlei zwielichtiges Gesindel in der Gegend herum.