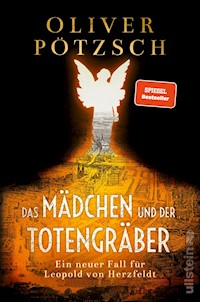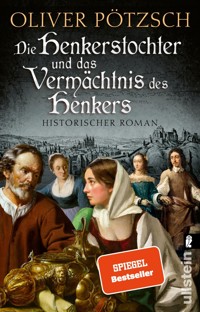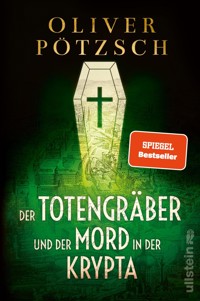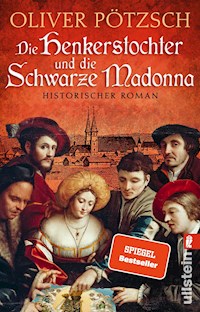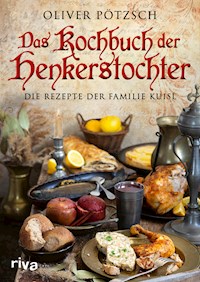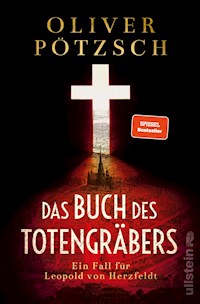
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn in Wien der Tod umgeht, gibt es nur einen, der ihm alle Geheimnisse entlocken kann 1893: Augustin Rothmayer ist Totengräber auf dem berühmten Wiener Zentralfriedhof. Ein schrulliger, jedoch hochgebildeter Kauz, der den ersten Almanach für Totengräber schreibt. Seine Ruhe wird jäh gestört, als er Besuch vom jungen Inspektor Leopold von Herzfeldt bekommt. Herzfeldt braucht einen Todes-Experten: Mehrere Dienstmädchen wurden ermordet – jede von ihnen brutal gepfählt. Der Totengräber hat schon Leichen in jeder Form gesehen, kennt alle Todesursachen und Verwesungsstufen. Er weiß, dass das Pfählen eine uralte Methode ist, um Untote unter der Erde zu halten. Geht in Wien ein abergläubischer Serientäter um? Der Inspektor und der Totengräber beginnen gemeinsam zu ermitteln und müssen feststellen, dass sich hinter den Pforten dieser glamourösen Weltstadt tiefe Abgründe auftun … "Packend erzählt." Süddeutsche Zeitung "Oliver Pötzsch ist ein begnadeter Geschichtenerzähler" Krimi-Couch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch des Totengräbers
OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der "Henkerstochter"-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Wien 1893: Im Prater wird eine tote Dienstmagd gefunden, brutal gepfählt. Es ist der Auftakt einer ganzen Serie von Pfahl-Morden. Leopold von Herzfeldt, junger Polizeiagent und neu in der Stadt, soll bei den Ermittlungen helfen. Doch die Kollegen wollen von seiner modernen Tatortanalyse nichts wissen, er wird mit einem anderen Fall betraut. Herzfeldt will nicht aufgeben und findet unerwartete Unterstützung bei Augustin Rothmayer. Der eigenwillige Totengräber vom Wiener Zentralfriedhof ist der Beste seiner Zunft, er kennt jede Todesarte und Verwesungsstufe. Vor allem aber weiß er, dass es für fast jeden Aberglauben eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Doch in der Polizeidirektion helfen Leopold von Herzfeldt diese Erkenntnisse wenig. Niemand will ihm zuhören. Bis auf die junge Polizeimitarbeiterin Julia Wolf. Doch Julia, von den Kollegen spöttisch „Lämmchen“ genannt, ist eine Wölfin im Schafspelz. Bei Tag gibt sie die brave Angestellte, nachts taucht sie ein in die Halbwelt des verruchten 16. Bezirks. Denn dort befindet sich Julias eigentliches Zuhause – und auch ihr großes Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren darf. Leopold ahnt nicht, worauf er sich da eingelassen hat ...
Oliver Pötzsch
Das Buch des Totengräbers
Ein Fall für Leopold von Herzfeldt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021 Umschlaggestaltung: www.zero-media.net, München Titelabbildung: © Granger / Bridgeman Images (Stadtansicht Wien); © FinePic®, München (Kreuz, Schriftmuster, Glow)
Karte von Wien: © Peter Palm
Autorenfoto: © Frank Bauer
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor. E-Book Konvertierung powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-2479-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Aus dem Almanach
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Karte von Wien
Nachwort
Leseprobe: Der Totengräber und der Mord in der Krypta
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Aus dem Almanach
Widmung
Für meinen Ururgroßvater Max Kuisl (1861–1924), dessen Grab irgendwo in São Pedro in Brasilien liegt und der zum Zeitpunkt dieses Romans ein junger Arzt war.Ich habe beim Schreiben oft an ihn gedacht!
Motto
»O, du lieber Augustin, alles ist hin … Augustin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin. O, du lieber Augustin, alles ist hin.«
(Altes Wiener Volkslied, das auf den Bänkelsänger Marx Augustin zurückgeht, der betrunken und vermeintlich tot in eine Pestgrube geworfen – und am nächsten Tag lebendig daraus geborgen wurde.)
Aus dem Almanach
Aus dem »Almanach für Totengräber« von Augustin Rothmayer, geschrieben zu Wien 1893
Im menschlichen Leben gibt es wohl keinen Zustand, der mehr gefürchtet ist als der des Scheintods. Dieser Zustand kann vielerlei Gründe haben: Ertrinken oder Erhängen, in Bergwerken oder Lawinen verschüttet werden, aber auch Vergiftung, Starrkrampf oder sehr hohes Fieber. Immer wieder finden sich Berichte, daß Menschen als Scheintote lebendig begraben wurden. Die Rede ist von Klopfen am Sargdeckel, von verzweifelten Rufen auf dem Friedhof. Manche der Begrabenen wurden später exhumiert, und man fand sie in seltsamer Stellung, so als hätten sie vor ihrem Tod noch mit aller Kraft versucht, sich zu befreien.
Um festzustellen, ob ein Mensch wirklich tot ist, empfiehlt es sich, die Fußsohlen mit Stichen zu reizen, ein glühendes Eisen aufzulegen oder den vermeintlich Toten mit kochendem Wasser zu überschütten, bis sich Blasen auf der Haut bilden. Im Zweifel hilft ein Stich mit dem Herzstilett, wie es etliche Ärzte empfehlen und auch anwenden. So kann unvorstellbares Leiden erspart werden.
Wie lange man in einem Sarg überleben kann, wird durch das Verhältnis von Sargvolumen zu Lungenkapazität bestimmt, es ist von vierzig Minuten bis maximal einer Stunde auszugehen. Mir selbst ist bis auf eine Ausnahme nie dergleichen begegnet, doch dieser eine Fall gehört ohne Zweifel zu den merkwürdigsten meiner gesamten bisherigen Laufbahn …
Prolog
Der Mann im Sarg öffnete die Augen und hörte seiner eigenen Beerdigung zu.
Dumpfe Wortfetzen drangen bis hinunter in sein Grab, durchsetzt vom Klagen und Weinen einer Frau. Er glaubte zu wissen, wer dort weinte, und sein Herz füllte sich mit Sehnsucht.
Anders als erwartet roch es im Sarg nicht schlecht. Das frische Fichtenholz duftete nach Harz, außerdem drang durch die schmalen Schlitze, dort, wo der Deckel mit dem Kasten vernagelt war, ein wenig Luft. Ein schwacher, fast nicht wahrnehmbarer Lichtschein fiel herein. Nun ertönte über ihm eine tiefe Stimme. Der Mann im Sarg konnte den genauen Inhalt der Rede nicht verstehen, aber es war sicher eine gute Rede, eine, die den Leuten vor Augen führte, was für ein wertvoller Mensch er gewesen war. Warum hatten sie nicht so über ihn geredet, als er noch lebte?
Aber was dachte er da? Er lebte ja noch …
Er hatte starke Kopfschmerzen, sein Schädel fühlte sich an wie in ein Glas Leinöl getaucht, aber natürlich, er lebte noch. Probeweise bewegte er erst Finger und Zehen, dann den rechten und den linken Fuß, schließlich die Arme. So ein Sarg war geräumiger als zunächst angenommen, nur ein wenig hart, ein krumm eingeschlagener Nagel drückte gegen sein rechtes Schulterblatt. Außerdem war ihm kalt, es fehlte eine Decke.
Wieder weinte die Frau über ihm, dazu erklang jetzt ein monotoner, gutturaler Laut aus vielen Kehlen gleichzeitig. Es war ein zweisilbiges Wort, das die Menschen dort oben murmelten, und der Mann brauchte eine Weile, um sich zu vergegenwärtigen, was für ein Wort es war.
Amen.
Sie kamen zum Ende.
Plötzlich war ein neues Geräusch zu hören, viel näher diesmal. Ein leises Rummsen und anschließendes Rieseln, das in regelmäßigen Abständen erfolgte.
Schrapp … schrapp … schrapp …
Der Mann hielt den Atem an. Jemand schippte Erde auf den Sarg, kleine Steine klickerten und rollten über den Holzdeckel, das Licht in der Kiste wurde nach und nach schwächer, während die Grube sich mit fetter, lehmiger Erde füllte.
Schrapp … schrapp … schrapp …
Dann war es dunkel. So dunkel, wie es in einem Grab eben war.
Schrapp …
Eine letzte Schaufel voll, verhallende Stimmen, Schritte, die sich langsam entfernten.
Stille.
Der Mann konnte die Stille beinahe fühlen, sie war wie zähflüssiges schwarzes Öl, das von seinen Beinen aufstieg, seinen fröstelnden Körper und schließlich den Kopf und die Haare erreichte und ihm die Ohren verklebte. Er badete förmlich in der Stille. Es war angenehm, auch weil er wusste, dass die Stille nicht ewig währen würde.
Der Mann wartete. Er lauschte, er horchte … dann endlich hörte er etwas. Ein stetes Pochen, so als würde jemand in weiter Ferne an eine Tür klopfen. Das Pochen wurde schneller, lauter!
Sie kommen! Endlich, sie kommen!
Erst nach einer Weile begriff er, dass es das Klopfen seines eigenen Herzens war. Es schlug und schlug, viel zu hastig, wie eine Uhr, die man zu schnell aufgezogen hatte.
Was ist dort oben nur los? Warum geschieht nichts?
Der Mann schrie, und sein eigener Schrei gellte ihm in den Ohren, so laut, dass es die ganze Welt vernehmen musste. Doch niemand hörte ihn, höchstens die paar Käfer, Asseln und Regenwürmer, die irgendwo, ganz nah, in der Erde krabbelten und krochen und darauf warteten, sich in seine Ohren, Augen und Eingeweide zu wühlen.
Allmählich wurde die Luft knapp. Wie lange reichte sie in so einem Kasten? Eine Stunde? Eine halbe? Weniger? Verzweifelt führte er seine Arme nach oben, bis sie auf Höhe des Brustkorbs lagen, dann drückte er mit aller Kraft gegen den Sargdeckel. Erde rieselte an den Rändern herein, verklebte ihm die Augen, er hustete, brüllte, drückte, schrie, schob, presste – doch vergeblich. Seine Fingernägel bohrten sich ins Holz, als könnte er sich auf diese Weise einen Weg ins Freie bahnen, durch Sarg und Erde hindurch, zurück zu den Lebenden.
Wieder schrie der Mann.
Er schrie, weil er insgeheim hoffte, dass er dann aufwachte. Als Kind hatte er einmal einen schlimmen Albtraum gehabt, ein großer Wolf mit blutigen Lefzen hatte an ihm gezerrt und ihn bei lebendigem Leib zerrissen. Damals hatte er geschrien und war schweißgebadet aufgewacht, dann war die Mutter an sein Bett gekommen und hatte ihm ein Schlaflied gesungen, und bald war alles wieder gut gewesen. Er hoffte, er betete, dass auch das hier nur ein Traum war.
Doch es war keiner.
Es ist die Wirklichkeit, dachte der Mann, während er langsam in den Wahnsinn hinüberglitt. Die unbarmherzige Wirklichkeit. Ich bin allein, keiner wird mir helfen, auch sie nicht …
Dieser Sarg war sein Grab, und das Grab war so wirklich wie der muffige Geruch der Erde, das eigene, immer schwächer werdende Keuchen, das Krabbeln der Käfer, Asseln und Spinnen und die ewige Dunkelheit, die ihn tiefer und tiefer hinabzerrte.
Kapitel 1
Wien, nachts auf dem Prater, Oktober 1893
Der Lichtstrahl der Petroleum-Starklichtlampe tastete wie ein dünner, langer Finger durch die Nacht. Er huschte hierhin und dorthin, wanderte über Büsche und Bäume, streifte ein paar weiter entfernte Würstelbuden und Ringelspiele, die Rückwand eines bunten Kasperltheaters und die hohe Kuppel der Rotunde und verharrte schließlich auf dem Fiaker mit schwarzem Verschlag, der sich vom Prater her mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Kutscher zügelte die Pferde, und das zweispännige Gefährt blieb mit quietschenden Rädern auf der vom Regen aufgeweichten Prater-Hauptallee stehen. Grinsend sah der Kutscher durch die Luke nach hinten und zwinkerte seinem Fahrgast zu.
»So schnell wia a englische Dampflok. Beim Praterderby kannt i mi anmelden. Gnädigster Diener, der Herr …« Erwartungsvoll streckte er die Hand aus, und Leopold gab ihm wie vereinbart den doppelten Lohn und sogar noch ein paar Münzen obendrauf.
»Herzlichen Dank«, sagte Leopold und richtete sich leise stöhnend im lederbespannten Sitz auf. Von dem Höllenritt taten ihm sämtliche Knochen weh. »Das war wirklich verdammt schnell. Sie können froh sein, dass uns kein Polizist angehalten hat.«
»Na, wenn die Polizei selbst im Fiaker sitzt, wird uns scho ka Kieberer anhalten«, gab der Kutscher zurück. Er öffnete den Verschlag, und die kühle, nach Gras, Pferdedung und Moder riechende Feuchte eines Wiener Herbstgewitters empfing Leo. Ein Geruch, der ihn an ein großes, verwesendes Untier denken ließ.
Es regnete seit Stunden, wenn auch nicht mehr so stark wie zu Beginn, ein satter Oktoberregen, der auf das Dach der Kutsche prasselte und von den umstehenden Kastanienbäumen tropfte wie Harz. Leo klappte seine silberne Savonette-Taschenuhr auf, es war exakt acht Minuten nach Mitternacht. Von der Polizeidirektion am Schottenring hierher hatten sie nur zwölf Minuten gebraucht, unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln. Sie konnten von Glück reden, dass ihnen keine Pferdetramway entgegengekommen war oder, noch schlimmer, eines dieser neuen Automobile, von denen Leo schon mal eines auf den Straßen Wiens gesehen hatte, am Steuer irgendein besoffener reicher Spinner mit seinem Flittchen.
Kurz schaute Leo über die Schulter zurück zu der Allee, die den großen Park wie ein schwarzes Band mittendurch schnitt. Der Prater war ein weitläufiges Erholungsgebiet, geprägt von den Auenlandschaften der Donau, von kleinen Waldgruppen und Büschen, bis hinunter zum Lusthaus und der Galopprennbahn Freudenau, wo sich Adel und Bourgeoisie amüsierten. Gleich hinter den Bäumen, wo der sogenannte Wurstelprater endete, schien die Stadt zu glühen. Die zahlreichen Gaslaternen hüllten die Varieté-Theater, Kaffeehäuser, Spiegelkabinette und Wurfbuden in ein warmes gelbliches Licht. Hier im nordwestlichen Teil des Parks amüsierte sich das einfache Volk auf die immer gleiche Weise. Von den Wirtshäusern ertönten selbst um diese späte Stunde noch Gelächter, Schreie und Schrammelmusik. Eine verstimmte Gitarre leierte zusammen mit einer steirischen Knopfharmonika einen kitschigen Gassenhauer.
Mein Bluat ist so lüftig und leicht wia der Wind, i bin halt an echt’s Weanerkind …
Unwillkürlich summte Leo die Melodie mit. Er hängte sich die abgegriffene Kameratasche samt dem Zusatzbehälter für die Trockenplatten um, nahm den unförmigen ledernen Kastenkoffer in die Hand und stieg aus. Der Kutscher wendete mit einem letzten Peitschenknall und fuhr dorthin zurück, wo die Musik, das Licht und der Lärm herkamen, dorthin, wo das Leben war.
Hier im Wald wartete der Tod.
»Heda, Bubi, hier ist nichts mit Spazierengehen!«, erklang eine Stimme aus der Dunkelheit. Ein kleiner Hügel zeichnete sich grau vor dem pechschwarzen Horizont ab. »Schleich di, hab ich gesagt, des ist a Befehl! Polizeiliche Anordnung!«
Im Regendunst sah Leo einen dicklichen, älteren Wachmann, der in durchnässter Uniform schnaufend auf ihn zukam. Er trug eine flackernde Laterne mit Glühstrumpf, eines der neuen sogenannten Auerlichter, dessen Strahl zuvor auch den Fiaker gestreift hatte. Das rechte Bein zog der Mann leicht nach, er hatte sichtlich Mühe, sich durch das Dickicht abseits des Weges zu kämpfen. »Ist alles abgesperrt hier!«, schimpfte er. »Hast verstanden, Strizzi? Wannst deine Miezn suchst, die san ausgeflogen. Also, kehrt marsch, retour!«
»Ich habe sehr wohl verstanden, bin ja nicht taub«, sagte Leopold. Er klappte das Revers seines Chesterfieldmantels um, wo die allbekannte Marke prangte, eine grauschwarze Stoffkokarde mit dem Habsburger Doppeladler in der Mitte. »Wir beide tun hier nur unsere Pflicht, Herr Wachtmeister.«
»Oh, Verzeihung, Herr Inspektor, ich … ich wusste nicht …« Der Wachmann nahm sofort Haltung an. »Bitte vielmals um Vergebung, Herr Inspektor, aber die Herren Kollegen vom Wiener Sicherheitsbüro sind schon da.«
»Auch das ist mir geläufig«, erwiderte Leopold. »Das dort vorne wird ja kaum ein Lagerfeuer sein.« Er deutete auf den flackernden Schein, der aus dem Waldstück jenseits des Hügels zu ihnen herüberleuchtete. »Sind die Spuren bereits gesichert?«
»Spuren … gesichert …?« Der Wachmann sah ihn verständnislos an. Leopold wies auf die vor Dreck starrenden Schuhe des Beamten.
»Nun, ich sehe, Sie laufen hier mit Ihren Kommissstiefeln durch den Matsch. Selbst im schwachen Licht Ihrer Laterne kann ich Spuren auf dem Erdboden erkennen. Der Tiefe nach könnten sie zu einem, nun ja, stämmigen Mann passen, jemandem wie Sie. Sie hinken leicht, auch das zeigen die Spuren. Das lang gezogene Schleifen ist deutlich zu erkennen, sehen Sie? Ich frage also, ob mögliche andere Spuren bereits gesichert wurden oder ob Sie hier einfach durchtrampeln wie ein Wildschwein durch den Kartoffelacker?«
»Bitte … bitte … vielmals um Vergebung, Herr Inspektor«, stotterte der Dicke.
»Das sagten Sie bereits. Also wohl keine Spurensicherung. Kriegsverletzung?« Leo deutete auf das steife rechte Bein des Mannes.
»Krieg …? Äh, ja, aber woher …«
»Ihre Ausdrucksweise. Erinnert an Militär, vermutlich die Schlacht bei Königgrätz, wenn ich Ihr Alter richtig schätze. Und, ach ja, schicken Sie ein paar Männer zur Zeugenbefragung hinüber zum Wurstelprater, falls das noch nicht geschehen ist. Wenn ich die Zusammenrottung vorhin am Calafati richtig deute, hat sich unser Fall bereits herumgesprochen.«
Ohne ein weiteres Wort schritt Leo an dem verdutzten Wachmann vorbei und näherte sich dem Hügel. Daneben lag ein kleiner See, dessen Oberfläche im Licht weiterer Auerlampen ölig schwarz leuchtete. Einige Uniformierte mit den typischen Blechhelmen und den dunkelgrünen Waffenröcken standen am Ufer, außerdem drei Männer in Zivil. Zwei von ihnen trugen Mantel und Bowler, von deren Krempe der Regen tropfte, der dritte, ein jüngerer Mann, war barhäuptig. Er stützte sich etwas abseits an einer Weide ab, hielt den Kopf gesenkt und gab würgende Geräusche von sich. Der ganze Boden im Umkreis war durchweicht und aufgewühlt.
So viel zu weiteren Spuren, dachte Leo. Ein Wildschwein hätte weniger Schaden angerichtet.
Er atmete noch einmal tief durch. Dann ging er mit zügigen Schritten, den Koffer und die zwei Ledertaschen in den Händen, auf die beiden Männer in Zivil zu. Mit den Wachleuten umstanden sie einen leblosen Körper am Ufer. Als Leo in den Lichtkegel trat, sahen die Männer überrascht auf.
»Verflucht, was machen Sie denn hier?«, knurrte der eine von ihnen, ein stämmiger Kerl mit Glatze und zugeknöpftem Ledermantel, den er fast zu sprengen schien. Trotz des Regens kaute er auf einer erkalteten Zigarre. »Na los, verschwinden Sie! Das ist hier nicht der Nordbahnhof, wenn Sie den suchen.«
»Suche ich nicht, und ich bin auch kein verirrter Reisender. Guten Abend, die Herren!« Leo lüftete seinen eleganten grauen Homburg, dann zeigte er erneut seine Marke. »War der Untersuchungsrichter vom Landesgericht schon da?«
Der Glatzkopf kniff die Augen zusammen, kaute weiter an der Zigarre und musterte einen Moment lang die Marke. »Wer zum Teufel sind Sie? Hab Sie noch nie in der Direktion gesehen.«
»Herzfeldt«, sagte Leo und verbeugte sich leicht. »Leopold von Herzfeldt. Ihr neuer Kollege.«
»Herzfeldt … Klingt ziemlich jüdisch. Sind Sie Jude?«
Leo schwieg. Der zweite Mann mit Bowler trat nun hinzu. Im Gegensatz zu seinem stämmigen Kollegen war er hager, mit Walrossschnauzer und dünnem Haar, das ihm in die Stirn hing wie nasser Tang. Der schwere, mit Wasser vollgesogene Filzmantel zog an seinen Schultern, im Dunkeln sah er aus wie eine zerfledderte Vogelscheuche nach einem Gewitter.
»Ich glaub, ich weiß, wer das ist, Paul«, sagte er. »Polizeikommissär Stukart hat kürzlich auf der Morgensitzung von ihm erzählt, erst vor ein paar Tagen, erinnerst du dich? Dieser junge Kerl aus Graz …«
»Wenn du mich fragst, klingt der da eher wie ein jüdischer Piefke. So spricht doch kein Steirer.«
Die beiden unterhielten sich, als wäre Leo gar nicht anwesend. Er räusperte sich.
»Mein Dienst fängt erst morgen an«, sagte er förmlich. »Aber ich war heute schon in der Direktion, um mich ein wenig, nun ja … einzurichten. Und da hab ich von dem Einsatz hier gehört. Dachte, ich unterstütze Sie spontan …«
»Spontan, am Sonntag? Sie waren am Sonntag im Büro, ohne dass Sie Dienst hatten?« Der dicke Glatzkopf, der offenbar Paul hieß, lachte laut auf, ohne dabei die Zigarre aus dem Mund zu nehmen. Sein buschiger Backenbart verdeckte nur schlecht einen Schmiss an der rechten Wange. Er wandte sich an seinen zaundürren Kollegen. »Was sag ich, Erich? Er muss ein Piefke sein. So was macht kein Österreicher, nicht mal ein Steirer!«
»Und sein Reisegepäck hat er auch gleich dabei«, sagte der Dünne grinsend und deutete auf den sperrigen Koffer und die Taschen.
Leo setzte ein schmales Lächeln auf. »Nun, da ich schon mal hier bin – vielleicht klären mich die Herrschaften kurz auf, mit was wir es zu tun haben.« Er deutete auf den leblosen Körper zwischen ihnen. »Vielmehr mit wem.«
Zum ersten Mal sah er hinunter zu der Leiche, die vor ihm am schlammigen Ufer lag. Die Tote war eine zierliche junge Frau, Leo schätzte sie auf Anfang bis Mitte zwanzig. Sie hatte blassblonde Locken, in denen Laubreste und Dreck klebten, ihre Leinenbluse, unter der sich ein üppiger Busen abzeichnete, war zerrissen, der mit Blutflecken verunreinigte Rock hochgeschoben. Auch an den weit gespreizten Oberschenkeln klebte getrocknetes Blut sowie an der Bluse, im Gesicht und eigentlich überall, vor allem aber am Hals, der eine einzige offene Wunde war. Jemand hatte dem Mädchen die Kehle durchgeschnitten, und zwar so gründlich, dass der Kopf zur Seite hing, als könnte er jeden Moment abfallen.
Leo bemerkte einen schillernden schwarzen Käfer, der aus den regennassen Haaren hervorkroch und über das Gesicht der Toten lief. Ihre Augen waren weit aufgerissen, als könnte sie ihren frühen Tod noch immer nicht fassen, die Füße ragten ins Wasser. Ein Schuh hatte sich gelöst, er dümpelte im Uferwasser wie ein kleines Boot.
Leo fiel das Lied wieder ein, das die Musikanten eben gespielt hatten.
Mein Bluat ist so lüftig und leicht wia der Wind, i bin halt an echt’s Weanerkind …
Er betrachtete eine Pfütze, in der sich rötliches Wasser sammelte, es sah aus wie verdünnte Farbe.
»Die Sicherheitswache vom zweiten Bezirk hat uns eben erst dazugerufen«, sagte der Hagere, der offenbar der Zugänglichere der beiden Zivilinspektoren war und Erich hieß. »Papiere hatte das arme Hascherl keine bei sich. Aber das wird sich schon noch aufklären.« Er zuckte mit den Schultern. »Der Untersuchungsrichter verspätet sich ein bisserl, ist halt Sonntag. Da sitzen die braven Bürger bei Sauerbraten und geschmelzten Erdäpfeln am Tisch und gehen dann früh zu Bett. Na ja, und die nicht ganz so braven, die gehen eben in den Prater …«
Mit einer Kopfbewegung deutete er auf die Leiche. Jenseits des Hügels kreischten ein paar Frauen vor Vergnügen, ein Mann lachte dreckig; der sogenannte Calafati, die überlebensgroße Statue eines Chinesen mit Ringelspiel, war nicht weit entfernt. »So was sieht man leider immer wieder, wenn die jungen Damen einen Ausflug in den Prater machen«, erklärte der Dünne. »Der See am Constantinhügel ist ein beliebtes Ziel für junge Paare. Ich denke, sie wollte mit ihrem Hawara eine nächtliche Bootspartie machen, und er wollte mehr als sie. Sie hat geschrien, da hat der Kerl Panik bekommen …«
»Und schneidet ihr gleich den ganzen Hals durch wie einem Huhn?« Leo kniete sich in den Dreck und begann, die Leiche oberflächlich zu untersuchen. Er glaubte, den feinen metallischen Geruch des Blutes noch immer wahrzunehmen. »Warum hat man noch keine Spuren gesichert?«
»Verflucht, als wir hier ankamen, war alles schon zertrampelt«, murrte der stämmige Glatzkopf mit Zigarre, der neben seinem bohnendünnen Kollegen stand. Zusammen erinnerten sie Leo an zwei Schießbudenfiguren vom benachbarten Wurstelprater. »Zuerst die Zeugen, die die Kleine gefunden haben, dann deren Spezln, dann die Wachleute …«
»Wo sind diese Zeugen? Hat man sie getrennt befragt?«
»Das waren zwei Betrunkene, die zum Brunzen auf den Hügel gegangen sind. Zusammen mit einer Hure übrigens, die ihnen offenbar ihre kleinen Zumpferl gehalten hat. Aber ja, Herr Kollege …« Der glatzköpfige Dicke gab dem Wort einen spöttischen Beiklang. »Wir haben die drei getrennt befragt und zur Überprüfung in die Theobaldgasse bringen lassen. Wir sind ausgebildete Polizeiagenten so wie Sie, schon vergessen? Wir wissen, was wir tun. Und wenn Sie hier schon ungefragt … He, was wird das?«
Leo hatte in der Zwischenzeit den Lederkoffer und die beiden Taschen abgestellt. Mit einem gut geölten Schnappen klappte der Koffer auf, darin befanden sich Fächer in verschiedenen Größen, gefüllt mit Ampullen, Dosen, vielerlei Kästchen und Utensilien, außerdem zehn Bogen Schreibpapier, Feder und Bleistift, Lupe, Schrittzähler, Kompass, Maßband, drei weiße Stearinkerzen und ein silbernes Kruzifix.
Mit geübten Fingern zog Leo den Schrittzähler hervor, eine teure Sonderanfertigung aus Jena. Schweigend und mit genau bemessenen Schritten ging er mit dem taschenuhrgroßen Blechapparat in der Hand die Lichtung ab, wobei er immer wieder stehen blieb und sich Notizen machte. Die beiden Kollegen waren so verblüfft, dass sie für eine Weile schwiegen, und auch die Wachmänner sahen dem Schauspiel staunend zu, wie einem seltenen Tier auf der Balz.
»Was … was zum Teufel machen Sie da?«, meldete sich schließlich der Glatzkopf.
»Ich messe den Tatort ab, suche nach Spuren und … Ah! Würden Sie mir mal leuchten? Hier, bitte.« Leo wandte sich an einen der Wachmänner, der seine Laterne nun dicht über einen Gegenstand am Uferboden hielt. Dort lag, von einem Stiefel in den Dreck getreten, ein schlammverschmiertes rotes Seidenband. Mit einer Pinzette nahm Leo es hoch und steckte es in einen der gefalteten Papierbögen. Suchend sah er sich nach weiteren Spuren um.
»Haben Sie einen Hut gesehen?«, fragte er schließlich in die Runde. »Einen Frauenhut?«
»Da war kein Hut«, sagte der dünne Erich. »Wir haben selbst schon alles abgesucht. Bloß das Band haben wir wohl übersehen. Warum fragen Sie?«
»Nun, manchmal ist fast interessanter, was man nicht findet, nicht wahr?« Leo deutete auf das knappe Dutzend Männer, das schweigend im Kreis um ihn herumstand. »Sie alle tragen einen Hut, und das mit gutem Grund, denn es regnet. Wäre eine Frau draußen ohne Hut unterwegs, bei einem solchen Gewitter? Ich denke, nein. Es regnet seit …« Er klappte seine Taschenuhr kurz auf. »… zwei Stunden etwa. Sie muss also schon vor dem Regen zu Hause losgegangen sein, mit oder ohne Begleitung. Die Totenstarre hat allerdings noch nicht eingesetzt. Und für einen größeren Ausflug hat sie viel zu wenig an, nicht mal eine Jacke, und das im Oktober. Der Todeszeitpunkt dürfte also zwischen neun und zehn Uhr abends gewesen sein, und sie kommt aus der näheren Umgebung, ich denke, aus dem zweiten Bezirk. Die Kleidung ist ärmlich, aber trotzdem gepflegt. Hm …« Leo nickte nachdenklich. »Ein armes, jedoch ordentliches Mädchen, das sich mit einem roten Band ein wenig aufgehübscht hat und am Sonntag einen kleinen Ausflug zum Constantinhügel im Prater macht. Ich vermute, eine Dienstmagd. Wir sollten unsere Suche nach der Identität der Leiche also auf den zweiten Bezirk und dort auf vermisst gemeldete Dienstmädchen konzentrieren. Sind Sie damit einverstanden, meine Herren?«
Eine ganze Weile sagte keiner etwas, nur das Prasseln des Regens und die entfernte Musik waren zu hören. Die Wachleute hatten Leos Ausführungen mit offenem Mund gelauscht.
Schließlich trat der Glatzkopf vor, an seiner Stirn war eine Ader rot angeschwollen, die Narbe auf der Wange zuckte nervös. »Das sind doch alles nur Vermutungen, Sie Obergscheiter!«, bellte er. »Und überhaupt, was soll dieser großspurige Auftritt? Weiß Oberpolizeirat Stehling überhaupt, dass Sie hier sind? Ich leite hier die Ermittlungen, verstanden?«
»Nun beruhig dich erst mal, Paul.« Der dünne Erich fasste seinen dicken Kollegen am Arm. »Das klingt doch zumindest interessant. Lass den Piefke mal machen, kann ja nicht schaden.«
Der dicke Paul gab ein abfälliges Geräusch von sich. In der Zwischenzeit war nun auch der dritte Mann in Zivil hinzugetreten. Er war noch sehr jung, jünger als Leo, und auffällig blass, mit semmelblondem Haar und einem wie mit dem Bleistift aufgemalten dünnen Schnurrbart.
Verlegen wischte er sich mit einem Taschentuch über den Mund, an dem noch Spuren von Erbrochenem klebten. Der Anblick der blutüberströmten Leiche war für den zartbesaiteten Kollegen wohl zu viel gewesen. Doch augenscheinlich hatte er Leos Darlegungen aufmerksam zugehört. Trotz seines kränklichen Zustands wirkte er interessiert, jedenfalls weit mehr als die beiden älteren Zivilinspektoren.
»Meinen Sie, Sie könnten mir kurz helfen?«, wandte Leo sich mit ruhiger Stimme an den jungen Mann.
»Lassen Sie mir bloß den Andreas Jost in Ruhe!«, sagte der dicke Glatzkopf, der offenbar der Vorgesetzte war. »Das ist seine erste Leiche. Mir reicht es schon, wenn er auf die Lichtung kotzt. Wenn er über das Opfer speibt, ists vorbei mit Ihrer schönen Spurensicherung. Außerdem warten wir gefälligst, bis der Herr Untersuchungsrichter eintrifft. So sind die Vorschriften!«
»Wenn der Herr Untersuchungsrichter hier eintrifft, sind alle Spuren vom Regen weggewaschen«, entgegnete Leo. »Wollen Sie das verantworten?«
»Ich denke, er hat recht, Paul«, sagte dessen hagerer Kollege. »Wir sollten wenigstens schon mal anfangen.«
Der Oberinspektor schwieg trotzig und kaute auf seiner Zigarre. Derweil kam der junge Jost auf Leo zu und nickte. »Es … es geht schon wieder, Verzeihung! Hab die Blutwurst zum Abendbrot wohl nicht so gut vertragen. Was … was soll ich genau tun?«
»Ich brauche einen Protokollanten.« Leo reichte dem jungen Kollegen Stift und Papier. »Schreiben Sie alles auf, was ich Ihnen jetzt sage.« Er kniete sich neben die Leiche und begann, seine Beobachtungen laut zu diktieren. »Geschlecht weiblich, etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre alt. Die Totenstarre ist noch nicht eingetreten. Die Kehle wurde mit einem …« Er beugte sich über den Kopf der Toten. »… scharfen Gegenstand durchschnitten.«
»Na, mit einem Messer halt«, warf der dünne Erich grinsend ein. »Mit was sonst, Sie Schlaumeier.«
»Feiner Schnitt ohne Einfransungen«, fuhr Leo stoisch fort und nahm das Maßband zur Hand. »Das Schnittbild weist auf eine sehr scharfe Klinge hin, möglicherweise ein Rasiermesser. Der Schnitt ist …« Er blinzelte. »17,3 Zentimeter lang und geradlinig, eine Glasscherbe wie von einer Weinflasche kann deshalb meines Erachtens ausgeschlossen werden. Weiteres klärt die Gerichtsmedizin. Das Mordopfer ist vermutlich vergewaltigt worden.«
»Vermutlich?« Paul, der Glatzkopf, lachte. »Gratuliere, Herr Kollege, zu dieser großartigen Erkenntnis! Da hat einer seinen Spaß gehabt, und zwar ganz gehörig.«
»Kaum Spuren von Kampf«, ergänzte Leo seine Ausführungen, während der junge Jost zitternd mitschrieb. »Es muss sehr schnell gegangen sein, was auf eine Vertrautheit des Opfers mit dem Täter schließen lässt.« Leo nahm die Hände der Frau und betrachtete sie sorgfältig. »Keine ausgerissenen Haarbüschel, keine Kratzer, nur …« Er zögerte und wandte sich an einen der Wachmänner. »Würden Sie mit Ihrer Laterne bitte einmal näher kommen?«
Im wabernden Licht des Glühstrumpfs sah Leo jetzt, dass sich am rechten Ärmel der Bluse schwarze Flecken befanden, es war eine schmierige ölige Masse, die dort klebte. Er nahm eine kleine Schere aus dem Koffer und schnitt das verdreckte Stück aus der Bluse.
»Ein Reagenzglas aus dem Koffer bitte«, wandte er sich an seinen neuen Assistenten. Dieser reichte ihm nach einigem Suchen das Gläschen.
»Was … was ist das?«, fragte der junge Kollege.
»Das werden wir hoffentlich noch herausfinden.« Leo schnupperte an der Masse. Sie roch wie Teer, allerdings schärfer. »Wir sollten uns das auf alle Fälle unter dem Mikroskop näher ansehen. Vielleicht ist es ein Hinweis auf den Mörder, vielleicht auch einfach nur Dreck. Jede Spur muss untersucht werden.« Er steckte den Fetzen in die Ampulle, verkorkte sie sorgfältig und reichte das Gläschen einem der Wachmänner. »Bitte bringen Sie das in die Direktion. Sie werden doch ein Mikroskop dort haben, oder?«
»Sind Sie dann fertig mit Ihrer Vorstellung, ja?«, unterbrach ihn der Glatzkopf. »Ich hab jetzt wirklich lange genug zugeschaut …«
»Eine Sache noch, Herr Oberinspektor.« Leo stand auf und ging hinüber zu der Ledertasche, die er dort abgestellt hatte. »Ich nehme nicht an, dass die Kollegen eine Kamera dabeihaben?«
»Eine fotografische Kamera? Machen Sie Witze?« Der dünne Erich kicherte. »Was glauben Sie, was das hier ist? Die Weltausstellung in Chicago?«
»Die Universal-Detektivkamera von Goldmann ist ein wahres Wunderwerk an Technik«, sagte Leo, ohne auf den Spott des Kollegen einzugehen. Währenddessen kramte er in der Tasche. »Eine der modernsten Kameras auf diesem Gebiet, sogar mit Weitwinkelobjektiv.« Er zog einen schwarzen, kantigen Gegenstand hervor, etwa von der Größe einer Kaffeemühle. Mit geübter Bewegung klappte Leo den Verschluss auf, woraufhin sich ein Stoffbalg auffaltete wie bei einer Ziehharmonika.
»Es gibt natürlich auch noch handlichere Modelle wie die von Krügener«, erklärte Leo. »Aber bei Krügener ist das Format, wie ich finde, viel zu klein. Die Wiener Polizeidirektion sollte sich wirklich überlegen, ein paar dieser Goldmann-Kameras anzuschaffen. In Paris und London sind sie da schon viel weiter. Das Problem ist wie immer das Licht. Aber ich habe da etwas gebastelt, natürlich nur ein Provisorium …«
Leo präsentierte eine Kerze, um deren oberes Ende ein Blechröhrchen gewickelt war, das in einem Kautschukschlauch mit handgroßem Blasebalg endete. Der seltsame Apparat sah ein wenig aus wie eine kleine Blechhupe. Vorsichtig löffelte Leo aus einer Dose ein weißes Pulver in die Röhre und entzündete die Kerze. Dann reichte er Jost die merkwürdige Vorrichtung. »Drücken Sie bitte auf mein Kommando hin den Blasebalg. Schließen Sie dabei aber unbedingt die Augen, wenn Sie nicht erblinden wollen! Auf mein Zeichen. Eins, zwei und jetzt!«
Jost drückte den Blasebalg, woraufhin das selbst hergestellte Pulver aus Magnesium, Kaliumchlorat und Schwefelantimon in einer weißen Wolke in die Kerzenflamme gepustet wurde. Es explodierte mit einem lauten Knall. Für einen kurzen Moment war es am Seeufer taghell, die Leiche und die Männer, die sie im Kreis umstanden, wirkten wie eingefroren, dahinter erhob sich schwarz der Constantinhügel, gleich einem Scherenschnitt. Im gleichen Augenblick drückte Leo den Knopf seiner Kamera.
Es machte klick.
»Fertig«, sagte Leo und wechselte routiniert die Trockenplatte. »Selbst Kinder könnten mit so einer Kamera Aufnahmen machen. Man nennt es Amateurfotografie, ist in Amerika der neueste Schrei. Beeindruckend, nicht wahr?«
»Verflucht, wollen Sie uns alle in die Luft jagen?«, brüllte Paul, der Glatzkopf. »Es reicht mir jetzt endlich mit Ihren neumodischen Spielchen, Sie … Sie Piefke! Machen Sie, dass Sie hier verschwinden, bevor ich Sie von den Wachmännern abführen lasse! Diesen albernen Hokuspokus können Sie meinetwegen in New York oder Paris aufführen, aber doch nicht hier in Wien! He, hören Sie mir überhaupt zu?«
Doch Leo hörte nicht zu, stattdessen starrte er auf die Leiche. Im grellen Licht hatte er eben etwas bemerkt, was seinem aufmerksamen Auge bislang entgangen war. Vielleicht auch, weil er sich gescheut hatte, näher hinzusehen.
Zwischen den blutigen Schenkeln des Mordopfers steckte ein … Ding.
Jemand hatte dieses Ding so tief in die Vagina der Toten getrieben, dass nur ein winziges Stück davon herausragte.
»Was in Gottes Namen …«, murmelte Leo. Er stülpte sich seine Lederhandschuhe über und zog vorsichtig an dem länglichen Gegenstand. Langsam glitt er zwischen den Schamlippen hervor, fast wie ein Schwert aus einer Scheide.
Als Leo ihn schließlich ins Licht hielt, wichen die Männer unwillkürlich zurück und keuchten. Manche der Wachleute schlugen ein Kreuz. Einer von ihnen schickte ein kurzes Stoßgebet in den regenverhangenen Nachthimmel.
»Mein Gott, wie … wie abscheulich!«, ächzte der hagere Inspektor. »Welcher Teufel macht so etwas?«
»Kein Teufel, sondern ein Mensch«, sagte Leo leise. »Vergessen wir nicht, es sind immer Menschen, die so etwas tun.«
Es war ein angespitzter Pfahl, den Leo mit den Fingern vorsichtig umfasste, gut dreißig Zentimeter lang, aus hartem Holz. Das Blut hatte ihn dunkel gefärbt, trotzdem ließen sich einzelne geschnitzte Buchstaben im Holz erkennen.
»Domine, salva me«, las Leo vor. »Herr, errette mich.« Er wandte sich an den Glatzkopf mit Zigarre. Im Gegensatz zu vorher war dieser nun sehr still.
»Vielleicht sollten wir doch noch versuchen, ein paar Spuren mehr zu sichern«, sagte Leo. »Auch ohne Untersuchungsrichter. Was meinen Sie?« Er reichte dem Kollegen den blutigen angespitzten Pfahl, an dem einige schwarze, krause Haare klebten. »Aber natürlich haben Sie das Kommando, Herr Oberinspektor.«
Kapitel 2
Als Leo gute zwei Stunden später wieder in einem Fiaker saß, war er bis auf die Haut durchweicht. Er zitterte, und das lag nicht nur an der herbstlichen Kälte. Das Prasseln des Regens hatte mittlerweile aufgehört, nur das Klackern der Hufe und das monotone Rumpeln der Räder waren in der Nacht zu hören. Auf dem Wurstelprater rührte sich nichts mehr, die letzten Zecher waren von den Wachleuten vertrieben worden, auch die Musikanten hatten mittlerweile zu spielen aufgehört. Doch sicher machte der Mord bereits jetzt schon die Runde.
Und auch von dem Pfahl werden die Leute bald erfahren, dachte Leo. So etwas lässt sich nicht lange verheimlichen.
Der schreckliche Vorfall hatte zumindest dazu geführt, dass die Kollegen am Ende doch noch mit ihm kooperiert hatten – auch wenn die Stimmung ziemlich angespannt gewesen war. Schweigend und professionell hatten sie gemeinsam die Arbeit am Tatort verrichtet. Der Leichenwagen war gekommen und hatte die Leiche ins gerichtsmedizinische Institut gebracht, der abgesperrte Uferstreifen war noch einmal mit den starken Auer-Lampen abgesucht worden, jedoch ohne weiteres Ergebnis. Als der Untersuchungsrichter mit fast zweistündiger Verspätung völlig übermüdet, mit Ringen unter den Augen, eingetroffen war, musste er nur noch das Protokoll abzeichnen.
Sogar ein paar zusätzliche Aufnahmen mit seiner Kamera hatte Leo machen dürfen, unter den kritischen Blicken des glatzköpfigen Oberinspektors. Der Dicke mit dem Wangenbart hieß Paul Leinkirchner, sein hagerer, bohnenlanger Kollege war Erich Loibl, und beide waren sie Polizeiagenten des Wiener Sicherheitsbüros für Blutverbrechen, wobei Leinkirchner Loibls direkter Vorgesetzter war. Der dritte Zivilinspektor, jener blasse junge Mann namens Andreas Jost, befand sich noch in der Ausbildung. Jost hatte sich während der Untersuchung der Leiche ein wenig abseits gehalten, vermutlich, weil er einen weiteren peinlichen Schwächeanfall befürchtete, doch er hatte Leo später ein paar aufmerksame Fragen gestellt. Offenbar konnte er mit den modernen Ermittlungsmethoden weitaus mehr anfangen als die beiden älteren Kollegen.
Der Fiaker rumpelte über den Ring mit seinen vielen bürgerlichen Palästen, der Wiener Börse, dem Hofburgtheater und dem Volksgarten, wo im kalten Licht einige elektrifizierte Leuchten flackerten, und bog am Schmerlingplatz rechts ab in die Lerchenfelder Straße. Gaslaternen brannten in regelmäßigen Abständen und wiesen dem Kutscher den Weg. Ein paar lärmende Nachtschwärmer, die vermutlich aus einem der anrüchigen Etablissements am Spittelberg kamen, passierten die Straße, ansonsten war die Gegend um diese Uhrzeit wie ausgestorben, der Himmel schwarz und sternenlos.
Die Kutsche fuhr nach rechts in die Lange Gasse und hielt schließlich vor einem mehrstöckigen Mietshaus, wo Leo erst kürzlich eine Unterkunft gefunden hatte. Hier in der Josefstadt, dem achten Bezirk, wohnte das gediegene Bürgertum, es war ein besseres Viertel, wenn auch nicht so elegant, wie es Leo von seinem Grazer Viertel Geidorf gewohnt war. Sein altes Leben schien ihm bereits lange zurückzuliegen, dabei war er erst wenige Tage in Wien.
Er gab dem Kutscher ein paar Münzen, sperrte so leise wie möglich die untere Tür auf und stieg die Treppe hoch. Offenbar nicht leise genug, denn auf der Stiege im zweiten Stock erwartete ihn bereits seine Zimmerwirtin. Die ältere Dame trug einen verschlissenen Seidenrock und eine Schlafhaube, die beide schon bessere Zeiten gesehen hatten, ebenso wie deren Besitzerin. Adelheid Rinsinger war eine Beamtenwitwe aus besserem Haus, die sich den Unterhalt ihrer Wohnung mit dem Vermieten eines ihrer vielen Zimmer finanzierte. Sie sah Leo säuerlich an.
»Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Ich dachte, es wären Einbrecher im Haus.«
»Nun, dann ist es ja gut, dass jetzt die Polizei da ist«, erwiderte Leo mit einem lahmen Scherz und versuchte, sich an seiner Zimmerwirtin vorbeizustehlen.
»Herr von Herzfeldt, ich verstehe durchaus, dass die Polizei niemals schläft. Aber ich tue es, allerdings nicht sehr gut. Ich bin sehr geräuschempfindlich. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie um diese Zeit …«
»Frau Rinsinger, wollen Sie jetzt schon etwas wissen, was morgen in allen Zeitungen steht?«, fragte Leo in verschwörerischem Ton. Er hatte die alte Witwe richtig eingeschätzt, sofort wurde sie hellhörig.
»Ein Mord etwa?«, hauchte sie.
»Am Prater.« Leo nickte ernst. »Leider darf ich Ihnen nicht mehr sagen. Polizeigeheimnis, Sie verstehen sicherlich.«
»Natürlich, natürlich.« Frau Rinsinger versuchte, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Trotzdem hatte Leo bei ihr sichtlich an Ansehen gewonnen. Bislang war er für sie lediglich ein junger, attraktiver Inspektor aus Graz gewesen, mit guten Umgangsformen, doch eigentlich ein Niemand. Nun war er plötzlich zum Mordermittler aufgestiegen. Zumindest wusste Leo jetzt, wie er sich Frau Rinsinger in Zukunft gefügig machen konnte.
»Wollen Sie noch etwas essen?«, fragte sie mitfühlend. »Ein Käsebrot mit eingelegten Zwiebeln vielleicht?«
»Danke, ich bin hundemüde, und die Ermittlung hat mir auf den Magen geschlagen.«
»Das ist nur allzu verständlich. Dann gute Nacht, Herr von Herzfeldt!« Sie begleitete ihn durch den langen, mit staubigen Teppichen ausgelegten und mit verblassten Biedermeier-Gemälden behängten Gang bis zu seinem Zimmer. Die sauertöpfischen Mienen der Porträtierten ließen Leo vermuten, dass es Frau Rinsingers vor langer Zeit verstorbene Ahnen waren.
»Wenn ich sonst noch etwas für Sie …«
»Danke, sehr freundlich. Gerne einen Kaffee morgen früh um acht, bevor ich ins Büro gehe. Schwarz, ohne Zucker. Gute Nacht und ergebensten Dank!« Er schloss die Tür hinter sich und ließ seine neugierige Wirtin draußen im Flur stehen. Dann stellte er den Koffer und die beiden Taschen ab und sah sich in dem kleinen Zimmer um.
Ein schmales Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Garderobenspiegel und zwei Stühle … Immerhin hingen frisch gewaschene Gardinen am Fenster, das Parkett war gebohnert, der Raum gelüftet, er hätte es schlechter treffen können. In den letzten Tagen war er noch nicht einmal dazu gekommen, seinen fast mannshohen Garderobenkoffer auszuräumen.
Bei Leos Ankunft am Wiener Südbahnhof vor drei Tagen war der Kutscher zuerst an den großen Hotels am Ring vorbeigefahren, am Grand Hotel, am Bristol und am Imperial, und hatte den Reiseführer gespielt, offenbar in der Annahme, der gut gekleidete junge Gentleman mit dem Homburghut und dem umfangreichen Gepäck würde hier irgendwo absteigen. Als sie dann schließlich vor Leos Pension in der Langen Gasse hielten, war der Kutscher sichtlich enttäuscht gewesen. Vermutlich hatte er auf mehr Trinkgeld gehofft.
Im Spiegel betrachtete Leo sein Gesicht. Kein Wunder, dass er bei Frau Rinsinger mütterliche Gefühle weckte, er hatte eindeutig schon mal besser ausgesehen. Das blonde Haar hing ihm nass und in Strähnen in die Stirn, sein sonst so akkurat glatt rasiertes Kinn zeigte erste Stoppeln. Im Gegensatz zu den meisten Männern trug Leo keinen Bart, nicht mal einen Schnauzer, was auch daran lag, dass ihm trotz seiner dreißig Jahre kein rechter Bart wachsen wollte. Seine Schwester Lili nannte ihn deshalb oft scherzhaft immer noch Bubi, obwohl er der Ältere von ihnen war.
Er zog Mantel, Hose, Weste und Hemd aus, hüllte sich in eine Wolldecke und kramte in der Schublade nach einer Schachtel Zigaretten. Es war die letzte, die andere Schachtel war vom Regen völlig durchweicht. Bislang hatte er in keiner Wiener Trafik seine geliebten Yenidze-Zigaretten finden können, vielleicht würde er sich welche aus Dresden liefern lassen müssen. Wenn das Geld dafür noch reichte … Er hätte dem Kutscher, der ihn zum Prater gefahren hatte, nicht so viel Trinkgeld geben sollen, auch wenn der Kerl wie der Teufel gefahren war!
Der Prater …
Leo erschauerte. Die Erinnerungen an den Tatort kamen zurück. Es war beileibe nicht seine erste Leiche, in Graz als junger Untersuchungsrichter hatte er in den letzten Jahren etliche Tote gesehen. Erschlagene, Erschossene, Erwürgte, Erdolchte … Meist waren es Eifersuchtsdramen gewesen, oder es war um Geld gegangen, man hatte die Täter schnell gefasst. Aber diese Leiche auf der Lichtung am Prater war etwas … anderes, das hatte er sofort gespürt. Ob dieser Irre den Pflock erst post mortem verwendet hatte oder schon davor, als das Mädchen noch lebte? Und was sollte diese seltsame Inschrift?
Domine, salva me …
Nun, die gerichtsmedizinische Untersuchung würde sicher Genaueres ergeben.
Zitternd nahm Leo einen tiefen Zug von seiner Zigarette und sah dem Rauch zu, wie er zur Decke stieg. War es falsch gewesen, den Tatort aufzusuchen? Vermutlich ja. Er war in seinem neuen Büro gewesen, in der Polizeidirektion am Schottenring, der Pförtner hatte ihm staunend aufgemacht und ihm nach Prüfung der Akten sogar schon den Dienstrevolver und seine Kokarde ausgehändigt. Die berühmte Kokarde der Wiener Polizeiagenten! Kaum jemand war am Sonntag im Präsidium. Leo hatte seine Bücher und Akten eingeräumt, sich ein wenig mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht, die Zeit totgeschlagen … Und dann hatte er im Nachbarraum gehört, wie eine Frau, vermutlich eine der Sekretärinnen, einen Telefonanruf entgegennahm. Sie hatte die spärlichen Informationen notiert und schließlich den Anruf an die Polizeiwache vom zweiten Bezirk weitergeleitet. Leos Entschluss war spontan gewesen, aber er hatte sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt. Denn eines war klar: Mit seinem ersten Auftritt in Wien hatte er sich nicht eben Freunde gemacht.
Aber darin war er ohnehin sehr schlecht.
Leo drückte die Zigarette im Aschenbecher neben seinem Bett aus, stand auf und setzte sich, noch immer die Wolldecke um die Schultern, an den Tisch. Das »Handbuch für Untersuchungsrichter« lag aufgeschlagen vor ihm, er blätterte zur allerersten Seite, wo die Widmung stand.
Meinem besten Schüler Leopold von Herzfeldt. Möge er den Weg beschreiten, den ich ihm gewiesen habe. Mit Respekt und gegenseitiger Hochachtung, Hans Gross, Staatsanwaltschaft Graz.
Nicht zum ersten Mal spürte Leo den Druck, der mit diesen Zeilen einherging. Die Erwartung, die er hoffte, erfüllen zu können. Oder hatte er sie bereits jetzt schon enttäuscht? Doch es gab kein Zurück mehr. Hier war sein neues Zuhause, das Schicksal hatte den goldenen Käfig für ihn geöffnet. Und draußen in der Wiener Nacht schwirrten die seltsamsten, unheimlichsten Vögel.
Ohne seinen seidenen Pyjama anzuziehen, legte Leo sich mit der Wolldecke ins Bett und fiel kurz darauf in einen tiefen Schlaf, aus dem ihn erst Frau Rinsingers starker Morgenkaffee wieder weckte.
»Zigarre?«
In der Wiener Polizeidirektion schob Oberpolizeirat Albert Stehling Leo das nach frischem Tabak duftende Mahagonikästchen hin, doch dieser lehnte lächelnd ab. Dabei bemühte er sich, den menschlichen Schädel zu ignorieren, der ihn vom Tisch aus beinahe vorwurfsvoll anstarrte. Es war Montag, neun Uhr morgens, doch durch die fast gänzlich zugezogenen Vorhänge fiel nur wenig Licht. Stattdessen flackerte über ihnen eine Gaslampe, ihr Schein kämpfte sich durch die Rauchschwaden, die Stehlings majestätisch großes Büro wie Nebelschleier durchzogen.
»Danke, ich rauche Zigaretten.« Leo zog eine seiner letzten Yenidzes aus der Schachtel und ließ sich von Stehling Feuer geben. Erst dann entzündete der Herr Oberpolizeirat seinen eigenen Stumpen und paffte genüsslich.
»Ich werde diese neue Mode nie verstehen«, sagte Stehling nach ein paar schweigsamen Zügen. Er deutete auf Leos Zigarette. »Was findet die Jugend nur an diesen dünnen Glimmstängeln? Fade, ohne Geschmack, schon nach ein paar Minuten sind sie aufgeraucht …«
»Ich denke, das macht gerade ihren Erfolg aus. Alles Neue geht jetzt schneller, auch das Rauchen.«
»Verflucht, da haben Sie recht!« Stehling lachte laut auf. Er war ein Berg von einem Mann, mit buschigem Backenbart, fleischigen Hängewangen und großer Knubbelnase, als hätte Gott bei seiner Erschaffung noch ein paar Klumpen Lehm übrig gehabt. »Vermutlich werden irgendwann alle diese Schilfröhrchen rauchen. Aber ich bin eben noch ein Mann aus der guten alten Zeit. So wie unser guter alter Kaiser, möge er noch lange leben.«
Albert Stehling wies auf das Bild Franz Josefs, das über seinem Bürotisch hing, wie in allen Amtsgebäuden der k. u. k. Monarchie. Durch das fast gänzlich das Gesicht bedeckende Haargewucher sahen sich der Oberpolizeirat und sein Kaiser erstaunlich ähnlich, wie Leo fand.
Stehlings Büro war eine Mischung aus Büro, Museum und Asservatenkammer. Leo hatte schon von der makabren Einrichtung gehört, nun konnte er sich selbst ein Bild davon machen. Neben dem Schädel auf dem Tisch, dem Relikt eines hingerichteten Mörders, lag ein alter, verrosteter Revolver, der sicher irgendeinem anderen berühmten Mörder oder Anarchisten gehört hatte. An den Wänden hingen gleich Museumsstücken Einbruchswerkzeuge, Handschellen, vergilbte Steckbriefe und sogar ein Lasso wie aus einem dieser neuen Wildwestromane. All dies stand in krassem Gegensatz zu seinem Besitzer, der mit seinem bäuerlich gutmütigen Gesicht eher wie ein Schankwirt als der Leiter des berühmten Wiener Sicherheitsbüros aussah. Seine Mitarbeiter nannten ihn deshalb hinter seinem Rücken halb spöttisch, halb liebevoll Papa Stehling.
»Darf ich fragen, warum Sie als Grazer den hochdeutschen Zungenschlag sprechen?«, fragte Papa Stehling und paffte genüsslich an seiner Zigarre.
»Meine Mutter ist Deutsche«, sagte Leo achselzuckend. »Sie stammt aus Hannover. Dort habe ich auch die ersten Schuljahre im Internat verbracht. Ich habe das Hochdeutsche nie ganz ablegen können.«
»Wem sagen Sie das?« Stehling grinste. »Ich stamme ursprünglich aus Kassel. Wir Piefkes haben es in Wien nicht immer leicht, das kann ich Ihnen sagen. Alles e bissi anders da«, fiel er in seinen nordhessischen Dialekt. Er zwinkerte Leo verschwörerisch zu und blies den Zigarrenrauch aus wie eine Dampflok. Plötzlich wurde seine Miene ernst.
»Tja, eigentlich sollte ich Ihnen jetzt zu Ihrem neuen Posten als Wiener Polizeiagent gratulieren, mit einem Glas Cognac anstoßen, so von Piefke zu Piefke. Ich würde Ihnen die Räumlichkeiten zeigen und Ihnen alles Gute wünschen. Doch bedauerlicherweise müssen wir stattdessen über diesen leidigen Vorfall letzte Nacht sprechen.«
Leo zog verlegen an seiner Zigarette, die ihm plötzlich gar nicht mehr schmeckte. Er hatte geahnt, dass sein nächtlicher Auftritt Folgen haben würde. Als Stehling ihn gleich nach seinem Eintreffen zu sich ins Büro gebeten hatte, hatte sich diese Ahnung noch verstärkt.
»Lassen Sie mich erklären …«, begann Leo. Doch der Oberpolizeirat unterbrach ihn barsch.
»Da gibt es nichts zu erklären. Sie waren für diesen Fall nicht eingeteilt, punktum!« Stehlings Stimme hallte wie Donner durchs Büro. »Wenn, dann erkläre ich Ihnen jetzt mal was!«
Leo stellte fest, dass das Hochdeutsche im Gegensatz zum Wienerischen viel strenger klang, so gar nicht nach Papa Stehling. Dessen sonst so gutmütig leuchtende Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Im Grunde hätten Sie noch gar nicht Ihre Marke tragen dürfen, Ihr Dienst fängt erst heute an! Außerdem hat mir Oberinspektor Paul Leinkirchner vorhin berichtet, dass Sie die Ermittlungen ohne Untersuchungsrichter begonnen und auch noch das Leben Ihrer Kollegen gefährdet haben. Es gab da wohl eine Explosion …«
»Das war doch nur Blitzlichtpulver!«, empörte sich Leo. »Was kann ich dafür, wenn der Kollege so etwas nicht gleich erkennt?«
»Wir arbeiten hier mit anderen Methoden als in Graz, Agent Herzfeldt. Ich habe schon von Ihren neuartigen Methoden gehört, die dieser … dieser …« Stehling blätterte in seinen Notizen. »… Hans Gross in seinem ›Handbuch für Untersuchungsrichter‹ niedergeschrieben hat. Das Buch mag in gewissen Kreisen ja ein Erfolg sein, aber bei uns in Wien müssen sich diese Methoden erst noch beweisen. Das klingt doch alles sehr nach blutleerer Theorie.« Der Oberpolizeirat nahm einen weiteren tiefen Zug von der Zigarre und lehnte sich zurück. »Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Herzfeldt. Dass das Wiener Polizeiagenteninstitut Sie probeweise in den Dienst aufgenommen hat, geht nicht auf meinen Wunsch zurück.« Er hob die Hand. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Sie haben die besten Empfehlungen, haben Ihr Jus-Studium mit summa cum laude abgeschlossen, waren wohl in Graz ein glänzender Untersuchungsrichter. Ich will das nicht schmälern. Aber das war eben Graz und nicht Wien. Hier ticken die Uhren anders.«
»Wie darf ich das verstehen, Herr Oberpolizeirat?«, fragte Leo vorsichtig.
Stehling beugte sich vor. »Wien ist eine der größten Städte der Welt, prächtig und gnadenlos zugleich. Atemberaubend und tödlich. Unsere Mordrate kann durchaus mit der von London und New York mithalten, vor allem jetzt, da so viele Migranten aus dem Osten in unsere Stadt strömen. Diese Stadt ist eine giftige Suppe, die jederzeit überkochen kann. Was im kleinen, beschaulichen Graz funktioniert, muss hier noch lang nicht funktionieren. Ihre Einstellung geht einzig und allein auf eine Empfehlung von Polizeikommissär Stukart zurück. Sie wissen, wer das ist, nehme ich an?«
»Der stellvertretende Leiter des Sicherheitsbüros«, erwiderte Leo und nickte. »Ihr Vize.«
»Mein Vize, ja. Und sicher einer der kommenden Männer hier im Präsidium, anders als ich alter, fetter Gaul.« Stehling machte ein abfälliges Geräusch, das wirklich fast wie ein Wiehern klang. »Manche sehen Stukart schon als nächsten Polizeipräsidenten. Ein Mann der neuen Zeit, in der jetzt alles schneller geht, wie Sie vorhin so treffend bemerkten. Nun, vielleicht geht manches schneller, aber deshalb nicht unbedingt besser. Auch wenn wir jetzt diese Apparate hier haben.« Er deutete auf einen hölzernen Kasten mit Blechmuschel, der auf einem Beistelltisch stand. »Das Geklingel raubt mir noch den letzten Nerv.«
Stehling blätterte in den Akten vor sich auf dem Tisch. Unangenehmes Schweigen trat ein.
»Eines müssen Sie mir noch erklären, Herzfeldt«, sagte der Oberpolizeirat schließlich, ohne aufzublicken. »Sie kommen aus allerbestem Haus, waren bereits Untersuchungsrichter. Mit Ihrer bisherigen Laufbahn und Ihren Kontakten hätten Sie sofort einen Posten als Richter am Grazer Landesgericht bekommen, hätten eine Bilderbuchkarriere gemacht. Und nun wollen Sie als einfacher Polizeiagent bei uns in Wien im Dreck wühlen? Warum, um Gottes willen?«
»Mich … interessiert diese Arbeit eben«, sagte Leo zögernd. »Staatsanwalt Hans Gross meint immer …«
»Ihr großartiger Mentor, jaja, ich weiß.« Stehling seufzte. »Sie haben bei ihm im Gericht Ihre Ausbildung als Untersuchungsrichter durchlaufen, wie ich den Akten entnehme. Kollege Stukart kennt ihn wohl auch und ist ganz begeistert von seinen Methoden. Stukart stellt sich wohl so etwas Ähnliches hier in Wien vor, vielleicht sogar einen eigenen Studiengang der Kriminalistik, so nennt man das ja wohl neuerdings. Kriminalistik, ha! Als könnte Wissenschaft jemals die Erfahrung langjähriger Polizeiarbeit wettmachen!« Der Oberpolizeirat schnaubte. »Wie ich höre, will dieser Gross schon im November eine Vortragsreihe bei uns in Wien halten. Und Sie sind dann wohl so etwas wie die Vorhut, hm?«
Leo versuchte ein Lächeln. »Nun, Staatsanwalt Gross hielt es in der Tat für hilfreich, wenn einer seiner Mitarbeiter schon ein wenig, sagen wir … den Boden bereitet.«
»Na, das ist Ihnen gestern Nacht ja schon hervorragend gelungen. Den Boden bereiten, ha!« Stehling grinste, doch sofort wurde er wieder ernst. »Davon abgesehen ist das ein grauenhafter Fall, auf den Sie da gestoßen sind. Das arme Mädchen! Was für ein Irrer macht so was – mit einem Pfahl? Und dann noch diese seltsame Inschrift!« Er schüttelte sich. »Ich habe die Kollegen Leinkirchner und Loibl für diesen Fall eingeteilt, und zwar ausschließlich.«
»Weiß man denn schon etwas über die Identität des Opfers?«, erkundigte sich Leo. »Oder darüber, woher dieser Pfahl stammt? Ich habe Spuren an der Bluse der Leiche gesichert, die …«
»Das hat Sie nicht mehr zu interessieren, Herr Kollege.« Stehling drückte seine Zigarre in einem Aschenbecher aus, der, wie Leo jetzt erst bemerkte, aus einer menschlichen Hirnschale geschnitzt war. »Ich danke Ihnen für Ihre eifrige Mitarbeit, doch die ist, was diesen Fall betrifft, hiermit beendet.«
»Aber wieso …?«, fragte Leo.
»Weil sich, wie bereits erwähnt, die Kollegen Leinkirchner und Loibl mit dem Fall befassen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Sie nach den Vorkommnissen gestern noch mit den beiden zusammenspannen kann? Ich denke, Sie backen erst mal kleinere Brötchen, Herzfeldt.«
»Verstehe«, sagte Leo tonlos.
»Na, nun seien Sie doch nicht gleich traurig.« Stehling setzte wieder seinen gemütlichen Papa-Blick auf. »Ich verlange ja gar nicht, dass Sie hier nur Akten wälzen. Sehen Sie sich das hier mal an.« Er schob Leo eine dünne Mappe zu. Sie enthielt ein paar zerfledderte Zeitungsartikel, außerdem einen Totenschein und einen hastig hingekritzelten Abschiedsbrief. Offenbar ging es um einen Selbstmörder, doch Leo wurde beim ersten Überfliegen nicht ganz schlau daraus.
»Es handelt sich um den Selbstmord eines gewissen Bernhard Strauss«, erklärte Stehling. »Der Gute hat sich zu Hause erhängt und wurde vor ein paar Tagen auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben.«
»Und?«, fragte Leo.
Stehling seufzte. »Na ja, es gab nach der Beerdigung wohl einen unschönen Vorgang. Jemand wollte die Leiche wieder ausgraben und ist im letzten Moment dabei entdeckt worden.«
»Leichenräuber also. Verstehe.« Leo nickte. »Das gibt es sogar bei uns im kleinen, ach so beschaulichen Graz von Zeit zu Zeit.« Er hoffte, dass Stehling seine Verbitterung nicht zu sehr heraushörte.
Weil die Medizinprofessoren für ihre wissenschaftlichen Sektionen ständig neue Leichen brauchten, wurden gelegentlich Leichenräuber gedungen, um den Ärzten frisches Material zu besorgen. Im schottischen Edinburgh hatten zwei Galgenvögel vor einigen Jahrzehnten sogar über ein Dutzend Menschen umgebracht, um sie der Universität als Frischfleisch zu präsentieren. Es wunderte Leo nicht, dass in Wien mit seiner großen Universität solche Leichendiebstähle vorkamen – zumal Selbstmörder oft ohnehin auf den Sektionstischen der Studenten landeten.
»Tja, so wird es wohl sein«, entgegnete Stehling achselzuckend. »Ich möchte trotzdem gerne, dass Sie der Sache nachgehen. Ich nehme an, Sie sind mit der Familie Strauss vertraut?«
»Strauss …« Leo blieb kurz der Mund offen stehen. »Sie meinen doch nicht etwa …?«
»Doch, genau diese Familie. Bernhard Strauss ist ein Halbbruder von Walzerkönig Johann Strauss höchstpersönlich. Zwar nur ein Bastard des alten Strauss, aber immerhin. Die Zeitungen überschlagen sich. Vielleicht haben Sie in einem Wiener Kaffeehaus am Wochenende ja schon davon gelesen?«
Leo räusperte sich. »Ich … hatte noch nicht die Gelegenheit.«
»Nun, dann wüssten Sie, dass dieser Bernhard Strauss einen larmoyanten Abschiedsbrief hinterlassen hat. Eben diesen hier.« Stehling tappte mit seinem dicken Finger auf das zerknitterte Stück Papier aus der Mappe. »Und nicht nur das. Er hat den Brief freundlicherweise vor seinem Ableben an alle großen Wiener Zeitungen geschickt. Darin behauptet der Kerl frech, er und nicht Johann Strauss junior sei der Komponist des berühmten Donauwalzers. Sie wissen schon … Lalalaladummdidumdidumm …« Stehling brummte mehr schlecht als recht ein paar Töne in seinen Bart, trotzdem erkannte Leo die Melodie sofort. Jeder kannte sie, sie war so etwas wie die inoffizielle Hymne der Donaumonarchie. Der Stolz aller Österreicher.
»Tja, und jetzt gräbt auch noch jemand seine Leiche aus«, fuhr Stehling fort. »Vermutlich wäre sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden, wenn der Totengräber die verfluchten Halunken nicht in letzter Minute gestört hätte. Sind auf und davon, ohne Leiche. Wir können nur hoffen, dass die Zeitungen keinen Wind davon bekommen. Es reicht schon diese Sache mit dem Suizid und dem Donauwalzer.« Der Oberpolizeirat wies auf die Mappe. »Lesen Sie sich in den Fall ein, und dann fahren Sie raus zum Wiener Zentralfriedhof. Aber bitte öffentlich, auch wir müssen sparen! Gehen Sie der Sache nach, damit wir die Akte schließen können. Ich will nur nicht, dass es wieder irgendwelchen Trubel gibt! Also kein Blitzlichtpulver und solchen Hokuspokus, verstanden?«
Leo nickte stumm.
»Tja, dann wäre das ja geklärt.« Stehling wollte eben zu einer Glocke auf dem Tisch greifen – dem Miniatur-Nachbau eines Armesünderglöckchens, wie es bei Hinrichtungen erklang –, als Leo sich noch einmal räusperte.
»Was ist denn noch?«, fragte Stehling ungeduldig.
»Äh, ich weiß, es ist unüblich«, begann Leo. »Aber könnte ich vielleicht einen Vorschuss …«
»Einen Vorschuss?« Stehling sah ihn verblüfft an. »Das ist in der Tat unüblich. Vor allem, wenn man aus einem so vermögenden Haus stammt wie Sie. Kann Ihnen Ihr Herr Vater nicht unter die Arme greifen?«
»Mein Vater und ich … das ist zurzeit ein eher schwierigeres Kapitel.«
»Hm, verstehe.« Stehling nickte. »Nun, wenns denn sein muss. Lassen Sie sich im ersten Stock an der Kasse fünfzig Kronen auszahlen.« Er kritzelte seine Unterschrift auf ein Formular. »Aber dafür fahren Sie mir heute noch mit der Pferdetramway auf den Zentralfriedhof!« Er klingelte mit der Glocke, und eine Dame im mausgrauen Kleid erschien, vermutlich eine der vielen Sekretärinnen in der Direktion. »Das Fräulein wird Ihnen jetzt noch die Räumlichkeiten zeigen. Ach, und, Herzfeldt …«, sagte Stehling, während Leo schon mit seiner Begleiterin zur Tür ging. Der Papa fischte sich eine neue Zigarre aus dem Mahagonikästchen.
»Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf. Versuchen Sie, so wenig hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Ich weiß, wovon ich rede. Einen schönen ersten Arbeitstag in Wien.«
Als Leo Stehlings Büro verließ, fühlte er sich wie in Watte gepackt. Fast mechanisch folgte er dem Fräulein, das auf Türen zur Linken und zur Rechten wies und dabei irgendetwas sagte, doch er hörte gar nicht richtig hin. So wie es aussah, hatte Stehling ihn aufs Abstellgleis geschoben, und das schon am ersten Tag. Einen Ausflug mit der Pferdetramway zum Zentralfriedhof, um ein geschändetes Grab zu inspizieren, das also war sein Auftrag! Und vermutlich war das nur der Anfang seiner großartigen Karriere hier in Wien. Was würde noch folgen? Das Aufspüren vermisster Schoßhunde, ein Tortendiebstahl in der Konditorei Demel? Wie zum Hohn kam ihm just in diesem Moment auch noch Oberinspektor Paul Leinkirchner entgegen und grinste breit. Wie bereits gestern Nacht kaute der Glatzkopf auf einem Zigarrenstumpen, vielleicht sogar noch auf demselben.
»Ah, der neue Kollege! Waren wohl eben gerade beim Chef, wie? Na, wie ist es gelaufen?«
Leo schwieg und versuchte, sich im engen Gang an Leinkirchner vorbeizudrängen, aber dieser ließ nicht locker.
»Wie ich sehe, führt Sie unser reizendes Lämmchen durch die Direktion. Mein liebes Fräulein, vergessen Sie nicht, dem Kollegen auch unser großes Archiv im Keller zu zeigen! Vermutlich wird Herr von Herzfeldt dort demnächst viel Zeit verbringen. Doch nicht mit Ihnen.« Lachend gab Leinkirchner der jungen Frau einen Klaps auf den Po und schob sich an ihnen vorbei. Leo roch kalten Zigarrenrauch, vermischt mit Schweiß. Erst jetzt fiel ihm auf, dass der Kollege sein linkes Bein leicht nachzog.
»Wo haben Sie denn Ihren Koffer gelassen, Herzfeldt?«, rief Leinkirchner ihm noch zu. »In irgendeiner kleinen Judenpension?«
Kurz war Leo versucht, Leinkirchner nachzulaufen, den Kerl an seinem schmutzigen Kragen zu packen und gegen die nächste Tür zu werfen.
Wunderbar, Staatsanwalt Gross wäre stolz auf dich! Vom Polizeiagenten zum Untersuchungshäftling in nur einem Tag …
Stattdessen folgte er brav seiner Führerin, die sich nun zum ersten Mal nach ihm umdrehte. Sie trug einen strengen Dutt, ein langes, eng anliegendes graues Kleid und eine weiße Bluse. Hinter ihrer Brille, die an einer Kette um ihren Hals hing, musterte sie ihn, als würde sie ihn erst jetzt richtig wahrnehmen.
»Die Kollegen kennen sich?«, fragte sie kühl.
»Nur beiläufig. Wir … wir haben uns gestern Abend erst kennengelernt.«
»Offenbar Liebe auf den ersten Blick.« Ihre Miene blieb ausdruckslos, nur ein kleines Funkeln in den Augen verriet den Spott. Leo zögerte. Irgendwoher kannte er die Frau, aber er wusste nicht, woher. Sie drehte sich wieder um und fuhr fort, ihm die einzelnen Räume zu erläutern.