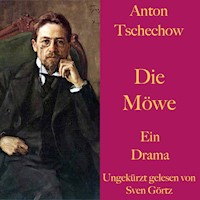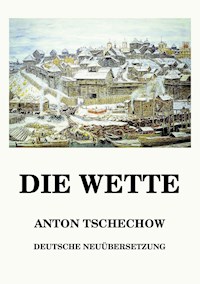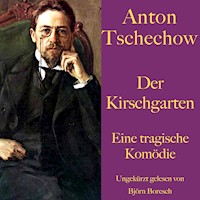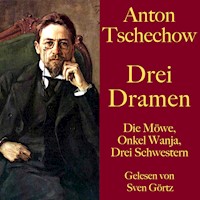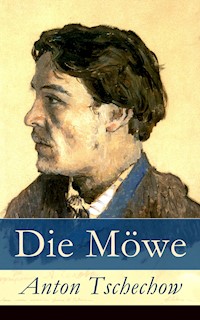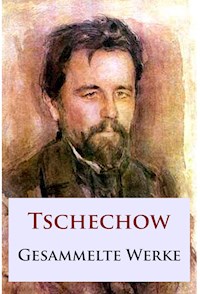Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anton Tschechow gehört zu den bekanntesten Schriftstellern, Novellisten und Dramatiker Russlands. Insgesamt werden über 600 literarische Werke ihm zugerechnet. In diesem Band finden sich die folgenden Geschichten: Eine schreckliche Nacht Der Redner Die Nacht vor der Verhandlung Verwirrung der Geister Der Rächer seiner Ehre Ein Glücklicher Der teure Hund Der Dramatiker Der Gast Der Kater Ein Unikum Die Rache Die Freude! Ein wehrloses Geschöpf Eine Tochter Albions Das Drama Das Kunstwerk Ja, das Publikum! Ein Chamäleon Aus dem Regen in die Traufe Teure Stunden Die Jungens Eine Bagatelle Die letzte Mohikanerin Zu Hause Die Leichtbeschwingte Wolodja der Große und Wolodja der Kleine Ein Fall aus der Praxis Der Taugenichts Das Ende des Komödianten Im Alter Der Typhus Wolodja Jonytsch Schatten des Todes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine schönsten Geschichten
Anton Tschechow
Inhalt:
Anton Tschechow – Biografie und Bibliografie
Eine schreckliche Nacht
Der Redner
Die Nacht vor der Verhandlung
Verwirrung der Geister
Der Rächer seiner Ehre
Ein Glücklicher
Der teure Hund
Der Dramatiker
Der Gast
Der Kater
Ein Unikum
Die Rache
Die Freude!
Ein wehrloses Geschöpf
Eine Tochter Albions
Das Drama
Das Kunstwerk
Ja, das Publikum!
Ein Chamäleon
Aus dem Regen in die Traufe
Teure Stunden
Die Jungens
Eine Bagatelle
Die letzte Mohikanerin
Zu Hause
Die Leichtbeschwingte
Wolodja der Große und Wolodja der Kleine
Ein Fall aus der Praxis
Der Taugenichts
Das Ende des Komödianten
Im Alter
Der Typhus
Wolodja
Jonytsch
Schatten des Todes
Meine schönsten Geschichten, A. Tschechow
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849637866
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Anton Tschechow – Biografie und Bibliografie
Russischer Schriftsteller, geboren am 29.1.1860in Taganrog. Nach seinem Schulabschluss beginnt er im Alter von 19 Jahren in Moskau mit dem Medizinstudium und veröffentlicht bereits erste kurze Novellen. 1884 wird bei ihm zum ersten mal die Tuberkulose diagnostiziert. Seine Beliebtheit beim russischen Volk steigt rasant und 1887 wird zum ersten mal eines seiner Dramen, "Iwanow" gespielt. Ab 1891 reist T. immer wieder durch Europa und zieht nach Melichowo in der Nähe von Moskau. 1897 nimmt der Verlauf seiner Krankheit rasant zu und er muss ins Krankenhaus. Obwohl er selbst immer mehr an der Tuberkulose leidet, hilft er anderen, oft mittellosen Kranken beim Kampf gegen den Tod. Tschechow heiratet 1901 die Schauspielerin Olga Knipper. Obwohl ins deutsche Badenweiler gekommen um Heilung von seiner Krankheit zu erfahren, stirbt er dort am 15. Juli 1904 im Hotel Sommer.
Wichtige Werke:
1887: Iwanow
1888: Der Bär
1888: Der Heiratsantrag
1889: Tatjana Repina
1889: Tragödie wider Willen
1889: Die Hochzeit
1889: Der Waldschrat
1891: Das Jubiläum
1895: Die Möwe
1896: Onkel Wanja
1901: Drei Schwestern
1903: Der Kirschgarten
Eine schreckliche Nacht
Iwan Petrowitsch Panichidin erblaßte, schraubte den Lampendocht hinunter und begann mit erregter Stimme:
»Dichte Finsternis hielt die Erde umfangen, als ich in der Weihnachtsnacht 1883 von meinem inzwischen verstorbenen Freund heimkehrte, bei dem wir eine spiritistische Sitzung abgehalten hatten. Alle Gassen, durch die ich ging, waren aus irgendeinem Grunde nicht beleuchtet, und ich mußte mich beinahe vorwärtstasten. Ich wohnte damals in Moskau, dicht neben der Kirche ›Mariä Himmelfahrt auf den Gräbern‹, im Hause des Beamten Trupow, also in einer der entlegensten Gegenden des Arbat-Stadtteils. Während ich heimging, bedrückten mich schwere Gedanken ...
»– Dein Leben geht seinem Ende entgegen ... Tue Buße ... –«
So lautete der Satz, den mir bei der Sitzung Spinoza sagte, dessen Geist zu zitieren uns gelungen war. Ich bat ihn, die Worte zu wiederholen, und die Untertasse wiederholte sie nicht nur, sondern fügte noch hinzu: – Heute nacht! – Ich glaube nicht an den Spiritismus, doch der Gedanke an den Tod, selbst jeder Hinweis auf ihn, versetze mich in Trauer. Der Tod, meine Herrschaften, ist unvermeidlich, er ist alltäglich, und doch ist der Gedanke an ihn der Natur des Menschen zuwider ... Aber damals, als mich die undurchdringliche, kalte Finsternis einhüllte, vor meinen Augen die Regentropfen wirbelten, und ich weit und breit keine lebendige Seele sah und keine Menschenstimme hörte, war meine Seele von einem ungewissen, unfaßbaren Grauen erfüllt. Ich, der ich sonst frei von Vorurteilen bin, eilte vorwärts und fürchtete, zurückzublicken oder auf die Seite zu schauen. Es war mir, als müßte ich, wenn ich zurückblickte, unbedingt den Tod in Gestalt eines Gespenstes sehen.«
Panichidin seufzte kurz auf, trank einen Schluck Wasser und fuhr fort:
»Dieses ungewisse, doch Ihnen begreifliche Grauen verließ mich auch dann nicht, als ich den dritten Stock des Trupowschen Hauses erstiegen, die Türe geöffnet und mein Zimmer betreten hatte. In meiner bescheidenen Behausung war es finster. Der Wind heulte im Ofen und klopfte gegen die Luftklappe, als begehrte er Einlaß ins warme Zimmer.
– Wenn Spinoza die Wahrheit gesprochen hat, – sagte ich mir lächelnd, – so werde ich heute nacht, während der Wind so weint, sterben müssen. Es ist doch recht unheimlich! –
Ich entzündete ein Streichholz ... Ein wilder Windstoß lief über das Hausdach. Das leise Weinen wurde zu einem wütenden Gebrüll. Irgendwo unten klapperte ein Fensterladen, den der Wind schon halb von den Angeln gerissen hatte, und die Luftklappe meines Ofens winselte jämmerlich um Hilfe ...
– Wie mag es wohl in einer solchen Nacht einem Obdachlosen zumute sein! – dachte ich mir.
Es war aber nicht die Zeit für ähnliche Betrachtungen. Als der Schwefel an meinem Zündholz mit einer bläulichen Flamme aufleuchtete und ich mich in meinem Zimmer umsah, bot sich meinen Augen ein unerwarteter und schrecklicher Anblick ... Wie schade, daß der Windstoß mein Zündholz nicht erreichte! Dann hätte ich vielleicht gar nichts erblickt und meine Haare stünden nicht zu Berge. Ich schrie auf, taumelte einen Schritt zurück und schloß, von Verzweiflung und Erstaunen erfüllt, die Augen ...
In der Mitte meines Zimmers stand ein Sarg.
Das blaue Flämmchen brannte nur kurz, doch ich hatte Zeit, die Umrisse des Sarges zu unterscheiden ... Ich sah den rosagetönten, glitzernden Silberbrokat, mit dem der Sarg überzogen war, ich sah das goldene Kreuz auf dem Deckel. Es gibt Dinge, meine Herrschaften, die sich tief unserem Gedächtnis einprägen, selbst wenn wir sie nur einen kurzen Augenblick gesehen haben. So war es auch mit diesem Sarg. Ich sah ihn nur eine Sekunde lang, kann mich aber seiner in allen Einzelheiten erinnern. Der Sarg war für einen Menschen von mittlerem Wuchs bestimmt, der rosa Farbe nach zu schließen, wohl für ein junges Mädchen. Der kostbare Silberbrokat, die Füße und Griffe aus Bronze, – alles sprach dafür, daß es sich um eine vermögende Leiche handelte.
Ich stürzte wie wahnsinnig aus meinem Zimmer und rannte, ohne zu denken, ohne zu überlegen, nur von unbeschreiblicher Angst erfüllt, die Treppe hinunter. Im Korridor und auf der Treppe war es finster, ich trat immer auf die Schöße meines Pelzmantels, und es ist einfach erstaunlich, daß ich mir dabei nicht das Genick brach. Mein Herz klopfte furchtbar, mein Atem stockte ...«
Eine der Zuhörerinnen schraubte den Lampendocht wieder hinauf, rückte näher an den Erzählenden heran, und dieser fuhr fort:
»Ich würde mich nicht gewundert haben, wenn ich in meinem Zimmer eine Feuersbrunst, einen Dieb oder einen tollen Hund angetroffen hätte ... Auch nicht, wenn die Decke und der Fußboden eingestürzt und die Mauern umgefallen wären ... Dies alles ist natürlich und begreiflich. Wie konnte aber in mein Zimmer der Sarg geraten sein? Wo kam er her? Ein teurer, offenbar für eine junge Aristokratin bestimmter Sarg, – wie konnte er in das armselige Zimmer eines bescheidenen Beamten gekommen sein? Ist er leer, oder liegt in ihm eine Leiche? Wer ist diese so früh aus dem Leben geschiedene reiche Dame, die mir einen so seltsamen und schrecklichen Besuch abgestattet hat? Ein qualvolles Geheimnis!
– Wenn es kein Wunder ist, so ist es ein Verbrechen, – ging es mir blitzartig durch den Kopf.
Ich war ganz ratlos. Meine Türe war während meiner Abwesenheit abgeschlossen gewesen und der Schlüssel hatte sich an einer Stelle befunden, die nur meinen nächsten Freunden bekannt war. Der Sarg war doch nicht von meinen Freunden auf mein Zimmer gebracht worden! Man könnte annehmen, daß der Sargmacher den Sarg aus Versehen in mein Zimmer gebracht hatte. Er hätte sich im Stockwerk oder in der Türe irren und den Sarg in eine falsche Wohnung abliefern können. Wer weiß aber nicht, daß unsere Sargmacher niemals das Zimmer verlassen, ehe sie das Geld für ihre Arbeit oder wenigstens ein Trinkgeld bekommen haben?
– Die Geister haben mir den Tod prophezeit, – dachte ich mir: – Vielleicht haben sie mich auch gleich mit einem Sarge versorgt? –
Meine Herrschaften, ich glaubte niemals an den Spiritismus und glaube auch heute nicht an ihn, doch so ein Zufall kann selbst einen Philosophen in eine mystische Stimmung versetzen.
– Das ist aber so furchtbar dumm, und ich bin ängstlich wie ein Schuljunge, – sagte ich mir. – Es war nur eine optische Täuschung und sonst nichts! Auf dem Heimwege befand ich mich in einer so düsteren Stimmung, daß es gar kein Wunder ist, wenn meine kranken Nerven einen Sarg zu sehen vermeinten ... Natürlich, eine optische Täuschung! Was denn sonst? –
Der Regen peitschte mich ins Gesicht, und der Wind zerrte wütend an meinen Schößen und meiner Mütze ... Ich war ganz durchfroren und durchnäßt. Ich mußte doch irgendwo hingehen, doch wohin? Nach Hause zurückkehren, hieße doch, sich dem Risiko aussetzen, wieder den Sarg zu sehen; dieser Anblick ging aber über meine Kraft. Ohne eine lebende Seele in meiner Nähe zu haben, ohne eine Stimme zu hören, hätte ich, wenn ich mit dem Sarg, in dem vielleicht auch eine Leiche lag, allein geblieben wäre, verrückt werden können. Es war aber auch unmöglich, im Regen und in der Kälte auf der Straße zu bleiben.
Ich entschloß mich, zu meinem Freunde Upokojew zu gehen, der sich, wie Sie wissen, später erschossen hat, und bei ihm zu übernachten. Er lebte in der Pension Tschereepow in der Totengasse.«
Panichidin wischte sich den kalten Schweiß vom Gesicht, seufzte schwer auf und fuhr fort:
»Ich traf meinen Freund nicht an. Nachdem ich angeklopft und mich überzeugt hatte, daß er nicht zu Hause war, fand ich auf dem Pfosten über der Türe den Schlüssel und trat ein. Ich warf meinen durchnäßten Pelzmantel auf den Fußboden, fand im Finstern tastend das Sofa und setzte mich hin, um auszuruhen. Es war stockfinster ... Im Ventilator summte traurig der Wind. Im Ofen zirpte eintönig das Heimchen. Im Kreml fing man eben an, zur Weihnachtsmesse zu läuten. Ich beeilte mich, ein Zündholz anzustecken. Das Licht befreite mich jedoch nicht von der düsteren Stimmung, sondern im Gegenteil. Ein schreckliches, unsagbares Grauen bemächtigte sich meiner von neuem ... Ich schrie auf, wankte und verließ halb bewußtlos das Zimmer ...
Im Zimmer meines Freundes sah ich dasselbe wie bei mir: einen Sarg!
Der Sarg meines Freundes war beinahe doppelt so groß als der meinige, und der braune Stoff, mit dem er überzogen war, verlieh ihm einen besonders düsteren Charakter. Wie war er nur hergeraten? Daß es bloß eine optische Täuschung war, unterlag wohl keinem Zweifel ... Wie sollte auch in jedes Zimmer ein Sarg kommen? Es war offenbar eine rein nervöse Erscheinung, eine Halluzination. Wohin ich jetzt auch gehen wollte, überall würde ich wohl die schreckliche Behausung des Todes sehen. Folglich war ich dem Wahnsinn nahe und im Begriff, an einer ›Sargomanie‹ zu erkranken; die Ursache der Erkrankung war nicht schwer zu ergründen: ich brauchte mich nur der spiritistischen Sitzung der Worte Spinozas zu erinnern ...
– Ich werde verrückt! – sagte ich mir entsetzt und griff mich an den Kopf. – Mein Gott! Was soll ich machen?
Mein Kopf drohte zu zerspringen, meine Beine knickten ein ... Es goß in Strömen, der Wind ging mir durch Mark und Bein, und ich hatte weder Pelz noch Mütze. In das Zimmer Upokojews zurückkehren, um meine Sachen zu holen, ging über meine Kraft ... Das Grauen hielt mich in seinen kalten Armen fest. Die Haare standen mir zu Berge, kalter Schweiß rann mir in Strömen von der Stirne, obwohl ich auch fest daran glaubte, daß es nur eine Halluzination sei.«
»Was sollte ich machen?« fuhr Panichidin fort. »Ich wurde allmählich verrückt und riskierte, mich auch noch zu erkälten. Zum Glück erinnerte ich mich, daß in der Nähe der Totengasse mein guter Freund Pogostow, ein junger Arzt, wohnte, der soeben sein Staatsexamen gemacht und in dieser Nacht der gleichen spiritistischen Sitzung beigewohnt hatte. Ich eilte zu ihm ... Damals war er noch nicht mit der reichen Kaufmannswitwe verheiratet und wohnte im vierten Stock des Hauses des Staatsrates Kladbischtschenskij.
Bei Pogostow stand meinen Nerven eine neue Tortur bevor. Während ich zum vierten Stock hinaufstieg, hörte ich einen furchtbaren Lärm. Oben rannte jemand herum, trampelte mit den Füßen und schlug die Türen zu.
– Zu mir! – hörte ich ein herzzerreißendes Geschrei: – Zu mir! Hausmeister! –
Einen Augenblick später rannte mir von oben eine dunkle Gestalt im Pelzmantel und eingedrücktem Zylinder entgegen ...
– Pogostow! – rief ich aus, als ich meinen Freund erkannte. – Sind Sie es? Was haben Sie denn? –
Pogostow blieb vor mir stehen und griff krampfhaft nach meiner Hand. Er war blaß, keuchte schwer und zitterte. Seine Augen schweiften wie bei einem Irren umher, und seine Brust hob und senkte sich ...
– Sind Sie es, Panichidin? – fragte er mit dumpfer Stimme. – Sind Sie es wirklich? Sie sind blaß wie eine Leiche ... Vielleicht sind auch Sie eine Halluzination? ... Mein Gott ... Sie sind so schrecklich ... –
– Aber was haben Sie? Auch Sie sehen entsetzlich aus! –
– Ach, lassen Sie mich erst Atem holen ... Ich bin froh, daß ich Sie sehe, wenn Sie es wirklich sind und es keine optische Täuschung ist. Die verfluchte spiritistische Sitzung ... Sie hat meine Nerven so furchtbar erregt, daß ich, nach Hause zurückgekehrt, in meinem Zimmer ... was glauben Sie wohl? ... einen Sarg sah! –
Ich traute meinen Ohren nicht und bat ihn, seine Worte zu wiederholen.
– Einen Sarg, einen echten Sarg! – sagte der Arzt, indem er sich erschöpft auf eine der Stufen niederließ. – Ich bin kein Feigling, aber auch der Teufel selbst wird erschrecken, wenn er nach einer spiritistischen Sitzung im Finstern auf einen Sarg stößt! –
Stotternd erzählte ich ihm von den Särgen, die ich gesehen hatte ...
Eine Minute lang glotzten wir einander mit weit aufgesperrten Augen und Mündern an. Dann fingen wir an, einander zu kneifen, um uns zu vergewissern, daß es keine Halluzination sei.
– Wir spüren beide den Schmerz, – sagte der Arzt – folglich schlafen wir nicht und sehen einander wirklich. Folglich sind die Särge, wie der Ihrige so auch der meine keine optischen Täuschungen, sondern etwas Greifbares. Was fangen wir jetzt an, lieber Freund? –
Nachdem wir eine geschlagene Stunde im kalten Treppenhaus gestanden und alle möglichen Hypothesen aufgestellt hatten, waren wir ganz erfroren und faßten den Entschluß, uns von der kleinmütigen Angst freizumachen, den Diener zu wecken und mit ihm in das Zimmer des Arztes zu gehen. So machten wir es auch. Wir traten ins Zimmer, zündeten eine Kerze an und erblickten tatsächlich einen mit weißem Silberbrokat überzogenen Sarg mit goldenen Fransen und Quasten. Der Diener schlug andächtig ein Kreuz.
– Jetzt wollen wir feststellen, – sagte der Arzt ganz bleich und am ganzen Leibe zitternd, – ob dieser Sarg leer ist oder ... bewohnt ... –
Nach einem langen, wohlbegreiflichen inneren Kampfe beugte er sich und hob, vor Angst und Spannung die Zähne zusammenbeißend, den Sargdeckel. Wir blickten in den Sarg hinein und ...
Der Sarg war leer ...
Es lag keine Leiche darin, dafür fanden wir einen Brief folgenden Inhalts:
– Lieber Pogostow! Du weißt doch, daß mein Schwiegervater vor dem Bankrott steht. Er steckt bis an den Hals in Schulden. Morgen oder übermorgen kommt der Gerichtsvollzieher, und das wird seine Familie, wie auch die meine endgültig ruinieren und auch unsere Ehre untergraben, die für mich doch am wertvollsten ist. Auf unserem gestrigen Familienrate beschlossen wir, alles, was einen Wert hat, zu verstecken. Da das ganze Vermögen meines Schwiegervaters in Särgen steckt (er ist, wie Du weißt, der beste Sarglieferant in unserer Stadt), so entschlossen wir uns, die besseren Särge auf die Seite zu tun. Ich wende mich an Dich mit der Bitte, mir den Freundschaftsdienst zu tun und mir zu helfen, unser Vermögen und unsere Ehre zu retten! In der Hoffnung, daß Du uns helfen willst, unser Vermögen zu erhalten, schicke ich Dir, lieber Freund, einen Sarg und bitte Dich, ihn bei Dir zu verwahren, bis ich ihn wieder abhole. Ohne Hilfe unserer Bekannten und Freunde müssen wir zugrunde gehen. Ich hoffe, daß Du mir die Bitte nicht abschlagen wirst, um so mehr als der Sarg bei Dir höchstens acht Tage bleiben soll. Jedem, den ich für unseren wahren Freund halte, schickte ich einen Sarg und baue auf seine Großmut und Güte. In Liebe Dein Iwan Tscheljustin. –
Nach dieser Geschichte mußte ich mich drei Monate lang von einem Nervenarzt behandeln lassen, doch unser Freund, der Schwiegersohn des Sargmachers, hat sein Vermögen und seine Ehre gerettet: heute ist er Besitzer eines Beerdigungsinstituts und handelt mit Grabmälern und Grabsteinen. Seine Geschäfte gehen nicht besonders gut, und sooft ich jetzt abends heimkomme, fürchte ich immer, neben meinem Bette einen Grabstein aus weißem Marmor oder einen Katafalk vorzufinden.«
Der Redner
Eines schönen Morgens beerdigte man den Kollegienassessor Kirill Iwanowitsch Wawilonow, der an zwei Krankheiten, die in unserem Vaterlande besonders verbreitet sind, gestorben war: an einer bösen Frau und am Alkoholismus. Als der Leichenzug sich von der Kirche zum Friedhofe in Bewegung setzte, nahm einer der Kollegen des Verstorbenen, ein gewisser Poplawskij eine Droschke und fuhr zu seinem Freund Grigorij Petrowitsch Sapojkin, einem noch jungen, aber schon recht populären Herrn. Sapojkin hat, wie es vielen meiner Leser schon bekannt ist, die seltene Gabe, Hochzeits-, Jubiläums- und Grabreden aus dem Stegreif zu halten. Er kann in jedem Zustande reden: wenn man ihn aus dem Schlafe weckt, auf den nüchternen Magen, besoffen und im Fieber. Seine Reden fließen ebenso gleichmäßig und reichlich dahin wie das Wasser aus einer Regentraufe; in seinem Vokabular gibt es viel mehr rührende Worte als in einem beliebigen Wirtshause Kakerlaken. Er spricht immer geschraubt und so lang, daß man zuweilen, besonders bei Hochzeiten in Kaufmannsfamilien die Hilfe der Polizei anrufen muß, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Ich komme zu dir mit einer Bitte, Bruder!« begann Poplawskij, als er ihn zu Hause angetroffen hatte. »Zieh dich augenblicklich an und komme mit mir. Einer von den Unsrigen ist gestorben, wir geben ihm eben das letzte Geleite, also muß man zum Abschied irgendein Blech zusammenreden ... Du bist unsere einzige Hoffnung. Wenn einer von den kleineren Beamten gestorben wäre, hätte ich dich nicht belästigt; es ist aber der Sekretär, sozusagen der Grundpfeiler der ganzen Kanzlei. So einen Kerl kann man doch wirklich nicht ohne eine Rede beerdigen.«
»Ach so, der Sekretär!« versetzte Sapojkin gähnend. »Der Trunkenbold?«
»Ja, der Trunkenbold. Es wird Pfannkuchen geben und noch mancherlei ... die Droschke kriegst du bezahlt. Komm mit, Liebster! Du wirst am Grabe etwas im Stile Ciceros vorquatschen, und der Dank wird nicht ausbleiben!«
Sapojkin ging darauf gerne ein. Er zerzauste sich das Haar, nahm einen melancholischen Gcsichtsausdruck an und trat mit Poplawskij auf die Straße.
»Ich kenne euren Sekretär,« sagte er, in die Droschke steigend. »Ein Spitzbube und eine Bestie war er, Gott hab' ihn selig, wie man nicht so bald einen zweiten findet.«
»Grischa, auf einen Toten schimpft man doch nicht!«
»Ja, gewiß, aut mortuis nihil bene, aber er war doch ein Gauner.«
Die beiden Freunde holten den Leichenzug ein und gesellten sich zur Prozession. Diese bewegte sich so langsam, daß Poplawskij und Sapojkin unterwegs Zeit hatten, dreimal in Wirtshäuser einzukehren und für das Seelenheil des Verstorbenen je ein Glas Schnaps zu trinken.
Auf dem Friedhofe wurde eine Messe gelesen. Die Schwiegermutter, die Witwe und die Schwägerin vergossen der Sitte gemäß viele Tränen. Als der Sarg ins Grab versenkt wurde, schrie die Witwe sogar auf: »Laßt mich zu ihm!« Sie folgte ihm aber doch nicht ins Grab, wahrscheinlich, weil sie sich der Pension erinnerte. Als alles still geworden war, trat Sapojkin vor, ließ seine Blicke im Kreise schweifen und begann:
»Soll ich meinen Augen und Ohren trauen? Ist nicht dieser Sarg, sind nicht diese verweinten Gesichter, diese Seufzer und Klagerufe nur ein schrecklicher Traum? Doch ach, es ist kein Traum, und unsere Augen täuschen uns nicht! Der, den wir vor kurzem so rüstig, so jugendlich und so frisch gesehen haben, der vor unseren Augen, der emsigen Biene gleich, den Honig in den Bienenstock der staatlichen Ordnung trug, der, welcher ... dieser selbe ist nun Staub geworden, eine körperliche Fata Morgana. Der unerbittliche Tod hat ihn mit seiner erstarrenden Hand zu einer Zeit berührt, wo er, trotz seines gebeugten Alters, noch voller blühender Kräfte und strahlender Hoffnungen war. Dieser unersetzliche Verlust! Wer kann seine Stelle ausfüllen? Gute Beamte haben wir genug, doch Prokofij Ossipytsch war der einzige. Er war bis in die Tiefe seiner Seele seiner ehrlichen Pflicht ergeben, er schonte seine Kräfte nicht, er durchwachte manche Nacht und war uneigennützig und unbestechlich ... Wie verachtete er diejenigen, die sich bemühten, ihn zum Schaden der Allgemeinheit zu bestechen, die es versuchten, ihn durch die Anerbietung der verlockenden irdischen Güter zu verführen, seiner Pflicht untreu zu werden! Ja, wir alle sahen es, wie Prokofij Ossipytsch sein kleines Gehalt unter seinen ärmeren Kollegen verteilte, und wir hörten eben die Klagen der Witwen und Waisen, die von seinen Gaben lebten. Seinen Pflichten und den guten Werken ergeben, kannte er keine Lebensfreuden und entsagte selbst dem Glücke des Familienlebens: es ist Ihnen allen bekannt, daß er bis ans Ende seiner Tage Junggeselle blieb! Und wer wird ihn uns als Kollegen ersetzen? Ich sehe sein bartloses, herzinniges Gesicht mit dem gutmütigen Lächeln wie lebendig vor mir und höre seine sanfte, zärtliche, freundschaftliche Stimme. Friede deiner Asche, Prokofij Ossipytsch! Ruhe sanft, du edler Held der Pflicht!«
Sapojkin redete weiter, doch die Zuhörer begannen zu tuscheln. Die Rede gefiel allen sehr gut, weckte auch einige Tränen, erschien aber in mancher Beziehung etwas sonderbar. Erstens war es unverständlich, warum der Redner den Verstorbenen Prokofij Ossipytsch nannte, während er in Wirklichkeit Kirill Iwanowitsch hieß. Zweitens war es allen bekannt, daß der Verstorbene sein Leben lang mit seiner legitimen Gattin gekämpft hatte und folglich nicht als Junggeselle angesehen werden durfte; drittens hatte er einen üppigen roten Vollbart, und es war unverständlich, warum der Redner von seiner Bartlosigkeit sprach. Die Zuhörer staunten, wechselten Blicke und zuckten die Achseln.
»Prokofij Ossipytsch!« fuhr der Redner fort, begeistert auf das Grab blickend. »Dein Gesicht war unschön, sogar häßlich, du warst mürrisch und unfreundlich, doch wir wußten alle, daß in dieser sichtbaren Hülle ein ehrliches Freundesherz schlug!«
Die Zuhörer merkten nun, daß auch mit dem Redner etwas Sonderbares vorging. Er starrte auf einen Punkt, rückte unruhig hin und her und zuckte auch selbst die Achseln. Plötzlich verstummte er, riß erstaunt den Mund auf und wandte sich zu Poplawskij um.
»Hör einmal, er lebt doch!« sagte er entsetzt.
»Wer lebt?«
»Prokofij Ossipytsch! Da steht er ja neben dem Grabdenkmal!«
»Er ist ja auch gar nicht gestorben! Gestorben ist Kirill Iwanowitsch!«
»Du hast mir doch selbst gesagt, euer Sekretär sei gestorben!«
»Kirill Iwanowitsch war auch unser Sekretär. Du hast es verwechselt! Prokofij Ossipytsch war allerdings bei uns einmal Sekretär, aber man hat ihn schon vor zwei Jahren als Amtsvorstand in die zweite Abteilung versetzt.«
»Da soll sich der Teufel auskennen!«
»Warum bist du aber mitten drin stecken geblieben? Fahre fort, es paßt ja nicht!«
Sapojkin wandte sich zum Grabe und setzte mit früherer Begeisterung die unterbrochene Rede fort. An einem Grabdenkmal stand tatsächlich Prokofij Ossipytsch, ein alter Beamter mit glattrasiertem Gesicht. Er blickte den Redner an und machte ein unzufriedenes Gesicht.
»Was ist dir nur eingefallen!« lachten die Beamten, als sie mit Sapojkin vom Friedhofe heimgingen. »Einen lebendigen Menschen wolltest du beerdigen!«
»Es ist nicht schön, junger Mann!« brummte Prokofij Ossipytsch. »Ihre Rede taugt vielleicht für einen Toten, doch in bezug auf einen Lebenden klingt sie wie Hohn! Erlauben Sie einmal, was haben Sie gesagt? Uneigennützig, unbestechlich! Von einem lebenden Menschen kann man doch so was nur zum Spott sagen. Auch hat Sie niemand gebeten, sich so über mein Gesicht zu verbreiten. Gut, ich bin unschön und häßlich, aber warum soll man mein Gesicht so der Öffentlichkeit zeigen? Das ist doch kränkend.«
Die Nacht vor der Verhandlung
(Erzählung eines Angeklagten)
Es wird ein Unglück geben, Herr!« sagte der Postillon, sich zu mir wendend und mit der Peitsche auf einen Hasen zeigend, der uns über den Weg lief.
Ich wußte auch ohne den Hasen, daß meine Lage eine verzweifelte war. Ich fuhr nach S., um mich vor dem Kreisgericht wegen Bigamie zu verantworten. Das Wetter war entsetzlich. Als ich spät in der Nacht die Poststation erreichte, sah ich wie ein Mensch aus, den man mit Schnee beworfen, mit Wasser begossen und obendrein auch durchgeprügelt hatte: so furchtbar war ich durchfroren, durchnäßt und vom eintönigen Rütteln betäubt. Auf der Station empfing mich der Stationsaufseher, ein langer Kerl in blaugestreifter Unterhose, kahl, verschlafen und mit einem Schnurrbart, der ihm aus den Nasenlöchern zu wachsen schien, so daß er wohl nichts riechen konnte.
Aber es gab da, offen gestanden, was zu riechen. Als der Aufseher, brummend, schnaubend und sich den Hals juckend, die Tür zu den Stationszimmern aufmachte und mir schweigend mit dem Ellbogen meine Ruhestätte zeigte, umfing mich sofort ein durchdringender Geruch von etwas Saurem, von Siegellack und zerdrückten Wanzen, so daß ich beinahe erstickte. Das Blechlämpchen, das auf dem Tische stand und die ungestrichenen Holzwände beleuchtete, qualmte wie ein Kienspan.
»Einen Gestank haben Sie hier, Signore!« sagte ich, als ich eintrat und meinen Koffer auf den Tisch stellte.
Der Aufseher schnupperte die Luft und schüttelte mißtrauisch den Kopf.
»Es riecht wie überall,« sagte er und juckte sich von neuem. »Das kommt Ihnen nach dem Frost nur so vor. Die Kutscher schlafen bei den Pferden, und die Herrschaften riechen nicht.«
Ich schickte den Aufseher hinaus und begann meine provisorische Behausung zu mustern. Das Sofa, auf dem ich schlafen sollte, war breit wie ein zweischläfriges Bett, mit Wachstuch überzogen und kalt wie Eis. Außer dem Sofa befanden sich im Zimmer ferner: ein großer eiserner Ofen, ein Tisch mit dem schon erwähnten Lämpchen, ein Paar Filzstiefel, eine fremde Handtasche und eine spanische Wand, die eine der Zimmerecken abteilte. Hinter der Wand schlief jemand leise. Nachdem ich mir dies alles angesehen hatte, machte ich mir auf dem Sofa mein Nachtlager zurecht und begann mich auszuziehen. Meine Nase gewöhnte sich bald an den Gestank. Nachdem ich den Rock, die Beinkleider und die Stiefel ausgezogen hatte, fing ich an, um den eisernen Ofen herumzuspringen, wobei ich meine bloßen Füße emporwarf, alle meine Glieder dehnte, mich krümmte und vor Behagen lächelte. Diese Sprünge erwärmten mich. Es blieb mir nur noch übrig, mich auf dem Sofa auszustrecken und einzuschlafen, als plötzlich etwas Unerwartetes passierte. Mein Blick fiel zufällig hinter die spanische Wand und ... man stelle sich nur mein Entsetzen vor! Hinter der Wand guckte ein Frauenköpfchen mit aufgelöstem Haar und schwarzen Augen hervor. Es zeigte die Zähne, die schwarzen Brauen zuckten, auf den Wangen zitterten reizende Grübchen, – folglich lachte es. Ich wurde verlegen. Als das Köpfchen sah, daß ich es bemerkt hatte, wurde es auch verlegen und verschwand. Wie schuldbeladen ging ich mit gesenkten Blicken still zu meinem Sofa, legte mich hin und deckte mich mit meinem Pelzmantel zu.
– Furchtbar dumm! – dachte ich mir. – Sie hat also gesehen, wie ich herumgesprungen bin! Furchtbar dumm .... –
Das entzückende Gesichtchen wollte mir nicht aus dem Sinn, und meine Phantasie ging durch. Bilder, eines schöner und verführerischer als das andere, drängten sich in meinem Kopfe, und plötzlich fühlte ich, wohl als Strafe für meine sündhaften Gedanken, einen heftigen, brennenden Schmerz auf der rechten Wange. Ich griff nach der Wange, fing nichts, erriet aber sofort den Sachverhalt: es roch stark nach einer zerdrückten Wanze.
»Das ist wirklich, der Teufel weiß was!« hörte ich im gleichen Augenblick eine weibliche Stimme. »Die verfluchten Wanzen wollen mich wohl auffressen.«
Hm! ... Ich erinnerte mich meiner nützlichen Angewohnheit, auf Reisen stets Insektenpulver mitzuführen. Auch diesmal war ich dieser Gewohnheit treu geblieben. Die Büchse mit dem Insektenpulver war im Nu aus dem Koffer hervorgeholt. Es blieb mir nur noch übrig, der Besitzerin des hübschen Köpfchens dieses Mittel anzubieten, und die Bekanntschaft war geschlossen. Aber wie sollte ich es ihr anbieten?
»Das ist entsetzlich!«
»Gnädigste,« sagte ich mit süßer Stimme, »Wenn ich Ihre letzte Bemerkung richtig verstanden habe, so werden Sie von den Wanzen geplagt. Ich aber habe Insektenpulver bei mir. Wenn Sie wünschen, so ....«
»Ach, bitte!«
»In diesem Falle ... ich ziehe sofort meinen Pelz an,« rief ich erfreut, »und bringe es Ihnen ....«
»Nein, nein .... Reichen Sie es mir über die Wand herüber, hierher dürfen Sie nicht!«
»Ich weiß selbst, daß ich es nur über die spanische Wand herüberreichen darf .... Haben Sie keine Angst: ich bin doch kein Räuber ....«
»Wer kann das wissen! Unterwegs begegnet man allerlei Menschen ....«
»Hm! ... Und wenn ich auch hinter die Wand komme .... Es ist doch nichts Besonderes dabei .... um so mehr als ich Arzt bin,« log ich ihr vor. »Aerzte, Gerichtsvollzieher und Damenfriseure haben aber das Recht, ins Privatleben einzudringen.«
»Ist es auch wahr, daß Sie Arzt sind? Im Ernst?«
»Mein Ehrenwort. Darf ich Ihnen also das Insektenpulver bringen?«
»Nun, wenn Sie Arzt sind, dann .... Warum sollen Sie sich aber bemühen? Ich kann ja auch meinen Mann zu Ihnen herausschicken ... Fedja!« sagte die Brünette mit gedämpfter Stimme. »Fedja! So wach doch auf, du Schlafmütze! Steh auf und geh hinaus .... Der Herr Doktor ist so freundlich und bietet uns Insektenpulver an.«
Die Anwesenheit Fedjas hinter der spanischen Wand war für mich eine erschütternde Neuigkeit. Ich war wie vor den Kopf geschlagen .... Meine Seele war von einem Gefühl erfüllt, das wahrscheinlich der Gewehrhahn empfindet, wenn er mal versagt hat: ich empfand Scham, Aerger und eine schmerzliche Enttäuschung .... Es war mir so übel zumute, und dieser Fedja kam mir so gemein vor, daß ich, als er hinter der spanischen Wand hervortrat, beinahe um Hilfe schrie. Fedja war ein großgewachsener, sehniger Mann von etwa fünfzig Jahren mit grauem Backenbart, zusammengepreßten Beamtenlippen und blauen, unruhig zitternden Aederchen an Nase und Schläfen. Er hatte einen Schlafrock und Morgenschuhe an.
»Sie sind sehr freundlich, Herr Doktor...« sagte er, indem er mir das Insektenpulver aus der Hand nahm und wieder hinter seine Wand ging. »Ich danke schön .... Wurden Sie auch vom Schneesturm überrascht?«
»Ja!« brummte ich, indem ich mich wieder aufs Sofa legte und wütend den Pelz über mich zog. »Ja!«
»So, so .... Sinotschka, über dein Näschen läuft gerade eine Wanze! Erlaube, daß ich sie fange!«
»Du darfst es,« antwortete Sinotschka lachend. »Nicht gefangen! Bist ein Staatsrat, alle fürchten dich, und doch kannst du nicht mal mit einer Wanze fertig werden!«
»Sinotschka, der Herr hört dich ja .... (Ein Seufzer.) Immer bist du so .... Bei Gott ....«
»Diese Schweine lassen einen gar nicht einschlafen!« brummte ich. Ich war wütend, ich wußte selbst nicht, auf wen.
Doch die Gatten schliefen bald ein. Ich schloß die Augen und bemühte mich, an nichts zu denken, um einzuschlafen. Es verging aber eine halbe Stunde, eine Stunde .... ich schlief noch immer nicht. Endlich regten sich auch meine Nachbarn und begannen leise zu fluchen.
»Es ist erstaunlich, selbst das Insektenpulver wirkt auf sie nicht!« brummte Fedja. »Diese Menge von Wanzen! Herr Doktor! Sinotschka bittet mich, Sie zu fragen, warum die Wanzen so abscheulich stinken?«
Wir kamen ins Gespräch. Wir sprachen von den Wanzen, vom Wetter, vom russischen Winter, von der Medizin, in der ich mich ebenso auskenne wie in der Astronomie; wir sprachen auch von Edison ....
»Sinotschka, geniere dich doch nicht .... Er ist ja Arzt!« hörte ich ihn nach dem Gespräch über Edison flüstern. »Geniere dich nicht und frage ihn .... Brauchst dich nicht zu fürchten. Scherwezow hat dir nicht geholfen, aber dieser wird vielleicht helfen.«
»Frag' ihn selbst!« flüsterte Sinotschka.
»Herr Doktor,« wandte sich Fedja an mich: »Woher mag es wohl kommen, daß meine Frau immer diese Brustbeklemmung hat? Sie hustet, wissen Sie .... und dabei hat sie so einen Druck in der Brust, als ob in der Lunge etwas eingetrocknet wäre ....«
»Das ist eine lange Geschichte, so einfach kann ich Ihre Frage nicht beantworten,« sagte ich, um mich aus der Affäre zu ziehen.
»Das macht doch nichts, daß es eine lange Geschichte ist! Wir haben ja genug Zeit, wir schlafen sowieso nicht .... Lieber Freund, untersuchen Sie sie doch! Ich muß vorausschicken, daß sie bisher von Scherwezow behandelt wurde. Dieser ist zwar ein guter Mensch, aber ... wer soll sich da auskennen? Ich traue ihm nicht! Ich traue ihm gar nicht! Ich sehe wohl, daß Sie keine Lust haben, aber seien Sie doch so gut! Untersuchen Sie sie, und ich gehe inzwischen zum Stationsaufseher und lasse einen Samowar bringen.«
Fedja schlürfte mit seinen Pantoffeln und ging hinaus. Ich begab mich hinter die spanische Wand. Sinotschka saß auf einem breiten Sofa, von einer Menge Kissen umgeben, und hielt den Spitzenkragen ihrer Nachtjacke fest.
»Zeigen Sie mal die Zunge!« begann ich, indem ich mich neben sie aufs Sofa setzte und die Stirne runzelte.
Sie zeigte die Zunge und lachte. Die Zunge war rot und ganz gewöhnlich. Ich tastete nach ihrem Puls.
»Hm! ...« sagte ich, nachdem ich den Puls nicht gefunden hatte.
Ich weiß nicht mehr, was ich an sie noch alles für Fragen stellte, während ich ihr ins lachende Gesicht blickte; ich weiß nur noch, daß ich schließlich so dumm und blöde geworden war, daß mir gar keine Fragen mehr einfallen wollten.
Schließlich saß ich in Gesellschaft Fedjas und Sinotschkas vor dem Samowar; ich mußte ihr ein Rezept verschreiben, und ich machte es nach allen Regeln der ärztlichen Wissenschaft:
Rp. Sic transit0,05
Gloria mundi1,0
Aquae destillatae0,1
Einen Löffel alle zwei Stunden.
Für Frau Ssjelowa.
Dr. Saitzew
Als ich am Morgen vollkommen reisefertig, mit dem Koffer in der Hand, von meinen neuen Bekannten für alle Ewigkeit Abschied nahm, hielt mich Fedja am Rockknopf fest und reichte mir einen Zehnrubelschein.
»Nein, Sie sind verpflichtet, das Geld zu nehmen!« redete er mir zu. »Ich pflege jede ehrliche Arbeit zu bezahlen! Sie haben doch studiert und gearbeitet! Ihr Wissen hat Sie genug Schweiß und Blut gekostet! Ich weiß es doch!«
Was sollte ich machen? Ich mußte den Zehnrubelschein einstecken.
Beiläufig so verbrachte ich die Nacht vor der Gerichtsverhandlung. Ich will gar nicht beschreiben, was ich fühlte, als vor mir die Tür aufging und der Gerichtsdiener mir die Anklagebank zeigte. Ich will nur sagen, daß ich blaß und verlegen wurde, als ich um mich blickte und die tausend auf mich gerichteten Augen sah; und als ich die ernsten, feierlichen Physiognomien der Geschworenen musterte, las ich mir selbst das Sterbegebet ....
Doch ich kann gar nicht beschreiben, und Sie können sich auch gar nicht vorstellen, welches Grauen mich beschlich, als ich meinen Blick auf den mit rotem Tuch bedeckten Richtertisch hob und auf dem Staatsanwaltssessel – wen glauben Sie wohl? – Fedja erblickte! Er saß da und schrieb etwas. Als ich ihn ansah, mußte ich an die Wanzen, an Sinotschka und an meine Diagnose denken, und ein ganzes Eismeer überlief mir den Rücken .... Als er mit seinem Schreiben fertig war, sah er mich an. Zuerst erkannte er mich nicht, dann aber erweiterten sich seine Pupillen, sein Unterkiefer hing auf einmal kraftlos hinab, seine Hand zitterte. Er stand langsam auf und richtete auf mich seinen bleiernen Blick. Auch ich stand, ich weiß selbst nicht warum, auf und starrte ihn an ....
»Angeklagter, nennen Sie Ihren Namen, Stand usw.« begann der Vorsitzende.
Der Staatsanwalt setzte sich hin und trank ein Glas Wasser. Kalter Schweiß war ihm in die Stirne getreten.
– Nun werde ich was erleben! – dachte ich mir.
Anscheinend hat der Staatsanwalt fest beschlossen, mich ordentlich zu verdonnern. Während der ganzen Verhandlung war er aufgeregt, wühlte in den Zeugenaussagen herum, machte lange Geschichten und schimpfte ....
Ich muß aber schließen. Ich schreibe dies im Gerichtsgebäude während der Mittagspause .... Gleich kommt die Rede des Staatsanwalts.
Was werde ich wohl erleben?
Verwirrung der Geister
Die Erde stellte eine Hölle dar. Die Nachmittagssonne brannte mit solchem Eifer, daß selbst das Thermometer, das im Amtszimmer des Akzisebeamten hing, ganz ratlos wurde: es stieg bis 35,8 Grad Reaumur und blieb unentschlossen stehen .... Von den Bürgern troff der Schweiß wie von müdegehetzten Pferden; sie ließen ihn ruhig eintrocknen, denn sie waren zu faul, um ihn abzuwischen.
Ueber den großen Marktplatz, längs der Häuserreihe mit den hermetisch verschlossenen Fensterläden, gingen zwei Bürger: der Rentmeister Potscheschichin und der Rechtskonsulent (und jahrelanger Berichterstatter der Zeitung »Sohn des Vaterlandes«) Optimow. Sie gingen nebeneinander und schwiegen infolge der großen Hitze. Optimow hatte wohl Lust, Kritik am Magistrat wegen des Staubes und Schmutzes auf dem Marktplatze zu üben, da er aber den friedlichen Charakter und die gemäßigte Gesinnung seines Weggenossen kannte, zog er es vor, zu schweigen.
Mitten auf dem Marktplatze blieb Potscheschichin plötzlich stehen und blickte zum Himmel hinauf.
»Was schauen Sie denn, Jewpl Serapionytsch?«
»Da sind eben Stare vorbeigeflogen. Ich will mal sehen, wo sie sich hinsetzen werden. Eine ganze Wolke! Wenn man aus einem Gewehr schießen und sie dann auflesen wollte ... und wenn man .... Im Garten des Herrn Dompfarrers haben sie sich hingesetzt!«
»Keine Spur, Jewpl Serapionytsch! Nicht beim Herrn Dompfarrer, sondern beim Herrn Diakon Wratoadow. Und wenn man von hier aus schießen wollte, so würde man nichts treffen. So ein Schrotkorn ist ja klein und verliert, ehe es sie erreicht, jede Kraft. Und warum soll man sie auch töten? Der Vogel fügt zwar dem Beerenobst Schaden zu, ist aber immerhin eine Kreatur Gottes. Der Star kann auch beispielsweise singen .... Warum singt er aber? Um den Schöpfer zu preisen. Alles, was Odem hat, lobt den Herrn. Ach nein, sie haben sich doch beim Dompfarrer hingesetzt!«
Drei alte Wallfahrerinnen mit Säcken auf dem Buckel und in Bastschuhen gingen lautlos an den Sprechenden vorbei. Sie blickten Potscheschichin und Optimow, die aus einem unbegreiflichen Grunde das Haus des Dompfarrers betrachteten, fragend an, verlangsamten die Schritte, blieben nach einer Weile gleichfalls stehen, sahen sich noch einmal nach den beiden Freunden um und begannen gleichfalls das Haus des Dompfarrers anzustarren.
»Ja, Sie haben recht, sie haben sich tatsächlich beim Dompfarrer niedergelassen,« fuhr Optimow fort. »Bei ihm sind eben die Kirschen reif geworden, sie wollen sich wohl an die Kirschen machen.«
Aus dem Dompfarrhause trat nun der Dompfarrer Wosmistischijew in eigener Person in Begleitung des Küsters Jewstingej auf die Straße. Als er sah, daß man sein Haus so aufmerksam betrachtete, und da er nicht verstehen konnte, was die Leute so anzog, blieb auch er stehen und begann mit dem Küster gleichfalls zum Himmel hinaufzublicken, um die Ursache zu ergründen.
»Vater Pajissij geht wohl zu einer heiligen Amtshandlung,« sagte Potscheschichin. »Gott stehe ihm bei!«
Zwischen den Freunden und dem Herrn Dompfarrer gingen die Arbeiter von der Purowschen Fabrik vorbei, die soeben im Flusse gebadet hatten. Als sie den Vater Pajissij, der angestrengt zum Himmel hinaufblickte, und die Wallfahrerinnen, die unbeweglich dastanden und gleichfalls hinaufstarrten, sahen, blieben auch sie stehen und blickten in die gleiche Richtung. Dasselbe taten ein Junge, der einen blinden Bettler führte, und ein Bauer, der ein Fäßchen verdorbener Heringe schleppte, um sie auf dem Marktplatze abzuladen.
»Es ist wohl etwas los,« sagte Potscheschichin. »Vielleicht eine Feuersbrunst? Nein, es ist kein Rauch zu sehen .... He, Kusjma!« schrie er dem Bauern zu, der stehen geblieben war. »Was ist denn los?«
Der Bauer antwortete etwas, aber Potscheschichin und Optimow hörten es nicht. In allen Ladentüren zeigten sich die verschlafenen Kommis. Die Maurer, die das Mehllager des Kaufmanns Fertikulin tünchten, ließen ihre Leitern stehen und gesellten sich zu den Fabrikarbeitern. Der Feuerwehrmann, der auf dem Wachtturme barfuß im Kreise herumging, blieb stehen, sah eine Weile bin und stieg hinunter. Der Wachtturm war auf einmal verwaist. Dies erschien verdächtig.
»Brennt es nicht irgendwo? Stoßen Sie doch nicht so, Sie Schweinekerl!«
»Wo sehen Sie eine Feuersbrunst? Was für eine Feuersbrunst? Meine Herrschaften, gehen Sie auseinander! Ich bitte höflichst!«
»Es brennt wohl innen!«
»Er bittet höflichst und fährt dabei einem mit den Händen ins Gesicht. Fuchteln Sie nicht mit den Händen! Sie sind zwar die Obrigkeit, haben aber doch kein Recht, so mit den Händen herumzufuchteln!«
»Aufs Hühnerauge ist er mir getreten! Der Teufel soll dich überfahren!«
»Wen hat man überfahren? Kinder, da hat man einen Menschen überfahren!«
»Warum dieser Auflauf? Zu welchem Zweck?«
»Einen Menschen hat man überfahren, Euer Wohlgeboren!«
»Wo? Geht auseinander! Meine Herrschaften, ich bitte höflichst darum! Ich bitte dich höflichst, du Klotz!«
»Die Bauern kannst du herumstoßen, aber bessere Leute darfst du nicht anrühren! Untersteh' dich nicht!«
»Sind es Menschen? Kann man denn diesen Teufeln mit guten Worten beikommen? Ssidorow, ruf mal den Akim Danilytsch her! Schnell! Meine Herrschaften, Sie werden's ja bereuen! Wenn Akim Danilytsch kommt, werden Sie was erleben! Bist du auch dabei, Parfen? Du blinder, heiliger Greis! Er sieht nichts, muß aber doch dabei sein, wo sich die Leute drängen, und gehorcht auch nicht! Smirnow, schreib mal den Parfen auf!«
»Zu Befehl! Soll ich auch die Purowschen Leute aufschreiben? Dieser da, mit der geschwollenen Backe, ist einer von den Purowschen!«
»Die Purowschen brauchst du einstweilen nicht aufzuschreiben .... Purow hat morgen Namenstag!«
Die Stare erhoben sich als dunkle Wolke über dem Garten des Herrn Dompfarrers, aber Potscheschichin und Optimow sahen nicht mehr hin; sie standen da, starrten in die Höhe und suchten zu begreifen, warum sich so viele Menschen angesammelt hatten und warum sie hinaufschauten. Da erschien, an einem Bissen kauend und sich die Lippen abwischend, Akim Danilytsch. Er drang mitten in die Menge hinein und brüllte:
»Feuerwehrleute, macht euch bereit! Auseinandergehen! Herr Optimow, gehen Sie auseinander, sonst geht es Ihnen schlecht! Statt in Zeitungen Kritiken über anständige Leute zu schreiben, sollten Sie sich lieber selbst angemessener aufführen. Von den Zeitungen lernt man nichts Gutes!«
»Ich bitte Sie, die öffentliche Meinung nicht anzutasten!« fuhr Optimow auf. »Ich bin Literat und kann es nicht dulden, daß man die öffentliche Meinung antastet, obwohl ich Sie auch aus bürgerlichem Pflichtgefühl als einen Vater und Wohltäter verehre!«
»Feuerwehr! Los!«
»Es ist kein Wasser da, Euer Wohlgeboren!«
»Keine Widerrede! Fahrt zum Fluß und holt Wasser! Schnell!«
»Wir können nicht hinfahren, Euer Wohlgeboren. Der Major ist mit den Feuerwehrpferden weggefahren, um seine Tante abzuholen.«
»Auseinandergehen! Zurück, hol' dich der Teufel! ... Das sitzt?! Schreib ihn mal auf, diesen Satan!«
»Ich hab den Bleistift verloren, Euer Wohlgeboren!«
Die Menge wuchs immer an .... Gott weiß, zu welchen Dimensionen sie noch angewachsen wäre, wenn es dem Gastwirt Grjeschkin nicht eingefallen wäre, in diesem Augenblick das aus Moskau verschriebene neue Orchestrion zu probieren. Als die Leute das »Schützenlied« hörten, stöhnten sie vor Entzücken auf und stürzten zum Gasthaus. So erfuhr kein Mensch, warum sich die Menge angesammelt hatte, und auch Optimow und Potscheschichin hatten schon die Stare, die wahren Schuldigen, ganz vergessen. Nach einer Stunde war die Stadt schon wieder still und unbeweglich, und man sah nur einen einzigen Menschen: den Feuerwehrmann, der auf dem Wachtturme herumging.
Am Abend des gleichen Tages saß Akim Danilytsch im Kolonialwarengeschäft Fertikulins, trank Brauselimonade mit Kognak und schrieb: »Dem offiziellen Bericht erlaube ich mir meinerseits einen Nachtrag beizufügen. Euer Hochwohlgeboren, Vater und Wohltäter! Nur dank den Gebeten Ihrer tugendhaften Frau Gemahlin, die sich in der wohlduftenden Sommerfrische in der Nähe unserer Stadt aufhält, ist es nicht zum Aeußersten gekommen! Was ich an diesem einen Tag ausstehen mußte, kann ich gar nicht schildern. Für die administrative Tüchtigkeit Kruschenskijs und des Feuerwehrmajors Portupejew finde ich keine gebührende Bezeichnung. Ich bin stolz auf diese würdigen Diener des Vaterlandes! Ich aber tat alles, was ein schwacher Mensch, der seinen Nächsten nur Gutes will, überhaupt zu tun vermag. Und während ich jetzt am eignen Herde sitze, danke ich unter Tränen dem, der uns vor einem Blutvergießen bewahrt hat. Die Schuldigen sitzen wegen mangelnder Beweise einstweilen hinter Schloß und Riegel, doch ich habe die Absicht, sie nach etwa acht Tagen herauszulassen. Nur aus Unwissenheit haben sie das Gebot übertreten!«
Der Rächer seiner Ehre
Fjodor Fjodorowitsch Ssigajew stand, kurz nachdem er seine Frau auf frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung Schmucks & Co. und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Schmerz und unwankbare Entschlossenheit aus.
– Ich weiß wohl, was ich zu tun habe ... – dachte er sich: – Das Familienprinzip ist beschimpft, die Ehre ist in den Schmutz getreten, das Laster triumphiert, und darum muß ich als Bürger und anständiger Mensch das Amt eines Rächers übernehmen. Zuerst töte ich sie und ihren Geliebten, dann mich und ...
Er hatte zwar noch keinen Revolver gewählt und niemand getötet, doch seine Phantasie zeigte ihm schon drei blutende Leichen, zersprengte Schädel, herausquellende Gehirne, den Skandal, die Menge müßiger Zuschauer und die Obduktion ... Mit der Schadenfreude eines Gekränkten stellte er sich das Entsetzen der Verwandtschaft und des Publikums vor, den Todeskampf der Ehebrecherin und las bereits in der Phantasie die Zeitungsartikel über die Zersetzung der Familienprinzipien.
Der Verkäufer, ein bewegliches Männchen mit einem dicken Bäuchlein und einer weißen Weste – er sah wie ein Franzose aus – legte ihm einen Revolver nach dem anderen vor und sprach, respektvoll lächelnd und immerzu Kratzfüße machend:
»Ich möchte Ihnen raten, mein Herr, diesen wunderschönen Revolver zu nehmen. System Smith & Wesson. Das letzte Wort der Feuerwaffentechnik. Mit dreifacher Wirkung, hat einen Patronenauswerfer, schießt sechshundert Schritt weit, Zentralfeuersystem. Beachten Sie nur, mein Herr, die wunderbare Arbeit. Es ist das allerneuste System, mein Herr ... Wir verkaufen täglich an die zehn Stück als Mittel gegen Räuber, Wölfe und Ehebrecher. Die Wirkung ist zuverlässig und äußerst stark, er schießt auf die größte Distanz und durchbohrt zugleich die Frau und ihren Geliebten. Und was den Selbstmord betrifft, so weiß ich überhaupt kein besseres System, mein Herr ...«
Der Verkäufer spannte und entspannte die Hähne, hauchte die Läufe an, zielte und tat so, als ginge ihm vor Entzücken der Atem aus. Wenn man sein begeistertes Gesicht ansah, konnte man glauben, daß er sich selbst gern eine Kugel in die Stirn jagen würde, wenn er nur einen Revolver von einem so herrlichen System wie Smith & Wesson besäße.
»Und wie ist der Preis?« fragte Ssigajew.
»Fünfundvierzig Rubel, mein Herr.«
»Hm! ... Das ist mir zu teuer!«
»In diesem Falle will ich Ihnen ein anderes System vorlegen, mein Herr, das etwas billiger ist. Wollen Sie nur sehen! Wir haben eine riesengroße Auswahl in allen Preislagen ... Zum Beispiel dieser Revolver, System Lefaucheur, kostet bloß achtzehn Rubel, aber ... (der Verkäufer verzog verächtlich das Gesicht) ... aber, mein Herr, dieses System ist schon veraltet. Es wird nur noch von geistigen Proletariern und hysterischen Frauen gekauft. Sich selbst oder seine Frau aus einem Lefaucheur-Revolver zu erschießen, gilt jetzt als geschmacklos. Der gute Ton anerkennt nur das System Smith & Wesson.«
»Ich will weder Selbstmord begehen, noch jemand erschießen,« log Ssigajew düster. »Ich kaufe es nur für die Sommerfrische, um die Diebe zu verscheuchen ...«
»Uns interessiert es gar nicht, wozu Sie ihn kaufen,« sagte der Verkäufer mit bescheiden gesenkten Augen. »Wenn wir in jedem Falle den Gründen nachgehen wollten, so müßten wir wohl unseren Laden schließen. Zum Verscheuchen der Diebe taugt aber der Lefaucheur gar nicht, denn er gibt nur einen leisen, dumpfen Knall; zu diesem Zweck würde ich Ihnen die gewöhnliche Mortimer-Pistole empfehlen, eine sogenannte Duell-Pistole ...«
– Soll ich ihn nicht zum Duell fordern? – ging es Ssigajew durch den Kopf. – Das wäre aber zu viel Ehre! Solche Halunken erschießt man einfach wie die Hunde ... –
Der Verkäufer legte vor ihm, immer graziös tänzelnd, lächelnd und plaudernd, einen ganzen Haufen von Revolvern hin. Am appetitlichsten und solidesten sah der von Smith & Wesson aus. Ssigajew nahm einen Revolver dieses Systems in die Hand, starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Gedanken. Seine Phantasie malte ihm aus, wie er die Schädeldecken sprengt, wie das Blut in Strömen über den Teppich und das Parkett fließt, wie die Ehebrecherin im Sterben mit einem Fuße zuckt ... Dies alles war aber für seine empörte Seele noch zu wenig. Die blutigen Bilder, die Schreie und das Entsetzen genügten ihm noch nicht ... Er mußte noch etwas Schrecklicheres erfinden.
– Ich mache es so: ich töte ihn und mich, – sagte er sich. – Sie lasse ich aber am Leben. Soll sie nur an Gewissensbissen und an der Verachtung ihrer Umgebung zugrunde gehen. Für ein so nervöses Geschöpf wie sie ist das qualvoller als der Tod ... –
Und er stellte sich seine eigene Beerdigung vor: er, der gekränkte Gatte, liegt im Sarg mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, und sie folgt, blaß, von Gewissensbissen gepeinigt, wie Niobe dem Sarge und weiß nicht, wie sich vor den vernichtenden, verächtlichen Blicken zu verbergen, die ihr die empörte Menge zuwirft ...
»Ich sehe, mein Herr, daß Ihnen Smith & Wesson am besten gefällt,« unterbrach der Verkäufer seine Träume. »Wenn er Ihnen zu teuer vorkommt, so will ich gerne fünf Rubel nachlassen ... Wir haben übrigens auch andere Systeme, die etwas billiger sind.«
Das Männchen mit der französischen Figur wandte sich graziös um und holte von den Regalen noch ein weiteres Dutzend Futterale mit Revolvern.
»Hier haben Sie etwas für dreißig Rubel, mein Herr. Das ist wirklich nicht teuer, um so mehr als der Rubelkurs gefallen ist, während die Einfuhrzölle von Tag zu Tag steigen. Mein Herr, ich schwöre Ihnen, ich bin zwar konservativ gesinnt, aber auch ich fange schon zu murren an! Ich bitte Sie: der Kurs und die Einfuhrzölle haben es bewirkt, daß nur reiche Leute Waffen kaufen können! Den Armen bleiben nur die in Tula hergestellten Waffen und Phosphorzündhölzer übrig; die Tulaer Waffen sind aber ein wahres Unglück! Man schießt aus so einem Revolver auf seine Frau und trifft sich selbst ins Schulterblatt ...«
Ssigajew tat es plötzlich furchtbar leid, daß er, wenn er tot ist, die Qualen der Treulosen nicht zu sehen bekommt. Die Rache ist doch nur dann süß, wenn man die Möglichkeit hat, ihre Früchte zu sehen und zu betasten; was hat man aber davon, wenn man im Sarge liegt und nichts empfindet?
– Vielleicht soll ich es so machen, – überlegte er sich. – Ich töte ihn, gehe zur Beerdigung, sehe alles und erschieße mich hernach ... Uebrigens wird man mich noch vor der Beerdigung verhaften und mir die Waffe wegnehmen ... Also: ich töte ihn, sie bleibt am Leben, und ich ... ich bringe mich zunächst nicht um, sondern lasse mich verhaften. Mich umzubringen, habe ich noch immer Zeit. Die Verhaftung hat das Gute, daß ich bei der Voruntersuchung die Möglichkeit haben werde, vor den Behörden und dem Publikum die ganze Gemeinheit ihres Benehmens aufzudecken. Wenn ich mich umbringe, so ist sie imstande, mit der ihr eigenen Verlogenheit und Frechheit, die ganze Schuld auf mich abzuwälzen, und die Oeffentlichkeit wird ihr recht geben und vielleicht auch meiner spotten; wenn ich aber am Leben bleibe, so ... –.
Nach einer Minute dachte er:
– Ja, wenn ich mich töte, so wird man mich vielleicht eines kleinlichen Gefühls verdächtigen ... Außerdem, warum soll ich mich überhaupt töten? Das ist erstens. Und zweitens: Selbstmord ist Feigheit. Also: ich töte ihn, lasse sie am Leben und komme selbst vors Gericht. Bei der Verhandlung wird sie als Zeugin vernommen werden ... Ich kann mir so lebhaft ihre Schande, ihre Verlegenheit vorstellen, wenn mein Verteidiger an sie seine Fragen richtet! Die Sympathien des Gerichts, des Publikums und der Presse werden selbstverständlich auf meiner Seite sein ... –. So überlegte er sich, während der Verkäufer ihm immer neue Ware zeigte und sich bemühte, den Kunden zu unterhalten:
»Hier sind englische Revolver des neuesten Systems, wir haben sie erst vor kurzem erhalten,« schwatzte er. »Aber ich muß Ihnen sagen, mein Herr, daß alle diese Systeme vor dem Smith & Wesson verblassen. Dieser Tage, – Sie haben es wohl schon gelesen, – kaufte ein Offizier bei uns einen Revolver von Smith & Wesson. Er schoß auf den Geliebten seiner Frau, und, was glauben Sie? – die Kugel ging durch und durch, durchschlug eine Bronzelampe, dann ein Klavier, prallte ab, tötete ein Schoßhündchen und verwundete die Frau. Dieser glänzende Effekt macht unserer Firma alle Ehre. Der Offizier wurde verhaftet ... Er wird natürlich zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt werden! Erstens, haben wir eine veraltete Gesetzgebung; und zweitens, mein Herr, ist das Gericht immer auf Seite des Ehebrechers. Warum? Es ist sehr einfach, mein Herr! Die Richter, die Geschworenen, der Staatsanwalt und der Verteidiger, alle haben Verhältnisse mit fremden Frauen und fühlen sich sicherer, wenn es in Rußland einen Gatten weniger gibt. Unserer Gesellschaft wäre es am angenehmsten, wenn die Regierung alle Ehemänner auf die Insel Sachalin verbannen wollte. Oh, mein Herr, Sie wissen gar nicht, wie tief mich die heutige Sittenverderbnis empört! Mit einer fremden Frau ein Verhältnis zu haben, ist jetzt ebenso normal, fremde Zigaretten zu rauchen oder fremde Bücher zu lesen. Unser Geschäft geht von Jahr zu Jahr schlechter, – das bedeutet nicht, daß es weniger Ehebrecher gibt, sondern nur daß die Männer sich mit diesem Zustand abgefunden haben und das Zuchthaus fürchten.«
Der Verkäufer sah sich um und flüsterte:
»Und wer hat die Schuld, mein Herr? Die Regierung!«
– Wegen eines solchen Schweines nach Sachalin zu kommen, wäre unvernünftig, – überlegte sich Ssigajew. – Wenn ich ins Zuchthaus komme, so kann meine Frau zum zweitenmal heiraten und auch ihren zweiten Mann betrügen. Sie wird triumphieren ... Also: sie lasse ich am Leben, mich bringe ich nicht um, und ihn ... bringe ich auch nicht um. Ich muß etwas Vernünftigeres und Gefühlvolleres erfinden. Ich werde sie beide mit Verachtung strafen und einen aufsehenerregenden Ehescheidungsprozeß anstrengen. –
»Hier, mein Herr, ist noch ein neues System,« sagte der Verkäufer, ein neues Dutzend Revolver vom Regal herunterholend. »Belieben Sie nur den originellen Mechanismus des Schlosses zu beachten ...«
Ssigajew brauchte nach seinem neuen Entschluß keinen Revolver mehr, der Verkäufer geriet aber immer mehr in Begeisterung, zeigte ihm immer neue Systeme. Der in seiner Ehre gekränkte Gatte schämte sich schon, daß der Verkäufer sich seinetwegen so sehr abmühte, sich begeisterte, lächelte und unnütz seine Zeit verlor ...
»Schön, in diesem Falle ...« stammelte er, »komme ich später vorbei, oder ... oder ich schicke jemand her.«
Er sah den Gesichtsausdruck des Verkäufers nicht, doch er fühlte sich verpflichtet, um die peinliche Situation zu vertuschen, irgend etwas zu kaufen. Was sollte er aber kaufen? Er sah sich im Laden nach einem möglichst billigen Gegenstand um und heftete schließlich seinen Blick auf ein grünes Netz, das neben der Türe hing.
»Dieses da ... was ist es eigentlich?« fragte er.
»Das ist ein Netz für Wachtelfang.«
»Was kostet es?«
»Acht Rubel, mein Herr.
»Gut, packen Sie es mir ein ... «
Der gekränkte Gatte bezahlte die acht Rubel, nahm das Netz und verließ, noch tiefer gekränkt, den Laden.
Ein Glücklicher
Der Personenzug hat eben die Station »Bologoje« der Nikolajewer Eisenbahn verlassen. In einem der Raucherabteile II. Klasse duseln, in die Dämmerung gehüllt, fünf Passagiere. Sie haben soeben gegessen und bemühen sich nun, auf ihren Sitzen kauernd, einzuschlafen. Es ist still.
Die Türe geht auf, und in den Wagen tritt ein baumlanger Mensch in braunrotem Hut und elegantem Mantel; er erinnert lebhaft an einen Zeitungskorrespondenten aus einer Operette oder aus einem Roman von Jules Verne.
Der Mensch bleibt mitten im Wagen stehen, holt Atem und mustert aufmerksam die Bänke.
»Nein, es ist nicht der richtige!« murmelt er. »Weiß der Teufel! Es ist einfach empörend! Es ist noch immer nicht der richtige Wagen!«
Einer der Reisenden studiert lange den Neuankömmling und ruft plötzlich erfreut aus:
»Iwan Alexejewitsch! Wie kommen Sie her? Sind Sie es?«
Der baumlange Iwan Alexejewitsch fährt zusammen und blickt stumpfsinnig den Reisenden an. Als er ihn erkannt hat, schlägt er vor Freude die Hände zusammen.
»Ach, Pjortr Petrowitsch!« sagt er. »So lange haben wir uns nicht gesehen! Ich wußte gar nicht, daß Sie mit dem gleichen Zuge fahren.«
»Geht es gut?«
»Nicht schlecht. Ich habe aber eben mein Abteil verloren und kann es unmöglich finden, so ein Idiot bin ich! Es ist niemand da, der mich dafür durchprügeln könnte!«
Der baumlange Iwan Alexejewitsch wankt hin und her und kichert.
»Was man nicht alles erlebt!« fährt er fort. »Ich ging nach dem zweiten Glockenzeichen hinaus, um einen Kognak zu nehmen. Ich trank auch einen, und dachte mir: da die nächste Station nicht so bald kommt, so will ich noch ein zweites Glas nehmen. Während ich es mir überlegte und trank, läutete es zum dritten Mal ... ich laufe wie ein Verrückter aus dem Büfett und springe in den ersten besten Wagen. Bin ich nun kein Idiot, kein Trottel?«
»Sie sind aber in einer sichtbar lustigen Stimmung,« sagt Pjotr Petrowitsch, »setzen Sie sich nur her! Sie bekommen einen Platz und den gebührenden Respekt!«
»Nein, nein, ich gehe meinen Wagen suchen! Leben Sie wohl!«
»Im Finstern werden Sie unterwegs aus dem Zuge stürzen. Setzen Sie sich nur her; aus der nächsten Station werden Sie Ihren Wagen suchen. Setzen Sie sich!«
Iwan Alexejewitsch seufzt und setzt sich unentschlossen neben Pjotr Petrowitsch. Er ist sichtbar erregt und sitzt wie auf Nadeln.
»Wo fahren Sie hin?« fragt Pjotr Petrowitsch.
»Ich? In den Weltenraum! In meinem Kopfe ist solch ein Wirrwarr, daß ich selbst nicht weiß, wohin ich fahre. Das Schicksal fährt mich irgendwohin, und ich lasse mich fahren. Ha-ha ... Lieber Freund, haben Sie schon mal einen glücklichen Narren gesehen? Nein? Also schauen Sie mich an. Vor Ihnen sitzt der Glücklichste der Sterblichen! Jawohl! Sehen Sie denn nichts in meinem Gesicht?«
»Das heißt, man sieht Ihnen an, daß Sie ... ein wenig ...«
»Ich mache ein furchtbar dummes Gesicht! Schade, daß ich keinen Spiegel zur Hand habe, ich würde mir so gern meine Fratze anschauen! Ich fühle, mein Lieber, daß ich ein Idiot geworden bin. Mein Ehrenwort! Ha-ha! Ich befinde mich, denken Sie sich nur, auf der Hochzeitsreise. Bin ich kein Trottel?«
»Sie? Haben Sie denn geheiratet?«
»Heute, mein Lieber! Und bin gleich nach der Trauung in diesen Zug gestiegen.«
Es folgen Glückwünsche und die üblichen Fragen.
»So, so ...« lacht Pjotr Petrowitsch. »Darum sind Sie auch auf einmal so elegant!«
»Jawohl! ... Um die Illusion zu vervollständigen, habe ich mich sogar mit Parfüm besprengt. Stecke bis zu den Ohren in so leichtsinnigen Dingen! Habe weder Sorgen, noch Gedanken, sondern nur ein Gefühl von ... weiß der Teufel, wie ich es nennen soll ... von Glückseligkeit ... Seit ich lebe, habe ich mich noch nie so wohl gefühlt!«
Iwan Alexejewitsch schließt die Augen und schüttelt den Kopf.
»Ich bin in einer ganz empörenden Weise glücklich!« sagt er. »Urteilen Sie doch selbst. Gleich gehe ich mein Abteil suchen. Dort sitzt ein Geschöpf, das Ihnen, sozusagen, mit seinem ganzen Wesen ergeben ist. So ein Blondinchen mit einem Näschen ... mit Fingerchen ... Mein Herzchen! Mein Engel! Mein Schätzchen! So eine Reblaus meiner Seele! Und erst das Füßchen! Mein Gott! So ein Füßchen ist doch etwas ganz anderes als unsere Männerfüße; es ist etwas Winziges, Bezauberndes ... Allegorisches! Ich wäre imstande, so ein Füßchen einfach aufzufressen! Ach, Sie verstehen doch nichts davon! Sie sind Materialist und kommen gleich mit Ihrer Analyse und ähnlichem Kram! Ein trockener Junggeselle sind Sie und sonst nichts! Wenn Sie mal heiraten, werden Sie meiner Worte gedenken! Wo mag jetzt Iwan Alexejewitsch sein? – werden Sie dann sagen. Ja, gleich gehe ich in mein Abteil. Dort erwartet man mich mit Ungeduld ... man genießt mein Erscheinen schon im voraus. Ein Lächeln empfängt mich. Ich setze mich zu ihr und nehme sie so mit zwei Fingern am Kinn ...«
Iwan Alexejewitsch schüttelt den Kopf und bricht in ein glückliches Lachen aus.
»Dann legt man ihr seinen Kopf auf die Schulter und nimmt sie mit der Hand um die Taille. Im Abteil ist es still ... wissen Sie, so ein geheimnisvolles Halbdunkel. Die ganze Welt möchte man in einem solchen Augenblick umarmen! Pjotr Petrowitsch, gestalten Sie mir, daß ich Sie umarme!«
»Ich bitte sehr!«