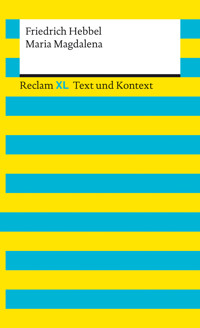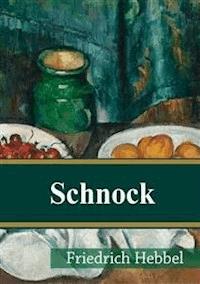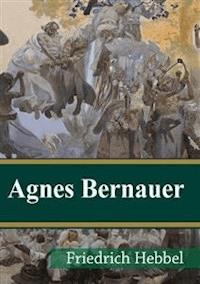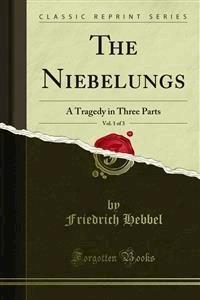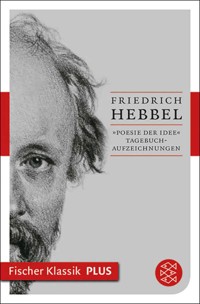8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum 200. Geburtstag von Friedrich Hebbel am 18. März 2013 Eine junge Magd, die durch die Übergriffe ihres Dienstherrn so sehr in die Enge getrieben wird, dass sie das Dorf in Brand steckt, ein Mann, der vor lauter Angst zum Helden wird, oder eine Bauernfamilie, die sich durch eine absurde Verkettung von Umständen in wenigen Stunden zugrunde richtet: Prägnant und spannend schildert Hebbel alltägliche Charaktere und tragische Situationen von ungeheurer Zeitlosigkeit. • Modern und zeitlos: Eine Originalausgabe mit den schönsten Erzählungen des großen Tragikers • Hervorragend für Studium und Schule geeignet • Mit Nachwort, Zeittafel und Literaturhinweisen von der Hebbel-Forscherin Monika Ritzer Mit den Erzählungen: Anna · Barbier Zitterlein. Novelle - Pauls merkwürdigste Nacht - Schnock. Ein niederländisches Gemälde - Der Schneidermeister Nepomuk Schlägel auf Freudenjagd - Herr Haidvogel und seine Familie - Ein Abend in Straßburg. Aus einer Reisebeschreibung - Eine Nacht im Jägerhause - Ein Traum - Die einsamen Kinder. Märchen - Matteo - Die Kuh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Hebbel
Meistererzählungen
Herausgegeben und mit einem Nachwortvon Monika Ritzer
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2013
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2013 Deutscher Taschenbuch Verlag, München.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41645-0 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14193-2
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
ANNA
BARBIER ZITTERLEIN
PAULS MERKWÜRDIGSTE NACHT
SCHNOCK
DER SCHNEIDERMEISTER NEPOMUK SCHLÄGEL AUF DER FREUDENJAGD
HERR HAIDVOGEL UND SEINE FAMILIE
EIN ABEND IN STRASSBURG
EINE NACHT IM JÄGERHAUSE
DER TRAUM
DIE EINSAMEN KINDER
MATTEO
DIE KUH
ANHANG
NACHWORT
ZU LEBEN UND WERK
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
ANNA
»Himmel blau und mild die Luft,
Blumen voll von Tau und Duft,
Und am Abend Tanz und Spiel,
Das ist mehr, als allzuviel!«
Lustig sang dies an einem hellen Sonntagmorgen Anna, die junge Magd, während sie zugleich aufs fleißigste mit Reinigung der Küchen- und Milchgeschirre beschäftigt war. Da ging im grün-damastenen Schlafrock der Freiherr von Eichenthal, in dessen Diensten sie seit einem halben Jahre stand, an ihr vorüber, ein junger verlebter Mann, voll Hypochondrie und Grillen. »Was soll das Gejohle – herrschte er, indem er vor ihr stehen blieb, ihr zu – Sie weiß, daß ich keine Leichtfertigkeiten leiden kann!« Anna erglühte über und über, sie erinnerte sich, daß der gestrenge Herr sie vor einigen Abenden in der Gartenlaube gern leichtfertig gefunden hätte, sie hatte ein scharfes Wort auf der Zunge, griff aber, es mit Gewalt unterdrückend, nach einer weißporzellänenen Suppenterrine, und ließ diese, in heftigem Kampf mit der ihr eigenen Unerschrockenheit begriffen, zu Boden fallen. Das kostbare Geschirr zerbrach, der Freiherr, der bereits einige Schritte vorwärts getan hatte, kehrte zornglühenden Gesichts um. »Was? – rief er laut aus und trat dicht vor das Mädchen hin – will Sie Tückmäuserin an meiner Mutter Küchengerätschaften Ihr Mütchen kühlen, weil Ihre Verstocktheit es Ihr nicht erlaubt, einen wohl verdienten Vorwurf ruhig hinzunehmen, wie sichs geziemt?« Und damit gab er ihr rechts und links, scheltend und tobend, Ohrfeigen über Ohrfeigen, während sie ihn, erstarrend, wie ein Kind, der Sprache, ja fast der Sinne beraubt, in der einen Hand noch den Henkel der Terrine haltend, die andere unwillkürlich gegen die Brust drückend, ansah. Aus diesem, an Ohnmacht grenzenden Zustand wurde sie erst durch das spöttische Gelächter des Kammermädchens Friederike erweckt, die, gefälliger, wie sie, es sich gern gefallen ließ, daß der Freiherr, lüstern tändelnd, sie in die Wangen kniff und mit ihren Locken spielte. Höhnisch schaute die freche Dirne zu ihr hinüber und rief ihr zu: »Das gibt guten Appetit für die Kirmse, Jungfer Männerscheu.« Der Freiherr aber stemmte, laut lachend, die Arme in die Seite und sagte: »Laß Sie sich das Gelüste nach Tanz und Spiel nur vergehen; ich nehme die von meiner Mutter erteilte Erlaubnis zurück, Sie soll das Haus hüten.« »Gibts denn heute nichts für sie zu tun?« fuhr er, mit sich selbst ratschlagend, fort. Friederike flüsterte einiges. »Richtig – rief er überlaut – sie soll Flachs hecheln, bis spät in die Nacht, hört Sies?« Anna, in gänzlicher Verwirrung, nickte mit dem Kopf und sank dann kraftlos auf die Kniee, ergriff aber zugleich, instinktartig, ein messingenes Gefäß und begann, während ihr die Tränen heiß und unaufhaltsam aus den Augen drangen, es blank zu scheuern. Da ging der Gärtner, der ihr, frisch und blühend, wie sie war, längst, aber vergebens, nachgestellt, und den vorigen Auftritt von ferne angesehen hatte, an ihr vorbei, grüßte sie und fragte hämisch, wie’s ihr gehe. »Oh, oh!« stöhnte sie, krampfhaft zusammenzuckend, sprang auf und packte den hohnsprechenden Buben bei Brust und Gesicht. »Rasende!« rief er erschreckend und stieß sie, sich ihrer mit aller Manneskraft erwehrend, zurück. Sie, als wüßte sie selbst nicht, was sie getan, starrte ihm nach mit weit aufgerissenen Augen; dann, wie sich besinnend, ging sie wieder an ihre Arbeit, die sie ununterbrochen, nur zuweilen unbewußt laut aufseufzend, fortsetzte, bis man sie mittags zum Essen in die Küche rief. Hier sah sie sich empfangen von lauter schadenfrohen Gesichtern, und von mehr oder minder unterdrücktem Gelächter und Gekicher, welches, da sie mit brennenden Wangen auf ihren Teller niederblickte und zu allen reichlich vorgebrachten Anspielungen kein Wort sagte, immer stärker und rücksichtsloser ward. Die Mägde, teilweise schon im Putz, neckten sich in unverkennbarem Bezug auf sie gegenseitig mit den Liebhabern, die sie gefunden hatten oder zu finden hofften, und der breitnasigte Küchenjunge, durch Großknecht und Kutscher mit Augenzwinkern zu dieser Frechheit aufgemuntert, fragte Anna, ob er nicht ihre rotgeblümte Schürze, sowie den bunt bebänderten Hut, den des Majors Bedienter Friedrich ihr zur Weihnacht geschenkt, leihen dürfe; sie werde ja in der Flachskammer diese Sachen entbehren können, und er hoffe, sich ein Mädchen, dem es an Putz fehle, dadurch geneigt zu machen. »Bube«, rief sie aus mit blassen, bebenden Lippen, »ich will dir, wenn du krank liegst und von niemanden beachtet wirst, keine Milchsuppen wieder kochen«; schob ihren Teller zurück, und ging, die leeren Wasser-Eimer ergreifend, um sie, wie es ihr zukam, frisch aus dem Brunnen zu füllen, hinaus. »Pfui«, sagte Johann, ein alter Diener, der, im Dienst seines Vaters grau geworden, bei dem Freiherrn von Eichenthal das Gnadenbrot genoß, »es ist Unrecht, der Dirne Essen und Trinken durch galligte Reden zu verderben!« »Ei«, versetzte der Gärtner, »der schadts nicht, sie ist so hochmütig, seit der Friedrich, der dünnleibigte Speichellecker, hinter ihr herläuft, als ob ein Edelmann angebissen hätte!« »Hochmut kommt vor dem Falle!« sagte Liese, die kleine dralle Köchin, mit einem zärtlichen Blick auf den phlegmatischen Großknecht, »wißt Ihr, daß sie sich schnürt?« »Warum auch nicht hochmütig«, sagte der Kutscher, »ist sie doch des Schulmeisters Tochter!« Friederike, das Kammermädchen, trat mit erhitztem Gesicht in die Küche. »Ist die Anna nicht hier – fragte sie, sich die Stirn mit dem seidenen Taschentuche trocknend – der gnädige Herr hat sich eben zu Bett gelegt, er war sehr spaßhaft – hier hustete sie, weil die anderen sich mit bedeutenden Blicken ansahen und lachten – und ich soll ihr sagen, daß sie gleich mit dem Flachshecheln beginnen und – dies setzte sie eigenmächtig hinzu – vor zehn Uhr nicht Feierabend machen soll!« »Ich wills ihr schon ausrichten, Rike!« versetzte Liese. Friederike tänzelte wieder fort. »Ob die sich nicht auch schnürt?« fragte der Großknecht. »Pst! Pst!« wisperte Johann und klimperte verlegen mit seiner Gabel auf dem Teller. Anna trat mit ihrer Tracht Wasser in die Küche. »Anna – begann Liese geschäftig – ich soll dir sagen« – – »Ich weiß schon Bescheid – erwiderte Anna trocken in festem Ton: – Ich bin dem Boten begegnet. Wo hängt der Schlüssel zur Flachskammer?« »Drüben am Nagel!« versetzte die Köchin und zeigte mit dem Finger auf die Stelle. Anna, gelassen, weil im Innersten zerschlagen, nahm den Schlüssel und ging, während die übrigen sich zu ihren Koffern begaben, um dort vor einem Drei-Groschen-Spiegel den Anzug zu vollenden, hastig in die Flachskammer, deren Fenster auf Schloßhof und Landstraße hinausgingen. Sie setzte sich, das Gesicht gegen die Fenster gewendet, so, daß sie alle Fröhlichen, die aus dem Dorfe auf die Kirmse zogen, sehen und ihre muntern Gespräche hören konnte, an die Arbeit, die sie in dumpfer Emsigkeit begann, und, wenn sie auch zuweilen in unbewußtes Hinbrüten versank, doch sogleich aus diesem, wie vor Schlangen- und Tarantelstich, schreckhaft auffahrend, mit verstärktem, ja unnatürlichem, Eifer fortsetzte. Nur einmal während des ganzen langen Nachmittags stand sie von ihrem niedrigen, harten Blockstuhl auf, und zwar, als ihr Mitgesinde, auf bequemem, von raschen Pferden gezogenen Leiterwagen den Schloßhof hinunterjagte, aber laut auflachend, wie zu eigener Verspottung, setzte sie sich wieder nieder und trank, obwohl sie in all der Hitze und all dem Staub durstig ward, daß ihr die Zunge am Gaumen klebte, nicht einmal den Kaffee, den ihr um vier oder fünf Uhr die alte Brigitte, die bei einer Gelegenheit, wie die heutige, für die Mägde das Haus zu hüten pflegte, mitleidig gebracht hatte. Als die Nacht allmählig hereinbrach, ging sie, ohne sich die wild ums Gesicht herunterhängenden Locken zurückzustreichen, in die Küche, wo sie, auf Brigittens freundliche Einladung, dort zu bleiben und eine leckere Pfanne voll gebratener Kartoffeln mit ihr zu verzehren, nichts erwidernd, ein Licht aus dem Lichtkasten nahm, und sich dann mit diesem, es mit darübergehaltener Hand vor dem Zugwind schützend, in die Flachskammer zurückbegab. Nicht lange dauerte es, so klopfte es bei ihr ans Fenster, und als sie die Tür öffnete, trat Friedrich, über und über schwitzend, mit Hast herein. »Ich muß doch sehen – sagte er, fast außer Atem und sich die Weste aufreißend – sie flüstern allerlei!« »Du siehst!« erwiderte Anna schnell, dann aber stockend und steckte ihren Busenlatz, der sich etwas verschoben hatte, fest. »Dein Herr ist ein Hundsfott!« brauste Friedrich auf und knirschte mit den Zähnen. »Ja, ja!« sagte Anna. »Ich mögt ihm begegnen, drüben am Abhang – rief Friedrich – o, es ist entsetzlich!« »Wie heiß bist du – sagte Anna, indem sie sanft seine Hand faßte – hast du schon getanzt?« »Wein hab ich getrunken, fünf, sechs Gläser, – versetzte Friedrich – komm, Anna, zieh dich an, du sollst mit, jedem Teufel zum Trotz, der sich drein legen will.« »Nein, nein, nein!« sagte Anna. »Ja doch«, fuhr Friedrich auf und legte seinen Arm um ihren Leib, »doch!« »Ganz gewiß nicht!« erwiderte Anna leise, ihn innig umschlingend. »Du sollst, ich wills«, rief Friedrich und ließ sie los. Anna ergriff, ohne etwas zu antworten, die Hechel und sah vor sich nieder. »Willst du oder nicht?« drängte Friedrich und trat dicht vor sie hin. »Wie könnt ich?« entgegnete Anna, indem sie, ihm vertrauensvoll in die Augen sehend, ihre Hand aufs Herz legte. »Gut, gut«, rief Friedrich, »du willst nicht? Gott verdamme mich, wo ich dich wieder seh!« Wie rasend stürzte er fort. »Friedrich – schrie Anna ihm nach – bleib doch, bleib einen Augenblick, horch, wie der Wind braust!« Sie wollte ihm nacheilen, da streifte ihr Kleid das niedrig auf einen Eichenklotz gestellte Licht; es fiel herunter und entzündete den schnell in mächtiger Flamme auflodernden Flachs. Friedrich, von Wein und Zorn berauscht, zwang sich, wie dies in solchen Augenblicken wohl geschieht, ein Lied zu singen, während er in die sehr unfreundlich gewordene Nacht hinausschritt; in wilder Lustigkeit drangen die wohlbekannten Töne zu Anna hinüber. »Ach! ach!« seufzte sie aus tiefster Brust. Da erst bemerkte sie, daß die Kammer schon halb in Feuer stand. Mit Händen und Füßen schlagend und tretend, warf sie sich in die gefräßigen Flammen, die ihr heiß und brennend entgegenschlugen und sie selbst verletzten. Dann rief sie – Friedrichs Stimme verklang eben in weiter Ferne in einem letzten Halloh – »ei, was lösch ich, laß! laß!« und eilte, die Tür mit Macht hinter sich zuwerfend, mit einem gräßlichen Lachen hinaus, unwillkürlich den nämlichen Weg durch den Garten einschlagend, den Friedrich gegangen war. Bald aber, auf einer Wiese, die zunächst an den Garten stieß, sank sie kraftlos, fast ohnmächtig, zusammen und drückte, laut stöhnend, ihr Gesicht ins kalte, nasse Gras. So lag sie lange Zeit. Da ertönten dumpf und schrecklich von nah und von fern die Not- und Feuerglocken. Sie richtete sich halb auf, doch sah sie sich nicht um; aber über ihr war der Himmel blutrot und voll von Funken; eine unnatürliche Wärme verbreitete sich, von Minute zu Minute zunehmend; Geheul und Gebrause des Windes, Geprassel der Flammen, Wehklage und Geschrei. Sie legte sich wieder der Länge nach am Boden nieder, ihr war, als ob sie schlafen könne, doch schreckte sie im nächsten Augenblick aus diesem, dem Tode ähnlichen Zustand die Rede zweier Vorübereilenden wieder auf, von denen einer ausrief: »Herr Jesus, es brennt schon im Dorf!« Jetzt, mit Riesenkraft, raffte sie sich zusammen und eilte mit fliegenden Haaren in das hart an die brennende Seite des Schlosses stoßende Dorf hinunter, wo die leicht Feuer fangenden Strohdächer bereits an mehr, als einer Stelle, in lichten Flammen aufschlugen. Immer gewaltiger erhob sich der Wind, die meisten Einwohner, Kinder und alte, schwächliche Personen ausgenommen, waren über vier Meilen entfernt auf der Kirmse; die elenden Feueranstalten hätten den zwei verbündeten furchtbaren Elementen ohnehin, auch wenn die nötige Mannschaft zur Stelle gewesen wäre, nur eitlen Widerstand leisten können, es fehlte sogar, denn der Sommer war ungewöhnlich trocken, an Wasser. Unglück, Gefahr, Verwirrung wuchs mit jeder Minute; ein kleiner Knabe rannte umher und schrie: »Ach Gott, ach Gott! mein Schwesterlein!« und wenn man ihn fragte: wo ist deine Schwester? so begann er, als ob er, jedes klaren Gedankens unfähig, die Frage nicht verstanden hätte, von neuem sein Entsetzen erregendes Geschrei. Eine alte Frau mußte mit Gewalt gezwungen werden, ihr Haus zu verlassen; sie jammerte: »Meine Henne, meine arme kleine Henne«, und in der Tat war es rührend anzusehen, wie das Tierchen in dem erstickenden Rauche ängstlich von einer Ecke in die andere flatterte, und sich dennoch, weil es in bessern Zeiten gewöhnt sein mogte, die Schwelle nicht zu überschreiten, von seiner Herrin selbst nicht durch die offne Tür ins Freie hinausscheuchen ließ. Anna, mit der Tollkühnheit der Verzweiflung, weinend, schreiend, sich die Brust zerschlagend, dann wieder lachend, stürzte sich in jede Gefahr, rettete, löschte, und war allen anderen zugleich Gegenstand des Erstaunens, der Bewunderung und unheimliches Rätsel. Zuletzt, als man in allgemeiner Kleinmütigkeit selbst die Hoffnung aufgab, dem Feuer, das immer weiter um sich griff und das ganze Dorf mit der Einäscherung bedrohte, Einhalt tun zu können, sah man sie in einem brennenden Hause auf die Kniee sinken und mit gerungenen Händen zum Himmel emporstarren. Da rief der Pfarrer: »Um Gottes willen, rettet das heldenmütige, brave Mädchen, das Dach schießt herunter!« Anna, seine Worte hörend, blökte ihm, noch immer auf den Knieen liegend, mit einer Gebärde des heftigsten Abscheus die Zunge entgegen und lachte ihn wahnsinnig an. In diesem Augenblick erschien Friedrich, der sie nur kaum in der entsetzlichen Todesgefahr erblickte, als er, bleich werdend, wie eine Wand, auf das den Einsturz drohende Haus zustürzte. Sie aber, ihn sogleich gewahrend, sprang erschreckt auf und rief: »Laß! laß! Friedrich! ich, ich bin schuld, dort – dort –.« Und mit der Hand auf die Gegend zeigend, wo das Schloß lag, eilte sie, um jegliche Rettung unmöglich zu machen, die schon brennende Leiter, welche zum Boden des Hauses führte, hinauf. Die Leiter, bereits zu stark vom Feuer versehrt, brach unter ihr, zugleich aber schoß, eine Flammenmauer bildend, das Strohdach herunter; man hörte noch einen durch Mark und Bein dringenden Schrei, dann wards still.
Der Freiherr von Eichenthal kam. Sowie Friedrich ihn erblickte, eilte er auf ihn zu und stieß ihn, bevor der Freiherr sich seiner erwehren konnte, mit dem Fuß vor den Leib, daß er rücklings zu Boden schlug; dann ließ er die Bauern, die sich auf Befehl des Schulzen seiner Person zu bemächtigen suchten, ruhig gewähren.
Als der Freiherr am andern Morgen erfuhr, was sich mit Anna begeben hatte, befahl er, ihre Gebeine aus dem Schutt hervorzusuchen und sie auf dem Schindanger zu verscharren. Dies geschah.
BARBIER ZITTERLEIN
Novelle
1
Es war Abend, und der Barbier Zitterlein saß an seinem Tisch. Eine helle Lampe brannte auf demselben und beleuchtete das Gesicht des langen, dünnen Mannes, der sich um das Abendbrot, welches seine Tochter Agathe auftrug, wenig bekümmerte. Die Tochter setzte sich an den Tisch und klimperte, um den Vater aus seinen Gedanken zu wecken, mit den zinnernen Löffeln; endlich sagte sie leise:
»Vater, wollt Ihr nicht essen?«
»Ja wohl«, antwortete Zitterlein und rückte näher zum Tisch.
»Eine Biersuppe? ach, du liebes, treues Kind!«
Beide fingen an zu essen. Zitterlein fiel in sein vorheriges Stillschweigen zurück und aß nur wenig; Agathe sah ihn zuweilen mitleidig an, bald legte auch sie den Löffel nieder und begann, den Tisch abzuräumen.
»Bist du schon satt, Agathe?« fragte der Vater und heftete einen glühenden Blick auf sie.
»Ihr wißt, ich esse zur Nacht nicht viel«, antwortete Agathe, »aber Ihr, Vater, Ihr solltet die schöne, kräftige Suppe nicht so verschmäht haben, denn Ihr eßt sie gern, und sie tut Euch wohl!«
»Du hast recht, mein Kind, und ich sollte es umso weniger getan haben, als dies der letzte Abend ist, wo wir so recht innig beisammen sind!«
»Der letzte Abend?« fragte Agathe und sah ihren Vater erstaunt an.
»Freilich, der letzte«, – antwortete dieser – »du weißt, morgen hole ich den Gesellen, und dann ist das vorbei!«
»Mein Gott, Vater, ich versteh Euch nicht. Ich meine, der Gesell soll die Stütze Eures Alters werden; Ihr sollt Ruhe haben, und ein junger Mann, wie der Gesell, kann in die einförmige Stille unsers Hauses recht gut passen: Ihr werdet nicht so oft sitzen und grübeln, und ich –«
»Du wirst weniger Langeweile haben, nicht wahr?« – unterbrach Zitterlein sie heftig – »das ist recht, mein Kind, quäle du mich auch!«
»Vater, was meint Ihr?« – antwortete Agathe ihm sanft, indem sie sich vor ihn hinstellte – »Ihr wißt, daß ich Euch liebe, und daß ich, wenn Ihr so tiefsinnig zu grübeln sitzt, nicht Langeweile, sondern nur das tiefste Mitleid, ja Grausen, empfinde.«
Zitterlein ergriff ihre Hand und drückte sie an die Brust. Dann sagte er:
»Vergib mir, liebe Tochter, ich weiß das ja alles, es kann ja nicht anders sein, denn du bist das einzige Gut, was mir ist, was von Tage zu Tage inniger mit mir verwächst. Aber eben darum – sieh, liebes Kind, ich bin nicht, wie ein Baum, der in der Erde wurzelt und sich von Luft und Sonne ernährt; er braucht sich um seinesgleichen nicht zu bekümmern, aber ich bin ein Mensch, ich muß mit Menschen leben, ich liebe sie sogar, weil sie unglücklich sind. Doch, sie sind mir in der tiefsten Seele verhaßt, wenn sie mir nähertreten, ich mögte sie ermorden, wenn sie in mein Haus kommen. Ich will nur dich, nur dich; warum kommen sie denn? haben sie nicht auch Weib und Kind? Gehe ich zu ihren Weibern, ihren Kindern? Und nun muß ich mir selbst den Gesellen holen; ich muß, denn ich bin alt, und der Vogt glaubt, meinen zitternden Händen das Egelsetzen und Aderlassen nicht mehr anvertrauen zu dürfen. Der wird nun mit kalter Teufelsfaust in meine heiligsten Gefühle hineingreifen, er wird mir überall störend und zerstörend in den Weg treten, er wird mit uns in einem Hause schlafen, an einem Tische mit uns essen, und ich kann es nun einmal nicht dulden!«
»Lieber Vater« – sagte Agathe – »Ihr seid krank! Und doch« – fügte sie leise mit herzzerschneidender Wehmut hinzu – »doch ist er nicht anders, wie immer.«
»Nein, Tochter, ich bin nicht krank, ich sehe bloß voraus, wie alles kommen wird. Ach, ich fürchte mich vor meinem Gesellen! Gibt es nicht Gesichter, die mich anstarren, wie Larven der Hölle, Augen, deren feindlicher, vernichtender Strahl mich tötet? Hast du nie ein Lächeln gesehen, welches dir jede Freude, jede Lebenslust zusammenschnürte, wie eine Schlange?«
2
Am andern Morgen war Zitterlein früh aufgestanden und hatte sich nach der nahgelegenen Stadt – er wohnte in dem Kirchdorf Müntzen – aufgemacht, um sich dort auf der Herberge der Bader nach einem Gesellen umzutun. Auf seine Frage, ob etwa ein Gesell angekommen sei, antwortete der Herbergsvater: dies wäre allerdings der Fall; es sei am gestrigen Abend ein stiller, netter Bursch zugereist gekommen, und er zweifle nicht, daß er mit Vergnügen in Arbeit treten werde; der Winter sei nahe und dann tue das Wandern nicht wohl. Es dauerte auch nicht lange, so kam der junge Gesell von der Polizei, woselbst er seine Papiere hatte in Ordnung bringen lassen, zurück; er war von ansehnlicher Statur, hatte blondes Haar, blaue Augen und viele Freundlichkeit im Benehmen.
»Es ist Arbeit für Euch in Müntzen« – rief ihm der Herbergsvater entgegen – »das Dorf liegt eine halbe Stunde von hier.«
»Das ist mir sehr lieb«, antwortete der Gesell und trat auf Zitterlein zu, auf den der Herbergsvater ihn verwies.
»Ich gebe aber nur zwanzig Groschen Wochenlohn«, sagte Zitterlein, ohne ihn anzusehen.
»Das ist wenig« – antwortete der Gesell – »ich bin vierundzwanzig gewohnt. Aber, ich nehme Euer Anerbieten an. Seht hier meine Kundschaft und meine Arbeitszeugnisse.«
»Steckt sie nur ein« – entgegnete Zitterlein – »das ist mir einerlei. Nennt mir Euren Namen, laßt Euch einen Schnaps geben und kommt mit mir!«
»Mein Name ist Leonhard Ziegler; Schnaps trink ich nicht.«
»Wein ist doch für einen Barbiergesellen, der wöchentlich nur zwanzig Groschen verdient, zu kostbar!« sagte Zitterlein mit einem höhnischen Lächeln, indem er selbst den Schnaps austrank, den er sich hatte einschenken lassen.
Zitterlein und Leonhard machten sich bald auf den Weg; sie gingen schweigend nebeneinander her, denn Leonhard mogte sprechen, was er wollte, er erhielt immer eine kurze, oft bittre Antwort und verlor so am Ende die Lust, ein Gespräch fortzuspinnen, was so sichtlich vermieden wurde. Als sie nahe vor Müntzen waren, fing es an zu regnen. »Wir werden noch naß!« sagte Leonhard.
»Daran muß ein reisender Gesell gewöhnt sein!« entgegnete Zitterlein und ging langsamer, wie bisher. Leonhard wußte nicht, was er aus ihm machen sollte; er hatte zuweilen ein scharfes Wort auf der Zunge, aber er hielt es zurück, wenn er in das blasse, schmale Gesicht des Mannes sah, der alle seine Freundlichkeiten so schnöde abwies. »Vielleicht ist er krank!« dachte er, »und jedenfalls kannst du nach einer Woche deinen Bündel wieder schnüren, wenn es dir nicht bei ihm gefällt!« Sie kamen zu Zitterleins Hause und traten hinein. Agathe trat ihnen aus der Küche, wo sie mit Zubereitung des Mittagsessens beschäftigt war, entgegen; sie sagte herzlich: »Guten Tag, lieber Vater!« aber dieser schob sie, nachdem sie den Gesellen kaum gegrüßt hatte, fast unsanft in die Küche zurück und rief ihr zu: »Bekümmere du dich nicht um uns!« Dann zeigte er Leonhard die für ihn bestimmte Kammer und sein Bett, gab ihm den Schlüssel zu einem dort aufgestellten Schrank und bat ihn, sich einzurichten, worauf er zu seiner Tochter in die Küche ging.
3
Agathe hatte das Essen aufgetragen und fragte Zitterlein, ob sie den Gesellen rufen solle. Zitterlein antwortete ihr nicht, sondern stand schnell auf, um dieses selbst zu tun. Stumm kam er mit Leonhard zurück, setzte sich mit ihm zu seiner Tochter an den Tisch und nötigte ihn einsilbig, zuzulangen. Während des Essens wurde fast kein Wort gesprochen, obgleich dies ängstliche Schweigen Agathen fast ebensosehr drückte, wie Leonhard; der letztere entfernte sich bald. Kaum hatte er das Zimmer verlassen, als Zitterlein seine Tochter fragte: »Warum wurdest du rot, als der Gesell in das Zimmer trat?«
»Gott, Vater«, – antwortete sie – »das bin ich selbst gar nicht gewahr geworden, und wenn es wäre, so ist es ja wohl etwas so Unerhörtes nicht, vor einem Menschen zu erröten, den man nie gesehen hat.«
»Ganz recht, liebe Tochter«, – sagte Zitterlein beruhigt – »einen andern Grund kann das ja auch nicht haben; aber du weißt, mir liegt das Nächste immer am fernsten. Jetzt will ich mir die Papiere des Gesellen geben lassen, ich muß sie zum Vogt tragen. In einer Stunde bin ich wieder hier.«
Er nahm aus einem Kasten einige Rasiermesser hervor und ging damit zu Leonhard in die Kammer.
»Ich muß Euch bei dem Vogt melden«, – sagte er zu diesem – »und bitte Euch jetzt um die Papiere. Mittlerweile seid Ihr wohl so gut, diese Messer für den morgenden Gebrauch ein wenig zu wetzen.«
Leonhard gab ihm die Papiere, und er ging.
Leonhard wollte beginnen, die Messer zu wetzen; da merkte er, daß Zitterlein vergessen hatte, ihm einen Wetzstein zu geben. Er ging daher in das Wohnzimmer, woselbst er Agathen vorfand.
»Entschuldigt, wenn ich Euch störe. Ich soll diese Messer wetzen, und Euer Vater hat mir keinen Wetzstein gegeben!«
»Ach«, – antwortete Agathe – »mein Vater ist zuweilen etwas zerstreut; kehrt Euch nicht daran, er ist sonst gut!«
Diese im Ton der herzlichsten Bitte vorgebrachten Worte rührten Leonhard tief; er schaute das Mädchen, welches den seltsamen Vater so einfach und doch so eindringlich zu verteidigen wußte, näher an. Da klingelte die Haustür, und Zitterlein, der einen für den Vogt aus der Stadt mitgebrachten Brief vergessen hatte, trat ins Zimmer, um diesen zu holen. Sein Auge flammte von heftigem Zorn, als er Leonhard bei seiner Tochter erblickte.
»Ihr seid wohl ein Meister im Messerwetzen«, – rief er diesem zu – »daß Ihr schon jetzt Muße zu plaudern habt; und du, Agathe –«
»Verzeiht«, – unterbrach ihn Leonhard, der nur durch einen Blick auf das schöne, schüchterne, von tiefer Scham übergossene Mädchen von der Äußerung seines heftigen Unwillens abgehalten wurde – »verzeiht, ich wollte nur einen Wetzstein holen, den Ihr vergessen hattet.«
»Einen Wetzstein?« – entgegnete Zitterlein – »ach so, da, nehmt, nehmt, hier ist er!«
Leonhard nahm ihn und kehrte in seine Kammer zurück.
4
Am andern Morgen, früh, als Leonhard kaum aufgestanden war, trat Zitterlein zu ihm in die Kammer, brachte ihm sein Frühstück und ging dann mit ihm aus im Dorf, um ihn den Kunden vorzustellen, die er künftig zu bedienen hatte. Als dieses geschehen war, kehrte er selbst in sein Haus zurück, Leonhard aber ließ er bei dem Bierbrauer des Orts, an dessen starkem Bart er sich zuerst versuchen sollte.
»Das ist hohe Zeit, junger Gesell«, – sagte Herr Tobias zu Leonhard – »daß Ihr kommt. Mit Eurem Meister wurde es wirklich zu arg, er würde keinen einzigen Kunden behalten haben, wenn im Dorf nur ein anderer Barbier vorhanden gewesen wäre. Ich wenigstens ging in der letzten Zeit lieber in die Stadt, als zu ihm.«
»Er ist alt und seine Hände mögen zittern«, – versetzte Leonhard.
»Dies würde noch so viel nicht gemacht haben«, – antwortete Herr Tobias – »aber er ist verrückt, und der Teufel mag einem verrückten Bartscherer seinen Hals anvertrauen. Ich hatte vor vierzehn Tagen in seiner Barbierstube einen Auftritt mit ihm, an den ich zeitlebens denken werde. Ich ging den Sonnabendsabend nach meiner Gewohnheit zu ihm, um mich rasieren zu lassen. Er verrichtete sein Geschäft anfänglich still und emsig; plötzlich aber fühlte ich einen heftigen Schmerz, mein Blut floß, und ich bemerkte, daß er mir eine Warze, die ich am Kinn trug, abgeschnitten. Dies konnte nun freilich angehen, umso eher, da er mich bei Licht rasierte; als ich ihn aber fragte, ob er nicht sehen könne, antwortete er mir mit einem häßlichen Lachen: »Dankt Gott, daß es der Hals nicht ist!« und damit hob er sein Messer, als ob er es nun auch auf den Hals abgesehen habe. Natürlich sprang ich schnell auf und hielt ihm die Hand. Da aber war er auf einmal ganz wieder, wie im Anfang, er fragte mich, ob ich keinen Spaß verstehen könne, bat mich um Verzeihung wegen seiner Unvorsichtigkeit, und brachte sein Geschäft ruhig zu Ende. Aber mir wars durch Mark und Bein gedrungen, jenes häßliche Lachen konnt ich nicht wieder vergessen; daher ging ich sogleich zum Vogt, meinem Nachbar, und dieser, der so gut für seine Kehle zitterte, wie ich für die meinige, befahl ihm, sich einen tüchtigen Gesellen zu halten, widrigenfalls ihm das Handwerk gelegt werden solle.«
»Das ist alles seltsam«, – antwortete Leonhard – »und Ihr könntet mir fast die Lust verleiden, länger, als die ersten acht Tage, bei Herrn Zitterlein zu bleiben.«
»Ich könnte es Euch so sehr nicht verdenken, junger Mann«, – entgegnete Herr Tobias, während Leonhard ihn einseifte – »dieser Zitterlein ist in jedem Betracht der sonderbarste Mensch von der Welt. So hat er da ein junges Ding von Tochter – Ihr werdet sie gesehen haben – von ganz leidlichem Gesicht und angenehmer Figur; meint Ihr, daß das arme Mädchen zu Tanz und Kirmse gehen darf, wie andere? Ein oder zwei Mal im Jahr darf sie an einer Lustbarkeit teilnehmen, und dann ist der alte verrückte Vater dahinter her, als ob er, verzeih mirs Gott, sie selbst heiraten könnte oder mögte. Ist das Raison? Alle Donnerwetter, wohin meine Tochter und des Vogts Tochter kommen, da ist es für die Barbiermamsell auch gut genug!«
»Da ist das Mädchen ja sehr zu bedauern«, – sagte Leonhard.
»Allerdings ist sie das!« – versetzte Herr Tobias – »sie zählt 17 oder 18 Jahr, und für so junges Blut ist Glas und Rahmen drückend. Und doch ist der Vater ebensosehr zu bedauern. Ja, wär er von jeher so ein Tückmäuser gewesen!«
»Also war er nicht immer so?« – fragte Leonhard.
»Nein, wahrhaftig nicht!« – entgegnete Herr Tobias. »Ein Narr war er freilich immer, aber desungeachtet ein guter Barbier, ein lustiger Mann in Gesellschaft. Er wollte zwar immer zu hoch hinaus, vertrieb sich die Zeit mit unsinnigem Zeug, mit Büchern z. E., statt Kugel zu schieben, war auch nie damit zufrieden, daß er dem Pastor den Bart abnehmen mußte, wär lieber für ihn auf die Kanzel gestiegen – aber, was war das gegen seine jetzigen Albernheiten!«
»Und diese auffallende Veränderung – weiß man denn nicht, worin sie ihren Grund hat?« – unterbrach ihn Leonhard.
»Schicksal! Schicksal!« – antwortete Herr Tobias – »so gehts! Mein Knecht trägt zwei Tonnen Weizen, mancher sinkt unter einer zusammen. Als hier vor ungefähr zwanzig Jahren das große Viehsterben war, verlor ich dreizehn Ochsen und einige Pferde, prächtige, wohlgenährte Tiere; doch, ich dachte: der Himmel wills, und rauchte ruhig meine Pfeife. Dem Barbier starb vor fünf, sechs Jahren sein Weib, und er wurde verrückt. So gehts!«
Leonhard war mittlerweile mit dem Bart des Herrn Tobias fertig geworden und reichte ihm jetzt das Handtuch zum Abtrocknen. Als Herr Tobias sich abgetrocknet hatte, sagte er zu Leonhard, der sein Geschirr wieder einpackte:
»Ihr gefallt mir; es soll mir lieb sein, wenn Ihr hin und wieder einen Abend bei mir verplaudern wollt, Ihr werdet bei Eurem Meister Langeweile genug haben.«
5
Zitterlein saß eines Abends mit seiner Tochter einsam in seinem Zimmer, da trat Leonhard in seinem Sonntagsrock herein und sagte:
»Meister, Ihr werdet nichts dagegen haben, wenn ich ein wenig ausgehe; Herr Tobias, der Brauer, hat mich schon mehrere Male eingeladen.«
»Daran tut Ihr recht, sehr recht«, – versetzte Zitterlein mit Freundlichkeit – »ich habe nicht das geringste dagegen, Ihr könnt ausgehen, wenn Ihr wollt, wiederkommen, wenn es Euch beliebt; ich wünsche Euch viel Vergnügen!«
»Auch ich!« – setzte Agathe hinzu, die sich durch das peinliche Verhältnis gedrückt fühlte, in welchem sie sich zu dem jungen Mann befand, der in ihr Haus gekommen war und mit dem sie kein freundliches Wort reden durfte.
Leonhard ging, Zitterlein aber nahm sogleich Gelegenheit, ihr die wenigen Worte zu verweisen, die sie sich erlaubt hatte.
»Sieh, liebe Tochter«, – sagte er – »als ich diesen Gesellen annahm, da versprach ich ihm zwanzig Groschen Wochenlohn, Essen und Trinken und eine Kammer zum Schlafen. Alles dieses habe ich ihm gegeben und vollkommen gehalten, was ich ihm versprach. Freundlichkeiten aber habe ich ihm nicht versprochen, und ich sähe es gern, wenn du die deinigen besser zu Rate hieltest. Es schneidet mir durch die Seele, wenn du ihn ansiehst, ich mögte dich schlagen, wenn du mit ihm redest.«
»Ihr verlangt das Unmögliche von mir, Vater« – erwiderte Agathe. »Ich kann doch gegen den Gesellen nicht steif und abgemessen sein, als wenn ich von Stein wäre.«
»Sollst es auch nicht!« – unterbrach sie Zitterlein. »Bewahre, wenn er dich grüßt, so dankst du ihm, wenn er sagt: es ist schönes Wetter! so antwortest du: ja wohl. Aber dann eilst du schnell in dein Zimmer zurück und setzest, wenn deine Zunge nicht ruhen kann, das Gespräch fort mit dem Kanarienvogel. Teuerste Tochter, wenn du wüßtest, welche entsetzliche Pein du mir dadurch erspartest – du würdest gewiß alles tun, was ich von dir verlange. Wird es dir denn so schwer? fühlst du dich nicht ebenso fest und unauflöslich an mich gebunden, wie ich mich an dich? Bist du nicht mein Fleisch und Blut? Mir kommst du vor, wie ein Teil meiner selbst; was du denkst und empfindest, ist mein, ich kann mein Eigentum nicht mit einem andern teilen; und auch du, Tochter, sei überzeugt, nur meine Brust versteht das Leben, welches die deinige bewegt.«
Eine Träne trat dem alten bleichen Mann ins Auge. Agathe warf sich in seine Arme. Plötzlich faßte er ihre beiden Hände, schaute ihr ins Gesicht und sagte:
»Agathe, willst du mir etwas schwören? Willst du mir schwören, dich nie einem Manne zu ergeben?«
Agathe sah ihren Vater lange an, dann legte sie ihre Hände kreuzweis vor die Brust und sprach:
»Vater, ich liebe Euch, so sehr, wie jemals eine Tochter ihren Vater geliebt hat. Das weiß der allmächtige Gott; was soll ich mehr? Ihr quält mich!«
»Schlaf wohl, liebes Kind!« – sagte Zitterlein und verließ schnell das Zimmer.
Agathe stand lange regungslos, dann trat sie ans Fenster und schaute hinaus in die Nacht. Der Mond schien hell und klar. Sie faltete die Hände und betete.
6
Es gibt Menschen, die jenen Bäumen zu vergleichen sind, welche auf fremde Stämme gepfropft werden müssen, wenn sie gedeihen sollen; auf die Art dieser fremden Stämme kommt es denn gar nicht an, sie kommen fort auf jedem, aber sie werden schlechte Früchte tragen, wenn sie sich unmittelbar aus der Erde selbst Saft und Nahrung saugen. So senken jene Menschen sich mit jeder Faser ihrer Seele in das Wesen hinein, welches sie zufällig am ersten erreichten, sei dieses ein Freund, eine Geliebte, eine Mutter, oder was es sei; sie sind glücklich und sanft, aber jenes Wesen soll sich ihnen dafür auch ganz und gar zu eigen geben, und man hat es auch wohl erlebt, daß dieses im vollsten Maße geschieht. Solch ein Mensch war der Barbier Zitterlein. Von Jugend auf still und verschlossen, hatte er beständig mit sich selbst gelebt, aber auch beständig eine innere Unbehaglichkeit empfunden, die er sich nicht zu erklären wußte, und die er, seiner Armut halber, durch Wissenschaft, auf die sein Sehnen ging und in der er Befriedigung zu finden gehofft, nicht hatte vertreiben können. Erst spät, nachdem er längst schon seine eigene kleine Wirtschaft eingerichtet, zog die Liebe in seinem Herzen ein, als er ein anspruchsloses Mädchen fand, welches ihn mit all der Innigkeit umfaßte, deren er bedurfte; nun aber liebte er auch grenzenlos, er fühlte sein eigenes Ich in der Braut und nachherigen Frau ergänzt, sie war ihm gewissermaßen ein neuer Sinn, durch welchen ihm Welt und Leben aufgingen in voller Bedeutung und Herrlichkeit. So lebte er manche Jahre mit ihr fort, heiter und in Frieden; sie gebar ihm eine Tochter, aber das Kind trug kaum dazu bei, sein Glück zu vermehren, denn seine Liebe war eine unteilbare, und die kleine Agathe erfreute ihn eigentlich nur dann, wenn er sah, daß sie die Mutter erfreute. Als das Mädchen dreizehn Jahr alt war, brach eine hitzige Krankheit in seinem Wohnorte aus; viele wurden davon ergriffen, auch Zitterleins Tochter Agathe; diese genas, aber die durch sie angesteckte Mutter starb, unter allen Erkrankten fast die einzige. Zitterlein versank in tiefe Schwermut, er schlich wie ein Schatten umher, er würde sich selbst den Tod gegeben haben, wenn er eine kräftigere Natur gewesen wäre; vor allem aber vermied er seine Tochter Agathe, in der er nichts mehr sah, als die Todesursache seines Weibes. Das arme Mädchen war sehr bemitleidenswert, in jener Periode, wo die Jungfrau sich, wie ein süßes Geheimnis, leise, leise aufschließt, wo sie der Mutter mehr, wie jemals, bedarf, lag die ihrige im Grabe, und der Vater, der jene ohnehin niemals ersetzen kann, stand ihr schroff und kalt gegenüber, wie der fremdeste Mensch. Dies konnte sie nicht ertragen, sie verzehrte sich in tiefem Schmerz, sie fiel ab und wurde krank. Zitterlein bekümmerte sich wenig um sie, er holte ihr einen Arzt, und der verschrieb seine Tropfen.
Eines Abends raffte sie ihre letzten Kräfte zusammen und stand auf; sie empfand eine wunderbare Beruhigung darin, das Grab ihrer Mutter noch einmal zu besuchen; sie hatte zum Kirchhof nicht weit und schlich sich dahin. Sie setzte sich auf dem kalten, feuchten Grabe nieder, sie faltete die Hände, sie betete: »Mutter, erscheine mir doch nur noch einmal und sage mir, was ich meinem Vater getan habe, daß er mich haßt!«
Da fühlte sie sich plötzlich heftig umschlungen, ihres Vaters Stimme rief: »Vergib mir, Tochter, vergib mir!« seine heißen Tränen benetzten ihre Wange. Er führte sie nach Hause, er setzte sich an ihr Bett, er erschöpfte sich in Aufmerksamkeiten. Einmal faßte er ihre Hand und sagte: »Agathe, der Satan hat mich verblendet, daß ich heute zum ersten Mal sehe, daß deine Mutter mir in dir noch immer nahe ist. Spricht nicht ihre Treu und Milde aus deinen Augen? Ist es nicht ihre Stimme, die so holdselig aus deinem Munde tönt? Agathe, ich bin von heute an dein Vater, sei du meine rechte Tochter!«
7
Eines Morgens, als Leonhard eben aus seiner Kammer trat, hörte er einen schweren Fall, wie vom Boden herunter; erschreckt sprang er hinzu und fand Agathe, ohnmächtig und blutend auf der Hausflur liegend. Sie hatte auf der Treppe einen falschen Tritt getan und war diese heruntergestürzt. Leonhard hob sie schnell auf, er war ganz blaß geworden und hielt sie noch in seinen Armen, als Zitterlein herzugeeilt kam. Ohne sich um den Zustand Agathens zu bekümmern, fuhr dieser den Gesellen mit rauhen Worten an: »Was solls? wer hat Euch gerufen?« Dieser erwiderte ihm im heftigsten Unwillen: »Was ich in diesem Augenblick getan habe, ist so natürlich, daß Ihr toll sein müßt, wenn Ihr etwas Auffallendes darin finden könnt. Ihr solltet, statt mich zu schelten, den Schnepper holen; seht Ihr nicht, wie Eure Tochter bleicher und bleicher wird, wie sie ganz zusammensinkt?«
»Gebt mir meine Tochter, und holt Ihr den Schnepper«, – antwortete Zitterlein – »sie hätte vorsichtiger sein sollen, dann würde sie Eurer Hülfe nicht bedurft haben!«
Dabei riß er mit Ungestüm Agathen aus Leonhards Armen. Dieser eilte schnell fort und holte den Schnepper.
»Haltet ihren Arm«, – rief er Zitterlein zu, nachdem er zurückgekehrt war – »daß ich die Ader nicht verfehle!«
Zitterlein tat es, und zum ersten Mal durfte Leonhard des Mädchens weiche, warme Hand berühren. Die seinige zitterte merklich, und als er am Ende die Ader öffnete, hatte er es wohl mehr dem Glücke, als seiner Geschicklichkeit zu danken, daß er die rechte traf. Ihr helles, rotes Blut strömte, er schaute zugleich mit Wollust und zugleich mit Grausen hinein in den rinnenden Strahl. Bald öffnete sie die Augen, und sie blickte ihn freundlich an, als sie ihn so ängstlich um sich besorgt sah. Zitterlein, ohne sich weiter um Leonhard zu kümmern, führte sie sogleich ins Wohnzimmer, um sie dort selbst zu verbinden; sie aber wandte sich an der Tür um und sagte: »Ich danke Euch, lieber Leonhard, für Eure Hülfe!«
Leonhard kehrte mit sehr gemischten Gefühlen in seine Kammer zurück. Das feindliche Entgegentreten des Alten hatte ihn besonders heute im tiefsten verletzt, aber zugleich war ihm Agathe noch niemals in einem solchen Licht der Schönheit aufgegangen, wie eben heute. Er verhehlte sich nicht länger, daß er eigentlich nur ihretwegen über acht Wochen bei seinem unheimlichen Meister ausgehalten hatte; er fühlte das Erwachen einer rasenden Leidenschaft für sie in seiner Brust, die er bekämpfen zu müssen glaubte und, wie es denn die Art und Weise des Menschen ist, in solchen Augenblicken gerade denjenigen Entschluß zu fassen, dessen Ausführung mit den größten Opfern verbunden sein würde, er entschloß sich, die Arbeit bei seinem Meister aufzugeben, und es ihm noch an demselben Abend zu sagen. Als seine Geschäfte beendigt waren und die Dämmerung anbrach, ging er in das Wohnzimmer. Zitterlein war nicht da, aber Agathe sagte ihm, der Vater werde bald zu Hause kommen, und nötigte ihn zum Bleiben. Er setzte sich ans Fenster. Agathe nahm zum ersten Mal Gelegenheit, ihn zu fragen, wie es ihm in dem Ort gefalle; sie setzte hinzu, daß der Sommer nicht ganz so langweilig verstreiche, wie der Winter, und daß die Kirmse gewiß auch ihn in den Wirbel muntrer Tänze hinein reißen werde.
»Dies« – antwortete Leonhard, indem er aus dem Fenster sah – »wird schwerlich geschehen; ich denke, in der nächsten Woche weiterzuwandern, und will dies Eurem Vater nach Handwerksgebrauch noch heute sagen.«
Agathe wurde sichtlich erschreckt, als sie dieses hörte; sie sagte:
»Das tut mir sehr leid, daß Ihr unser Haus so bald wieder verlassen wollt!«
Es tat Leonhard unendlich wohl, als er diese Worte aus Agathens Munde vernahm. Er schaute sie an. Sie stand in Gedanken. Dann trat sie auf ihn zu und sagte mit bittender Stimme:
»Tuts nicht, betrachtet meinen Vater, wie einen Kranken, habt Geduld mit ihm; ich will ihn bitten, freundlicher gegen Euch zu sein. Freilich« – setzte sie leiser hinzu – »habe ich ihn schon oft genug gebeten!«
»Habt Ihr? Agathe, habt Ihr wirklich?« fragte der Jüngling.
»Gewiß!« antwortete Agathe und errötete.
Da faßte er ihre Hand und sagte: »Agathe, bist du mir gut?«
Agathe schwieg, aber sie ließ ihm ihre Hand. Die Haustür ging auf; sie wollte ihm die Hand entziehen. Leonhard fragte noch einmal:
»Agathe, bist du mir gut?«
»Ja, ja« – antwortete sie – »aber laßt mich los, der Vater kommt ja!«
8
Es war ein kalter, stürmischer Abend, es schneite heftig; Zitterlein saß mit seiner Tochter und seinem Gesellen zu essen, als die Tür langsam aufgemacht wurde. Agathe ging hinaus, tun zu sehen, wer da sei; die Stimme eines alten Weibes wurde vernommen, welches sehr dringend um ein Nachtlager bat. Zitterlein wollte gerade aufstehen, als Agathe mit der Fremden ins Wohnzimmer trat.
»Vater« – sagte sie – »hier ist eine arme, alte Frau, die fast erstarrt ist und kein Obdach zu finden weiß. Ich habe ihr versprochen, daß sie bei uns bleiben soll.«
»Ich will ihr lieber einige Groschen geben« – antwortete Zitterlein – »damit kann sie ins Wirtshaus gehen.«
Die Alte unterbrach ihn: »Stoßt mich nicht wieder in die gräßliche Kälte hinaus, gönnt mir einen Platz hinter Eurem warmen Ofen, ich will mich morgen mit dem frühsten wieder aufmachen.«
Zugleich setzte sie sich mit der Zigeunern und reisenden Hausierweibern, zu welcher letzteren Klasse sie zu gehören schien, eigentümlichen Zudringlichkeit auf die Ofenbank, schob den Korb, den sie auf dem Rücken getragen und gleich beim Eintritt ins Haus heruntergenommen hatte, vor sich hin, und nahm einige zusammengebettelte Lebensmittel heraus, bei welcher Gelegenheit auch ein altes Spiel Karten zum Vorschein kam.
Als Zitterlein dieses erblickte, wurde er plötzlich aufmerksam. Er sagte: »Ihr seid wohl gar eine Kartenlegerin? Legt Eure Karten auf den Tisch, packt Eure Lebensmittel aber nur wieder ein; habe ich Euch einen Platz hinter meinem Ofen eingeräumt, so will ich Euch auch zu essen geben.«
»Ich danke Euch, lieber Herr« – erwiderte die Alte und blinzelte ihn an – »und wenn Ihr kein Verächter meiner edlen Kunst seid, so sollen auch die prophetischen Blätter noch heute abend reden.«
Agathe hatte ihr mittlerweile einen Teller voll warmer Suppe hingesetzt, und sie begann zu essen. Sie aß mit einer ekelhaften Gierigkeit. Zitterlein setzte das Gespräch mit ihr fort:
»Ich bin keineswegs ein Verächter Eurer Kunst; warum sollte das Schicksal, das sich des Mundes manches armseligen Käfers bedient, das sich den nächtlichen Uhu zum Herold ausersah, nicht auch durch das geheimnisvolle Spiel der Karten dem Menschen, der immer sieht und nimmer glaubt, reden? Ich weiß, was ich von Eurer Kunst zu halten