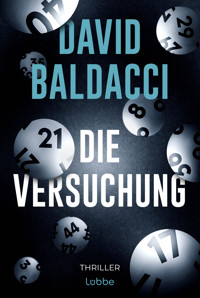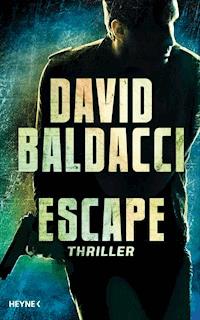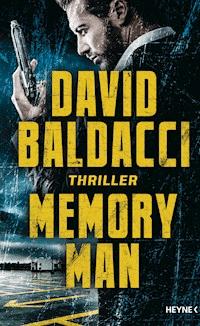
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Memory-Man-Serie
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, du kannst nie mehr etwas vergessen. Auch nicht, was du unbedingt vergessen willst.
Seit einem dramatischen Unfall kann Amos Decker nichts mehr aus seinem Gedächtnis tilgen. Eine Eigenschaft, die ihn zu einem perfekten Ermittler werden lässt. Bis seine Familie bestialisch ermordet wird und er unter der Flut der unlöschbaren Bilder fast zerbricht. Ein Jahr später taucht ein Mann auf und bekennt sich zu der Tat. Und noch während Decker verwirrt feststellt, dass der Mann lügt, findet erneut ein Massaker statt, diesmal an Deckers alter Schule. Wie hängen die Verbrechen zusammen? Wurden sie nur begangen, um Decker zu treffen? Und wird es ihm gemeinsam mit seiner früheren Kollegin gelingen, den Wahnsinn zu stoppen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DAVID BALDACCI
MEMORY MAN
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
Zum Buch
Zweimal schon hat sich das Leben von Amos Decker innerhalb eines einzigen Moments geändert. Das erste Mal, als er bei einem Footballspiel schwer am Kopf verletzt wird. Eine Folge des Hirntraumas: Er kann nie mehr etwas vergessen. Amos Decker hängt seinen Job als Profifußballer an den Nagel und wird ein genialer Ermittler. Bis das Schicksal ein zweites Mal zuschlägt: Als er eines Abends vom Dienst heimkommt, findet er seine geliebte Frau und seine kleine Tochter ermordet auf. Sein perfektes Gedächtnis wird zum Fluch, denn auch diese grauenvollen Bilder kann er nicht mehr vergessen. Sein Leben liegt in Trümmern.
Fünfzehn Monate später, als Decker sich endlich wieder halbwegs im Griff hat, erscheint ein Mann bei der Polizei und behauptet, die Morde begangen zu haben. Aber die Geschichte, die er auftischt, ist fehlerhaft – und gleichzeitig begeht ein Unbekannter ein Massaker an Deckers alter Schule. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Verbrechen? Widerstrebend nimmt Decker gemeinsam mit seiner früheren Kollegin die Ermittlungen auf. Nur so hat er die Chance, Schlimmeres zu verhindern – und vielleicht endlich mit den Geistern der Vergangenheit abzuschließen.
Zum Autor
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Memory Man
bei Grand Central Publishing / Hachette Book Group Inc., New York
Copyright © 2015 by Columbus Rose, Ltd.
Copyright © 2016 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung der Motive von shutterstock (Stokkete, symbiot)
Redaktion: Wolfgang Neuhaus
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-18213-7V003
www.heyne-verlag.de
Für Tom und Patti Maciag
Gehet hin und vergnüget euch,
ihr habt es verdient!
1
Blau. Lähmendes, bedrückendes Blau. Das war die Farbe, mit der Amos Decker die drei gewaltsamen Tode für immer in Verbindung bringen würde. Es waren Erinnerungen, die jedes Mal plötzlich und gewaltsam sein Inneres durchschnitten wie Schlachtermesser aus farbigem Licht. Er würde nie davon frei sein.
Die Observierung hatte lange gedauert und letzten Endes zu keinem Ergebnis geführt. Als Decker nach Hause gefahren war, hatte er sich darauf gefreut, ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, bevor er wieder hinaus auf die Straße musste. Er war auf die Einfahrt seines bescheidenen zweistöckigen Hauses eingebogen, das fünfundzwanzig Jahre auf dem Buckel hatte und das er mindestens genauso lange noch würde abbezahlen müssen. Der Regen hatte den Bürgersteig glatt gewaschen; als Deckers Stiefel von der Größe 48 die Pflastersteine berührt hatten, war er ein wenig gerutscht, bevor er Bodenhaftung bekam. Leise hatte er die Wagentür zugedrückt, denn er war sicher gewesen, dass zu dieser späten Stunde alle im Haus schliefen. Dann war er bedächtig zur Küchentür mit dem Fliegengitter gegangen und hatte aufgeschlossen.
Es war damit zu rechnen gewesen, dass das Haus so still dalag. Aber nicht damit, dass es zu still dalag. Nur dass Decker es in diesen Sekunden gar nicht wahrnahm (und sich später nach dem Grund dafür fragte). Ein Versagen mehr in dieser grauenhaften Nacht. Er hatte in der Küche haltgemacht und sich ein Glas Leitungswasser eingeschenkt, hatte es mit einem tiefen Schluck geleert und das Glas ins Spülbecken gestellt. Dann hatte er sich das Kinn abgewischt und war ins Nebenzimmer gegangen.
Wo er schon wieder ausrutschte. Diesmal schlug sein massiger Körper der Länge nach hin. Es war ein glattes Parkett mit Fischgrätmuster, auf dem er schon öfter ausgeglitten war. Diesmal aber stürzte er aus einem ganz anderen Grund, wie er bald feststellte. Es fiel genug Mondlicht durchs Fenster, dass er deutlich sehen konnte.
Als er die Hand hob, schimmerte sie dunkel.
Feucht. Rot.
Blut.
Verdammt, wo kam das Blut her?
Decker rappelte sich auf, um es herauszufinden.
Er entdeckte die Quelle im nächsten Zimmer. Johnny Sacks, sein Schwager. Ein großer, massiger Mann wie Decker selbst, jetzt der Länge nach ausgestreckt. Decker ging auf die Knie, beugte sich vor, bis sein Gesicht nur eine Handbreit von dem Johnnys entfernt war. Jemand hatte ihm die Kehle durchgeschnitten, von einem Ohr zum anderen. Es wäre absurd gewesen, nach einem Puls zu fühlen; es konnte keinen mehr geben. Der größte Teil von Johnnys Blut war auf den Boden geflossen.
Decker hätte in diesem Augenblick sein Handy hervorholen und den Notruf wählen können, aber er wusste es besser. Er wusste, dass man nicht an einem Tatort herumtrampeln durfte – und genau das war sein Haus nun geworden, dank des toten Johnny, der so unverkennbar durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen war. Das Haus war jetzt wie ein Museum: Man durfte nichts anfassen. Ja nichts anfassen! Deckers professionelles Ich schrie es geradezu.
Aber das war nur eine Leiche.
Deckers Blick zuckte zur Treppe. Sein Verstand löste sich plötzlich von ihm, als ihn Panik erfasste, die jede Faser seines Seins vibrieren ließ. Er fühlte tief im Bauch, dass das Leben ihm gerade alles genommen hatte, was er besaß und jemals besitzen würde.
Decker rannte los. Seine Stiefel patschten durch die Pfützen halb geronnenen Blutes.
Er zerstörte wichtige Beweise. Er berührte, was unberührt hätte bleiben sollen. Er veränderte, was niemals hätte verändert werden dürfen. In diesem Augenblick war es ihm scheißegal.
Er trug Johnnys Blut die Treppe hinauf, als er drei Stufen auf einmal nahm. Sein Atem ging keuchend, sein Herz schlug rasend schnell und heftig; es fühlte sich seltsam aufgebläht an, sodass es Decker wie ein Wunder erschien, dass es nicht den Brustkorb sprengte. Sein Verstand war wie gelähmt, doch seine Arme und Beine bewegten sich wie aus eigenem Antrieb.
Er gelangte in den Flur, prallte zuerst von der einen Wand ab, dann von der anderen, während er zur ersten Tür rechts rannte. Er holte seine Pistole gar nicht erst hervor; ihm kam nicht einmal der Gedanke, dass der Mörder noch hier sein könnte und darauf wartete, dass er, Amos Decker, nach Hause kam.
Er rammte die Tür mit der Schulter auf, schaute sich hektisch um.
Nichts.
Nein, falsch.
Decker erstarrte auf der Schwelle, als die Lampe auf dem Nachttisch schwach den nackten Fuß erhellte, der auf der anderen Bettseite auf der Matratze lag und unter dem Laken hervorragte.
Er kannte diesen Fuß. Er hatte ihn im Lauf vieler Jahre gehalten, massiert, gelegentlich auch geküsst. Er war lang und schmal, dieser Fuß, und noch immer schön geformt. Der Zeh neben dem großen war etwas länger, als er hätte sein sollen. Die blauen Äderchen um den Knöchel herum, die Schwielen unter der Fußsohle, die rot lackierten Nägel – alles war, wie es sein sollte. Sah man davon ab, dass der Fuß zu dieser Stunde nicht über der Matratze hätte hervorstehen sollen. Denn das bedeutete, dass der Rest des Körpers auf dem Boden lag.
Und warum sollte das der Fall sein?
Es sei denn …
Decker taumelte zur gegenüberliegenden Bettseite und schaute hinunter.
Cassandra Decker, von allen nur »Cassie« genannt, auch und vor allem von ihm, blickte vom Boden zu ihm hoch. Das heißt, »blicken« konnte sie eigentlich nicht mehr. Decker stolperte zwei Schritte vorwärts, blieb neben ihr stehen und ließ sich dann langsam zu der Toten hinunter, bis die Knie seiner Jeans in der Blutpfütze ruhten, die sich neben Cassies Leiche gesammelt hatte.
Ihr Blut.
Ihr Hals war unversehrt, wies keine Verletzung auf. Das war nicht die Quelle, aus der das Blut geströmt war. Es war ihre Stirn.
Eine einzige Eintrittswunde. Decker wusste, dass er es nicht hätte tun dürfen, doch er hob ihren Kopf behutsam mit dem Arm hoch und drückte ihn an seine Brust, die sich unter schweren Atemzügen hob und senkte. Ihr langes dunkles Haar breitete sich schimmernd und üppig auf seinem Arm aus. Der Punkt auf ihrer Stirn war geschwärzt und blasig von der Glut der Kugel.
Eine Kontaktwunde, der der Kuss einer Mündung vorausgegangen war, der nur eine Sekunde gedauert hatte, bevor das Projektil Cassies Leben ein Ende bereitete. Hatte sie geschlafen? War sie wach gewesen? Hatte sie die Angst ertragen müssen, ihren Mörder vor sich stehen zu sehen?
All diese Fragen schossen Decker durch den Kopf, als er seine Frau wohl zum letzten Mal in den Armen hielt.
Er legte sie dorthin zurück, wo er sie gefunden hatte, blickte hinunter auf das Gesicht, weiß und leblos, schaute auf das geschwärzte Loch auf der Stirn, das seine letzte Erinnerung an sie sein würde, ein grammatikalischer Punkt ganz am Ende.
Von allem.
Er stand auf. Seine Beine fühlten sich taub an, als er den Raum verließ und über den Flur zum einzigen anderen Zimmer hier oben taumelte.
Er öffnete die Tür nicht gewaltsam, denn er hatte jetzt keine Eile mehr. Er wusste, was er finden würde. Nur eines wusste er nicht. Noch nicht. Wie der Mörder auch sie umgebracht hatte.
Bei Johnny ein Messer. Bei Cassie eine Pistole.
Und bei Molly?
Sie war nicht im Kinderzimmer, womit das angrenzende Bad übrig blieb.
Die Deckenlampe war eingeschaltet und tauchte den Raum in helles Licht. Der Mörder hatte offensichtlich gewollt, dass Decker diese letzte Tat in allen Einzelheiten sah.
Und da saß sie, auf der Toilette. Der Gürtel ihres Bademantels war um den Spülkasten geschlungen und hielt ihre kleine Leiche, sonst wäre sie nach vorn gekippt.
Langsam ging er zu ihr, rutschte diesmal nicht aus. Es gab kein Blut. Sein kleines Mädchen hatte keine Verletzungen, die er auf den ersten Blick sehen konnte. Doch als er näher trat, sah er die Würgemale an ihrem Hals, hässlich und gefleckt, als hätte jemand sie dort eingebrannt. Vielleicht hatte der Mörder den Gürtel des Bademantels benutzt. Vielleicht auch nur die Hände. Decker wusste es nicht, und es war ihm gleichgültig. Tod durch Erwürgen war nicht schmerzlos, sondern qualvoll. Und Molly hatte dort gesessen und zum Täter hochgeschaut, während er langsam das Leben aus ihr drückte.
Molly wäre in drei Tagen zehn Jahre alt geworden. Sie hatten eine Geburtstagsfeier vorbereitet, Gäste eingeladen, Geschenke gekauft und eine Schichttorte mit Schokoladenfüllung bestellt. Decker hatte sich freigenommen, um Cassie zu helfen, weil sie Vollzeit arbeitete und so ziemlich alles im Haushalt erledigte, weil er keinen Achtstundenjob mit festen Arbeitszeiten hatte, nicht einmal annähernd. Sie hatten Witze darüber gemacht. Was wusste er schon vom wirklichen Leben? Einkaufen? Überweisungen ausfüllen? Molly zum Arzt fahren?
Nichts, wie sich herausstellte. Verdammt, nicht das Geringste. Er hatte keinen blassen Schimmer.
Decker setzte sich vor seiner toten Tochter auf den Boden und legte die langen Beine übereinander, wie sein kleines Mädchen es gern getan hatte, sodass der rechte Fuß auf dem linken Oberschenkel lag, der linke auf dem rechten Oberschenkel. Er war für einen so großen Mann sehr biegsam. Die Lotusposition, dachte er benommen. Oder so ähnlich. Er wusste nicht, warum er das dachte; er wusste nur, dass er unter Schock stand.
Mollys Augen waren weit aufgerissen und starrten zu ihm zurück, ohne ihn wahrzunehmen. Wie die Augen ihrer Mutter. Cassie und Molly würden ihn nie wieder sehen.
Decker saß einfach da, schaukelte vor und zurück und schaute seine Tochter an, ohne sie zu sehen – und weiß Gott im Himmel, sein kleines Mädchen sah seinen Daddy auch nicht.
Das war’s. Es ist nichts mehr übrig. Aber ich bleibe nicht allein zurück. Das kann ich nicht.
Decker zog die Neun-Millimeter aus dem Gürtelhalfter, bewegte den Schlitten ein Stück zurück und vergewisserte sich, dass eine Patrone in der Kammer steckte. Er legte die Hände um die Waffe. Ein schönes kleines Stück. Zielgenau und mit genug Durchschlagskraft. Mit dieser Waffe hatte er noch nie jemanden erschossen. Aber jetzt wollte er den Anfang machen. Mit sich selbst.
Er schaute hinunter auf die Laufmündung, auf Kimme und Korn. Wie oft hatte er diese Waffe auf dem Polizeischießstand abgefeuert? Tausend Mal? Zehntausend? Tja, der Schuss heute würde sitzen.
Er öffnete den Mund, schob den Lauf hinein, richtete ihn nach oben, sodass die Kugel das Gehirn durchschlagen und ihm ein schnelles Ende bereiten würde. Sein Finger fand den Abzug. Er sah zu Molly hoch – und mit einem Mal war es ihm peinlich. Er zog die Waffe wieder heraus, drückte sie gegen die rechte Schläfe und schloss die Augen, damit er seine Tochter nicht sehen konnte. Erneut glitt sein Zeigefinger zum Abzugsbügel. An ihm vorbei, zum Abzug selbst. Dann der langsame, stetige Druck bis zu dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Er würde nichts spüren. Sein Gehirn würde tot sein, bevor es dem Rest seines Körpers sagen konnte, dass sein Besitzer sich umgebracht hatte.
Er musste nur noch den Abzug betätigen.
Einfach drücken, Amos. Du hast nichts zu verlieren, weil dir nichts mehr geblieben ist. Sie sind tot. Sie sind … tot.
Er hielt die Waffe fest, fragte sich, was er zu seiner Familie sagen würde, sobald sie wieder vereint waren.
Es tut mir leid?
Vergebt mir?
Ich wünschte, ich wäre hier gewesen, um euch vor der Bestie zu beschützen, die das getan hat? Wer immer es gewesen ist? Ich hätte hier sein sollen, um euch zu retten?
Er hielt die Waffe fester, drückte das Metall so brutal an seine Schläfe, dass er spürte, wie der glatte Lauf in die Haut schnitt. Ein Blutstropfen erschien und versickerte in seinem ergrauenden Haar, das in den letzten paar Minuten noch grauer geworden war, davon war er überzeugt.
Er suchte verzweifelt nach der richtigen Balance, nach dem Gleichgewicht zwischen Mut und Selbstaufgabe. Aber konnte jemals irgendeine Ausgeglichenheit darin liegen, sich das Leben zu nehmen?
Noch mit der Waffe in der Hand holte er sein Handy hervor, wählte den Notruf, identifizierte sich mit seinem Namen und der Nummer seiner Dienstmarke und beschrieb mit zwei knappen Sätzen das Gemetzel an drei Menschen. Dann ließ er das Handy einfach fallen.
Unten war Johnny.
Den Flur entlang war Cassie.
Hier, vor ihm, war Molly.
Und plötzlich, ohne Warnung, sah er dies alles umrissen in den entsetzlichsten Schattierungen von Blau. Die Leichen, das Haus, den ganzen Abend. Diese blaue Blase – sie war überall. Er hob den Blick zur Decke und schrie einen Fluch, legte allen Zorn, allen Schmerz, alle Hoffnungslosigkeit hinein, die er in diesen Sekunden empfand. Sogar in diesem schrecklichen Augenblick stürmte das verdammte Blau auf ihn ein.
Warum konnte er nicht normal sein, nur dieses eine Mal, hier und jetzt, ein geschlagener Mann? Wieder saß er da, auf dem Boden, ein Häufchen Elend, eine Pistole auf seinen Kopf gerichtet, in dem Leid und Schmerz wüteten, während im Rest seines Körpers nichts mehr war, absolut nichts. Er war bereit zu sterben, bereit, sich zu Cassie, Molly und Johnny zu gesellen.
Doch aus irgendeinem Grund, den er selbst nicht kannte, zog Amos Decker nicht den Abzug durch.
Genau so fanden die Cops ihn, als sie vier Minuten später auftauchten.
2
Eine rot gestrichene Parkbank.
Die unangenehme scharfe Kälte des Herbstes, der in den Winter überging.
Amos Decker saß auf der Bank und wartete.
Ein Spatz sauste an ihm vorbei und wich knapp einem vorbeifahrenden Wagen aus, bevor er sich wieder in die Höhe schwang und von einer Brise fortgetragen wurde. Decker notierte im Geiste die Marke, das Modell, das Nummernschild und eine Beschreibung aller vier Insassen im Wagen. Mann und Frau vorn, der Nachzügler hinten in einem Kindersitz. Daneben ein weiteres Kind, älter, ungefähr zehn. Ein Sticker an der hinteren Stoßstange: MEIN JUNGE STEHT AUF DER LISTE DER BESTEN SCHÜLER AN DER THORNCREST ELEMENTARY.
Dann war der Wagen vorbei.
Glückwunsch, Blödmann. Du hast gerade einem Psycho verraten, wo er deinen ach so klugen Sprössling kidnappen kann.
Ein Stück entfernt rollte ein Bus an einer Haltestelle aus. Decker ließ den Blick schweifen und machte dieselben Beobachtungen: vierzehn Fahrgäste, die allesamt deprimiert und abgekämpft aussahen, obwohl erst Mittag war. Halt, nein: Einer war lebhaft, ein Kind. Es hüpfte neben seiner erschöpften Mutter herum, die vornübergebeugt dasaß, eine große, dicke Tasche auf dem Schoß. Die Fahrerin schien neu in ihrem Job zu sein, ihr Gesicht war ein Ausbund an Nervosität. Trotz der Servolenkung focht sie einen Kampf mit dem Lenkrad aus, als der Bus wieder anrollte, und nahm die nächste Kurve so langsam, dass man hätte glauben können, der Motor wäre abgesoffen.
Ein Flugzeug zog über sie alle hinweg, tief genug, dass Decker die Maschine als United 737 identifizieren konnte, ein späteres Modell, wie er an den Winglets erkannte, den nach oben gebogenen Tragflächenenden. Mit der Zahl 737 war für Decker die Farbe Silber verbunden. 737 war seiner Meinung nach eine wunderschöne Zusammenstellung: schlank, silbern, schnell wie eine Kugel. Alles, was mit einer Sieben anfing, löste diese Assoziationen in ihm aus. Deshalb gefiel es ihm, dass Boeing bei der Benennung seiner Flugzeugmodelle stets mit der Sieben anfing.
Zwei junge Männer gingen vorbei. Decker beobachtete sie, speicherte sie ab. Einer war älter, größer, der Alpha; der andere war der Sidekick und nur dabei, um ein paar Lacher zu produzieren und herumgestoßen zu werden.
Dann bemerkte er die vier Kinder, die im Park auf der anderen Straßenseite spielten. Alter, Rang, Hackordnung und Hierarchie waren bereits festgelegt, bevor sie sechs waren, wie bei einem Wolfsrudel. Gespeichert.
Danach eine Frau mit einem Hund. Ein deutscher Schäferhund. Nicht besonders alt, aber mit deutlichen Hüftproblemen. Wahrscheinlich Dysplasie, was bei dieser Rasse häufig vorkommt. Gespeichert.
Ein Mann, der in sein Smartphone quasselte. Anzug von Zegna, die ineinander verschlungenen Gs von Gucci auf den blank geputzten Schuhen, ein Stein von der Größe eines Fünfundzwanzigcentstücks in einem goldenen Ring an der linken Hand, so riesig wie ein Super-Bowl-Ring. Am rechten Handgelenk eine Zenith im Wert von 4000 Dollar. Für einen Profisportler war der Mann zu klein und untersetzt, für einen typischen Drogenhändler war er viel zu gut gekleidet. Vielleicht ein Hedgefonds-Manager. Oder ein auf Behandlungsfehler spezialisierter Anwalt. Vielleicht ein Projektentwickler auf dem Immobilienmarkt. Egal. Gespeichert.
Auf der anderen Straßenseite wurde eine alte Frau in einem Rollstuhl aus einem Rettungswagen gerollt. Die linke Körperhälfte war gelähmt, Gesichtslähmung auf derselben Seite. Schlaganfall. Gespeichert. Ihre Betreuungsperson hatte eine leichte Verkrümmung der Wirbelsäule und einen Klumpfuß. Gespeichert.
Amos Decker ließ den Blick schweifen, während sein Verstand alles speicherte, was sich vor ihm befand. Hier und da zog er Schlussfolgerungen. Manchmal spekulierte er, in anderen Fällen vermutete er lediglich. Nichts davon bedeutete irgendetwas. Es war nur das, was es war. Er schlug einfach nur die Zeit tot, während er wartete. Wie beim Malen nach Zahlen. Bloß ein Zeitvertreib.
Decker hatte sein Haus bei der Zwangsvollstreckung verloren. Selbst als ihre Welt noch in Ordnung gewesen war, hatten sie die Hypothek kaum mit seinem und Cassies Gehalt abbezahlen können. Mit seinem Einkommen allein war das unmöglich. Er hatte versucht zu verkaufen, aber wer wollte schon ein Haus, an dem Blut klebte?
Ein paar Monate hatte Decker in einem Apartment gewohnt. Anschließend in einem Motelzimmer. Als seine berufliche Situation sich änderte, war er auf die Couch eines Freundes umgezogen. Nachdem der Freund weniger freundlich geworden war, hatte er sich für eine Obdachlosenunterkunft entschieden. Als die Finanzierung auslief und der Laden dichtgemacht wurde, »verkleinerte« Decker sich auf einen Schlafsack im Park. Als der Schlafsack abgenutzt war und die Cops die Obdachlosen aus dem Park vertrieben, nahm er mit Kartons auf einem Parkplatz vorlieb.
Er war ganz unten angenommen. Aufgedunsen, starrend vor Dreck, mit verfilzten Haaren und buschigem Bart sah er aus, als hauste er in einer Höhle und versuchte, sich mit Außerirdischen gegen die Menschheit zu verschwören. Irgendwie war das der Wahrheit sogar ziemlich nahgekommen – bis er eines Morgens auf einem Walmart-Parkplatz aufwachte, auf das Logo des weltgrößten Pappenherstellers auf der Innenseite seines sich wellenden Wohnkartons starrte und die aufwühlende Erleuchtung hatte, dass Cassie und Molly sich wegen dem, was aus ihm geworden war, zutiefst schämen würden.
Also hatte er sich gewaschen, ein paar seltsame Jobs angenommen und ein paar Dollar gespart. Dann war er in ein Zimmer im Residence Inn gezogen und hatte ein Privatdetektiv-Schild an die Tür gehängt. Er nahm alle Fälle, die er kriegen konnte. Meist waren sie mies und wurden schlecht bezahlt, aber sie waren besser als nichts. Und mehr brauchte er nicht.
Er führte das unbedeutende Leben, das seiner unbedeutenden Person entsprach. Sein Bart war noch immer buschig, sein Haar noch ziemlich lang, und er brachte auch noch einiges zu viel auf die Waage, aber er war einigermaßen sauber, denn er duschte mittlerweile öfter als zweimal die Woche. Und er lebte nicht mehr in einem Karton.
Er schloss die Augen, um die jüngsten Beobachtungen auf der Straße auszublenden, obwohl alles noch da war, als wäre auf dem Inneren seiner Lider eine Kinoleinwand ausgespannt. Die Bilder würden von nun an immer dort sein, die fotografisch präzisen Erinnerungen. Oft wollte er vergessen, was er gerade eben gesehen hatte, doch alles in seinem Kopf wurde mit dauerhaften Markierungen versehen und abgespeichert. Entweder rief er es auf, wenn er es brauchte, oder es sprang ganz von selbst an die Oberfläche. Ersteres war hilfreich, Letzteres unendlich frustrierend.
Wie die Erinnerungen an jenen Abend, an dem die Cops ihm ausgeredet hatten, sich mit der eigenen Pistole eine Kugel in den Kopf zu schießen. Er hatte seitdem oft daran gedacht, sich umzubringen. So oft, dass er sich wegen dieses kleinen Problems einer Therapie unterzogen hatte, als er noch bei der Polizei gewesen war. Er hatte sogar vor einer Gruppe ähnlich gesinnter Selbstmordkandidaten gestanden.
Ich bin Amos. Ich will mich umbringen. Punkt. Ende der Geschichte.
Er schlug die Augen auf.
Fünfzehn Monate, einundzwanzig Tage, zwölf Stunden, vierzehn Minuten. Weil Decker der war, der er war, tickte die Uhr an der Vorderseite seines Verstands. Die gut fünfzehn Monate waren die Zeitspanne, die verstrichen war, seit er die drei Leichen in seinem Haus entdeckt hatte. Seit seine Familie ausgelöscht worden war. In sechzig Sekunden würden es fünfzehn Minuten plus die Monate, Tage und Stunden sein. Und so würde es weitergehen, immer weiter.
Decker schaute an sich hinunter. Nachdem er vier Jahre lang das College besucht hatte und dann kurze Zeit Footballprofi gewesen war, hatte er sich als Streifenpolizist und später als Detective fit gehalten. Aber mit Fitness hatte er sich nicht mehr befasst, nachdem er die Leichen seiner Frau, seines Schwagers und seiner Tochter offiziell identifiziert hatte. Er hatte mindestens zwanzig Kilo Übergewicht, wahrscheinlich mehr. Viel mehr. Er war ein eins fünfundneunzig großer Fettsack mit wackligen Knien, dicken Beinen, Schwabbelbauch, weichen Armen und feister Brust. Seine Wampe versperrte sogar den Blick auf seine viel zu langen Füße.
Sein Haar war ebenfalls lang, mit Grau gesprenkelt und nicht besonders sauber. Es schien perfekt geeignet, einen Verstand zu verbergen, der ihn ständig runterzog, weil er nichts vergaß. Sein Bart war aufsehenerregend, sowohl wegen seiner wuchernden Fülle als auch wegen seiner chaotischen Erscheinung. Die Büschel und Locken und einzelnen Strähnen sahen wie Adern aus, die auf der Suche nach irgendetwas waren und deshalb in alle Richtungen wuchsen. Aber er redete sich ein, dass das für seine Arbeit ganz gut war. Schließlich musste er Abschaum jagen, und der wäre nun mal kein Abschaum, wenn er aussähe wie der Durchschnitt. Oft lief Decker sogar vor solchen Leuten davon, obwohl er selbst kaum besser aussah als die meisten von ihnen.
Er berührte den fadenscheinigen Flicken auf seinen Jeans und schaute dann zu den Knien hinunter, wo noch immer die Blutflecke zu sehen waren.
Ihr Blut. Cassies Blut. Geradezu morbid, es noch immer an der Hose zu haben.
Verbrenn die Hose, Amos. Die meisten normalen Menschen hätten das längst getan. Nur, ich bin nicht normal. Ich war nicht mehr normal, seit ich den Treffer abbekommen habe.
Der Treffer. Er war das Einzige, an das Decker sich nie erinnert hatte. Die reinste Ironie, denn erst dieser Treffer hatte bewirkt, dass er jetzt nichts mehr vergessen konnte. Die Sache war damals unaufhörlich in den Sportsendungen gezeigt worden, selbst in den USA-weiten Nachrichten; den Zuschauern war genüsslich gezeigt worden, welch brutale Gewalt Decker angetan worden war. Jemand hatte ihm erzählt, der Filmschnipsel sei vor ein paar Jahren sogar auf YouTube hochgeladen und mehr als acht Millionen Mal angeklickt worden. Und doch hatte Decker den Clip nie gesehen. Das war auch nicht nötig. Er war hautnah dabei gewesen. Er hatte es zu spüren bekommen. Das reichte ihm.
Der alte Amos Decker hatte auf einem Footballfeld sterben müssen, um dieses Erdbeben an Aufmerksamkeit zu erhalten. Und das gleich zwei Mal.
Er schaute flüchtig und ziemlich verlegen an seinen Jeans hinab. Seine Wampe hing über den Bund; damals war er viel dünner gewesen. Inzwischen hatte er die Hose gewaschen, doch die Blutflecke waren nicht rausgegangen. Aber warum sollten die Jeans sich von seinem Gehirn unterscheiden? Sie hätten ein Beweisstück sein können, sein müssen. Sollten die Cops sie doch nehmen! Aber sie hatten es nicht getan, und er hatte es ihnen nicht angeboten. Er hatte sie behalten, trug sie noch immer. Das war dumm, denn es gab seinen Erinnerungen Nahrung. Wirklich dämlich. Eine schrecklich makabre Methode, einen winzigen Teil von Cassie bei sich zu behalten. Als würde er ihre Asche in einer Scooby-Doo-Butterbrotdose mit sich herumtragen.
Andererseits hatte er tatsächlich einen Dachschaden. Auch wenn er eine Bleibe und einen Job hatte und zum größten Teil funktionierte – er war wirklich nicht in Ordnung und würde nie wieder in Ordnung sein, in welcher Hinsicht auch immer.
Rein technisch gesehen war er in den Mordfällen damals ein Verdächtiger gewesen; das waren Ehemänner immer. Aber nicht lange. Der Todeszeitpunkt hatte jeden Zweifel beseitigt. Er hatte ein Alibi. Doch Alibis interessierten Decker nicht. Er wusste auch so, er hatte Cassie, Molly und Johnny kein Haar gekrümmt, und es war ihm vollkommen egal, wenn alle anderen das nicht glaubten.
Wichtig war nur, dass es wegen der Morde nie eine Verhaftung gegeben hatte. Es hatte nicht einmal Verdächtige gegeben, keine einzige Spur, der die Ermittler hätten nachgehen können.
Das Arbeiterviertel, in dem die Deckers gewohnt hatten, war ruhig. Die Leute dort waren freundlich und boten anderen jedes Mal ihre Hilfe an, weil niemand viel besaß und jeder hin und wieder Hilfe brauchte. Den Wagen oder den Backofen reparieren, einen Nagel in ein Brett schlagen, das Mittagessen kochen, weil Mom krank war, oder die Kinder irgendwo hinfahren – in solchen Dingen musste man sich auf andere verlassen können.
Es gab natürlich ein paar harte Nummern in der Nachbarschaft, aber Decker hatte keinen möglichen Mörder unter ihnen ausgemacht. Die schwarzen Schafe waren hauptsächlich Biker und Kiffer. Er hatte nachgeforscht, hatte selbst in dem Fall ermittelt, obwohl die Cops ihm offiziell gesagt hatten, er solle sich davon fernhalten. Decker hatte weitergewühlt, doch auch bei ihm hatten sich keine Spuren aufgetan, obwohl er zwanghaft gründlich vorgegangen war.
Es gab Gelegenheiten für ein solches Verbrechen, aber auch Hindernisse. Die Haustüren wurden oft nicht abgeschlossen, die Leute kamen und gingen; deshalb hatte der Täter sich ohne Weiteres Zutritt verschaffen können. Aber die Häuser standen dicht beieinander, also hätte ein Nachbar etwas hören müssen. Doch an jenem Abend hatte niemand im Haus 4305 Boston Avenue ein Geräusch gehört.
Wie konnten drei Menschen so leise gestorben sein? Ein solch brutaler, gewalttätiger Tod rief doch Angst hervor. Entsetzen, Panik, Schmerz. Hatte es keine Schreie gegeben? Keinen Kampf? Irgendetwas? Anscheinend nicht. Und der Schuss, der Cassie getötet hatte? Wie ein flüsternder Geist. Oder die gesamte Nachbarschaft hätte an diesem Abend taub, blind und stumm gewesen sein müssen.
Monate später – lange, nachdem die Spur kalt geworden und die Aussicht, den Fall aufzuklären und den Mörder zu fassen, gegen null gesunken war – hatten sie noch immer nichts. Decker hatte den Polizeidienst verlassen, weil er keinen Papierkram mehr erledigen, andere Fälle verfolgen und sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen auf dem Revier beschäftigen konnte. Seine Vorgesetzten sagten, sie bedauerten sehr, ihn gehen zu sehen, aber es bat ihn auch niemand zu bleiben. Wahrscheinlich befürchteten sie, dass er durchdrehte, zerstörerische Neigungen entwickelte und nicht mehr unter Kontrolle zu halten war.
Ihre Befürchtungen waren begründet. Denn mittlerweile war ihm alles egal.
Bis auf eins.
Ihre Gräber.
Er hatte die ganze Zeit ihre Grabstätten besucht, die er überhastet erworben hatte, denn welcher Mann und welche Frau Anfang vierzig kauften schon im Voraus Gräber für sich und ihr zehnjähriges Kind? Irgendwann aber war Decker nicht mehr hingegangen, weil er den Gedanken nicht mehr ertragen konnte, dass sie dort in der Erde lagen. Zumal er sie nicht gerächt hatte. Er hatte nichts getan, nur ihre Leichen identifiziert. Eine jämmerliche Buße dafür, seine Familie sterben zu lassen. Gott würde nicht allzu beeindruckt sein.
Aber eines stand für Decker fest: Ihr Tod musste mit seinem Beruf zu tun haben. Er hatte im Lauf der Jahre viele Kriminelle festgenommen. Einige von ihnen waren jetzt wieder draußen, andere hatten Freunde. Unmittelbar vor den Morden in der 4305 Boston Avenue hatte Decker dazu beigetragen, einen örtlichen Meth-Ring auffliegen zu lassen, der sein Bestes tat, jeden in der Gegend zu einem Süchtigen und damit zu einem guten Kunden zu machen – Junge und Alte und jede demografische Gruppe dazwischen. Diese Burschen waren übel und schreckten auch vor einem Mord nicht zurück. Sie hätten problemlos herausfinden können, wo er wohnte; er arbeitete ja nicht verdeckt. Vielleicht hatten sie ihre Rache an seiner Frau und seiner Tochter vollzogen – und an seinem Schwager, der sich den falschen Zeitpunkt ausgesucht hatte, um aus einer anderen Stadt zu Besuch zu kommen. Aber es gab nicht den geringsten Beweis gegen die Meth-Dealer. Und ohne Beweis keine Verhaftung. Kein Prozess. Keine Verurteilung. Keine Hinrichtung.
Sein Fehler. Seine Schuld. Vielleicht hatte er die Hundesöhne direkt zu seiner Familie geführt, und nun hatte er keine Familie mehr.
Die Stadt hatte Geld für ihn gesammelt. Ein paar tausend Dollar waren zusammengekommen. Sie lagen auf einem Bankkonto, das Decker nie angerührt hatte. Das Geld zu nehmen wäre ihm wie ein Verrat an den Menschen vorgekommen, die er verloren hatte. Also ließ er die Hände davon, obwohl er es gut hätte gebrauchen können. Er kam so gerade eben über die Runden. Aber mehr als so gerade eben brauchte er nicht. Von ihm selbst war auch nicht mehr als so gerade eben übrig geblieben.
Decker lehnte sich zurück und zog die Jacke straffer um sich.
Er saß nicht zufällig hier auf dieser Bank.
Es ging um einen Job.
Und als er nach links schaute, sah er, dass es an der Zeit war, sich an die Arbeit zu machen.
Er stand auf und folgte den beiden Personen, auf die er gewartet hatte.
3
Die Bar sah so ziemlich aus wie jede andere, in der Decker je gewesen war.
Dunkel, kühl, muffig, verraucht. Ein Raum, in den das Licht auf seltsame Weise einfiel und in dem alle so aussahen wie jemand, den man kannte oder kennen wollte. Oder, wahrscheinlicher, vergessen wollte. Wo jeder dein Freund war, bis er dein Feind wurde und dir ein Queue über den Schädel zog. Wo alles ganz cool war, bis die Kacke zu dampfen anfing. Wo man sich alles von der Seele trinken konnte, was das Leben mit einem getrieben hatte. Wo tausend Möchtegern-Billy-Joels einem in den frühen Morgenstunden ein Ständchen brachten.
Nur, dass ich tausend Drinks kippen könnte und niemals auch nur die beschissenste Kleinigkeit vergessen würde. Ich würde mich nur an jede Einzelheit der tausend Drinks erinnern, bis hin zur Form der Eiswürfel.
Decker setzte sich so an die Bar, dass er sich in dem großen Spiegel hinter den Flaschenbatterien sehen konnte.
Er bestellte ein Bier vom Fass für einen Dollar, umklammerte den Krug mit seinen fleischigen Händen und starrte in den Spiegel. Die Ecke rechts hinten. Da hatten sie Platz genommen – das Pärchen, dem er in diese Bar gefolgt war.
Der Mann war in den Vierzigern, die Frau ungefähr halb so alt. Der Mann hatte sich in Schale geschmissen. Dreiteiliger Nadelstreifenanzug, gelbe Krawatte mit blauen Tupfen, die aussahen wie Spermien auf dem Weg zu einer Eizelle, die sie befruchten wollten, stutzerhaftes, dazu passendes Taschentuch. Das zurückgekämmte Haar enthüllte eine breite, kantige Stirn – attraktiv bei einem Mann, bei einer Frau weniger, aber das Leben war in dieser Hinsicht immer schon unfair gewesen. Protzige Brillantringe an den manikürten Fingern. Wahrscheinlich gestohlen. Oder falsch. Genau wie der Typ selbst. Vermutlich waren auch seine Zehennägel von einem Fußpfleger bearbeitet worden. Seine Schuhe waren blitzblank gewienert, aber er hatte die Fersen vergessen. Sie waren abgewetzt, was der wahren Natur des Mannes schon viel näher kam. Ein Typ, der nur auf dem Weg hinein beeindrucken wollte, nicht auf dem Weg hinaus. Wenn er erst gegangen war, würde man ihn nie wieder sehen.
Die Frau hatte die Augen eines Rehs, wahrscheinlich auch die Intelligenz. Sie war hübsch auf nichtssagende »Hab ich irgendwie schon tausend Mal gesehen«-Weise. Als würde man sich einen 3-D-Film ohne 3-D-Brille anschauen. Irgendetwas fehlte. Die Lady war so blind vertrauensvoll und selbstvergessen, dass man am liebsten gehen und sie ihrem Schicksal überlassen wollte.
Aber Decker wurde dafür bezahlt, genau das nicht zu tun. Eigentlich wurde er sogar dafür bezahlt, das Gegenteil zu tun.
Sie trug einen Rock, eine Bluse und eine Jacke, die wahrscheinlich mehr gekostet hatten als Deckers Wagen. Besser gesagt, der Wagen, der ihm mal gehört hatte. Die Bank hatte sich auch den geholt, wie Banken es gern tun, wenn sie die Gelegenheit haben.
Sie kam aus einer Familie mit altem Geld und war so sehr an ein privilegiertes Leben gewöhnt, dass sie beim besten Willen nicht begreifen konnte, warum jemand viel daransetzen sollte, ihr etwas wegzunehmen, was sie für selbstverständlich hielt. Diese Geisteshaltung machte sie an jedem Tag ihres Lebens rund um die Uhr zu einem potenziellen Opfer.
So auch in diesem Augenblick: der Hai und das Dummchen. Decker sah ihn als Sechs, eine schmutzige Zahl in seiner Vorstellung. Sie war eine Vier, harmlos und uninteressant.
Sie berührten sich mit den Händen, dann mit den Lippen. Sie bestellten Drinks – er einen Whisky Sour, sie einen Pink Martini.
Das passt, dachte Decker, nippte an seinem Bier und wartete. Er betrachtete das Pärchen unauffällig, ohne dass sie es bemerkten. Zusätzlich zu dem Zahlenschildchen war die Frau für ihn gelb umrissen, der Mann lila – die Farbe, die Decker mit Null assoziierte, einer unerwünschten Ziffer. Also stellte der Kerl in Wirklichkeit zwei Zahlen für ihn dar – Sechs und Null. Das klingt kompliziert, aber Decker brachte es problemlos auf die Reihe, weil es in seinem Kopf so klar war wie ein Spiegelbild.
Es war ja nicht so, dass er die beiden genau in diesen Farben sah. Es war die Wahrnehmung dieser Farben. Das war die beste und einzige Möglichkeit, diesen Eindruck zu erklären. Er hatte das ja nicht in der Schule gelernt. Außerdem hatte er diese Entdeckung relativ spät gemacht. Also konnte er nicht mehr tun, als sein Bestes zu geben. Schließlich hatte er die Welt der Wachsmalstifte bereits im Kindergarten hinter sich gelassen.
Sie machten weiter mit ihrem Liebesgeplänkel, dem Händchenhalten, Füßeln, den maßvollen Petting-Spielchen am frühen Nachmittag. Die Frau wollte offensichtlich mehr. Nur dass der Mann noch nicht bereit war, es ihr zu geben. Und das musste er ihr irgendwie verständlich machen. Schließlich führte es zu nichts, so etwas zu überstürzen. Und dieser Kerl war gut. Nicht der Beste, den Decker je gesehen hatte, aber brauchbar. Wahrscheinlich hatte er ein ganz anständiges Einkommen.
Für eine purpurne Null.
Decker wusste, dass der Typ nur auf seine Chance lauerte, die Kleine anzugehen. Um ein Darlehen für ein Geschäft vielleicht, das er sich nicht entgehen lassen durfte. Oder wegen einer Tragödie im erweiterten Kreis seiner Familie, die seinen finanziellen Beistand erforderte, den er nicht leisten könne. Er wolle sie wirklich nicht um Geld angehen, verabscheue sich sogar dafür. »Aber du bist meine letzte Chance. Ich erwarte nicht, dass du verstehst oder sogar zustimmst …« In diese Richtung würde das Gespräch gehen, und was für eine Antwort konnte die Frau schon geben außer: »Schon gut, mein Schatz. Was ist denn schon Geld? Nimm das Doppelte. Meinetwegen auch das Dreifache. Daddy wird es nicht vermissen. Es ist schließlich nur Geld. Sein Geld.«
Eine Stunde und zwei weitere Pink Martinis später brach sie auf. Ihr Abschiedskuss war zärtlich, ja leidenschaftlich, und der Typ reagierte genau richtig. Bis die Kleine sich zur Tür drehte. In diesem Augenblick veränderte sich sein Gesicht. Aus dem Ausdruck von Zärtlichkeit und Liebe wurde eine Miene des Triumphs, vielleicht sogar der Grausamkeit.
Decker mochte es nicht, auf Menschen einzuwirken. Er zog seine eigene Gesellschaft vor. Er hasste müßige Konversationen, weil er deren Sinn nicht mehr einsah. Aber was jetzt kam, gehörte nun mal zu dem, was er von Berufs wegen tat. So verdiente er sein Geld. Bring es hinter dich, sagte er sich. Denn es war an der Zeit, die Kontrolluhr zu stechen.
Der Mann wandte sich zum Gehen. Decker trug sein Bier gerade noch rechtzeitig zu seinem Tisch hinüber, um eine schwere Hand auf seine Schulter zu legen und ihn auf den Stuhl zurückzudrücken.
Decker setzte sich dem Mann gegenüber, schaute auf den Whiskey Sour, den der Typ nicht angerührt hatte – Raubtiere tranken während der Arbeit nicht –, und hob dann wie zum Zuprosten den Bierkrug.
»Gut gemacht. Ich schaue einem echten Profi gern bei der Arbeit zu.«
Zuerst sagte der Mann nichts. Er musterte Decker, schätzte dessen ungepflegte Erscheinung ab und wirkte auf unangenehme Weise beeindruckt.
»Kenne ich Sie?«, fragte er schließlich mit abfälligem Beiklang. »Ich wüsste allerdings nicht, wie das möglich sein sollte.«
Decker seufzte. Er hatte etwas Originelleres erwartet. Nun ja, es sollte wohl nicht sein.
»Nein«, sagte er, »und Sie müssen mich auch nicht kennen. Sie müssen sich nur die hier mal anschauen.«
Er zog den Umschlag aus seiner Jackentasche und schob ihn zu dem Mann hinüber.
Der zögerte, nahm ihn dann aber.
Decker trank einen Schluck von seinem Bier. »Machen Sie ihn auf.«
»Warum sollte ich?«
»Okay, dann lassen Sie’s. Ich hab kein Problem damit.«
Decker wollte den Umschlag wieder an sich nehmen, aber nun zog der Kerl ihn zu sich, sodass Decker nicht mehr herankam. Der Mann öffnete ihn und nahm das halbe Dutzend Fotos heraus.
»Hören Sie zu, Kumpel«, sagte Decker. »Keine Spielchen am Rande, wenn Sie einen Job durchziehen. Das ist die erste Regel für Betrüger. Als ich vorhin sagte, Sie wären Profi, war das wohl doch ein bisschen übertrieben.«
Er streckte die Hand aus und tippte auf das oberste Foto. »Diese Kleine hier hat so gut wie nichts an, und Sie auch nicht. Eine so heiße Nummer ist in so ziemlich allen Bundesstaaten südlich der Mason-Dixon-Linie verboten.«
Der Mann sah auf. In seinem Blick lag jetzt Vorsicht. »Woher haben Sie die Fotos?«
Wieder war Decker von der Frage enttäuscht. »Es ist bloß eine Verhandlungssache. Ich bin befugt, Ihnen fünfzigtausend Mäuse zu geben. Im Gegenzug schreiben Sie die Kleine ab und ziehen zu einer anderen weiter. In einem anderen Staat.«
Der Mann lächelte und schob das Foto zurück. »Warum haben Sie ihr die Fotos nicht gezeigt, wenn Sie glauben, das wäre ein echtes Problem für mich? Warum sind Sie hier und bieten mir einen finanziell lukrativen Ausweg an?«
Decker seufzte zum zweiten Mal und war zum dritten Mal enttäuscht. Der Typ war einfach keine Herausforderung.
Er sammelte die Fotos ein und steckte sie in den Umschlag zurück.
»Sie denken wie ich, Kumpel. Genau das habe ich dem alten Herrn von der Kleinen auch gesagt. Danke, dass Sie meine Meinung bestätigt haben. Das Mädchen ist übrigens sehr religiös. Was Sie mit der Dame auf dem dritten Foto anstellen, lässt den Deal sowieso platzen, ganz abgesehen davon, dass sie Ihre Ehefrau ist. Schönen Tag noch.«
Decker stand auf, doch der Typ ergriff seinen Arm. »Ich kann Ihnen Scherereien machen.«
Decker packte die Finger des Mannes und bog sie nach hinten, bis er aufstöhnte. Da – und erst da – ließ Decker los.
»Ich bin ein Fettsack«, sagte er, »aber ich bin so stark wie zwei von Ihrer Sorte und viel gemeiner. In meinem Job brauche ich kein hübsches Gesicht. Sie schon. Wenn wir jetzt also vor die Tür gehen, und ich geb Ihnen was auf die Fresse, ist das gar nicht gut für Ihren zukünftigen Cashflow. Verstehen Sie, worauf ich hinauswill?«
Der Mann hielt sich die verletzte Hand und wurde blass. »Ich nehme das Geld.«
»Toll. Ich habe den Scheck über fünfundzwanzig Riesen dabei.«
»Sie haben fünfzigtausend gesagt!«
»Die hätte es nur gegeben, hätten Sie auf der Stelle gespurt. Das haben Sie nicht. Also schrumpft Ihr Ertrag um die Hälfte.«
»Du Arschloch!«
Decker setzte sich wieder und zog einen kleineren Umschlag aus der Tasche. »Das Ticket. Einfacher Flug. So weit weg, wie es nur geht, ohne dass Sie die USA verlassen. Abflug in drei Stunden. Sie müssen an Bord sein, damit der Scheck eingelöst wird. Und machen Sie keine Dummheiten. Meine Auftraggeber haben Leute beauftragt, die alles bestätigen müssen.«
»Wo ist der Scheck?«, fragte der Typ.
Decker holte ein weiteres Blatt Papier hervor und schob es zu dem Kerl hinüber. »Zuerst müssen Sie das hier unterschreiben.«
Der Mann warf einen Blick darauf. »Aber das …«
»Es gewährleistet, dass die Lady nie wieder an Sie denken wird, zumindest nicht im Guten. Was wiederum bedeutet, dass Sie bei ihr abblitzen werden, falls Sie noch mal versuchen sollten, zu ihr zurückzukriechen.«
Der Mann dachte darüber nach, was hier gerade abging und was es wirklich zu bedeuten hatte. »Also wollen Sie mich mit den Fotos erpressen? Und damit, dass ich verheiratet bin? Um mich auf diese Weise zu bewegen, diesen Wisch hier zu unterschreiben? Und wenn ich nicht unterschreibe, werden Sie ihr die Fotos zeigen und ihr erzählen, dass ich verheiratet bin? Im Vertrauen darauf, dass das genügt, damit die Kleine mich nicht mehr mit der Kneifzange anfasst?«
»Was für ein Genie Sie doch sind.«
Der Mann schnaubte. »Ich habe Dutzende wie diese Schnalle an der Hand. Und jede von denen sieht besser aus. Die Kleine wollte, dass ich mit ihr bumse. Ich habe das immer wieder hinausgezögert. Sie haben die Fotos gesehen. Zu Hause habe ich ein Filet mignon. Warum sollte ich mich da mit einem Hamburger begnügen, selbst wenn er mit einem Treuhandfonds daherkommt? Sie ist eine dumme Kuh, die nur an guten Tagen einigermaßen annehmbar aussieht, trotz all dem Geld von Daddy.«
»Mr. Marks hat Sie aus einer Meile Entfernung kommen sehen, auch wenn seine kleine Jenny das nicht geschafft hat. Andererseits wurde Jenny ja schon von Abschaum wie Ihnen ausgenommen. Sie hat was Besseres verdient.«
Decker kannte Jenny Marks nicht, und ihre romantischen Techtelmechtel hätten ihm gleichgültiger nicht sein können. Er hatte den Kommentar nur von sich gegeben, weil dieser Schleimscheißer weitermachen sollte. Er musste ihn am Reden halten. Er sollte sich alles von der Seele quasseln.
»Sie hat etwas Besseres verdient? Scheiße, ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt so viel Mühe mit dieser Pussy mache. Ich krieg was Besseres als Jenny Marks, ohne mich anstrengen zu müssen. Und dann müsste ich mir nicht mehr ihr Kleinmädchen-Geplapper zuhören.«
»Schnalle? Pussy? Kleinmädchen-Geplapper? Mann, die Lady hat einen Collegeabschluss.« Decker hatte schon mehr, als er brauchte, aber er fand allmählich Spaß an der Sache.
»Ich habe mich falsch ausgedrückt. Jenny ist keine dumme Pussy. Sie ist eine gottverdammte Irre.«
Okay, Schluss mit lustig.
Decker nahm das nicht unterzeichnete Schriftstück und schob es zu den Fotos in den Umschlag. Dann steckte er den Umschlag zurück in die Jackentasche.
»He, was soll das?«, fragte der Mann ungläubig.
Als Antwort holte Decker einen kleinen Digitalrekorder hervor und drückte den Abspielknopf.
»Es wird Jenny bestimmt sehr gefallen, was Sie so über sie reden«, sagte er. »Übrigens, was für einen Hamburger meinen Sie? Reines Rindfleisch? Kontrollierte biologische Zucht? Vielleicht sogar eins von diesen seelenlosen Soja-Dingern?«
Der Mann saß da und schaute drein, als hätte ihn der Blitz getroffen.
Decker steckte den Rekorder ein und schob dem Typen das Hinflug-Ticket zu. »Das dürfen Sie behalten. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie in der Maschine sitzen. Der nächste Bursche, den man Ihnen schickt, ist noch größer als ich und noch mieser drauf, und dann werden nicht nur Ihre Finger knacken, sondern Ihr dürrer Arsch.«
»Wollen Sie mir etwa sagen«, fragte der Mann kläglich, »dass ich gar kein Geld bekomme?«
Decker stand auf und grinste. »Was für ein Genie Sie doch sind.«
4
Decker saß auf dem Bett in seiner Einzimmerwohnung von der Größe einer Gefängniszelle. Für Gespräche mit Kunden nutzte er einen Tisch im Speiseraum des Residence Inn; seine Monatsmiete schloss ein tägliches Frühstücksbuffet mit ein. Mit diesem Arrangement machten sie bei Decker eindeutig ein Verlustgeschäft, denn er schnappte sich manchmal ganze Platten vom Buffet und trug sie zu seinem Tisch. Er hätte einen Bagger statt einer Gabel nehmen können.
Er hatte seinen Scheck von Mr. Marks’ Boten bekommen. Ein Kumpel bei der Polizei hatte ihn dem schwerreichen Marks empfohlen; Decker sei der Richtige, sich um die delikate Angelegenheit mit seiner Tochter zu kümmern, die sich immer in den Falschen verliebte. Decker selbst hatte Marks nie getroffen, nur seine Laufburschen, aber das war schon okay, denn er bezweifelte, dass Marks es gern gesehen hätte, wenn ein Penner wie er die kostbaren Möbel verschandelte.
Decker hatte Marks’ Boten im Frühstücksraum getroffen – zwei junge Burschen in Tausenddollaranzügen, die sich weigerten, den Kaffee auch nur zu probieren. Wahrscheinlich standen sie mehr auf doppelte Espressos, die eine dieser dämlichen kleinen Maschinen ausspuckte, die von einem original italienischen Barista bedient wurden. Decker entnahm ihren Mienen, dass sie genau wussten, wie gut sie es hatten und wie beschissen Decker dran war. Er hatte bei dem Treffen sein bestes Hemd getragen, also das andere.
Daddy Marks hatte ihm bis zu hundert Riesen bewilligt, um die Bürde mit seinem kleinen Mädchen und ihrem Freier loszuwerden. Nachdem Decker sich den Betrüger angesehen hatte, ließ er die Laufburschen wissen, er schaffe das für wesentlich weniger. Und das war ihm auch gelungen. Für den Preis eines einfachen Flugtickets. Peanuts. Man hätte meinen sollen, Daddy Marks hätte ihm als Bonus zumindest einen kleinen Prozentsatz der sechsstelligen Summe zukommen lassen, die Decker ihm erspart hatte, aber Marks hatte sich genau an ihre Vereinbarung gehalten, und Decker hatte bloß seinen Stundensatz erhalten, wenngleich er den beträchtlich aufgestockt und sich damit einen schönen Zahltag verschafft hatte. Aber ein paar Prozent wären nicht übel gewesen. Na ja, so blieben die Reichen nun mal reich.
Aber einen Betrüger zu betrügen war die Sache auf jeden Fall wert gewesen. Und Decker ging davon aus, dass Jenny Marks in ein paar Monaten wieder in derselben Lage sein würde, sodass er erneut einen Anruf bekam. Vielleicht sollte er Daddy Marks dann um einen Vorschuss bitten.
Er verließ sein Zimmer und machte sich auf den Weg durch die Lobby zum Speiseraum des Hotels. Es war noch früh, und er war der Einzige dort, abgesehen von der achtzigjährigen June, die ihre goldenen Jahre genoss, indem sie am Buffet fettige Bratkartoffeln auf ihren Teller schaufelte.
Nachdem auch Decker sich den Teller gefüllt hatte, setzte er sich an seinen Stammtisch, um zu essen. Er hatte die Gabel gerade zum ersten Mal in den Mund geschoben, als er sie hereinkommen sah.
Sie musste jetzt zweiundvierzig sein, genauso alt wie er, sah aber älter aus. Offenbar spielte der Job ihr übel mit. Bei ihm war es genauso gewesen.
Er senkte den Blick auf die Gabel und streute viermal Salz über alles und jedes auf seinem Teller, einschließlich der Pfannkuchen. Dabei hoffte er, dass er trotz seiner beträchtlichen Größe hinter einer Wand aus Proteinen und Kohlehydraten zusammenschrumpfte und unsichtbar wurde.
»Hallo, Amos.«
Tja, hat wohl nicht geklappt.
Er schob sich eine Gabel mit Rührei, Maisgrütze, Schinken, Bratkartoffeln und Ketchup zwischen die Lippen, kaute mit offenem Mund und hoffte, dass der Anblick sie dazu bewegen würde, auf der Stelle umzudrehen und dorthin zurückzukehren, woher sie gekommen war.
Aber das Glück hatte er nicht.
Sie setzte sich ihm gegenüber. Sie war klein, genau wie der Tisch, im Unterschied zu Decker, der durch seine bloße Anwesenheit fast den ganzen Tisch in Beschlag nahm.
»Wie geht es dir?«, fragte sie.
Er stopfte sich noch mehr Essen in den Mund und schmatzte. Er schaute nicht hoch. Was für einen Sinn hätte das gehabt? Sie hatte nichts zu sagen, was er hören wollte.
»Ich kann das aussitzen, wenn du es so haben willst«, sagte sie. »Ich habe alle Zeit der Welt.«
Schließlich schaute er sie an. Sie war dünn wie eine Bohnenstange wegen der Zigaretten und des Kaugummis, das sie immer als Ersatz für Essen und Trinken benutzte. Er verdrückte bei dieser einen Mahlzeit wahrscheinlich mehr Nahrung als sie in einem Monat.
Ihr Haar war käsig blond, ihre Haut faltig und fleckig. Ihre Nase war schief – manche behaupteten, wegen einer Begegnung mit einem streitsüchtigen Betrunkenen, als sie noch Streifenpolizistin gewesen war. Ihr kleines, spitzes Kinn schien von einem überproportional großen Mund in den Hintergrund gedrängt zu werden, in dem unregelmäßige, vom Nikotin fleckige Zähne wie Fledermäuse in ihrer Höhle lauerten.
Man vergaß sie nicht so schnell. Aber das lag nicht an ihrem Aussehen. Sie war nicht hübsch. Nein, es lag daran, dass sie der erste weibliche Detective im Burlington Police Department gewesen war. Soweit Decker wusste, war sie noch immer die Einzige. Und sie war seine Partnerin gewesen. Sie beide hatten mehr Verhaftungen vorgenommen, die zu Verurteilungen geführt hatten, als jeder andere in der Geschichte des Departments. Einige in der Truppe fanden das großartig. Andere waren der Ansicht, sie nähmen sich zu wichtig. Starsky und Hutch, hatte ein Rivale sie mal genannt. Decker hatte nie herausgefunden, wer von ihnen beiden er sein sollte, der Blonde oder der Brünette.
»Hallo, Mary Suzanne Lancaster«, sagte er.
Sie lächelte und versetzte ihm einen spielerischen Stoß gegen die Schulter. Er zuckte leicht zusammen und gab den Schlag nicht ganz so behutsam zurück, doch Mary schien es überhaupt nicht zu bemerken. »Ich wusste gar nicht, dass du sogar meinen zweiten Vornamen kennst.«
Er schaute auf seinen Teller. Sein begrenzter Vorrat an Small Talk war ziemlich erschöpft.
Mary musterte ihn. Als sie fertig war, schien sie sich insgeheim einzugestehen, dass sämtliche Berichte, Decker sei ganz unten angelangt, hundertprozentig zutrafen.
»Ich werde dich nicht fragen, wie es dir ergangen ist, Amos. Nicht so gut, das sehe ich auch so.«
»Immerhin wohne ich hier im Hotel«, sagte er, »nicht mehr in einem Karton.«
»Tut mir leid«, entgegnete sie verlegen. »So habe ich es nicht gemeint.«
»Was willst du? Ich hab einen vollen Terminkalender.«
Mary nickte. »Das glaube ich dir gern. Ich bin vorbeigekommen, weil ich mit dir sprechen wollte.«
»Woher wusstest du, dass du mich hier findest?«
»Vom Freund eines Freundes.«
»Hätte nicht gedacht, dass du so viele Freunde hast«, sagte Decker. Es war nicht spaßig, und er lächelte auch nicht.
Mary – in der Hoffnung, das Eis zu brechen – zwang ein Kichern hervor, schien dann aber zu begreifen, dass es ziemlich dumm war. »Tja, ich bin auch Detective. Wenn es sein muss, kann ich manche Dinge herausfinden. Und Burlington ist ja nicht sooo groß. Es ist nicht New York. Oder L. A.«
Decker schmatzte erneut, schaufelte eine Gabel Frühstück hinterher und schwieg.
Mary schien zu spüren, dass er sich zurückzog. »Tut mir leid, was dir passiert ist. Du hast viel verloren, Amos. Das hast du nicht verdient. So etwas hat niemand verdient.«
Er schaute sie an, um festzustellen, ob sich in ihrem Blick irgendein Gefühl spiegelte. Auf Mitgefühl jedenfalls konnte er verzichten. Er hatte es nie gesucht, hauptsächlich, weil sein Verstand nicht viel damit anfangen konnte. Zumindest nicht mehr. Mitgefühl und sein noch schlimmerer Vetter, Mitleid, gehörten nicht mehr zu seinem Repertoire.
Vielleicht spürte Mary, dass sie ihn schon wieder zu verlieren drohte, denn sie fügte rasch hinzu: »Außerdem wollte ich dir etwas sagen.«
Sein Blick glitt über sie hinweg, von Kopf bis Fuß. Dann sagte er, weil er nicht anders konnte: »Du bist dünn geworden. Du hast locker fünf Kilo verloren, was du dir aber nicht leisten kannst. Und du leidest möglicherweise unter Vitamin-D-Mangel.«
»Wie kommst du darauf?«
»Du gehst wie auf Stelzen. Ganz steif. Schmerzende Knochen sind ein klassisches Symptom.« Er deutete auf ihre Stirn. »Und du schwitzt, obwohl es draußen kalt ist. Noch ein Symptom. Außerdem hast du in der kurzen Zeit, die du hier sitzt, die Beine fünfmal übereinandergeschlagen. Probleme mit der Blase. Ein weiterer Klassiker.«
Sie runzelte die Stirn bei dieser sehr persönlichen Einschätzung. »Studierst du jetzt Medizin, oder was?«, entgegnete sie leicht verärgert.
»Als ich vor vier Jahren beim Zahnarzt warten musste, habe ich einen Artikel gelesen.«
Sie tippte sich an die Stirn. »Ich vermute, ich komme nicht genug an die Sonne.«
»Und du rauchst wie ein Schlot, was auch nicht gerade hilfreich ist. Versuch’s mit einem Vitaminpräparat. Vitamin-D-Mangel hat schlimme Folgen. Und hör mit den Zigaretten auf. Da hilft ein Nikotinpflaster.« Er senkte den Blick und schaute auf das, was ihm bereits aufgefallen war, als Mary sich gesetzt hatte. »Deine linke Hand zittert ziemlich stark.«
Mary hielt ihre linke Hand mit der rechten fest und rieb unbewusst über die Stelle. »Ist nur eine Nervensache.«
»Aber du schießt mit der linken Hand. Vielleicht solltest du das mal untersuchen lassen.«
Sie schaute auf die leichte Ausbeulung auf der rechten Seite ihrer Jacke. Dort, am Hosenbund, steckte ihre Pistole in einem Halfter.
Dann lächelte sie. »Willst du mir noch ein paar Sherlock-Holmes-Folgerungen an den Kopf werfen? Möchtest du meine Knie untersuchen? Dir meine Fingernägel ansehen? Mir sagen, was ich zum Frühstück gegessen habe?«
Er trank einen großen Schluck Kaffee. »Lass es lieber untersuchen. Könnte ja auch was anderes sein. Mehr als nur ein Zittern. Schlimme Erkrankungen fangen oft in den Händen und den Augen an. Das ist ein Frühwarnsystem, wie ein Kanarienvogel in einem Kohlebergwerk. Außerdem steht nächsten Monat wieder die routinemäßige Waffeneignungsuntersuchung an. Ich bezweifle, dass du sie bestehst, wenn deine Hand verrücktspielt.«
Ihr Lächeln verblasste. »Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich gehe zum Arzt. Danke, Amos.«
Er schaute auf seinen Teller und atmete tief durch. Er war fertig, wartete nur darauf, dass sie ging. Vielleicht, wenn er am Tisch einschlief? Decker schloss die Augen.
Mary spielte müßig mit den Knöpfen ihrer Jacke. Warf Decker einen Blick zu. Bereitete sich auf das vor, weshalb sie in Wirklichkeit hergekommen war. Was sie ihm in Wahrheit sagen wollte.
»Wir haben eine Verhaftung vorgenommen, Amos. In deinem Fall.«
Decker schlug die Augen auf. Und hielt sie offen.
5
Decker legte die Hände auf den Tisch.
Mary sah, dass sie sich zu Fäusten ballten und der Daumen so fest am Zeigefinger rieb, dass er eine weiße Spur hinterließ.
»Sein Name?«, fragte Decker und starrte auf das wabbelige Rührei, das er nicht angerührt hatte.
»Sebastian Leopold. Ein ungewöhnlicher Name, ich weiß. Aber den hat er uns genannt.«
Decker schloss erneut die Augen und schaltete ein, was er seinen »Festplattenrekorder« nannte – eine der positiven Konsequenzen dessen, was aus ihm geworden war. Die Einzelbilder huschten so schnell an seinen Augen vorbei, dass sie kaum zu unterscheiden waren, aber er konnte trotzdem alles sehen. Doch er beendete seine geistige Übung ohne jeden Treffer. Er öffnete die Augen, schüttelte den Kopf. »Nie von ihm gehört. Du?«
»Nein. Vielleicht ist es nicht sein richtiger Name.«
»Kein Ausweis? Keine Papiere?«
»Nichts. Leere Taschen. Ich glaube, er ist obdachlos.«
»Habt ihr seine Fingerabdrücke überprüft?«
»Wir sind noch dabei. Bislang keine Treffer.«
»Wie seid ihr auf ihn gekommen?«
»Das war der einfache Teil. Er hat sich gestellt. Kam um zwei Uhr heute Morgen ins Revier. Die reibungsloseste Festnahme, die wir je gemacht haben. Ich komme gerade eben von einem Verhör mit ihm.«
Decker blickte Mary durchdringend an. »Nach fast sechzehn Monaten spaziert der Bursche hier rein und gesteht einen Dreifachmord?«
»Ich weiß. Das passiert nicht jeden Tag.«
»Sein Motiv?«
Mary schaute unbehaglich drein. »Ich bin nur vorbeigekommen, um dich aus reiner Höflichkeit vorzuwarnen, Amos. Es ist eine laufende polizeiliche Ermittlung. Du weißt, was das bedeutet.«
Er beugte sich vor, fast über den gesamten Tisch hinweg. So ruhig, als würde er Mary nach dem Wetter fragen, wiederholte er: »Das Motiv?«
Sie seufzte, zog einen Streifen Kaugummi aus der Tasche, bog ihn halb durch und steckte ihn sich in den Mund. »Leopold behauptet, du hättest ihn mal zur Schnecke gemacht«, sagte sie, nachdem sie dreimal schnell gekaut hatte. »Ihm ans Bein gepinkelt. Ihn runtergemacht. Ihn gedisst.«
»Wann? Wo?«
»In einem 7-Eleven. Ungefähr einen Monat, bevor er … na ja, bevor er getan hat, was er getan hat. Der Mann ist anscheinend furchtbar sauer auf dich. Unter uns gesagt, ich glaube, er ist nicht ganz dicht.«
»In welchem 7-Eleven?«
»Bitte?«
»In welchem 7-Eleven?«
»Das bei dir in der Gegend, glaube ich.«
»An der DeSalle und Fourteenth?«
»Er sagte, er sei dir nach Hause gefolgt. Deshalb wusste er, wo du wohnst.«
»Also ist er obdachlos, hat aber einen Wagen? Denn ich bin nie im Leben zu Fuß zu diesem 7-Eleven gegangen.«
»Er ist jetzt obdachlos. Ich weiß nicht, wie es damals war, Amos. Er ist einfach ins Revier marschiert. Es sind noch viele Fragen offen.«
»Polizeifoto.« Es war keine Frage. Wenn der Mann verhaftet worden war, hatten sie ein Foto von ihm machen und ihm die Fingerabdrücke abnehmen müssen.
Mary hielt ihr Handy hoch und zeigte es ihm. Auf dem kleinen Bildschirm war das Gesicht eines Mannes. Es war sonnenverbrannt und schmutzig, das Haar eine wirre Mähne, der Bart ungepflegt und wuchernd. Was das anging, sah Leopold aus wie Decker.
Er schloss die Augen, schaltete seine interne Festplatte wieder ein. Aber auch diesmal gab es keine Treffer. »Ich hab ihn noch nie gesehen.«
»Tja, vielleicht sieht er jetzt anders aus.«
Decker schüttelte den Kopf. »Wie alt?«
»Schwer zu sagen. Und er hat keine Angaben gemacht. Vielleicht Anfang vierzig.«
»Wie groß?«
»Eins achtzig. Um die achtzig Kilo.«
»Schlank oder fett?«
»Schlank. Drahtig sogar, soweit ich sagen kann.«
»Mein Schwager hatte meine Größe, war Bauarbeiter und hätte ein Armdrücken mit einem Lastwagen gewonnen. Wie konnte dieser Leopold ihn im Kampf Mann gegen Mann besiegen?«
»Das ist Teil der Ermittlung, Amos. Ich kann es nicht sagen.«
Er schaute ihr wieder in die Augen, ließ diesmal aber sein Schweigen für sich sprechen.
Mary seufzte und biss heftig auf ihr Kaugummi. »Er hat uns gesagt, dein Schwager hätte betrunken am Küchentisch gesessen. Hätte ihn gar nicht kommen sehen. Leopold dachte, du wärst es, hat er ausgesagt. Zumindest von hinten.«
Er glaubte, er hätte mich umgebracht, als er Johnny die Kehle durchschnitten hat?
»Aber ich sehe meinem Schwager überhaupt nicht ähnlich.«
»Von hinten, Amos. Und wie ich schon sagte, dieser Leopold ist nicht ganz dicht.«
Decker schloss die Augen.
Und dann ist dieser Typ nach oben gegangen, hat meine Frau erschossen und meine Tochter erwürgt?
Er schlug die Augen in dem Moment auf, als Mary aufstand.
»Warte. Ich hab noch ein paar Fragen«, sagte er.
»Aber ich habe keine Antworten mehr. Ich könnte meine Marke verlieren, weil ich hergekommen bin und dir das alles gesagt habe. Das weißt du, Amos.«
Er stand ebenfalls auf, überragte sie wie ein Turm, ein großer, massiger Fleischklops von Mann, vor dem kleine Kinder kreischend die Flucht ergriffen.
»Ich muss den Kerl sprechen.«
»Unmöglich.« Mary wandte sich zum Gehen, drehte sich dann aber wieder um, weil sie die Ausbuchtung an seinem Hosenbund bemerkt hatte.
»Trägst du eine Waffe?«, fragte sie ungläubig.
Decker schaute nicht zu der Stelle, auf die Mary blickte. »Ich hab meine Waffe abgegeben, als ich bei der Polizei in den Sack gehauen habe.«
»Das habe ich nicht gefragt. Jeder kann eine Waffe kaufen. Jederzeit. Trägst du eine?«
»Wenn es so wäre, gäbe es kein Gesetz, das es mir verbietet.«
»Offenes Tragen«, berichtigte sie ihn. »Aber es gibt ein Gesetz gegen verdecktes Tragen, wenn man kein Cop ist.«
»Die Waffe ist nicht verdeckt. Du siehst sie doch, oder? Von da, wo du stehst.«
»Das ist nicht das Gleiche, Amos, und das weißt du.«
Er streckte beide Arme aus. »Dann leg mir Handschellen an. Verhafte mich. Stecke mich in dieselbe Zelle wie Sebastian Leopold. Du kannst meine Waffe nehmen, ich werde sie nicht brauchen.«