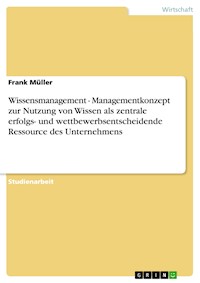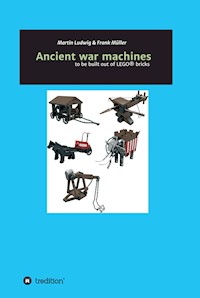Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Minderwertig ist ein intelligenter und zugleich hochemotionaler Action-Thriller, in dem eine an Multipler Sklerose erkrankte Ex-Kommissarin privat um Hilfe bei der Suche nach der hochschwangeren Melissa gebeten wird. Sabine Sommer organisiert ihr Leben abseits der Fürsorge mit Hilfe des Persönlichen Budgets, indem sie eigene Assistenzkräfte für ihre Pflege beschäftigt. Ihre Recherchen bringen sie auch wieder in Kontakt mit Dennis Jäger, der Liebe ihres Lebens, den sie wegen ihrer Krankheit verließ. Er ist Mitglied einer Task-Force, die sich mit dem Verschwinden zahlreicher hochschwangerer Frauen beschäftigt. Von ihm erfährt sie, dass offenbar grausame Genexperimente an ungeborenen Kindern durchgeführt werden. Was beide nicht ahnen: Sie werden von einer mächtigen Gruppe, die seit 3.500 Jahren ihren Platz in der Evolution zurückerobern will, beobachtet und abgehört. Neben historischen Fakten, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Genforschung und intensiven Rückblicken in eine durch eine grausame Erkrankung zerstörte Liebe, zeigt das Buch auf faszinierende Weise, wie sich Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben dank des Persönlichen Budgets bewahren können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1
»Bitte, retten Sie mein Baby! Bitte!« Die rechte Hand der jungen Frau hatte sich bei ihren panischen Worten in die Jacke des Notarztes gekrallt. So kraftvoll ihr Handgriff auch war, so schwach war ihre Erscheinung. Tiefschwarze Ränder lagen um ihre Augen, die Haut war kalkweiß, und auf ihrer Stirn hatte sich kalter Schweiß angesammelt. Es war nicht zu übersehen, dass sie sich nur durch das Anlehnen zwischen der Mauer und der Tür auf den Beinen halten konnte. Ihre Jogginghose war zwischen den Beinen blutgetränkt. Langsam löste der Arzt ihre Hand von seiner Jacke und schob stützend seinen linken Unterarm unter ihre Achsel. »Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun. Wir sind jetzt da. Sind Sie Bettina Kraus? Haben Sie den Notruf gewählt?«
»Ja«, röchelte die werdende Mutter, die nun wieder beide Hände auf ihren hochschwangeren Bauch gelegt hatte. »Ich habe solche furchtbaren Schmerzen. Ich blute. Ich höre gar nicht mehr auf zu bluten!«
»Ganz ruhig Frau Kraus. Ich bin Doktor Schmidt. In fünf Minuten sind wir in der Klinik. Warum haben Sie nicht in Ihrer Wohnung gewartet?«
»Ich habe solche Angst. Ich konnte Peter nicht erreichen«, keuchte die junge Frau mit schwacher Stimme. Dann knickten ihr die Beine weg.
»Wo bleibt die Trage?«, schrie der Arzt den Rettungsassistenten zu, die genau in diesem Augenblick die Tür erreichten.
Der Blick der Frau fiel auf die regennasse Straße hinter dem Rettungswagen. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und tauchte eine Pfütze in ein silbernes Licht. »Silber«, kam es kaum verständlich aus ihrem Mund. »Silber, … wir werden alle sterben.« Die Augen der Frau verdrehten sich. Sekundenbruchteile später sackte ihr Kopf zur Seite.
»Auf die Trage und los!«, befahl der Arzt. »Für eine Fehlgeburt verliert sie extrem viel Blut. Da ist noch etwas anderes im Spiel. Los, los, los!«
Die Rettungsassistenten rannten mit der blutverschmierten Patientin auf der Trage los, während der Arzt immer wieder auf Bettina Kraus einredete, dass sie bei ihnen bleiben, dass sie nicht aufgeben solle.
Als der Notarztwagen unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger mit lautem Geheul der Sirenen losfuhr, informierte der Fahrer die Klinik, damit sich die Ärzte dort auf extreme Komplikationen bei einer Schwangeren im geschätzten achten Monat vorbereiten konnten.
Der Notarzt und der Rettungsassistent agierten unter routinierter Höchstanspannung im Rettungsfahrzeug. Als eingespieltes Team versuchten sie alles, um das Leben der Mutter und des noch ungeborenen Kindes zu retten. Nüchternen Anweisungen folgten zielgerichtete Handreichungen, bis eine Vollbremsung des Rettungswagens beide in Fahrtrichtung schleuderte. Ihr Aufprall gegen die Rückwand der Fahrerkabine und auf den Fahrzeugboden war hart und laut. Ärztliche Instrumente lagen danach wildverstreut umher. Der Arzt und der Rettungssassistent waren sichtlich benommen und stöhnten bei jeder ihrer Bewegungen voller Schmerzen. In den letzten Sekunden hatten beide versucht, die Orientierung wieder zu finden. Obwohl sie sie noch nicht wiedererlangt hatten, trieb sie ihr Pflichtbewusstsein der Patientin gegenüber allerdings dazu an, wieder auf die Beine zu kommen. Stöhnen und Fluchen erfüllte die Kabine. Dazwischen war immer wieder der Fahrer zu hören, der sich nach dem Befinden seiner Teammitglieder erkundigte. Gerade wollte der Arzt ihm antworten, als der Fahrer entsetzt aufschrie.
»Was soll das denn jetzt werden?« Es folgte ein Geräusch, als ob Glas zersprungen wäre.
Doktor Schmidt hatte das Geräusch des splitternden Glases zwar wahrgenommen, konnte es aber gedanklich nicht einsortieren. Alle Knochen schmerzten ihm. Er fasste sich zum wiederholten Mal an seinen Hinterkopf. Als er die behandschuhte Hand wieder nach vorne führte, war der Gummihandschuh voller Blut. Er fragte sich, ob es sein Blut oder das der jungen Frau war. Die Patientin, ging es im explosionsartig durch den Kopf. Er sah sie an und richtete sich wieder auf. Genau in diesem Moment wurde die hintere Schwingtür des Rettungsfahrzeugs aufgerissen. Mit weit aufgerissenen Augen sahen der Doktor und der immer noch hockende Rettungsassistent in die Mündung einer Pistole mit Schalldämpfer.
»Was?«, war das letzte Worte des Sanitäters, als die Kugel sein Herz traf und ihn auf den Boden schleuderte.
Über Dr. Schmidts Lippen drang kein Wort, als die Waffe auf ihn gerichtet wurde. Er hatte nur die Augen vor Entsetzen und Ungläubigkeit weit aufgerissen, als die Kugel in seinem Brustkorb einschlug. Sein Körper wurde wieder mit Wucht vor die Rückwand der Fahrerkabine geschleudert. Noch ein Atemzug wich aus seinen Lungen, als er die Wand hinabrutschte. Das letzte, was er sah, war eine Pfütze hinter dem Schützen auf der Straße, die silbrig glänzte. Als die Tür von innen zugeschlagen wurde, war auch Dr. Schmidt tot.
Die Augen von Bettina Kraus waren mittlerweile so stark verdreht, dass nur noch das Weiß ihrer Augäpfel zu sehen war. Schnelles unrhythmisches Zittern durchfuhr ihren Körper. Ihr gewölbter Bauch zuckte unter Muskelkrämpfen. Der Schütze feuerte noch zweimal auf die am Boden liegenden Männer, während er sich neben Bettina Kraus stellte. Dieses Mal hatte er auf die Köpfe seiner Opfer gezielt. Offenbar wollte er sichergehen, dass die beiden reglosen Gestalten auf dem Boden des Rettungsfahrzeugs auch wirklich tot waren. Fast zeitgleich mit dem ersten Schuss schlug die Fahrertür des Rettungswagens zu. Während der Komplize den Wagen startete, klemmte er die Waffe mit der er den Fahrer durch das Seitenfenster erschossen hatte zwischen seine Beine. Zuvor hatte er den Leichnam des Fahrers vom Fahrersitz gezogen und auf die Straße stürzen lassen. Als der Motor aufheulte, schaltete er die Sirene ein und fuhr mit Vollgas los. Wenige Sekunden zuvor hatte ein SUV bereits mit quietschenden Reifen den Tatort verlassen. Zu dritt hatten sie in ihm gesessen, als sie den Rettungswagen zur Vollbremsung gezwungen hatten.
Der Mann im hinteren Teil des Rettungsfahrzeugs hatte Mühe, sich festzuhalten, als es mit Vollgas losging. Sein Gesichtsausdruck verzog sich dabei jedoch zu keinem Zeitpunkt. Genauso wie beim Abfeuern seiner Waffe, war er unempfänglich für den Ausdruck irgendwelcher Emotionen. Während sein Körper durch die wilde Fahrt hin und her geworfen wurde, ergriff er die linke Hand der schwangeren Frau, deren unkontrolliertes Zittern langsam in eine vollständige Verkrampfung ihres Körpers überging. Sein Blick ruhte auf den Händen. Regungslos verglich er seine Hand mit der ihren. Bei seinen Händen fehlten die kleinen Finger. Die Art der Verstümmelung zeigte deutlich, dass er mit nur acht Fingern geboren worden war. Dann zog er seine Hand weg und legte sie auf den Bauch der Frau. In das Mikrophon am Revers seines schwarzen Anzugs sagte er kalt: »Ich muss sofort abernten.« Weder beim Fahrer des SUV noch beim Fahrer des Rettungswagens spiegelte sich Mitleid wider, als sie die Nachricht über ihre Empfänger im Ohr vernommen hatten.
Kapitel 2
Hallo! Ich bin es, Mutti! Melissa! Dieses uralte Diktiergerät, das ich in meiner Hand halte, ist meine einzige Hoffnung, zu dir Kontakt herzustellen. Ich habe es mit ein paar gebrauchten Bändern von einem Trödelhändler während meiner Flucht geschenkt bekommen. Er hatte wohl Mitleid mit einer hochschwangeren Frau, der die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht. Du hast jetzt schon seit Wochen nicht mehr das geringste Lebenszeichen von mir erhalten. Glaube mir, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mehr liebe oder dich nicht mehr brauche. Genau das Gegenteil ist der Fall. So sehr, wie zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich dich noch nie gebraucht. Und dennoch: Es ist im Augenblick nicht möglich, einen direkten Kontakt zu dir herzustellen. Es wäre für dich viel zu gefährlich. Dabei bist du der einzige Mensch, dem ich noch vertraue! Ich weiß, dass du nichts mit ihnen zu tun hast. Aber sie kennen dich. Sie werden dich Tag und Nacht überwachen. Nichts wird dir aufgefallen sein. Warum auch? Woher solltest du wissen, dass es sie gibt? Ich hoffe so sehr, dass diese Bänder irgendwann einmal in deine Hände gelangen. So richtig kann ich nicht daran glauben. Und sie sind mir zu dicht auf den Fersen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit! Genau wie die Geburt. In vierzehn Tagen müsste es so weit sein. Es ist schon eigenartig, auf der Flucht zu sein, um sein Kind auf die Welt zu bringen. Das Wort Flucht trifft in meinem Fall zwar tatsächlich zu, aber es fehlen mir im Grunde genommen sämtliche Voraussetzungen für ihr Gelingen. Erfolgreiche Fluchtversuche, aus welchen Gründen auch immer, setzen beim Fliehenden ein hohes Maß an Aktivität, Ausdauer und Einfallsreichtum voraus. Zwar trifft das Letztere schon seit meiner Kindheit auf mich zu, was du sicherlich jedem bestätigen würdest, aber ich möchte die hochschwangere Frau sehen, die kurz vor der Niederkunft vor Aktivität und Ausdauer strotzt. Mein einziger Motor, allen Versuchungen der Selbstaufgabe nachzugeben, liegt in dem Wissen um die Rücksichtslosigkeit meiner Feinde. Wenn sie mich finden, werden sie mich unmittelbar nach der Geburt töten. Mein Kind werden sie, wenn es nicht von albtraumhaften Entstellungen gekennzeichnet ist, ein Leben lang untersuchen, um festzustellen, ob ihr Experiment gelungen ist. Es ist ein Albtraum, Mutti. Nein, es ist viel schlimmer. Es ist die Realität.
»Sehr spannend, auch wenn der Erzählstil für meinen Geschmack bisher ein wenig zu sachlich gehalten wurde. Unsere süße kleine Melissa versucht offenbar mit aller Anstrengung, ihre Gefühle im Zaum zu halten, damit die nackte Panik sich nicht ihres Verstandes bemächtigt. Naja, trotzdem, wenn diese Aufzeichnungen uns nicht gerade eine Reihe von Unannehmlichkeiten bereiten würden, wären sie gut für Hollywood geeignet!« Langsam lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, ohne jedoch die Hand von dem Diktiergerät zu nehmen, dessen Stopp-Taste er eben betätigt hatte.
Sein Gegenüber schob ihm die restlichen Kassetten seitlich über den Tisch zu. Dabei blieb sein Blick am Mund des Abhörers hängen. Es erstaunte ihn immer wieder, wie viel Zigarettenqualm zwischen den Lippen des Abhörers hervorquoll, wenn er etwas in seiner abweisenden Art sagte. Wie bei jedem Treffen der beiden, konnte er sich auch dieses Mal nicht eindeutig festlegen, ob ihn der Mann, der auf der anderen Seite des Tisches saß, faszinierte oder anekelte. Da es aber kein Aspekt ihrer Zusammenarbeit war, verwarf er die Suche nach einer Antwort wie immer schnell. Der Abhörer war der Beste von ihnen auf diesem Gebiet und für diesen Teil der Arbeit unverzichtbar. Wie alle, die wie er waren, so trug auch er eine stark verdunkelte Sonnenbrille, obwohl in den verrauchten, fensterlosen Raum kein Tageslicht fiel.
»Wie dem auch sei«, stellte der Mann, der die Diktierbänder gebrachte hatte, fest und sah den Abhörer ausdruckslos an. Er strich sich über seine auffällige Narbe, die quer über seine linke Wange lief. »Du hast nur sehr wenig Zeit für die Auswertung. Wir brauchen jeden noch so kleinen Hinweis, um die Flucht nachzuvollziehen. Die Ernte findet in Kürze statt. Bis dahin sollten möglichst alle Zeugen und Kontaktpersonen eliminiert sein. Wir wissen, dass ihre Mutter eine ehemalige Kommissarin aufgesucht hat, um ihr bei der Suche nach Melissa zu helfen. Sie ist wegen Multipler Sklerose schon lange aus dem Dienst ausgeschieden. Ihren hellen Kopf hat sie aber immer noch, auch wenn sie ihr Leben mit Assistenzkräften organisiert. Sie telefonierte gestern offenbar mit ehemaligen Kollegen. Die Zeit drängt. Egal, ob sie oder andere Nachforschungen anstellen, wir müssen einen deutlichen Vorsprung erarbeitet haben, um alle Spuren vorher beseitigen zu können. Es sind in letzter Zeit viel zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen.«
»Warum eliminieren wir diese Kommissarin nicht sofort?«, wollte der Abhörer mit regungslosem Gesichtsausdruck wissen. Wieder war dabei nahezu unaufhörlich Zigarettenqualm seinem Mund entwichen. Die Luft im Reich des Abhörers war zum Schneiden.
»Jede Spur, die wir übersehen, wird sie vielleicht entdecken. Sie muss in ihrer aktiven Zeit richtig gut gewesen sein. Wir hören sie ab. Gegebenenfalls werden durch ihre Erkenntnisse noch ein paar Nachreinigungen erforderlich. Alles andere wird beim Zieleinlauf entschieden. Du weißt ja, bis zu einem gewissen Grad fördert die Konkurrenz die Leistungsfähigkeit.« Ohne sich zu verabschieden, drehte er sich um und ließ den Abhörer mit den Kassetten zurück.
Mit einem flüchtigen Lächeln hörte der Abhörer, wie sich die Tür schloss und der Auftraggeber beim Hinaustreten so tief durchgeatmet hatte, wie es Taucher machen, wenn sie durch die Wasseroberfläche stoßen und endlich wieder Sauerstoff aufnehmen können. Fest zog er an der Zigarette, deren Glut sich augenblicklich erhellte. Er strich sanft über die Bänder auf dem Schreibtisch. Entspannung breitete sich in ihm aus. Weich waberte der Qualm aus seinem Mund. Endlich konnte er wieder in sein Element eintauchen. In die Welt der Töne. Dort und nur dort fühlte er sich lebendig. Alles um ihn herum löste sich dort in nichts auf. Alles, was ihn körperlich ausmachte, verschwand für diese Zeit aus seinem Bewusstsein. Es hatte eine Zeit gegeben, in der er sich Gedanken über seine Zustände gemacht hatte und dabei Gefahr gelaufen war, durch seine Analysen seine einzigen lebendigen Momente zu zerstören. Er hatte längst aufgegeben, auch nur nach Ansätzen von Lebensfreude in sich zu suchen. Das Einzige, was er brauchte, waren Aufträge wie dieser. Allein mit seinen Maschinen und Bändern zum Abhören - das war sein Leben. Die jahrelange Beschäftigung hatte sein Gehör geschärft. Er wusste schon fast instinktiv, an welchen Stellen er die Geräte einsetzen musste, um auch noch die feinsten Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Jeder Wortfetzen und die Analyse des Dialektes konnten wieder ein Mosaikstein im großen Bild werden. Er war ein Jäger nach schon längst verhallten Schallwellen der Vergangenheit. In ihm entstanden sie neu, wurden sie gebündelt. Als Ganzes brachte er sie wieder in die Gegenwart und machte sie so lange lebendig, bis seine Leute zuschlagen konnten. Danach zerfielen die zahlreichen Gesamtbilder, die er schon zu Hunderten hatte entstehen lassen, wieder in ihre Mosaike zurück und verloren sich in der damit beginnenden endgültigen Vergangenheit durch sein Loslassen und der gleichzeitigen Vernichtung der Bänder. Worte sind wie Schall und Rauch, fuhr es ihm durch den Kopf. Er zündete sich eine neue Zigarette mit seiner bis kurz vor dem Filter gerauchten Zigarette an und inhalierte tief den Rauch. Langsam drehte er sich auf seinem Arbeitsstuhl zu den Geräten, drückte die Starttaste des Diktiergerätes, zog seine Sonnenbrille ab und begann damit, sich über seine Konzentration wieder einmal zu verlieren, um endlich wieder einmal lebendig zu sein. Jedes Geräusch war wichtig. Langsam öffnete er seine Augen. Wie allen Dauer-Sonnenbrillenträgern unter ihnen fehlten ihm beide Pupillen. Die weißen Augäpfel leuchteten durch den aufsteigenden Zigarettendunst auf, als er erneut tief am glühenden Tabak zog.
Mutti, kannst du dich noch an unsere Gespräche erinnern, mit denen ich dich während meiner Oberstufenzeit auf dem Gymnasium immer strapazierte? Wie oft führte ich als Möchtegern-Weltverbesserin in epischer Breite aus, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 200 Kriege auf der Welt stattgefunden haben! Dass kein einziger Tag seitdem vergangen ist, an dem nicht irgendwo auf der Welt für die Ehre, das Vaterland, die Religion oder eine ideologische Überzeugung gekämpft und getötet worden ist. Ich erzählte dir damals von dem Psychoanalytiker Erich Fromm, der den Krieg für eine indirekte Rebellion gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Langeweile, wie sie das gesellschaftliche Leben in Friedenszeiten beherrschen, ansah. Seiner Meinung nach sollte die Tatsache nicht unterschätzt werden, dass ein Soldat – wenn er gegen den Feind kämpft – nicht gegen die Mitglieder seiner eigenen Gruppe um Nahrung, ärztliche Betreuung, Unterkunft und Kleidung kämpfen brauchte. Dass der Krieg diese positiven Züge aufweist, so stimmte ich Fromm damals zu, ist ein trauriger Kommentar zu unserer Zivilisation. Wie oft zitierte ich damals Fromm: »Wenn das bürgerliche Leben für Abenteuer, Gleichheit und Idealismus Raum hätte, wie sie im Krieg zu finden sind, könnte man die Menschen vermutlich nur sehr schwer dazu bewegen, in einen Krieg zu ziehen.« Heute weiß ich es besser, Mutti. Heute weiß ich, dass sich Fromm täuschte, dass wir uns alle täuschen. Nicht nur in Bezug auf eine solche Theorie, sondern auch über unser Selbstbewusstsein und sogar über unsere eigene Entstehungsgeschichte. Wir ziehen nicht in den Krieg, weil für uns kein Raum für Gleichheit und Gerechtigkeit vorhanden ist, sondern weil wir unbewusst den Krieg als unseren Schöpfer huldigen. Sie haben es mir gesagt, Mutti! Sie haben mir ihre Beweise vorgelegt, über die sie schon seit 3.500 Jahren verfügen. Seit dieser Zeit macht sich die Menschheit etwas vor. Auch du und ich! Und seit 3.500 Jahren haben wir sie zum Feind. Sollte ihr Experiment gelungen sein, so wird auch mein Kind zu unserer aller Feind werden. Großer Gott, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Oh, Mutti! Es tut mir so leid, dass ich dich aus meiner Schwangerschaft ausgegrenzt habe. Nur mit einer einzigen SMS habe ich dich daran teilhaben lassen. Oh Gott, was habe ich dir damit nur angetan! Verzeih mir, Mutti, bitte verzeih mir!
Kapitel 3
»Da haben wir ihn ja wieder, diesen vielsagenden Blick der früheren Kommissarin.« Langsam schob Karin Breit ihre Chefin mit dem kombinierten Dusch- und Toilettenstuhl vom Waschbecken weg. Erst jetzt trafen sich ihre Blicke über dem Spiegel. Die Chefin mochte es, wenn sie vor dem Duschen die Zähne geputzt bekam. Dann fühlte sie sich noch sauberer, dann war gefühlt alles perfekt, soweit das überhaupt noch möglich war.
Als Karin Breit den Stuhl in Richtung der bodengleichen weißgekachelten Dusche bewegte, verloren sie den Blickkontakt. »Was ist los mit dir, Sabine?«, fragte die Assistentin. »Seit ich hier bin, bist du so nachdenklich.«
Vor sechs Jahren noch hätte Sabine Sommer einfach ihren Kopf zu demjenigen gedreht, der sie von hinten ansprach. Aber heute ist halt nicht vor sechs Jahren, ging es ihr durch den Kopf. Sie wartete mit einer Antwort, bis sie auf ihrem Gefährt in der Mitte der Dusche von Karin Breit geparkt worden war. Jetzt konnten sich beide in die Augen sehen. Die eine blickte angezogen hinab und die andere blickte nackt hinauf.
Während Karin Breit die Dusche anstellte und die Wassertemperatur prüfend eine Hand unter den Wasserstrahl hielt, sagte Sabine Sommer nachdenklich: »Bevor deine Schicht heute anfing, hatte ich wieder Besuch von Sieglinde Meyer.«
»Die von schräg gegenüber?«, fragte die Assistentin, die offenbar mit der eingestellten Temperatur des Wassers zufrieden war.
»Ja, genau die. Sie war ja gestern schon da gewesen, wie du weißt.« Es entstand eine kurze Pause, weil die Assistentin den Duschkopf in die Hand genommen hatte und das Wasser über Sabine Sommers linke Hand laufen ließ. An dieser Hautpartie konnte sie am besten die Temperatur des Wassers fühlen. Im Gegensatz zu den Beinen, wo sie nicht wirklich sagen konnte, ob das Wasser zum Duschen eine angenehme Temperatur hat, oder eben nicht. Mit einem kurzen Nicken gab sie ihrer Assistentin ein Zeichen, dass das Duschen jetzt starten konnte. Von den Füßen aufwärts begann die Assistentin in weichen Spiralbewegungen den Duschkopf so zu bewegen, dass nicht nur überall Wasser hinkam, sondern dass es auch wie eine leichte Massage wirkte. Sabine Sommer folgte den Bewegungen des Duschkopfes mit ihrem Blick. »Die arme Frau ist nervlich am Ende. Restlos! Ihre Tochter Melissa ist verschwunden. Und das im achten oder neunten Schwangerschaftsmonat.«
»Ach du liebes bisschen«, sagte Karin Breit erschrocken, während sie das Wasser nun über das kräftige schulterlange, braune Haar ihrer Chefin laufen ließ.
Sabine Sommer hatte ihre Augen geschlossen, als sie mit ihrem Bericht fortfuhr. »Eine Frau von Anfang dreißig, die sich auf ihr erstes Kind freut, verschwindet nicht einfach. Da muss etwas passiert sein. Ich habe deshalb mit Kollegen von früher telefoniert.«
Karin Breit nickte nachdenklich, während sie den Duschkopf wieder in die Wandhalterung hing. Danach ergriff sie routiniert das Shampoo, ließ etwas davon in ihre Hand fließen und begann damit, die Haare ihrer Chefin zu waschen. Karin Breit hatte sich dazu neben Sabine Sommer gestellt und verteilte das Shampoo mit massierenden Bewegungen in das Haar. Sabine Sommers entspannter Gesichtsausdruck verriet, wie sehr sie diesen Teil des Duschens liebte. Ihr restlicher Körper zeigte nichts von dem Gefühl, das Sabine Sommer gerade durchfloss. Er war durch die spastischen Lähmungen so gezeichnet, wie er es durch die Krankheit bereits seit Jahren war.
Karin Breit wusste, wie sehr ihre Chefin diesen Teil der Grundpflege genoss und schwieg. Genau wie Sabine Sommer, in der ein paar Erinnerungsbilder aus der Zeit aufstiegen, als sie sich noch selbst waschen und pflegen konnte. Mit sehr viel Mühe, aber immerhin noch selbst. Lange Zeit hatte sie sich dagegen gewehrt, sich waschen zu lassen. Hatte den Schritt dorthin immer abgewehrt. Irgendwann brauchte sie morgens vier bis fünf Stunden, bis sie fertig war. Verdammte Multiple Sklerose, ging es ihr durch den Kopf. Sich das erste Mal von einem Fremden waschen zu lassen, war furchtbar gewesen. In ihrer Erinnerung war sie weiterhin die selbstbewusste und erfolgreiche Kommissarin, die viele ihrer Altersgenossen auf der Karriereleiter zurückgelassen hatte. Bis sie mit Ende zwanzig die Diagnose erhalten hatte. Ihr Denken und Fühlen würden sich niemals ändern. Doch der Körper tat es rasant. Als schließlich auch der rechte Arm und die rechte Hand immer wieder verkrampften, ging körperlich kaum noch etwas. Noch gestern hatte sie es unter Aufbringung aller Konzentration geschafft, eine Verkrampfung selbständig zu lösen, aber es hatte sich schon früh gezeigt, dass behutsame Hilfe einer Assistentin schneller wirkte. Sie musste damals unter Tränen akzeptieren, dass fremde Menschen sie waschen. Ihr wegen der Inkontinenz Einlagen und Windeln wechseln, ihr das Essen mundgerecht zubereiten, bei fast allem, was einmal eine Selbstverständlichkeit im Sein des selbstbestimmten Lebens war. Selbst bestimmen konnte sie immer noch, aber zur Ausführung ihres Willens brauchte sie Assistenten. Niemals, so hatte sie sich während des aggressiven Krankheitsverlaufes schon zu anfangs geschworen, würde sie sich in ein Pflegeheim abschieben lassen. Mit Mitte dreißig zwischen Senioren das Leben verbringen und über Jahrzehnte zu verbringen, war ihr ein Graus gewesen. Ihre Lebenserwartung würde nahezu normal sein. Also würde es auch ausreichen, wenn sie jenseits der 60 Jahre über ein Pflegeheim nachdenken würde. Ihr Kopf war voller Leben, voller Neugierde, voller Wissen und voller Tatendrang. Deshalb hatte sie sich für das Persönliche Budget und gegen die Fürsorge entschieden. Mit eigenen Assistenten, die sie als Arbeitgeberin mit der Finanzierung verschiedener sozialer Träger angestellt hatte, konnte sie selbstbestimmt leben. Bis zu 14 Stunden am Tag standen ihr Assistenzkräfte zur Verfügung. Und Karin Breit war ihr die liebste von allen. Im Laufe der Zeit war zwischen Chefin und Angestellter tiefe Freundschaft erwachsen.
Als die Haare ausgespült waren, öffnete Sabine Sommer wieder ihre Augen. Sofort nutzte Karin Breit die Gelegenheit, um eine Frage zu stellen, die ihr die ganze Zeit schon auf der Zunge lag: »Warum kam sie zu dir mit diesem Problem? Warum geht sie nicht zur Polizei?«
»Da war sie schon«, antwortete Sabine Sommer ruhig. »Nach eigenen Angaben mindestens zehnmal am Tag. Doch Antworten oder Hinweise blieben bisher aus.«
»Wie furchtbar! Die arme Frau.«
»Ja, sie ist nervlich völlig am Boden. Zu mir kam sie, weil ich einem Cousin von ihr mal richtig aus der Patsche helfen konnte. Alle Beweise sprachen damals gegen ihn. Nur dadurch, dass ich jedes Steinchen umdrehte, fand ich die Wahrheit heraus. Man hatte versucht, den Cousin aufs Kreuz zu legen. Für die Familie war ich im Anschluss so etwas wie eine Heilige.«
Beide lachten auf.
»Ich muss jetzt der Heiligen die Achselhöhlen waschen. Bist du bereit?«
Sabine Sommer nickte. So entspannend das Duschen bis zu diesem Zeitpunkt auch war, jetzt wurde es irgendwie Arbeit. Da die Spastik ihre Arme und Hände in einer Verkrampfung hielt, musste die waschende Assistenzkraft einiges Geschick und auch Kraft aufwenden, um mit dem Waschhandschuh unter die Achseln zu kommen. Um sich und Karin Breit davon etwas abzulenken, berichtete sie weiter. »Die Mutter von Melissa Meyer hat einen Karton mit Unterlagen gebracht. Neben Fotos gibt es einen Lebenslauf, eine Liste mit Namen von allen Leuten, die je enger etwas mit Melissa zu tun hatten und auch einige Krankenunterlagen. Sie hat mir heute Morgen alles vorgelesen.«
»Krankenunterlagen? Was hat sie denn?« Karin Breit drehte sich zum Waschbecken und wusch den Waschhandschuh unter dem Wasserhahn aus.
»Nichts mehr, so hofft es die Mutter zumindest. In ihrer Jugend litt Melissa Meyer wohl unter Panikattacken als posttraumatische Belastungsreaktion nachdem sie Opfer eines Überfalls geworden war. Sie ging wohl einige Zeit zu einer Therapeutin. Falls Melissa seelisch aus dem Gleichgewicht gekommen ist, hat sie sich eventuell an ihre alte Therapeutin gewendet. Wegen der ärztlichen Schweigepflicht kommt die Mutter aber hier nicht weiter.« Als sie sah, wie Karin Breit erneut Seife auf den Waschhandschuh verteilte, verstummte sie. Ihr Schweigen, genau wie das der Assistentin, gehörten ab diesem Moment einfach dazu, weil ihr jedes Mal dabei bewusst wurde, dass fremde, wenn auch vertraut gewordene und lieb gewonnene Personen bei der Grundpflege in Bereiche vordringen mussten, die man sonst lieber für sich behalten hätte. Dabei tröstete es sie immer, dass auch die Assistentinnen diesen Part der Pflege sicher nicht als den einfachsten und beglückendsten empfanden. So sehr sie diese Abhängigkeit und Nähe immer gefürchtet hatte, umso erleichterter war sie, mit welch professioneller Distanz die Grund- und Intimpflege nach eigenen Wünschen wie selbstverständlich und ganz natürlich abgearbeitet wurde, annähernd so, als hätte man es selbst getan. Lieber bin ich sauber und gepflegt als genant, sagte sie sich immer wieder dabei. Als Karin Breit begann, den Waschlappen wieder auszuwaschen, atmete Sabine Sommer tief durch. Gleich würde das Duschen wieder zu einem entspannenden Tageselement werden, weil gleich nur noch warmes Wasser über sie floss. Auf wundervolle Weise spürte sie dabei überall ihre Haut. Auch dort, wo sie sie selbst nicht mehr berühren konnte. Der warme Wasserstrahl traf sie am Rücken. Schweigend genoss sie das Wasser, das sie sanft umhüllte. Dann wurde ihr Blick wieder nachdenklich.
»Das Eigentümlichste an dem ganzen Fall ist aber, dass die Mutter keine Ahnung hat, wer Melissa geschwängert hat. Stell dir vor, die Mutter wurde mit nur einer einzigen SMS darüber aufgeklärt, dass Melissa schwanger ist. Keinen einzigen Besuch gab es danach mehr. Einmal im Monat nur ein kurzes Telefonat, dass mehr Sorgen hinterließ als Erkenntnisse darüber brachte, wie es der werdenden Mutter und dem noch ungeborenen neuen Leben überhaupt geht. Sie sieht in dem geheimnisvollen Mann den Grund für alles. Melissa und ihre Mutter waren immer eng verbunden gewesen, besonders nach dem Tod von Melissas Vater. Da waren aus Mutter und Tochter fast so etwas wie Freundinnen geworden. Die vergangenen neun Monate waren die Hölle für die Frau. Fragte sie am Telefon nach dem Mann oder Melissas Aufenthaltsort, wurde das Gespräch jedes Mal sofort unterbrochen. Die arme Frau weiß nur, dass es für Melissa die Liebe auf den ersten Blick war und in einem Kölner Hotel begann.« Sabine Sommer schloss noch einmal die Augen, um sich ganz auf das fließende Wasser auf ihrer Haut zu konzentrieren.
In weichen Bahnen ließ Karin Breit das Wasser nach und nach über den Körper ihrer Chefin fließen. »Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen«, bemerkte sie mit kritischer Miene an. »Wenn ich die Liebe meines Lebens finde und ein Kind von ihm erwarte, dann würde ich seinen Namen sogar herausschreien.«
»Ja, das sieht wohl jeder so.« Als Sabine Sommer ihre Augen wieder öffnete, war ihr deutlich anzusehen, dass sie mit dem Duschen gedanklich abgeschlossen hatte. Den Blick, den sie zeigte, kannten frühere Kollegen von ihr sehr gut. Sie hatte ihn immer dann gezeigt, wenn sie Feuer gefangen hatte und die Wahrheit ans Licht bringen wollte - um jeden Preis.
»Wenn die nur einmal im Monat miteinander telefoniert haben, warum glaubt Melissas Mutter ausgerechnet jetzt, dass ihre Tochter verschwunden ist?«, fragte Karin Breit mehr sich selbst, als sie die Brause abstellte.
»Melissa hatte beim letzten Anruf vor einer Woche panisch geklungen, redete wirres Zeug von Monstern - und dass sie auf der Flucht sei, aber nicht zur Mutter kommen könne, weil sie sie bestimmt schon observieren würden.«
»Von Monstern verfolgt?« Verwirrt breitete Karin Breit das gefaltete Handtuch aus. Wie alles in dem Bad, so war auch dieses Accessoire weiß.
»Ich kann mir auf das alles auch noch keinen Reim machen.«
Kapitel 4
Wie sich auch immer dieser Albtraum, in dem ich stecke, entwickeln wird, zu Beginn, war alles traumhaft. Ich lernte den Mann meines Lebens kennen, dachte ich zumindest eine ganze Zeit lang. Es war eigentlich kein Kennenlernen, Mutti, sondern ein Hineinstürzen. Ich hielt es für eine Fügung des Schicksals, für meine Bestimmung. Du weißt doch sicherlich noch, wie ich wegen des Rohrschadens in meiner Wohnung für ein paar Tage ins Hotel gezogen war. Das Bett war so ungewohnt, dass ich nachts keine Ruhe fand. Um meine Wachstunden sinnvoll zu füllen, besorgte ich mir zum Lesen einige Zeitschriften, die an der Rezeption des Hotels auslagen. Eigentlich hatte mich das Thema des Artikels, der kurze Zeit später mein Leben verändern sollte, gar nicht sonderlich interessiert. Deshalb las ich ihn auch. Mir sollte davon langweilig werden. So langweilig, bis mir endlich die Augen zufallen würden. In dem Artikel ging es um gentechnische Experimente an Tieren. Ursprünglich hatte ich ja die Hoffnung gehabt, dass dieser wissenschaftliche Artikel mich ermüden würde, aber das Gegenteil war der Fall. Nicht weil er so sonderlich interessant war, sondern weil im Anschluss des Artikels noch ein Interview mit einem Gentechniker gebracht wurde. Das Foto dieses Mannes versetzte mich für einige Minuten in euphorische Teenagerphasen zurück. Mutter, das Bild zeigte meinen Traummann! Groß, schlank, dunkelhaarig, einen sinnlichen Mund und dunkelbraune Augen. Als Beilage war er auch noch äußerst erfolgreich, ohne Familie, vermögend und, wie das Interview vermittelte, ein Weltverbesserer. In diesem Interview ging es um die ethische Verantwortlichkeit von genetischen Experimenten. Zunächst bezog er eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber so genannten Chimären. Das sind Lebewesen, die aus Zellen zweier verschiedener Arten bestehen. Für Aufsehen hatte wohl schon vor Urzeiten die Schiege gesorgt, eine Züchtung aus einer Ziege und einem Schaf. In freier Natur hatte die Schiege allerdings keine Überlebenschance, da ihre Körperproportionen unausgeglichen waren und ihr Organismus äußert empfindlich war. Dr. Peter Barlow, so der Name meines Traummannes, hielt nichts von Experimenten, bei denen es um die Vermischung von Arten geht. Seine Zustimmung bekamen jedoch alle Bemühungen der Gentechnik, die mit der Produktion von Medikamenten zusammenhängen. Als Beispiel gab er Kolibakterien an, die einem Menschen-Gen für die Produktion von Insulin eingebaut wurden. Als ich morgens aufwachte, hatte ich die Zeitschrift mit dem Bild meines Peters immer noch in der Hand.
Es war Fügung, Mutti, mein unabwendbares Schicksal. Mir kam es gar nicht in den Sinn, dass ein Stapel dieser Zeitschrift nur deshalb vom Hotel ausgelegt worden war, weil er Gast im Hotel und auch die Hauptperson des Symposiums war. Wie dem auch sei, Mutti, als ich morgens durch die Hotellobby schritt, kam er mir entgegen. Ein US-Spitzenforscher ist mein Traummann und er ist im gleichen Hotel wie ich, wegen eines Symposiums! So etwas kann nur Schicksal sein. Er telefonierte während des Gehens mit seinem Handy. Irgendetwas schien ihn zu verärgern, denn er blieb abrupt stehen. Ich blieb peinlicher Weise auch stehen - direkt neben ihm. Ich will gar nicht wissen, wie ich ihn angestarrt habe. Wie ein total verknallter Teenager wahrscheinlich. Ich war schlagartig in seinem Bann. Leibhaftig und noch attraktiver, als es das Foto vermittelt hatte. Mein Herz schlug bis zum Hals. Mein Blick, oder vielmehr mein Anstarren, schien ihn von seinem Ärger abzulenken. »Darf ich ein Autogramm haben?«, fragte ich ihn allen Ernstes auf Englisch. In mir steigt immer noch die Schamesröte auf, wenn ich daran zurückdenke.
»Nein«, sagte er in ausgezeichnetem Deutsch, dem man nur schwach den amerikanischen Akzent anhörte »aber ein gemeinsames Abendessen kann ich Ihnen anbieten.«
Oh Gott, Mutti! Ich kann mich an das erste Gespräch abends im Hotelrestaurant mit Peter so gut erinnern, als hätte es gerade erst stattgefunden. Er hatte eine Packung Pralinen dabei. Sie waren nicht für mich. Ich habe nie gefragt, woher er sie hatte. Seltsam, dass mir dieses Detail auf einmal in den Sinn kommt! In einem Anflug von Übermut fragte ich in Bezug auf die Pralinen jedenfalls: »Gentechnisch entwickelt?«