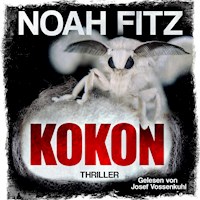Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mischa
- Sprache: Deutsch
Es war endlich wieder Frühling. Die kalten und dunklen Monate des langen sibirischen Winters waren vorbei. Laut der Zeitungen und den Gerüchten soll der Deutsche zurück in sein Land gedrängt worden sein und Menschen sprachen vom Ende des Krieges. Die Rote Armee soll in Berlin einmarschiert sein. Aber Michael konnte nicht so recht daran glauben, denn auch er war ja schließlich ein Deutscher. Was soll mit all den Menschen, die Deutsche waren und in Russland in Arbeitslagern lebten, passieren, sollte der Krieg tatsächliche im Jahr 1945 sein Ende finden? Trotz der schlimmen Jahre hat sich Michael nicht unterkriegen lassen und hat sich sogar in ein Mädchen verliebt. Leider, wegen der strengen Bestimmungen, lebten sie in zwei verschiedenen Arbeitslagern und sahen sich kaum. Nur ein Wunder könnte Maria und ihn näher zusammenbringen. Und der Sieg der Sowjetunion und der anderen Ländern, die gegen das Deutsche Reich kämpften, wäre vielleicht so ein Wunder. Michael, von allen nur Mischa genannt, hatte sich mittlerweile an diesen russischen Namen gewöhnt. Selbst die russische Sprache war ihm nicht mehr so fremd, wie noch vor dem Krieg. Klar vermisste er seine Eltern, die er im Krieg verloren hat. Aber Maria, das Mädchen, in das er sich verliebt hat, könnte für ihn ein Neuanfang werden … Teil 3 der bewegenden Geschichte über den Jungen, der an das Gute glaubte. Leserstimmen: "Ich hatte das Gefühl, alles mitzuerleben - als stiller Beobachter." "Ich schwelgte in Erinnerung an meine Großeltern, die viel von damals erzählt haben, denn ihnen ist es genauso ergangen wie Mischa." "Noah Fitz kann erzählen - eindringlich und so, dass es einem unter die Haut geht."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1 Winter 1943
Alexander schwitzte, obwohl es klirrend kalt war. Seine Rückenmuskulatur brannte, seine Finger krallten sich fest um das Holz. Ein trockenes klack-klack-klack zerschnitt die morgendliche Luft. Schnee schmolz auf seiner nackten Haut, denn er trug nur eine Hose und Gummistiefel.
Dunja stand in der Tür. Sie hatte sich in einen dicken Pelzmantel gewickelt. Stumm sah sie ihm zu, wie er das Holz spaltete.
»Sascha, das wird für zwei Winter reichen, und dieser ist hoffentlich schon bald vorbei«, sagte sie und zog den Mantel fester um ihre Schulter.
»Wer weiß, ob du im nächsten Winter noch einen Mann hast. Der eine ist an der Front, und mich können sie jederzeit holen, um mich zu erschießen«, entgegnete Alexander schnaufend. Sofort taten ihm seine Worte leid. Er holte zu einem weiteren Schlag aus. Die Axt sauste herunter, die Klinge war scharf und spaltete ohne viel Widerstand das Holz in zwei Stücke. Alexander streckte mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht seinen Rücken, die Axt hielt er in der linken Hand. Als keiner der Wirbel mehr knackte, drehte er sich zu Dunja um.
Ihre Wangen glühten, ob vor Zorn oder weil sie fror, vermochte Alexander nicht zu sagen. Sofort griff die Kälte nach ihm und jagte ihre eisigen Finger in seine von Schweißperlen bedeckte Haut.
»Komm rein, Sascha. Das Essen ist fertig«, flüsterte Dunja und verschwand hinter der Tür, die langsam und quietschend ins Schloss fiel.
Alexander rammte das Axtblatt in den großen Baumstamm einer Eiche, sammelte mehrere Scheite auf und folgte Dunja in das warme Haus.
Drinnen flackerte das Feuer, die wohlige Wärme spendete Trost. Alexander fühlte sich heimisch, genau dies machte ihm die ganze Zeit zu schaffen. Der Gedanke, Dunja verlassen zu müssen, nagte an seinem Gemüt. Er würde alles Erdenkliche versuchen, wenn er nur das Schicksal irgendwie bestechen könnte, damit es ihm hold blieb.
Er ging zum Ofen und richtete das Holz zu einem Stapel auf. Mit einem schweren Schürhaken öffnete er die gusseiserne Tür des Ofens, um die Glut zu schüren. Prüfend warf Alexander einen Blick hinein. Eine heiße Welle erfasste sein Gesicht, als er zwei Holzscheite in den brennenden Schlund hineinwarf, um dem Feuer mehr Nahrung zu geben. Als er die Tür wieder zumachte, versuchte er, die Lethargie von sich abzuschütteln. Er schloss die Augen, holte tief Luft und setzte eine fröhliche Miene auf. Irgendwie werde ich alles geradebiegen, dachte er, blieb in der Hocke sitzen, rieb seine von der Hitze kribbelnden Hände aneinander und öffnete die Augen. Die Glut fraß sich qualmend durch die Holzscheite, für deren Trocknung keine Zeit gewesen war. Er starrte auf das züngelnde Tanzen der Flammen, die über das helle Holz leckten und schwarze Flecken hinterließen, so lange, bis seine Augen zu tränen begannen.
»Sascha, das Essen bleibt nicht den ganzen Tag warm«, hörte er erneut Dunjas Stimme.
Er stand auf, wobei sein rechtes Knie knackte, wie eben eines der Holzscheite im Ofen, tat aber nicht weh. Leichtfüßig und etwas besserer Laune warf er einen kurzen Blick auf den Tisch. Darauf stand eine Schüssel mit drei gekochten Eiern, daneben etwas Butter und ein Stück Brot.
»Sascha, komm essen, die Eier werden sonst kalt.«, trieb ihn Dunja, die mit dem Rücken zu ihm an dem massiven Tisch stand, an. Sie goss aus einem kleinen irdenen Krug etwas Milch in zwei Becher. Als sie mit dem Ausschenken fertig war, drehte sie sich zu ihm um, den Krug hielt sie immer noch mit ihren zierlichen Händen fest umklammert.
Er nickte.
Dunja stellte das Gefäß ab und ging auf die andere Seite des Tisches.
Alexander sah sie einfühlsam an.
Sie schnitt jetzt das Brot in Scheiben und merkte nicht, dass er sie beobachtete. Womit habe ich nur solches Glück verdient?, dachte er. Das Schicksal hatte ihm eine kleine Chance eingeräumt, an die er sich mit aller Kraft klammerte. Doch dieses Seelenheil war vergänglich, das wusste er. Nichts anderes blieb ihm noch übrig, als jeden Tag das Leben zu genießen, so als wäre er der letzte. Wie schmerzhaft der Tod sein kann, hatte er am eigenen Leib erfahren, umso mehr freute er sich auf das Leben.
Dunja setzte sich und faltete die Hände zu einem kurzen Gebet. Sie sprach das Vaterunser.
Alexander verstaute den Eisenhaken an seiner Halterung, ging auf die junge Frau zu und nahm sie von hinten in den Arm. Ihre Finger legten sich auf seine Arme. Dünn und kalt, aber auch zärtlich waren ihre Hände. Sie blickte zu ihm auf. Ein zauberhaftes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Später vielleicht, jetzt essen wir.« Beide wussten, was mit später gemeint war. »Ich habe Hunger«, stellte sie mit Nachdruck fest.
Hunger habe ich auch, ging es Alexander durch den Kopf, als sein Magen knurrte. Die beiden lächelten einander an. Dunja zog seinen Kopf zu sich und gab ihm einen warmen Kuss, schob ihn dann wieder von sich, als Alexander noch mehr wollte. Seine linke Hand wanderte von der Schulter zu ihrer Brust, doch sie wehrte seine Zärtlichkeit mit einem entschiedenen Klaps ab, woraufhin Alexander knurrte.
»Schluss jetzt, sonst gibt es heute Abend kein später«, sprach sie mit gespielter Ernsthaftigkeit.
Sie sah ihn jedoch liebevoll an und hob ihre Hand. Mit sanfter Berührung flatterten ihre Finger über seine Stirn, an die Stelle, an der die Narbe, die die Kugel hinterlassen hatte, noch deutlich zu sehen war. Ihre Augen glänzten. »Lass uns essen, Sascha«, flüsterte sie.
Er nickte und nahm ihr gegenüber Platz.
Kapitel 2 In der Hütte bei Tante Elsa
Tante Elsa gab einen Schrei des Entsetzens von sich. Sie sah ihren Sohn finster an, so, als würde sie ihn am liebsten erschlagen.
»Was hast du angestellt, Konstantin? Du dummer Junge!« Ihre Stimme zitterte vor Zorn. Sie presste ihre Lippen fest aufeinander, sodass alle Farbe aus ihnen entwich.
Konstantin rührte sich nicht. Weder sein Gesichtsausdruck noch seine Körperhaltung verrieten den Anwesenden, was in ihm vorging. Er stand mit ausdrucksloser Miene einfach nur da, die Hände in den Taschen seiner an den Knien ausgebeulten Hose versteckt, sah er seine Mutter ohne ein Wort zu sagen an.
»Du weißt ganz genau, was ich meine. Also hör auf, mich so dumm anzustarren.«
Michael mochte die Frau nicht. Sie hatte sich verändert. Mit ihren Hass- und Schimpftiraden versuchte sie stets, die anderen in Angst und Schrecken zu versetzen, sodass jedes der Kinder heilfroh war, wenn sie für ihre Strafpredigten ein anderes Opfer ausgesucht hatte, um sich darauf zu stürzen.
»Ich möchte dir nur vor Augen führen, was dich erwartet, falls du dich weigerst, mir auf meine nächste Frage eine ehrliche Antwort zu geben. Falls du gedenkst, dich weiter in Lügen zu verstricken, so gnade dir Gott. Ich gebe dir eine Minute zum Überlegen.« Mit vor der Brust gekreuzten Armen stand sie mit finsterer Miene da und wartete. Ihr Haar war zerzaust, das eingefallene Gesicht kantig, die Augen eisig. Michael schauderte bei diesem Anblick.
Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, rührte sich Konstantin endlich. »I … ich ha … hatte Hu … Hunger«, flüsterte er die knappe Antwort mit belegter Stimme.
Michael beobachtete das Ganze, ohne sich einzumischen. Er ließ seinen Blick durch den Raum wandern, bis er auf Gregor traf. Aus dem Augenwinkel vernahm Michael eine Bewegung und wandte sich von seinem Bruder ab.
Tante Elsa kam raschen Schrittes auf ihren Sohn zu. Mit einer weit ausholenden Bewegung klatschte sie Konstantin mit der flachen Hand ins Gesicht. Sofort wurde die Haut an dieser Stelle rot. Michael sah, wie der Abdruck deutlich hervortrat, doch Konstantin verzog keine Miene. Er nahm seine Strafe mit stoischem Gesichtsausdruck auf sich. Den Blick nach vorne gerichtet sah er durch seine Mutter hindurch, als wäre sie Luft.
In Tante Elsas kalten Augen konnte Michael nicht eine Spur von Mitgefühls oder Verständnis für ihren Sohn erkennen. Was Konstantin getan hatte, war unverzeihlich. Er hatte die Reste vom Vorabend, es war ein Esslöffel Brei, der eigentlich für seinen kleinen Bruder gedacht war, aufgegessen. Wahrscheinlich nachts, als alle schliefen, mutmaßte Michael. Der kleine Rudi hatte schon seit zwei Tagen Fieber und war zu schwach, um den Brei ganz aufzuessen.
Michael sah sich in diesem Moment gezwungen, etwas zu sagen, damit die Situation nicht völlig eskalierte.
»Ich fahre heute zur Mühle und werde Mehl stehlen.« Er erkannte seine eigene Stimme nicht wieder, denn insgeheim hoffte er, die Frau würde ihn davon abhalten wollen.
Die während der harten Monate des kalten Winters stark gealterte Frau wandte sich von ihrem Sohn ab und sah Michael durchdringend an. »Hätte ich euch nicht am Hals gehabt …« Weiter kam sie nicht, dann hatten Tränen ihre Stimme erstickt. »Eure Mutter hätte sich um euch kümmern müssen, nicht ich«, schluchzte sie, nachdem sie sich wieder gefasst hatte.
Michael hatte keine Ahnung, wie lange er sich noch beherrschen könnte, darum biss er seine Zähne zusammen und ballte seine Hände so fest, dass sich seine Fingernägel tief in die Handballen gruben. Der Schmerz lenkte seine bösen Gedanken in eine andere Richtung, auch sein Zorn ebbte allmählich ab, sein Atem ging etwas flacher. Er verbiss sich die unschönen Worte, die sich in seinem Kopf zu einem langen Satz aufreihten.
»Ohne uns wären Sie schon längst verhungert«, mischte Gregor sich ein. Er sagte immer das, was er dachte, ohne einen Gedanken an die unweigerlichen Konsequenzen zu verschwenden. Einzig in Anwesenheit von Pulski oder Onkel Emil wusste sich Michaels Bruder zu beherrschen. Nun stand Gregor von dem Schemel, auf dem er saß und an einer Holzfigur schnitzte, auf. Sein Blick war provokativ. Mit der rechten Hand fuhr er durch sein dichtes pechschwarzes Haar. »Und wagen Sie es ja nicht«, ermahnte er die Frau, als sie sich ihm genähert hatte. Ihre Hand war erneut zu einer Ohrfeige erhoben, die Gregor gelten sollte. Gregors gespielte Gelassenheit brachte die Frau in Rage.
»Hüte deine Zunge, Junge!«, sagte sie mit gepresster Stimme.
»Sonst noch was?« Das scharfe Messer fuhr weiter durch das helle Holz. Feine Holzspäne segelten zu Boden. »Ich werde mich nicht von Ihnen verprügeln lassen. Nur dank meines Bruders und mir haben Sie und Ihre Söhne etwas zu essen. Wir könnten jederzeit dabei erwischt werden. Auch wenn wir nichts klauen, ist es nicht erlaubt, sich ungefragt in den Wald zu schleichen, um dort nach Beeren zu suchen. Aber jetzt im Winter gibt es dort nichts mehr zu holen. Pulski hat mich schon zweimal ermahnt. Er sagte, hier sei ein Arbeitslager und kein Kurort für stinkreiche Kapitalisten.«
Die eingeschüchterte Frau zauderte, ihr war natürlich bewusst, dass Gregor mit allem absolut recht hatte. Ihr Kinn bebte und sie bedeckte mit beiden Händen ihr Gesicht. Schluchzend sank sie auf einen Stuhl und begann laut zu weinen.
Der kleine Rudi wachte von der dröhnenden Auseinandersetzung auf. Sein vom Schleim belegtes Schreien wurde immer wieder von heftigen Hustenattacken unterbrochen.
Gregors Blick wanderte nach oben zum Ofen, dort, wo der kleine, vom Fieber geschwächte Rudi lag. Die warme Schlafstätte, die vom Feuer im Ofen warmgehalten wurde, gehörte der Frau und ihren zwei jüngsten Söhnen. Rudi quengelte eine Zeit lang, schlief dann aber wieder ein.
Michael sah seinen Bruder erwartungsvoll an, denn er wusste, dass Gregor mit sich selbst haderte. Er war unentschlossen, das Messer lag in seiner Hand und zeigte mit der Klinge nach unten, in der halbfertigen Holzfigur war jetzt schon die Form eines Pferdes zu erkennen. Sein großer Bruder lief zum Tisch und schmetterte die Figur auf die Tischplatte, dass es nur so krachte. Mit der rechten Hand rammte er das Messer tief ins blank polierte Holz hinein und stürmte mit dumpf polternden Schritten hinaus. Die Tür wurde aufgerissen, ein kalter Windstoß drang ins Innere und ließ Michael erschauern.
Gregor blieb nicht lange weg. Als er wieder zurückkam, waren seine Haare von Schnee bedeckt. Die Finger rot und nass, das Gesicht spiegelte unendliche Traurigkeit wider. Seine rechte Hand war zur Faust geballt, darin hielt er etwas versteckt, das Michael nicht richtig erkennen konnte. Gregors trauriger Blick war etwas anderem gewichen, Zorn vielleicht, überlegte Michael. Er hatte seinen Bruder noch nie richtig einschätzen können. Nie wusste er, woran er bei ihm war.
Alle starrten Gregor erwartungsvoll an. Mit festen Schritten lief er auf die verdutzte Frau zu. Seine nackten Füße klatschten auf den Dielen. »Hier«, sagte er mit gepresster Stimme und knallte zwei Knochen auf den Tisch. »Kochen Sie etwas Brühe für Ihr krankes Kind. Und du, Konstantin, wenn du ihm noch einmal etwas wegisst, dann werde ich deine Knochen herausschneiden, um für Rudi daraus eine Suppe zu kochen.«
Konstantins Unterkiefer mahlte, sein schuldbewusster Blick trübte sich.
Die Frau rappelte sich mit tränenverquollenen Augen auf die Beine und sank, als wäre sie angeschossen worden, auf die Knie. Sie klammerte sich an Gregors Beinen fest wie eine Bittstellerin. Gregor war auf so eine Wendung nicht vorbereitet, er wurde von diesem völlig unerwarteten Gefühlsausbruch fast erschlagen. Seine finstere Miene strahlte Unentschlossenheit aus, während Tante Elsa nur noch lauter schluchzte. Mit nasaler Stimme leierte sie irgendeinen Psalm herunter, den keiner verstehen konnte. Ihre klagenden Worte klangen belegt und sie zitterte am ganzen Körper, so, als ob sie fröre.
Gregor starrte sie mit einem nicht zu deutenden Blick an, zog sie an den Achseln auf die Beine und setzte sie zurück auf die Bank.
Eine nie gekannte bange Erwartung ließ Michael zur Salzsäule erstarren. Woher hatte Gregor diese Knochen? Diese eigentlich banale Frage beherrschte seinen Verstand. Doch in dieser Zeit, in der der Hunger allgegenwärtig war, konnten eine Handvoll Knochen über Leben und Tod entscheiden. Jeder, der beim Stehlen erwischt wurde, kam in ein anderes Arbeitslager, dorthin, wo andere Gesetze herrschten. Da war der Umgang rauer, nicht so wie hier. Das wusste er vom Hörensagen. Das Leben dort war schlimmer als der Tod.
»Gregor, wo hast du die her?«, flüsterte Michael mit einer Stimme, die ihm plötzlich selbst eigenartig fremd vorkam.
Sein Bruder schien zuerst eine Lüge in Betracht zu ziehen. Nach einem kurzen Moment der Stille besann er sich jedoch anders.
»Ich habe sie einem Hund weggenommen«, brummte Gregor.
Also doch nicht die Wahrheit, grämte sich Michael. Gregor mied den Blickkontakt mit ihm, weil beide wussten, dass er gelogen hatte.
Gregor nahm wieder auf dem kleinen Hocker Platz und begann seine nackten Füße mit langen Stoffstreifen aus grober Baumwolle einzuwickeln.
»Gerade eben?«, entfuhr es Konstantin.
Gregor warf ihm einen abschätzigen Blick zu, als habe er ein begriffsstutziges Kind vor sich.
»Was denkst du denn?« Die brüchig klingende Stimme nahm einen gefährlichen Klang an, als Gregor Konstantin durchdringend anschaute.
»Gregor, du bist ein Schatz! Nimm dir an deinem Freund ein Beispiel, Konstantin«, mischte sich Tante Elsa ein.
Seine finstere Miene bekam weichere Züge. »Wir sind Genossen, keine Freunde.« Früher war das anders gewesen, aber der Winter war hart und forderte Opfer.
Der Druck auf Michaels Brust löste sich. Ein zaghaftes Lächeln huschte über seine Lippen, als er bemerkte, wie Gregors Wangen einen roten Schimmer bekommen hatten. Er ging zu seinem Bruder, setzte sich neben ihn auf den staubigen Boden und begann jetzt auch seine Füße einzuwickeln.
»Ich habe die Knochen vor zwei Wochen im Schnee eingegraben«, rechtfertigte sich Gregor, als niemand mehr etwas sagte. »Wir sind spät dran«, murmelte er dann an Michael gewandt und stopfte das lose Ende des Stoffes zwischen die Lagen, die er sich um die Wade gewickelt hatte.
Michael zog die Wicklungen seiner Fußlappen nicht zu fest zu, aber auch nicht zu locker, damit die Stofflagen in den viel zu großen Filzstiefeln beim Gehen nicht verrutschen. Als er mit dem zweiten Bein fertig war, klopfte es an der Tür. Die Hiebe waren laut und fordernd.
Die Frau griff mit den Fingern nach den Knochen und versteckte sie hastig in ihrem üppigen . »Es ist offen!«, rief sie mit aufgesetzter Gelassenheit, während sie eilig ihr Haar unter der Kopfbedeckung richtete und ihr Kleid glatt strich.
Eine dunkle Gestalt trat mit gesenktem Kopf ein.
Die Fellmütze auf dem Kopf des Riesen war weiß von Schnee. Die Schneeflocken verwandelten sich durch die Wärme augenblicklich in Wassertropfen. Als eine große Pranke die Mütze vom Kopf streifte, erkannte Michael die Glatze. Auch das Gesicht des Mannes war ihm bestens bekannt. Es war Stepan. Der Riese atmete geräuschvoll ein, bevor er sprach: »Ich komme von Emil, er schickt mich, um das hier bei euch abzugeben.« Er beobachtete dabei die Frau, die nicht so recht wusste, was sie mit ihren Händen machen sollte, schließlich faltete sie sie wie zu einem Gebet und hielt sie vor ihrer Brust.
Stepans rechte Hand verschwand unter seinem dicken Mantel. Nach kurzem Zögern förderte er ein kleines Bündel zutage. Er stand immer noch vor der Tür und wagte nicht, sich weiter ins Haus hinein zu begeben. Die Tür lehnte an seinem Rücken, durch den schmalen Schlitz drang ein kalter Luftzug zu ihnen herein.
Unsicher, als stünde die Frau vor einer wichtigen Entscheidung, stand sie da und traute sich nicht, auf den Mann zuzugehen. Wieder war es Michael, der für die beiden Erwachsenen die Wahl traf. Er steckte seine Füße in die dicken Filzstiefel, schüttelte seinen Kopf und ging auf Stepan zu, um das Bündel entgegenzunehmen.
»Ich soll euch schöne Grüße ausrichten. Er erwartet euch beide an der Mühle.« Diese Information galt den beiden Brüdern. Dann stülpte er sich die Mütze auf seinen Kopf und trat in die klirrende Kälte hinaus, wobei er seinen Körper weit nach unten beugte, so wie es alle großen Menschen taten, wenn sie unter einer Zarge hindurch schritten.
Als die Tür ins Schloss fiel, löste sich die Anspannung. In dem Augenblick zerriss ein lauter Knall die Stille. Alle zuckten zusammen, auch Rudi war wieder aufgewacht. Weinend begann das aufgeschreckte Kind zu husten.
»Es war nur das Holz im Ofen«, flüsterte die Frau ihrem Sohn zu, der nach ihr rief.
Das Bündel in Michaels Hand wog nicht schwer. Er ging zum Tisch und löste mit spitzen Fingern und etwas Anstrengung den Knoten. Zwei Scheiben Brot und etwas Käse waren alles, was sich darin befand, aber es war mehr, als sie sich erhofft hatten.
»Ich kann daraus eine leckere Suppe machen«, stotterte Tante Elsa. Mit der linken Hand griff sie sich an den Busen. Ihre zittrigen Finger hielten die beiden Knochen, die sie bedächtig auf das weiße Tuch neben das verschrumpelte Brot und die ausgetrockneten Käsereste legte.
»Aber lasst etwas für uns übrig«, grummelte Gregor und schnappte nach seinem Mantel.
Sie hatten Glück. Onkel Emil hatte sie selbst in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen. Auch verdankten sie es dem Tod einer alten Oma, dass sie in dieses Haus hatten einziehen dürfen. Die anderen traf es weit schlimmer, sie lebten oft zu Dutzenden in einem einzigen Raum, der nicht einmal einen richtigen Ofen zum Heizen hatte. Aus einem unerklärlichen Grund lächelte Michael seinen Bruder an. Gregor hob die Augenbrauen. Dann stülpte er sich eine Pelzmütze aus abgewetzten Kaninchenhäuten auf den Kopf und zog sie über seine Stirn bis zu den dunklen Augen. »Komm jetzt, und hör auf, so dumm zu grinsen«, brummte Gregor und schlüpfte nach draußen.
Michael nahm den zweiten Mantel vom Haken. Die Jacke war zu weit und roch muffig. ›Immer noch besser, als mit dem nackten Arsch im Schnee zu sitzen.‹ Diese Bemerkung hatte sich Onkel Emil nicht nehmen lassen, als Michael beim Anblick des Kleidungsstücks die Nase gerümpft hatte. Immer noch mit einem schiefen Grinsen band er den Lederriemen fest um seinen Bauch.
»Und du, Konstantin, gib dir Mühe, nicht alles aufzuessen, und sieh zu, dass du heute den Korb fertig bekommst.« Gregor wollte eigentlich nur nachsehen, wo sein kleiner Bruder so lange blieb. Dann fiel sein Blick auf die Ecke, dorthin, wo zwei angefangene Körbe mit all dem dazugehörigen Flechtzeug lagen, das sie zum Arbeiten benötigten. Konstantin folgte Gregors Blick. Mit zerknirschter Miene nickte er zustimmend.
»Falls du wieder nicht fertig sein solltest, werde ich dich persönlich zu Pulski bringen, dann kannst du ihm deine Entschuldigung selbst vorstottern«, ermahnte ihn Gregor in barsch. »Michael, kommst du jetzt endlich?« Ohne die Antwort abzuwarten, verschwand er wieder.
»Bis heute Abend«, sagte Michael leise. Mit der rechten Hand stieß er die Tür auf.
Die Luft war eisig und brannte in der Nase, als er einen tiefen Atemzug machte.
Gregor hüpfte jetzt schon auf der Stelle. Eine dicke Dampfwolke entwich aus seinem Mund, als er sich warme Luft in die Fäustlinge einhauchte.
Michael machte die klirrende Kälte weniger aus. Die reine Luft tat seiner Seele gut, auch wenn sie in seiner Lunge brannte.
»Was ist?«, fragte Gregor, als er bemerkte, wie Michael ihn ansah. »Nun sag schon!«
»Wolltest du die Knochen selbst essen?«, rutschte es Michael heraus. Er wusste, dass Gregor ihm sein Geheimnis nicht verraten würde, trotzdem brannte ihm die Frage unter den Fingernägeln. Er wollte unbedingt wissen, wo sein Bruder unbemerkt die zwei dicken, in Scheiben gesägten Knochen her hatte.
Gregor hielt den zweiten Fäustling an den Mund, und erneut sah Michael, wie eine warme Wolke in einem Handschuh verschwand.
»Du hast sie hoffentlich nicht dem Adolf stibitzt?« Die Frage war eher als Witz gemeint.
Gregor bedachte seinen Bruder mit einem unsicheren Blick, die Augen zu zwei schmalen Schlitzen zusammengekniffen. »Klar«, lautete seine knappe Antwort. Dann stellte er den Kragen hoch, senkte den Kopf und stampfte Richtung Mühle. Michael folgte seinen Fußstapfen.
Ihre Beine versanken bis zu den Knien im Schnee, trotzdem mussten sie raus, ansonsten wären sie ohne Essen geblieben. ›Wer nicht arbeitet, isst nichts‹, lautete hier die Devise.
Kapitel 3 Dunjas Haus
Alexanders Hände waren flink. Dank seiner Schnelligkeit und seinem Geschick konnte er mehrere Körbe am Tag flechten. Diese Art von Beschäftigung lenkte ihn vom grauen Alltag ab, gleichzeitig verlieh ihm die Tätigkeit das Gefühl, gebraucht zu werden. Aus der Gesellschaft verstoßen zu werden ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.
»Genosse Pulski war heute wieder bei der Ausgabe dabei. Er hat nach dir gefragt«, meldete sich Dunja zu Wort. Sie saß am Tisch und siebte das Korn aus. »Bei ihm war auch noch ein anderer Mann, Andrej Koslov, glaube ich, hieß er.«
Alexander hielt inne, legte den Korb auf den Boden und sah über die Schulter zu Dunja. »Was wollten die beiden?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Dieser Koslov hat behauptet, dich gut zu kennen.«
»Wie sah er aus?«
»Er ist ungefähr so alt wie du, hat eine runde Brille, auch scheint er ein intelligenter Mann zu sein – zumindest auf den ersten Blick. Er arbeitet in der Fabrik. Halt, nein, ich glaube, er wurde versetzt.« Dunjas Hände schwebten über der Tischplatte. »Sie sprachen von der Mühle. Dieser Koslov sagte, ich soll dich von Herrn Scherbenkind oder so ähnlich grüßen.«
»Scherenkind?«, echote Alexander. »Achim?«
Dunja drehte sich zu ihm um. Mit leicht irritiertem Gesichtsausdruck zog sie die Augenbrauen zusammen. »Das weiß ich nicht«, flüsterte sie und zuckte erneut mit den Achseln. »Sie haben gesagt, das Rad muss bis zum Frühling repariert werden. Auf jeden Fall wirst du ihm zur Hand gehen müssen.«
»Wem?«
»Diesem Koslov. Pulski wird doch wohl kein Rad reparieren«, sagte Dunja. Mit der rechten Hand strich sie von der Tischplatte die ausgesiebten Körner in einen Mörser aus schwerem Gusseisen, wo sie sie langsam mit einem Stößel zu zermahlen begann.
Alexander seufzte und schloss die Augen. Manchmal brachte ihn Dunja mit ihrer Gelassenheit zur Verzweiflung. »Was hat dieser Koslov denn von mir gewollt? Wo möchte er mich denn sehen? In der Mühle?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie ihm.
Als Alexander im Begriff war, erneut zu einer Frage anzusetzen, schüttelte Dunja unmerklich den Kopf, ihre Augen waren rot vor ungeweinten Tränen. Ihr Blick heischte nach etwas, womit sie sich aus dieser Situation retten konnte. Als sie nichts fand, sagte sie: »Ich weiß es nicht, Alexander. Bitte verschone mich mit deinen Fragen, die uns beide überhaupt nicht weiterbringen werden, außerdem habe ich gehört …« Ihre Stimme brach abrupt ab, genauso wie ihr Mahlen.
»Was?« Alexander musste an sich halten. Er hasste es, ihr immer jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen zu müssen.
»Mein Mann lebt. Ich habe gehört, dass er wahrscheinlich verletzt wurde und im Frühjahr zurück nach Hause kommt.«
In ihrem hoffnungslosen Blick lag mehr Trauer, als Alexander es je bei einem Menschen gesehen hatte. Er stand von seinem Hocker auf, seine Knie knackten und taten weh vom vielen Sitzen. Mit heftigen Bewegungen klopfte er seine Hose ab und ging zu Dunja. Sie ließ sich in seine Arme fallen, als er dicht vor ihr stand. Das Gesicht an seine Brust gelehnt, weinte sie bittere Tränen, ihr Körper in seiner Umarmung zuckend. Von Weinkrämpfen geschüttelt, drückte sie ihn fest an sich, so als fürchte sie sich davor, in einen Abgrund zu stürzen.
»Wo? Wo soll ich hin? Welche Fabrik? Dunja, wenn du es mir nicht sagst, kann es schlimme Folgen nach sich ziehen.«
»Bei der Mühle«, schluchzte Dunja, ohne den Kopf zu heben. Ihre Stimme klang gedämpft. Alexander spürte ihren heißen Atem auf seiner Brust.
»Wann?« Alexander schob sie von sich weg. Mit Daumen und Zeigefinger hob er ihr Gesicht an, indem er ihr spitzes Kinn sanft umfasste.
Ihre nassen Augen waren immer noch rot.
»Heute«, sagte sie und tupfte sich mit einem Handtuch die Augen trocken. »Das heißt, eigentlich jetzt, Sascha. Ich habe nur Angst, dass es sich um eine Falle handelt. Ich traue diesem Pulski alles zu. Er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Bitte geh nicht, ich habe mit Fjodor Iwanowitsch …«
»Herrgott, Dunja, dein Fjodor Iwanowitsch wird mich nicht vor der Schlinge retten können. Falls Pulski sich dazu entschieden hat, mich an einem Balken hängen sehen zu wollen, wird er es durchziehen. Verstehst du das etwa nicht? Dein Fjodor Iwanowitsch wird ihn nicht aufhalten können. Pulski hat hier das Sagen!« Alexander nahm ihr zartes Gesicht in seine Hände, ihre Wangen glühten auf seinen Handflächen und waren feucht. »Alles, was ihn davon abhält, mich aus der Welt zu schaffen, bist du mit deiner auch für mich unbegreifliche Liebe zu mir.« Seine Augen füllten sich mit Tränen.
»Liebst du mich etwa nicht?« Ihre Augen wurden groß.
»Natürlich, aber darum geht es nicht. Ich bin ein … ich bin ein beschissener Deutscher, verdammt noch mal«, fluchte er und drückte sie fest an sich.
»Das ist mir egal.« Sie befreite sich aus seiner Umklammerung. »Meinem Herzen ist es egal, meine Liebe zu dir ist ehrlich.«
»Liebe ist launisch, genauso wie du.« Alexander verzog seinen Mund zu einem Lächeln, um sie gleich darauf anzuschauen. »Ich muss jetzt los. Wir dürfen das Schicksal nicht unnötig herausfordern. Ich schulde dem Tod schon zweimal mein Leben, nicht, dass heute wieder ein Unschuldiger statt meiner sterben muss. Das will ich wirklich nicht«, sagte er mit trauriger, dennoch sehr ernster Stimme. »Ich bin nicht der, von dem du getröstet werden solltest. Aber das klären wir ein anderes Mal. Ich werde jetzt gehen, und ich rate dir, dich mir nicht in den Weg zu stellen.« Seine Worte klangen eher müde als schroff.
Kapitel 4 Auf dem Weg zur Fabrik
Michael und Gregor stampften mit gesenkten Köpfen durch den Schnee. Ihre Füße brachen durch die Schneekruste, um jedes Mal tief in dem weichen Weiß zu versinken. Ihre Wangen glühten, der peitschende Wind schlug ihnen unerbittlich ins Gesicht und drängte sie vom Weg ab. Aber die beiden Brüder wussten, welche Konsequenzen sie wegen ihres Fehlens würden tragen müssen.
Endlich erkannten sie in der Ferne das Gebäude. Der aufgewirbelte Schnee war wie ein dichter Nebel. Sie nahmen die Umgebung wie durch einen mit eiskalten Nadeln gespickten Schleier wahr. Selbst auf ihren Wimpern hatte sich eine dünne Schicht Raureif gebildet. Michael erkannte das aus roten Ziegelsteinen errichtete Bauwerk als Erster.
»Da ist jemand!« Gregor zeigte auf einen Mann, der sich neben dem Tor postiert hatte. Das Gebäude wurde von einer steinernen Mauer umsäumt. Heute stand das schwere Tor aus dunklem Holz offen, davor schritt ein Mann hin und her wie ein Bär in einem Käfig. Doch dann blieb er abrupt stehen, als er die beiden Brüder bemerkt hatte.
»Ich glaube, das ist Onkel Emil.« Michael blinzelte. Die Sicht blieb weiterhin getrübt.
»Wo seid ihr solange gewesen?«, schrie Onkel Emil. Der Wind trug seine Worte fort, sodass sie seine Frage nur erahnen konnten. »Ihr sollt die Säcke abholen, sie hier auf den Hänger laden und in die Bäckerei fahren!«, schrie Emil weiter.
Michael und Gregor senkten ihre Köpfe und liefen eilig auf den Mann zu. Hier war der Schnee nicht so tief, darum fiel es den beiden leichter, schneller voranzuschreiten.
»Ich wäre hier fast erfroren. Stepan war schon längst bei mir.«
»Er ist ja auch ein riesiger Bär. Da unten ist der Schnee so tief.« Gregor hielt die linke Hand an sein Knie.
»Du bist nie um eine Ausrede verlegen«, fuhr Onkel Emil ihn an und hob die Stimme, als Gregor ihm widersprechen wollte. »Das ist mir egal. Ihr geht jetzt hinein«, schnitt der Mann dem aufgebrachten Jungen erneut das Wort ab.
Gregor presste die Lippen aufeinander. Mit dem rechten Fuß trat er gegen einen Eisklumpen, der in weitem Bogen davonflog.
Onkel Emil rieb die behandschuhten Hände aneinander. Sein grauer Bart hatte Eiszapfen, von seinem Mund stieg eine weiße Wolke empor und brachte die winzigen, kristallklaren Zapfen zum Schmelzen. Er klopfte sich mit den Händen, die in Fäustlingen steckten, gegen Brust und Arme.
»Der Gaul wird verrecken, wenn er sich nicht bald bewegt«, brummte Onkel Emil. Der Wind fegte eine Schneewolke über die weiße Schneeschicht und wirbelte sie zu einem Strudel auf. Für eine Sekunde verschwand die Welt in einem Nebel aus Puderzucker.
»Die nächste Ladung holt ihr ab, wenn ihr diese hier abgeladen habt.« Die tiefe Stimme kam wie aus dem Nirgendwo, weil sie in der Wolke aus Schneekristallen nichts erkennen konnten. »Ihr fragt in der Mühle nach Arthur Rosental. Wenn ihr zwei Fuhren erledigt habt, bringt ihr den Klepper zurück in die Stallungen zu den anderen Tieren. Und noch etwas …« Endlich legte sich der Wind ein wenig.
Onkel Emil brüllte jetzt nicht mehr so laut: »Wenn ihr die Säcke in der Backstube ausleert, müsst ihr danach die feuchten und angeschimmelten Flächen abkratzen. Am besten nehmt ihr dafür einen Korb. Versucht, so viel ihr könnt von dem abgekratzten Mehl darin zu verstauen, deckt es aber ordentlich ab, soll ja nicht jeder davon erfahren. Habt keine Angst, belangt werdet ihr deswegen nicht, falls jemand sich doch dazu entscheiden sollte, euch auf die Pelle zu rücken, dem richtet ihr schöne Grüße von mir und meinem Gürtel aus.«
Michael und Gregor sahen sich grinsend an, kurz darauf richteten sie ihre ganze Aufmerksamkeit erneut auf Onkel Emil. »Ich werde später den Tieren daraus Mehlsuppe kochen. Aber untersteht euch, es selbst zu essen, der grüne Schimmel ist giftig«, ermahnte er sie, dabei sah er die beiden Jungen ernst an. »Habt ihr alles soweit verstanden?«
»Ja«, entgegneten sie wie aus einem Mund.
»Gut, dann ich gehe jetzt. Ich bin zu alt für diese Kälte.« Mit diesem Satz verschwand der Mann in der nebeligen Luft.
»Komm, wir müssen uns bewegen, sonst friert mir noch alles ab«, sagte Gregor und klatschte in die Hände.
Gregor und Michael trugen beide dicke Fäustlinge, trotzdem waren ihre Finger klamm.
Das Tier schnaubte und schüttelte seinen Kopf wild, als Michael es bei den Zügeln nahm. Der Schlitten war wie festgefroren. Nur mit Mühe gelang es ihnen, das Ding in Bewegung zu setzen. Trotz der breiten Kufen versank der Schlitten im Schnee, eine Schneise hinterlassend.
Kapitel 5 Ein Toter in der Mühle
Alexander lief durch einen schmalen Gang eine steile Treppe nach oben. Die hölzernen Stufen knarzten, alles war von einer Staubschicht bedeckt. Hier oben war die Luft eisig und roch nach morschem Holz.
Das mechanische Poltern von Zahnrädern und breiten Riemen war ohrenbetäubend. Doch Alexander fiel auf, je höher er stieg, umso leiser wurde das Rattern der unzähligen Räder, Hebel und anderen mechanischen Teilen, die die komplexe Konstruktion in Bewegung hielten. Mit jeder weiteren Stufe wurde die Luft unerträglicher und kälter. Hier pfiff der Wind aus allen Ecken. Alexander zog den Kopf tiefer ein.
»Einfach ganz nach oben laufen«, wies ihm ein älterer Herr den Weg, als Alexander sich im Inneren der Mühlenanlage nach Kommandant Pulski erkundigt hatte.
»Was ist die Hölle im Vergleich zu dem Wutausbruch einer Frau, die ihrer Ehre verlustig ging?«, hörte er eine männliche Stimme. Kurz darauf erklang ein Gelächter, das die klackernden Geräusche mühelos übertönte.
Hier war nicht nur alles von einer dicken Staubschicht bedeckt, stellte Alexander fest, als er nach den lachenden Männern Ausschau hielt, es war Mehl, das sich mit Staub vermischt hatte. Er blieb stehen und horchte, um anhand der Stimmen die ungefähre Position der immer noch feixenden Männer abzuschätzen.
Endlich erblickte er zwei Gestalten. Sie standen dicht beieinander und unterhielten sich. Einer der beiden trug Uniform, der andere machte auf Alexander einen intellektuellen Eindruck. Er trug eine Brille. Das musste Achim Scherenkind sein, da war er sich sicher. Der zweite Mann kam ihm ebenfalls sehr bekannt vor, auch wenn er dessen Gesicht nicht erkennen konnte.
Alexanders Kehle wurde eng, als er sah, worauf sein ehemaliger Schulkamerad starrte. Sein Gesicht war genauso grau wie alles andere hier. Er rang um Fassung. Warum hatte er wohl gelacht, überlegte Alexander. Die Frage war überflüssig, musste er sich eingestehen, die Antwort simpel: Auch er hatte Respekt vor diesem Pulski. Warum verwenden die meisten diesen Ausdruck, anstatt ehrlich zu sagen, dass sie Angst hatten? Ist Respekt zu haben nicht ebenso erniedrigend wie sich vor irgendetwas zu fürchten?
Alexander ließ sich Zeit, um zu Atem zu kommen und die Situation einzuschätzen.
Achim tupfte sich mit einem Taschentuch über seine Stirn. Das, worauf sein Blick gerichtet war, widerte ihn an. Er kämpfte um Fassung, immer wieder stieß er auf, um die Galle mit verzogener Miene aufs Neue hinunter zu schlucken. Sein Gegenüber hingegen schien der Anblick nicht zu stören, er erzählte in demselben heiteren Ton weitere Anekdoten aus seinem Leben. Es war kein Geringerer als dieser Pulski. Alexander erkannte ihn in dem Moment, als er ihn von hinten sah.
Immer wieder wischte Pulski sich seine Augen trocken, die ihm vor Lachen tränten. Als Pulski seinem Gesprächspartner ins Gesicht schaute, musste er Achims starren Blick gefolgt sein, denn jetzt drehte auch er sich um und entdeckte Alexander. Seine Miene nahm einen anderen Ausdruck an. Das Lachen wurde zu einem abwertenden Grinsen. Seine Augen glänzten nicht mehr, sie wurden dunkel und schmal.
Mit einem kurzen Nicken bedeutete er ihm, näher zu treten.
Alexander näherte sich den beiden, dabei gab er sich Mühe, diesem Pulski nicht in die Augen zu sehen.
Als er sich den beiden bis auf zwei Schritte genähert hatte, entschied er sich dazu, dort stehen zu bleiben.
Pulski lachte verächtlich, schniefte und spuckte den Rotz vor die Füße des Neuankömmlings.
Alexander beachtete diesen abscheulichen Akt nicht weiter. Er wollte ihn nicht provozieren, die ganze Situation war jetzt schon mehr als heikel.
»Na endlich, wir dachten schon, du bist auf dem Weg hierher erfroren«, blaffte Pulski und heischte nach einem Lachen von Achim. Der junge Mann gewährte ihm diese Freude nicht. Zu Pulskis Verdruss schwieg er beharrlich.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte«, sagte Alexander trocken. Der Staub und das Mehl kratzten in seinem Hals. »Wie kann ich hier behilflich sein?« Er blieb sachlich.
Pulskis Augen wurden noch schmaler. Zu Alexanders Erstaunen trug er keine Handschuhe.
»Genosse Koslov hat mir versichert, dass du ein guter Handwerker bist und dich in der Mechanik gut auskennst. Seinen Worten nach bist du einer, der vielseitig einsetzbar ist, und auch sonst mehr als alle anderen Ahnung von der Technik hat. Ein Wunderkind sozusagen.« Pulski zog jedes Wort unnötig in die Länge, dann fuhr er sich langsam mit der Zunge unter seine Oberlippe.
Alexander sah, wie Achim kaum merklich nickte. Seine Lider blieben einen Augenblick länger als nötig zu. Daher weht also der Wind. Jetzt war Alexander auch das Durcheinander mit den Namen Koslov und Scherenkind klar. Sie hatten Achim eine neue Identität verpasst, einen Juden wollte niemand in den kommunistischen Reihen haben. War Trotzki, der eigentlich Bronstein hieß, nicht auch Jude?
»Stimmt es nun oder nicht?« Pulskis Miene blieb steinern.
»Ja, das stimmt«, entgegnete Alexander ruhig. Die Gefasstheit, die er nach außen ausstrahlte, schockierte ihn.
»Das ist gut«, grinste Pulski. Sein Kopf fuhr herum und sah in eine bestimmte Richtung. »Wir haben nämlich ein grundlegendes Problem.« Er deutete mit einer Hand auf eine Antriebswelle aus einem polierten Baumstamm. Darauf befand sich ein Rad, das von einem breiten Gürtel umspannt wurde. »Wie für jeden ersichtlich, ist das Rad von einem Fremdkörper, welchen es nun zu beseitigen gilt, blockiert.« Der Unterton boshafter Befriedigung war nicht zu überhören.
Der ›Fremdkörper‹ war eine männliche Leiche, die aus einem für Alexander unerklärlichen Grund irgendwie dazwischengeraten sein musste und von dem breiten Gürtel regelrecht zerquetscht worden war.
»Auch er war der Meinung, er könnte alles reparieren, nun wurde er für sein lautes Mundwerk eines Besseren belehrt. Wird ihm wohl eine Lehre sein.« Pulskis grinste wieder und fletschte dabei seine Zähne.
Alexander kämpfte gegen Krämpfe in seinem Magen an. Die Säure brannte in der Speiseröhre, aber Alexander schluckte die Galle einfach hinunter, ohne dabei eine Miene zu verziehen.
»Wie ist das passiert?«
»Er war zu wissbegierig und unerfahren, so steht es im Protokoll, das wir gemeinsam mit dem Genossen Koslov erstellt haben. Der eigentliche Grund seines Ablebens ist aber ein anderer. Ich mochte diesen Mann nicht, ich fühlte mich bei seinem Anblick stets an dich erinnert.« Mehr verriet der Uniformierte nicht. Er genoss die Situation.
»Sein Name war Arthur Rosental«, murmelte Achim und mied den Blick auf die zerquetschte Leiche.
Ein kalter Schauer durchzuckte Alexander. Diesen Arthur kannte er zwar nur flüchtig, dennoch war ihm der junge Mann im Gedächtnis geblieben. Er war nämlich derjenige, der ihm seine Freundschaft aufzwingen wollte, bevor sie getrennt worden waren.
Pulski grinste unaufhörlich und machte einen unbekümmerten Eindruck.
Dir wird das Lachen noch vergehen, dachte Alexander. Um seine Hände zu beschäftigen, ballte er sie zu Fäusten.
»Das ist der Kreis des Lebens. Gegen den Tod sind nicht einmal die vorsichtigsten Menschen gefeit.« Pulskis Stimme war völlig emotionslos und selbst die Kälte schien ihm nichts auszumachen.
»Das war ein Unfall. Genosse Pulski war der Erste, der die Leiche entdeckt hat. Wer weiß, wie lange der Tote hier noch unentdeckt geblieben wäre. Dieser Bereich der Anlage steht schon seit Längerem still«, nahm Achim Scherenkind das Gespräch wieder auf.
»Darum sind die täglichen Kontrollgänge so wichtig«, fügte Kommandant Pulski mit kalter Boshaftigkeit hinzu.
»Als würde sich an seinem Ausgang etwas ändern. Wenn man gestorben ist, ist man tot. Die Kälte macht Arthur wohl auch nichts mehr aus.« Alexander schnaubte verächtlich. Er wusste nicht, wem seine Verachtung mehr galt, Pulski oder Achim.
»Dein Humor gefällt mir. Aber sieh es als göttliche Fügung. Wärst du nicht angeschossen worden, wer weiß, ob nicht du hier deinen Kopf verloren hättest statt diesem – wie war sein Name nochmal? Ist auch egal. Dieser Unfall sollte jedem eine Warnung sein. Niemand ist unsterblich. Wir alle müssen uns an die Vorschriften halten. Dieser Mann hat nicht nachgeschaut, ob das Rad auch tatsächlich fachmännisch blockiert wurde. Also Obacht geben. Du bist auch nur ein Deutscher. Dank einigen Leuten giltst du nicht als Kriegsverbrecher, obwohl ihr alle demselben Schoß einer Hure entsprungen seid. Du kannst von Glück sagen, dass du noch nicht tot bist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.« Pulski machte eine Pause, um das Gesagte sacken zu lassen. »Welcher Lebensweg für uns vorgesehen ist, wissen wir nicht. Doch deinen bestimme immer noch ich. Solange du mir keinen Grund gibst, dich auf der Stelle zu erschießen, darfst du leben. Doch sobald ich etwas finde, das mich dazu veranlasst, meine Ansichten zu ändern, werde ich nicht zögern.« Pulski grinste teuflisch. Sein blasses Gesicht wirkte wie das eines Toten. »Nun gut. Auch in der Zeit des Krieges können Deutsche uns behilflich sein. Genosse Koslov hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Mechanismus professionell zu blockieren, leider war seine Mühe umsonst, dem armen Kerl kann niemand mehr helfen. Jetzt liegt es in deinen Händen, diesen Platz zu säubern und die Mühle wieder in Gang zu bringen.« Mehr sagte Pulski nicht. Alexander einen Genossen zu nennen, lag unter seiner Würde. Er benutzte nur das eine Wort: du! Dann räusperte sich der Kommandant und richtete schnell den Kragen seines Mantels auf. Er klopfte Achim freundschaftlich auf die Schulter, drehte sich auf dem Absatz um, und dann verschwand er endlich. Als Pulski die schmale Treppe hinunterstieg, stimmte er ein patriotisches Lied an. Die Worte durchdrangen Alexander bis ins Mark und ließen ihn frösteln.