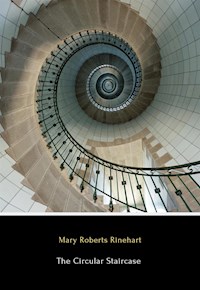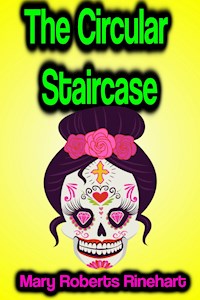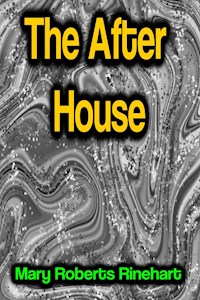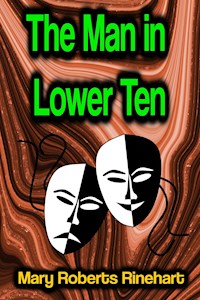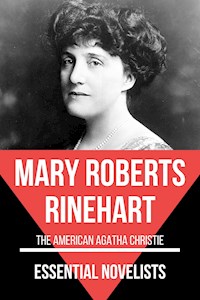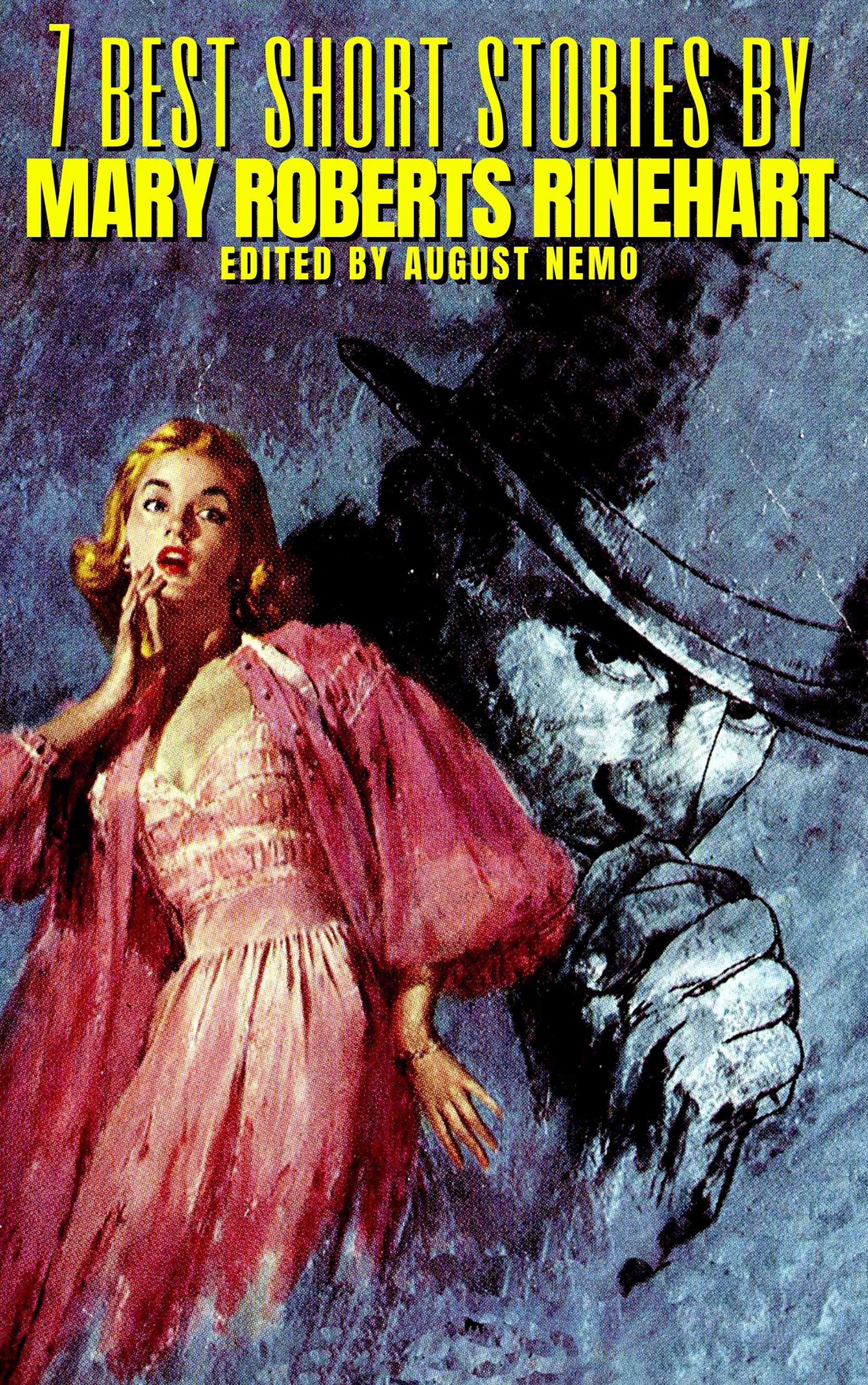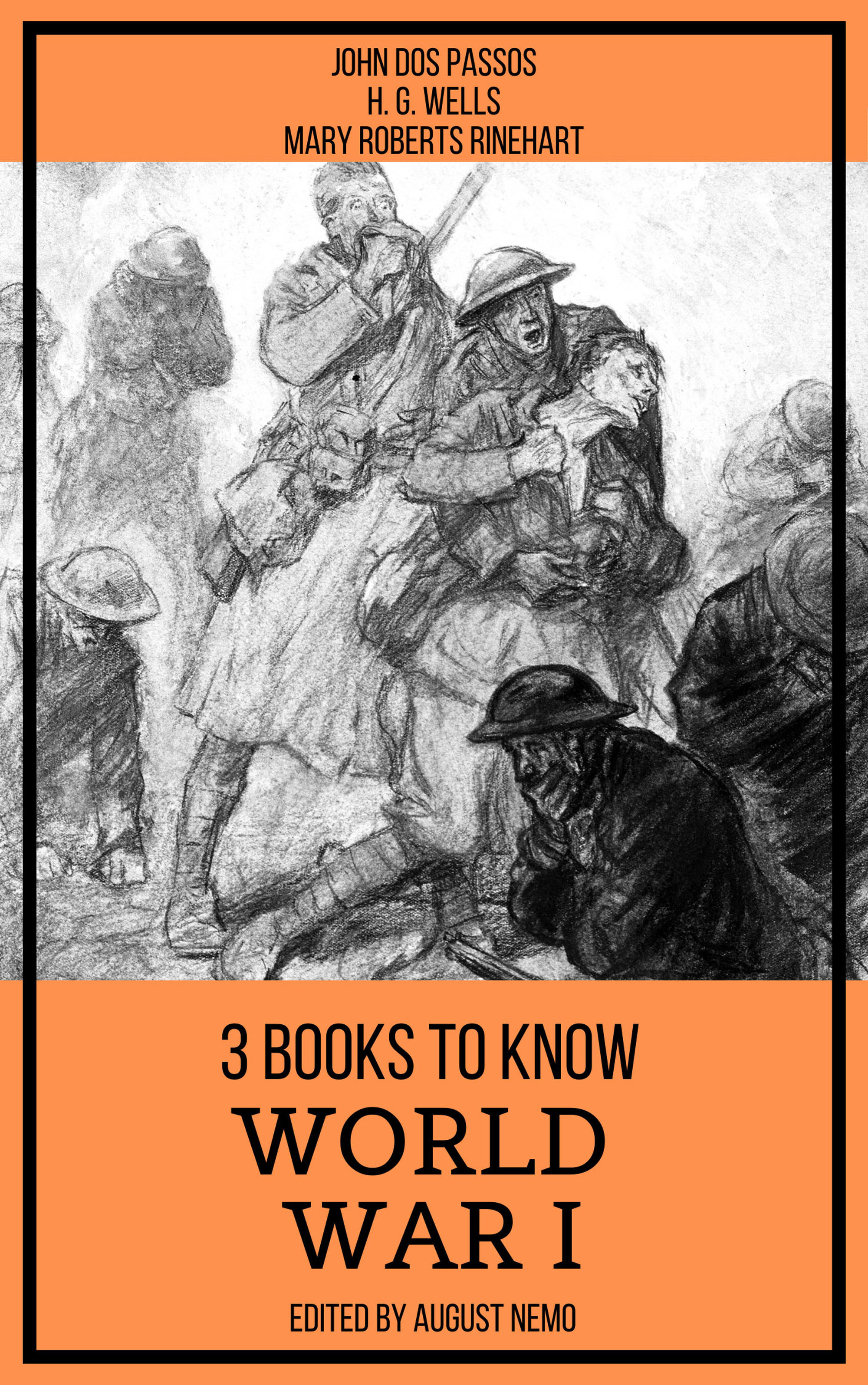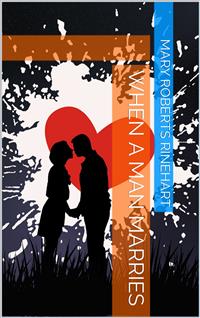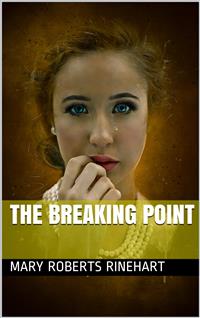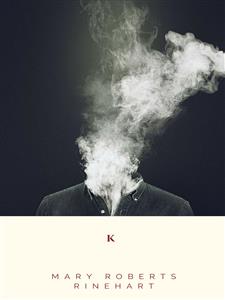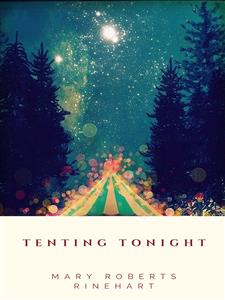3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Schwester Hilde Adams sanfte Hände bringen Kranken Linderung – und dem Mörder einen Strick … Als der Neffe der alten Dame Selbstmord begeht, will die scharfsinnige Krankenschwester der Sache auf den Grund gehen und begibt sich damit in tödliche Gefahr. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Ähnliche
Mary Roberts Rinehart
Miss Pinkerton oder Ein Fall für die feine Gesellschaft
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen
FISCHER Digital
Inhalt
Kleine Vorgeschichte
Es ist nun fünf Jahre her, seit George L. Patton mit einem Beinschuß ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Später leitete er eine große Privatdetektivagentur, und heute ist er Polizeiinspektor; aber damals war er noch Kreisdetektiv. Ich hatte gerade Nachtdienst, als sie ihn brachten.
Er war sehr ruhig, sagte, er werde die Gelegenheit benutzen, um sich ein wenig zu erholen, und schlief achtzehn Stunden hintereinander, ohne sich auch nur zu rühren.
Am selben Abend, an dem Mr. Patton eingeliefert wurde, hatten wir übrigens unseren ersten Zusammenstoß. Ich brachte ihm sein Essen, und nach einem Blick auf die Suppe und den Toast verlangte er ein Steak mit Zwiebeln.
»Tut mir leid«, sagte ich, »Sie sind für ein bis zwei Tage auf leichte Kost gesetzt.«
»Was hat denn mein Bein mit meinem Magen zu tun? Geben Sie mir ein anständiges Steak! Auf die Zwiebeln will ich meinetwegen verzichten, wenn es sein muß.«
»Ich halte mich an die ärztlichen Verordnungen, Mr. Patton«, entgegnete ich fest. »Sie können Rührei bekommen, wenn Sie wollen, aber kein Steak.«
Wir diskutierten eine Weile hin und her, und zu guter Letzt fand er sich mit der Suppe ab. Als er sie gegessen hatte, schaute er zu mir auf und schmunzelte.
»Sie sind mir zwar nicht sympathisch«, bemerkte er, »aber ich gebe zu, daß ich Respekt vor Ihnen habe. Unbedingter Gehorsam gehört zu den Dingen, die am allerschwersten zu erreichen sind. Und nun schicken Sie mir diesen Trottel von Assistenzarzt – ich will doch sehen, ob ich nicht wenigstens zum Frühstück ein Steak bekomme.«
Er bekam es, und sehr bald bekam er ungefähr alles, was ihm das Krankenhaus überhaupt bieten konnte. Natürlich spielte er politisch eine Rolle, und wir waren auf staatliche Unterstützung angewiesen, aber von mir jedenfalls erhielt er nichts, was nicht ausdrücklich bewilligt worden war. Er erklärte immer noch, mich nicht zu mögen; nach einer Weile jedoch hatte ich das Gefühl, ich sei ihm nicht mehr ganz so unsympathisch, und daß ich ihn beim Schach ein paarmal schlug, imponierte ihm.
»Sie sind intelligent, Miss Adams«, sagte er eines Tages zu mir, als er schon fast wiederhergestellt war. »Wollen Sie den Rest Ihres Lebens damit zubringen, Thermometer abzulesen und Kissen zurechtzuschütteln?«
»Ich habe daran gedacht, in die Ausbildungsarbeit zu gehen; da sind es wenigstens Menschen, die man hin und wieder zurechtschütteln muß«, erwiderte ich etwas bitter.
»Wie alt sind Sie? Keine Angst, ich sage es nicht weiter.«
»Neunundzwanzig.«
»Haben Sie Ihre Eltern noch, oder sonst Verwandte?«
»Meine nächsten Angehörigen sind zwei alte Tanten, die auf dem Land leben.«
Er schwieg eine Weile und meinte dann: »Ich habe nämlich eine Idee – vielleicht spreche ich noch mit Ihnen darüber. Das einzige Hindernis ist Ihr Aussehen. Sie sind zu hübsch.«
»Nicht wirklich«, entgegnete ich. »Ohne Haube habe ich eine viel zu hohe Stirn.«
»Schadet nichts; hohe Stirnen gefallen mir.«
Später brachte ich ihm einen Eierpunsch aufs Zimmer. Er saß im Lehnstuhl, und als ich ihm das Glas reichte, blickte er mich nachdenklich an. Er hatte übrigens noch nie einen Annäherungsversuch gemacht, im Gegensatz zu den meisten andern männlichen Patienten über Vierzig.
»Es liegt nicht nur an der Haube, Miss Adams«, bemerkte er lächelnd.
An jenem Nachmittag begann er plötzlich, mich über die andern Patienten auf der gleichen Etage auszufragen; aber ich erzählte ihm natürlich nichts, auch nicht, als er ärgerlich wurde und mich einzuschüchtern versuchte.
»Verstehen Sie denn nicht, daß Sie nur Ihre Zeit verschwenden?« sagte ich schließlich. »Wir geben keine Auskunft über andere Patienten, Mr. Patton. Wenn Sie etwas herausfinden wollen, müssen Sie schon einen Ihrer Detektive kommen lassen.«
Das schien ihn zu amüsieren, und zu meiner Überraschung fing er an zu lachen.
»Sehr gut!« erklärte er befriedigt. »Sie haben eine schwierige Prüfung mit Auszeichnung bestanden, Miss Adams. Sie sind verschwiegen, Sie halten sich an Ihre Vorschriften, und es steckt etwas hinter Ihrer berühmten hohen Stirn. Und jetzt will ich Ihnen meinen Vorschlag unterbreiten. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, daß fast bei jeder Krise in den Familien der sogenannten besseren Gesellschaft früher oder später eine Krankenpflegerin auftaucht?«
»Als Ursache oder Folge?«
»Als Folge natürlich. Sobald die Routine des normalen Familienlebens unterbrochen wird – durch einen Mord, einen Diebstahl oder ähnliche Ereignisse –, klappt jemand zusammen, legt sich ins Bett, und eine Pflegerin kommt ins Haus. Das ist das Resultat der ständigen Spannung, unter der die Leute leben. Es braucht nur eine zusätzliche Belastung, und schon ist der Knacks da. Und nun frage ich Sie: Wer hat eine größere Chance als die Pflegerin, Hintergründe, geheime Motive, die ganzen näheren Umstände in Erfahrung zu bringen? Sie sieht in alles hinein, nichts bleibt ihr verborgen, und – nein, gehen Sie jetzt auf Ihr Zimmer und überlegen Sie sich’s. Wenn es Sie interessiert, für uns zu arbeiten, habe ich einen Fall für Sie.«
Meine Einwände wollte er nicht hören; er ließ mich gar nicht erst zu Wort kommen. Da steckte ich ihm kurzerhand das Thermometer in den Mund und sagte ihm dann meine Meinung.
»Es ist ganz einfach nicht ehrlich«, schloß ich. »Sie verlangen von mir, daß ich meine Vertrauensstellung mißbrauche. Von einer Krankenschwester erwartet man, daß sie das Wohl ihrer Patienten im Auge hat und nicht das Gegenteil. Sie soll aufbauende, positive Arbeit leisten. In einem Haus zu pflegen und die Familiengeheimnisse auszuspionieren –«
Er riß sich mit einem Ruck das Thermometer aus dem Mund.
»Positive Arbeit!« wiederholte er zornig. »Ist es vielleicht keine positive Arbeit, einen Verbrecher an einen sichern Ort zu bringen, wo er der menschlichen Gesellschaft keinen Schaden mehr zufügt? Wenn Sie das Problem nicht von dieser Seite betrachten können, habe ich keine Verwendung für Sie. Gehen Sie jetzt und denken Sie darüber nach.«
In meinem Zimmer stellte ich mich vor den Spiegel und überlegte. Ich denke fast immer vor dem Spiegel nach; ich bespreche mich sozusagen mit mir selbst. Mein Gesicht zeigte mir deutlich, daß ich neunundzwanzig war, schon fast dreißig. Schwestern ausbilden, dachte ich und sah die langen eintönigen Jahre, sah mich einer Reihe von Regeln pflichtgetreu nachleben und dabei eng und schrullig werden. Dem gegenüber stand Mr. Pattons Angebot.
Ich erinnere mich noch sehr genau, wie eine leichte Röte in das Gesicht im Spiegel stieg. Ich würde meinen Verstand brauchen können, anstatt in sturem Gehorsam Anweisungen zu befolgen; ich würde meine Intelligenz mit der Intelligenz anderer messen können und vielleicht der überlegene Teil sein. Und ich würde Abenteuer erleben … Rasch zog ich eine meiner neuen Hauben an und ging hinunter zu Mr. Patton.
»Ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten«, sagte ich ruhig.
1
Als in jener Montagnacht das Telefon klingelte und ich schwerfällig aus dem Bett kroch, schien mir, ich sei eben erst eingeschlafen; ein Blick auf die Uhr belehrte mich jedoch, daß es kurz nach eins war. Natürlich gewöhnt man sich als Pflegerin an solche nächtlichen Störungen, aber ich hatte ausgerechnet diese Nacht etwas Schlaf nachholen wollen und war deshalb in keiner besonders freundlichen Stimmung, als ich den Hörer abnahm.
»Hallo?«
»Miss Adams? Hier ist Inspektor Patton.«
Er hätte sich nicht anzumelden brauchen; beim Klingeln des Telefons war ich gleich darauf gefaßt gewesen, daß die Polizei wieder einmal einen Fall für mich hatte.
»Rufen Sie ein Taxi und kommen Sie zum Mitchell-Haus in der Sylvan Avenue. Sie kennen doch das Haus?«
»Das kennt jeder. Was ist passiert?«
»Ich erzähle es Ihnen, sobald Sie hier sind. Wie lange brauchen Sie?«
»Ungefähr eine halbe Stunde«, erwiderte ich. »Aber ich hatte wirklich gehofft, diese Nacht ungestört schlafen zu können.«
»Ich auch«, gab er zurück und hängte auf.
Ich holte tief Atem und betrachtete mein Bett und die Tracht, die ich über eine Stuhllehne gelegt hatte, weil ich Knöpfe festnähen mußte. Dann warf ich einen Blick durch die offene Tür in mein kleines Wohnzimmer mit der neuen Chintz-Ausstattung und auf den Vogelkäfig, den ich sorgfältig zugedeckt hatte, um nicht von Dick, meinem Kanarienvogel, beim ersten Morgengrauen geweckt zu werden. Geweckt zu werden!
Meine Beziehung zur Mordkommission ist eigentlich nie genau definiert worden. Einmal sprach ein Polizeibeamter von mir als »Lockspitzel«, aber der Inspektor reagierte sehr sauer darauf. Ich habe ihn selten so wütend gesehen.
»Lockspitzel!« wiederholte er. »Was zum Teufel meinen Sie eigentlich damit, Burke? Miss Adams ist ein Mitglied dieser Abteilung, und ein verdammt wichtiges dazu. Wir haben genügend mit Blindheit geschlagene Stümper hier, die eine Menge von ihr lernen könnten, obwohl sie sich Detektive nennen!«
Manchmal nannte er mich Miss Pinkerton[1], aber das war nur ein Scherz zwischen uns. Ich habe nie behauptet, ein Detektiv zu sein. Meine Qualitäten bestehen vor allem in einem Paar guter Augen, die ich auch dort brauchen kann, wo die Polizei nicht hinsieht.
Und damit sind wir wieder bei dem neuralgischen Punkt angelangt: ich wollte sie gar nicht brauchen in jener Nacht. Ich wollte sie für mindestens elf Stunden schließen und am nächsten Morgen ausgehen und Besorgungen machen … Voller Ärger trug ich meinen kleinen Koffer hinunter und wartete vor dem Eingang auf das Taxi, damit nicht jedermann durch die Hausglocke geweckt würde.
Die Nachtluft erfrischte mich, und im Taxi versuchte ich mir vorzustellen, was mich wohl erwartete. Der Anruf des Inspektors war nicht sehr aufschlußreich gewesen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, daß etwas Schwerwiegendes geschehen sei. Was wußte ich überhaupt von dieser Familie Mitchell? Sie bestand, soweit mir bekannt war, nur aus zwei Personen: aus der alten Miss Juliet Mitchell und ihrem Neffen, einem gutaussehenden jungen Mann mit schwachem Kinn. Er war der einzige Sohn ihrer Schwester, die spät noch geheiratet hatte. Der Mann erwies sich als Taugenichts, und man erzählte sich von ihm, er habe erst das Geld seiner Frau und dann das von Miss Juliet durchgebracht. Ob das stimmte, konnte ich nicht beurteilen; außerdem war das Paar seit geraumer Zeit tot. Den Jungen hatten sie in der Obhut der verarmten Miss Juliet zurückgelassen.
Auch in einer großen Stadt wie der unsrigen gibt es immer eine oder mehrere führende Familien, und die Mitchells hatten während langen Jahren zu ihnen gehört. Man spricht von diesen Familien, und da ich viel herumkomme, bin ich stets ziemlich auf dem laufenden und wußte von den Schwierigkeiten, die der junge Herbert Wynne seiner Tante bereitete. Sie sorgte zwar dafür, daß er selten zu Hause war, aber auch in den verschiedenen Schulen, in die sie ihn steckte, und später im College führte er sich schlecht auf. Seit einiger Zeit wohnte er nun wieder bei seiner Tante und arbeitete, wenn sich gerade etwas bot und wenn es ihm paßte; meistens jedoch lungerte er herum. Er mußte jetzt etwa vierundzwanzig sein.
Es war allgemein bekannt, daß die beiden schlecht miteinander auskamen, und ich vermutete, es sei etwas zwischen ihnen vorgefallen – vielleicht war der Junge während einer Auseinandersetzung mit Miss Juliet tätlich geworden und hatte die alte Dame verletzt. Als das Taxi zwischen zwei alten eisernen Torflügeln hindurch in das Mitchellsche Grundstück einbog, überraschte es mich daher gar nicht, das Haus, das ich düster und verlassen in Erinnerung hatte, hell erleuchtet vor mir zu sehen.
Was ich allerdings nicht erwartet hatte, war der scharfe Ruck, mit dem das Taxi plötzlich stoppte. Der Fahrer beugte sich hinaus und rief wütend: »Können Sie denn nicht aufpassen? Mir direkt vor die Räder zu laufen!«
Nun sah auch ich die Gestalt vor uns am Rand der Auffahrt. Es war ein junges Mädchen.
»Warten Sie einen Moment, bitte!« sagte sie atemlos. »Ich muß mit Ihrem Fahrgast sprechen, ganz gleich, wer es ist.«
»Was gibt’s denn?« fragte ich.
Sie trat dicht vor den Wagen, und im Schein einer Straßenlampe betrachtete ich sie genauer. Sie war ein hübsches kleines Ding, vielleicht etwa zwanzig, in einem leichten Mantel und mit einer Baskenmütze. Es fiel mir auf, wie bleich und verstört sie aussah.
»Wissen Sie, was hier los ist?« erkundigte sie sich, noch immer atemlos. »Ist jemand verletzt?«
»Wahrscheinlich ist jemand krank. Ich bin Pflegerin.«
»Krank? Wieso steht denn ein Polizeiwagen vor dem Eingang?«
»Das weiß ich auch nicht. Wollen Sie nicht fragen? Ich glaube, es sind Leute unten in der Halle.«
Sie wandte sich um und starrte auf das Haus. »Man würde nicht nach einer Pflegerin schicken, wenn jemand – tot wäre«, murmelte sie vor sich hin. »Vielleicht ist eingebrochen worden, halten Sie das nicht auch für möglich? Daß die Leute aufgewacht sind und den Dieb gehört haben?«
»Kann sein«, meinte ich. »Kommen Sie mit, dann werden wir es bald wissen.«
Davor schreckte sie zurück. »Vielen Dank«, sagte sie, »aber ich glaube, ich gehe lieber. Man hat wohl nicht erwähnt, um was es sich handelt, als Sie angerufen wurden?«
»Nein. Ich habe wirklich keine Ahnung.«
Sie zögerte und blickte immer noch zum Haus hinüber. Plötzlich schien ihr einzufallen, daß ihre Anwesenheit eine Erklärung verlange, und sie wandte sich wieder zu mir.
»Ich fuhr draußen vorbei und sah all die Lichter und den Polizeiwagen. Wahrscheinlich ist es ja nichts Schlimmes, aber ich – hätten Sie wohl etwas dagegen, wenn ich Sie etwas später anriefe? Natürlich nur, wenn es nicht stört und Sie sicher sind, daß Sie noch aufsein werden.«
Nun schaute ich ebenfalls zu dem erleuchteten Haus hinüber, und vermutlich klang meine Stimme ziemlich grimmig, als ich antwortete.
»Es sieht nicht so aus, als ob ich diese Nacht viel zum Schlafen käme. Aber geben Sie mir für alle Fälle Ihren Namen, dann werde ich sagen, daß man mich rufen soll.«
Wieder zögerte sie. »Mein Name ist nicht wichtig«, bemerkte sie dann. »Wenn ich anrufe, wissen Sie ja, wer es ist.«
Damit ging sie, und ich sah ihr nach, wie sie sich durch das Tor entfernte. Ich erinnerte mich jetzt, daß ich draußen einen kleinen Sportwagen gesehen hatte; wahrscheinlich gehörte er ihr. Aber einen Augenblick später, als das Taxi mit einem halsbrecherischen Ruck anfuhr, hatte ich sie schon vergessen.
2
Dr. Stewart, den ich vom Sehen kannte, kam mir an der Tür entgegen.
»Sie sind wohl Miss Adams?«
»Jawohl.«
»Sie finden Ihre Patientin oben in dem großen Zimmer, das über der Halle liegt. Die Köchin ist bei ihr, und ich werde auch gleich kommen. Ich habe ihr eine Spritze gegeben; sie wird sich jetzt sicher rasch beruhigen.«
»Hat sie denn einen Schock gehabt?«
Er senkte die Stimme. »Ihr Neffe hat heute nacht Selbstmord begangen.«
»Hier?«
»Hier in diesem Haus. Im dritten Stock.«
Dr. Stewart war von kleinem Wuchs und bei allen Schwestern bekannt dafür, daß er am Krankenbett sehr liebenswürdig und im Umgang mit Untergebenen sehr reizbar sein konnte.
»Ich gehe also hinauf«, sagte ich ruhig.
Der Inspektor war in der Halle, aber er streifte mich nur mit einem raschen Blick wie immer, wenn ich für ihn arbeite. Auch der medizinische Experte beachtete mich nicht. Ein Polizist in Uniform nahm meinen Handkoffer und winkte mir, ihm zu folgen.
»Schlimme Sache, Miss«, bemerkte er. »Die alte Dame fand ihn; sie wollte nachsehen, ob er schon zu Hause sei.«
»Auf welche Weise brachte er sich um?« fragte ich.
»Er schoß sich in die Stirn«, erwiderte der Polizist. »Kniend, vor dem Spiegel. Ein wirklich trauriger Fall«, fügte er pathetisch hinzu.
»Sehr traurig«, bestätigte ich, und plötzlich dachte ich an das junge Mädchen und an ihren verstörten Gesichtsausdruck. Wahrscheinlich hatte sie etwas geahnt. Wenn sie später anrief, würde ich es ihr sagen müssen.
Der Gedanke daran beschäftigte mich noch, als ich in einen kleinen Raum trat, wo ich meinen Mantel ablegte. Vom anstoßenden Schlafzimmer her drangen Stimmen an mein Ohr; die eine leise und monoton, wie Schwerhörige reden, die andere schrill und hysterisch.
»Sie sollten wirklich nicht so viel sprechen, Miss Juliet. Ihm ist jetzt wohl, und er hat keinen Kummer mehr.« Das war die schrille Stimme.
Dann folgte etwas, das ich nicht verstand, und wieder die schrille Stimme:
»Es war ein Unfall; ich hab es Ihnen schon hundertmal gesagt. Sie wissen, daß er niemals den Mut dazu gehabt hätte. Als ich um acht hinaufging, um sein Bett zu richten, traf ich ihn beim Reinigen seines Revolvers an, und auf diese Weise ist es ihm passiert.«
Meine Ankunft war Miss Juliet offenbar nicht gemeldet worden, und ich beschloß, mich noch nicht gleich zu zeigen. Statt dessen verließ ich lautlos das Zimmer und stieg die Treppe zum dritten Stock hinauf. Was ich suchte, war leicht zu finden, denn auch hier brannten alle Lichter, und oben sah ich durch eine offene Tür einen Polizisten, der zeitunglesend auf einem Stuhl saß.
Der Tote lag in einer seltsam gekrümmten Stellung auf der Seite, die Knie leicht angezogen und einen Arm ausgestreckt. Eine Waffe konnte ich nirgends entdecken.
Als der Polizist mich bemerkte, faltete er die Zeitung verlegen zusammen. »Ich muß Sie bitten, das Zimmer nicht zu betreten, Miss«, erklärte er. »Befehl des Inspektors.«
»Ich habe nicht die Absicht hineinzukommen«, entgegnete ich. »Können Sie mir vielleicht sagen, wo die Köchin ist? Ich brauche ein wenig warmes Wasser.«
»Ich hab sie nirgends gesehen, Miss.«
Ich tat, als wollte ich gehen, zögerte jedoch und starrte auf die Leiche. »Es besteht wohl kein Zweifel, daß es sich um Selbstmord handelt?«
»Selbstmord oder Unfall, wenn Sie mich fragen, Miss. Es wird alles untersucht werden«, erwiderte er kurz und entfaltete wieder seine Zeitung. Das beendete das Gespräch, aber mein Interesse war nun geweckt. Unfall oder Selbstmord, und die Mordkommission an der Arbeit!
Es war kurz nach halb zwei, als ich wieder hinunterging – gerade noch rechtzeitig, denn eben kam Dr. Stewart von der Halle herauf. Glücklicherweise blieb er auf dem Treppenabsatz einen Moment stehen, um sich die Glatze abzuwischen, so daß ich das Schlafzimmer ohne Hast betreten konnte. Miss Juliet lag, von zahlreichen Kissen gestützt, in ihrem breiten Nußbaumbett, und eine bleiche, neurotisch aussehende kleine Frau, die ich auf ungefähr fünfzig schätzte, saß neben dem Bett und hielt ihr die Hand. Als sie mich sah, erhob sie sich.
»Sie ist schon viel ruhiger, Miss«, sagte sie. »Sprechen Sie laut mit ihr; sie ist schwerhörig.«
Ich warf einen Blick auf Miss Juliet und erkannte sofort, weshalb sie ruhiger war. Sie lag in einem Koma, und ihr Puls schlug nur noch ganz schwach.
»Dr. Stewart!« rief ich. »Dr. Stewart!«
Er war sofort da, und in den nächsten paar Minuten arbeiteten wir fieberhaft. Ich bereitete eine Nitroglyzerinspritze vor, während Dr. Stewart ständig Miss Juliets Puls kontrollierte. Niemand sprach, während wir darauf warteten, daß die Spritze sie wieder ins Leben zurückrufen würde.
»Seltsam«, meinte Dr. Stewart schließlich. »Natürlich stand sie noch unter der Schockwirkung mit den üblichen Symptomen: Unruhe, gerötetes Gesicht, stark erhöhter Puls. Außerdem hat sie ein schwaches Herz und Sklerose der Koronararterien, aber das alles erklärt nicht, wieso sie in ein Koma fiel. Als ich sie verließ, war sie schon ruhiger. Wissen Sie, ob sie sich über etwas sehr aufgeregt hat?«
»Ich bin erst sehr kurze Zeit im Zimmer.«
»Und Sie, Mary? Haben Sie etwas bemerkt?«
»Nein, nichts. Ich weiß nicht. Ich unterhielt mich mit ihr.«
»Erwähnten Sie vielleicht etwas, das sie beunruhigte?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich redete ihr zu, und sie wurde ruhiger. Einmal hat sie sich zwar plötzlich im Bett aufgesetzt und ihre Pantoffeln verlangt, aber dann hat sie nicht mehr darauf bestanden und sich wieder in die Kissen zurückgelegt.«
»Sie verlangte ihre Pantoffeln?«
»Ich glaube, sie wollte noch einmal in sein Zimmer hinauf. Ihn noch einmal sehen.«
»Sie sagte aber nichts dergleichen?«
»Nein.«
Dr. Stewart überlegte einen Moment.
»Und Sie machten keine Andeutung, daß er Selbstmord begangen haben könnte?«
»Warum sollte ich? Der und Selbstmord! Er war ein Feigling durch und durch. So was begeht keinen Selbstmord. Ich bin sicher, daß es ein Unfall war.«
Während sie sprach, musterte sie mich feindselig. Das war mir an sich nicht neu; ich mache immer wieder die Erfahrung, daß Dienstboten, besonders alte, einer Krankenschwester mit Mißtrauen begegnen. Aber seltsamerweise kam es mir so vor, als ob sie nicht eifersüchtig oder mißtrauisch sei, sondern eher ängstlich. Sie schien sich vor mir zu fürchten, und es war mir auch aufgefallen, wie schrill sie darauf bestanden hatte, daß es ein Unfall gewesen sei.
»Wieso sollte die arme Lady übrigens keinen Schwächeanfall kriegen?« fragte sie herausfordernd. »Nach allem, was sie durchgemacht hat. Und nicht nur diese Nacht«, fügte sie bedeutungsvoll hinzu.
Miss Juliet brauchte lange, bis sie zu sich kam, und dann dauerte es noch eine ganze Weile, bis Dr. Stewart den Eindruck hatte, er könne mit ruhigem Gewissen gehen. Er ließ mir ein paar Amylnitrit-Ampullen und zwei Röhrchen Nitroglyzerintabletten da, aber er sah immer noch besorgt aus, als ich ihm in den Korridor hinaus folgte.
»Seltsam«, wiederholte er, »dieser Zusammenbruch. Natürlich hat sie einen Schock gehabt, aber den hatte sie bereits überwunden, und außerdem hing sie nicht an dem Jungen – es bestand kein Anlaß dazu. Ich frage mich immer noch, ob Mary nicht irgendeine Bemerkung gemacht hat, die diese Ohnmacht auslöste. Wir haben Miss Juliet gegenüber an der Unfallversion festgehalten, verstehen Sie; wenn sie jedoch erfuhr, daß es Selbstmord war oder daß man die Möglichkeit mindestens in Betracht zieht, hätten wir des Rätsels Lösung.«
»Ich hörte zufällig, wie Mary ihr versicherte, daß es ein Unfall gewesen sei.«
»Das heißt also, daß –« er beendete den Satz nicht, denn von unten ertönten plötzlich schwere Schritte. Ich hatte den Mann, der langsam die Stufen heraufkam, schon irgendwo gesehen, und als er auf dem Treppenabsatz stehenblieb, fiel mir ein, wer er war: Mr. Glenn, der bekannte Rechtsanwalt.
»Wie geht es ihr?« fragte er und stieg die letzten Stufen herauf.
»Nicht allzu gut. Besser als noch vor ein paar Minuten; mehr kann ich nicht sagen.«
»Was halten Sie eigentlich von der Geschichte, Stewart? Weshalb hat er sich umgebracht? Hat er spekuliert?«
»Mit was sollte er spekuliert haben?« fragte der Arzt trocken zurück.
»Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Glauben Sie, daß ein Mädchen im Spiel war?«
»Ich glaube gar nichts, und es geht mich auch nichts an.«
Sie gingen zusammen hinunter, und ich zog mich wieder in das Krankenzimmer zurück.
Draußen hörte man auf der Treppe tastende, langsame Tritte und unterdrücktes Keuchen: Die Leiche wurde weggebracht. Mary atmete schwer und wurde ganz bleich, aber als der Transport an unserer Tür vorbei war, schoß sie plötzlich auf und hinaus in den Korridor. Mit allen Zeichen der Erregung kam sie kurz danach zurück.
»Hugo!« stieß sie hervor. »Sie haben ihn mitgenommen, Miss!«
»Wer ist Hugo?«
»Mein Mann. Was will die Polizei von ihm? Er weiß nichts. Er schlief neben mir im Bett, als Miss Juliet draußen an die Tür hämmerte und uns aufweckte.«
Aus ihrem hysterischen Gerede konnte ich mir zusammenreimen, daß Hugo und Mary schon seit Jahren die einzigen Dienstboten im Haus sein mußten. Früher einmal war Hugo als Butler und Mary als Köchin angestellt gewesen, aber mit der Zeit hatte Miss Juliet alle andern Dienstboten entlassen. Hugo versah nun die Stelle eines Hausknechts, Dieners und Butlers in einer Person, und Mary war jeden Abend so müde, daß ihr »fast die Füße abfielen«.
Es stellte sich heraus, daß sie und Hugo zwei Zimmer im zweiten Stock bewohnten, die ursprünglich zu den Räumlichkeiten der Familie gehört hatten und mit diesen durch eine Tür verbunden waren. Die Tür wurde jedoch nicht mehr benutzt und blieb stets verschlossen und verriegelt. Ich begleitete Mary hinunter und wartete in der Küche, bis sie mühsam die Hintertreppe emporgeklettert war.
Als ich noch dort stand und wartete, glaubte ich plötzlich, draußen an der Hausmauer ein leichtes Geräusch zu hören, als ob sich jemand ins Gebüsch drückte.
Vielleicht spielten mir meine Nerven einen Streich, oder es war ein Hund, aber die Sache gefiel mir nicht. Und da kam es auch schon wieder – etwas oder jemand strich deutlich an der Hausmauer entlang.
3
Ich hatte keine Lust mehr, Nachforschungen anzustellen; ich ging so rasch als möglich zu meiner Patientin zurück. Es muß etwas nach halb drei Uhr früh gewesen sein, als ich eine Weile später die Tracht auszog und in meinen Morgenrock schlüpfte.
Miss Juliet schlief friedlich, und ihr Puls war viel besser. Obwohl mir der Schreck von vorhin noch in den Knochen saß, zwang ich mich, ruhig alles für den Rest der Nacht vorzubereiten. Ich richtete mir ein Lager auf dem Sofa am Fußende des großen Nußbaumbettes und ordnete im anstoßenden kleinen Raum meine Medikamente auf einem Tablett.
Das Haus war voller unheimlicher Geräusche in dieser Nacht. Es ächzte und knarrte überall im Gebälk, obwohl draußen kein Wind wehte, und als ich das Fenster öffnete, begann es auch in den Möbeln zu knacken. Natürlich wußte ich, daß dies nur dem Temperaturunterschied zuzuschreiben war, aber es hörte sich genauso an, als ob eine unsichtbare Geisterhand auf das Holz trommelte.
Trotzdem muß ich wohl für eine Weile eingenickt sein, denn es dauerte lange, bis ein noch lauteres Geräusch in mein Bewußtsein drang. Es schien vom Fenster herzukommen. Ich erhob mich schlaftrunken und stellte fest, daß jemand Kieselsteine gegen den Fensterrahmen warf – eine Methode, die Inspektor Patton öfter anwendet, wenn er mich sprechen will.
Ich eilte sogleich hinunter und öffnete die Haustür. Die Dämmerung war noch nicht angebrochen, aber das schwache Licht einer Straßenlampe fiel auf das Gesicht des Inspektors.
»Wie geht’s der alten Dame?« fragte er.
»Sie schläft tief. Dr. Stewart hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben.«
Er kam nicht herein, sondern setzte sich draußen auf eine Treppenstufe, zog seine Pfeife aus der Tasche und zündete sie an.
»Ich will Ihnen erzählen, was wir bis jetzt herausfanden«, begann er, »aber hol’s der Teufel, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Von Wynne wissen wir, daß er beim Abendessen offensichtlich in bester Stimmung war und danach bis fast um neun seine automatische Pistole reinigte und ölte. Die Köchin ging etwa um acht in sein Zimmer, um das Bett abzudecken, und sie sagt aus, daß er ganz vergnügt an dem Schießeisen manipuliert habe. Kurz vor neun hörte ihn Hugo, der Butler, die Treppe hinuntersteigen und das Haus verlassen. Hugo behauptet, Wynne habe vor sich hin gepfiffen, als er die Treppe hinunterging. Das heißt mit andern Worten, daß die Selbstmordtheorie auf schwachen Füßen steht, wenn wir uns nur auf Hugos Aussage stützen.
Die Polizeiwache des Bezirks ist um Viertel nach zwölf alarmiert worden. Ein Polizeileutnant hat sich sogleich an den Tatort begeben, hat eine allgemeine Bestandsaufnahme gemacht und auf der Stelle entschieden, daß es sich um Selbstmord handle.
Scheint ein besonders heller Bursche zu sein«, meinte der Inspektor trocken. »Wie denkt der sich wohl einen Selbstmord ohne Pulverspuren? Außerdem sollte man in der ersten Stunde nach dem Tod eintreffen, um so etwas entscheiden zu können. Am besten schon in den ersten fünf Minuten, aber das kommt natürlich selten vor.«
»Dann fanden sich also keine Pulverspuren an der Leiche?«
»Keine. O’Brien brauchte zehn Minuten, bis er das herausgefunden hatte!«
Aber es war ihm schließlich doch aufgefallen, und er hatte unverzüglich die Polizeizentrale angerufen.
Glücklicherweise war der Inspektor noch in seinem Büro gewesen; er fuhr sofort los und langte um Viertel vor eins bei dem Mitchell-Haus an. Er habe genau zwei Minuten gebraucht, erwähnte er mit einem Anflug von Stolz, um festzustellen, daß es weder Selbstmord noch Unfall war. Daraufhin ließ er seine Leute kommen und rief mich an.
»Und was waren denn das für Beobachtungen, die Sie in zwei Minuten gemacht haben?«
»Nun, die Einschußstelle ist mitten in der Stirn; das bedeutet, daß der Junge auf der Stelle zusammenbrach, nachdem ihn die Kugel getroffen hatte. Aber wo war er, als man ihn fand? Er lag vor dem Sekretär auf dem Boden. Gut. O’Brien dachte zuerst, er habe vor dem Spiegel gestanden, als er abdrückte. Aber welchen Lauf hätte in diesem Fall die Kugel genommen? Sie hätte seinen Kopf durchbohrt und wäre über dem Bett in die Wand gedrungen. In Wirklichkeit nahm sie jedoch einen ganz andern Lauf; sie schlug rechtwinklig zum Bett in die Backsteinverkleidung des Kamins ein und prallte ab. Ich fand sie auf dem Fußboden.«
»Vielleicht stand er eben nicht vor dem Spiegel«, bemerkte ich und versuchte mir die Situation vorzustellen.
»Vielleicht nicht. Aber falls er sich tatsächlich selbst erschoß, muß er es stehend getan haben. Es gibt keinen Stuhl vor dem Sekretär. Interessant ist nur, daß die Kugel, die seinen Kopf in einer geraden Linie durchschlug, nicht höher als etwa einen Meter zwanzig über dem Fußboden auf die Backsteinverkleidung aufprallte. Herbert Wynne aber war ziemlich groß, fast einsachtzig. Verstehen Sie nun, was ich meine?«
»Könnte er sich denn nicht kniend erschossen haben?«
Er nickte beifällig. »Möglich wäre es. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Selbstmörder sich oft vor dem Hinfallen fürchten und Kissen oder Decken auf dem Boden ausbreiten, bevor sie sich erschießen. Und die Stellung, in der man Wynne fand – er hatte die Knie leicht angezogen – deutet ebenfalls auf diese Möglichkeit hin. Aber damit ist das Rätsel der fehlenden Pulverspuren immer noch nicht gelöst. Man schießt sich nicht durch den Kopf, ohne daß nachher mehr zu sehen ist als gerade nur ein sauberes kleines Loch. Es kann natürlich auch sein, daß er die Pistole fixierte und denAbzug mittels irgendeiner Vorrichtung aus der Distanz betätigte. Die Dienstboten oder Miss Juliet hätten genügend Zeit gehabt, alle Spuren einer solchen Vorrichtung zu beseitigen.«
»Und ein Unfall war es auch nicht?«
»Jedenfalls spricht sehr viel dagegen; unter anderem, daß Wynne im College Mitglied eines Pistolen-Klubs war und also wußte, wie man mit einem Schießeisen umgeht. Abgesehen davon ereignen sich die meisten solchen Unfälle während des Reinigens der Waffe und nicht zwei oder drei Stunden später. Wynne reinigte die Pistole, bevor er ausging; Öl und Lappen ließ er auf dem Sekretär liegen. Aber was mich interessiert, ist folgendes: wenn es ein Unfall war, warum sieht es dann wie ein Selbstmord aus? Die Pistole auf dem Boden, die angezogenen Knie, als ob Wynne vor dem Spiegel gekniet hätte, und die Kugel, die in gerader Linie durch den Kopf drang – wo war die Pistole, und wo war Wynne, als der Schuß losging?«
»Hörte denn überhaupt jemand den Schuß?«
»Nein. Aber das hat nicht viel zu bedeuten. Hugo und Mary waren ziemlich weit vom Tatort entfernt, und die alte Dame ist stocktaub. Wann genau der Schuß fiel, steht nicht fest. Stewart meint, daß Wynne noch keine volle Stunde tot war, als er eintraf, und der medizinische Experte glaubt, der Tod sei etwa um Viertel nach elf eingetreten; aber das sind alles nur Vermutungen. Auch ich kann vorläufig nur Vermutungen anstellen – zum Beispiel, daß dieser Mord, falls es sich überhaupt um einen Mord handelt, eine interne Angelegenheit ist.«
»Eine interne Angelegenheit? Was meinen Sie damit?« fragte ich. »War denn außer Miss Juliet und den beiden Dienstboten noch jemand im Haus?«
»Anscheinend keine Menschenseele. Und nun überlegen Sie einmal selbst: sogar wenn wir trotz der fehlenden Pulverspuren annehmen, daß sich der Junge selbst erschoß, haben wir immer noch keine Erklärung dafür, weshalb er um neun das Haus pfeifend verließ und zwei Stunden später Selbstmord beging. Und warum hatte er in seinem Schrank einen neuen Koffer, der zur Hälfte gepackt war? Für die Reise ins Jenseits braucht man keine seidenen Pyjamas.«
Ein leichter Schauder überlief mich bei seinen Worten, und der Inspektor sah mich besorgt an.
»Sie gehen jetzt wohl besser schlafen«, sagte er. »Ich werde Ihre Hilfe bei diesem Fall brauchen, und ich will nicht, daß Sie sich hier erkälten. Die Geschichte der alten Dame kann ich Ihnen am Morgen immer noch erzählen.«
Ich weigerte mich jedoch, zu Bett zu gehen, bevor ich alles gehört hatte, ich sah nur rasch nach Miss Juliet und holte mir meinen Mantel.
Miss Juliet lag immer noch ruhig da, und ihr Puls war ziemlich regelmäßig, aber obwohl sie die Augen geschlossen hielt, hatte ich das Gefühl, sie stelle sich nur schlafend.
Als ich wieder hinunterkam, saß der Inspektor in einer merkwürdig gespannten Haltung auf der Treppenstufe, als lauschte er angestrengt. Er bedeutete mir, leise zu sein, und dann, plötzlich und ohne Warnung, war er mit einem Satz um die Hausecke verschwunden. Volle fünf Minuten vergingen, bis er zurückkehrte.
»Ich brauche vermutlich etwas Schlaf«, sagte er verdrießlich.
»Aber ich könnte schwören, daß ich dort hinten beim Gebüsch ein Geräusch gehört habe.«
Ich berichtete ihm von meinem eigenen Erlebnis früher in der Nacht, und er machte einen zweiten Rundgang, aber auch diesmal ohne Erfolg. Daraufhin setzte er sich nicht wieder, sondern blieb stehen, bereit, sich beim geringsten verdächtigen Laut sofort in die Dunkelheit zu stürzen. Aber so konzentriert wir auch lauschten, es war nichts zu hören.