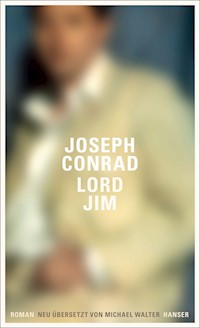9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joseph Conrad, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
»Mit den Augen des Westens« zeigt die Menschen im Bann der Täuschung und auswegloser Isoliertheit – ein großer politischer Roman Joseph Conrads Als Rasumow, ein gewöhnlicher junger Mensch, auf Studium und Karriere bedacht, vom Fanatiker Haldin zum Mitwisser eines Ministermordes gemacht wird, gerät sein ganzes Leben in Unordnung. Er verrät den Mörder an den Zaren – und wird zum Lohn im Dienst der Gegenspionage nach Genf geschickt, wo er die bolschewistischen Beschwörer beobachten soll. Diese aber nehmen ihn als einen der ihren auf und bringen ihm den Glauben an die Kraft der Revolution zu Frieden und Versöhnung bei. Bewegt von der jungen Natalie verrät Rasumow verrät sich selbst und muss grausame Rache erdulden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Joseph Conrad
Mit den Augen des Westens
Roman
Über dieses Buch
Als Rasumow, ein gewöhnlicher junger Mensch, auf Studium und Karriere bedacht, vom Fanatiker Haldin zum Mitwisser eines Ministermordes gemacht wird, gerät sein ganzes Leben in Unordnung. Er verrät den Mörder an den Zaren – und wird zum Lohn im Dienst der Gegenspionage nach Genf geschickt, wo er die bolschewistischen Beschwörer beobachten soll. Diese aber nehmen ihn als einen der ihren auf und bringen ihm den Glauben an die Kraft der Revolution zu Frieden und Versöhnung bei. Bewegt von der jungen Natalie verrät Rasumow verrät sich selbst und muss grausame Rache erdulden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Joseph Conrad, geboren 1857, wuchs als Waise bei seinem Onkel in Krakau auf. 1874 ging er zunächst nach Frankreich, wurde 1886 britischer Staatsbürger und machte als Seemann seine Leidenschaft zum Beruf. Als er 1890 die Seefahrt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, verarbeitete er seine Reiseerlebnisse in seinen Erzählungen. ›Lord Jim‹ (1900) und ›Das Herz der Finsternis‹ (1902) gehören zu seinen berühmtesten Werken. Joseph Conrad starb 1924 in England.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Vorbemerkung des Autors
Erster Teil
I
II
III
Zweiter Teil
I
II
III
IV
V
Dritter Teil
I
II
III
IV
Vierter Teil
I
II
III
IV
V
Agnes Tobin gewidmet, die ihre Begabung zur Freundschaft vom Rande der westlichsten Küste zu uns brachte.
»Ich würde nach der Freiheit greifen wie der Hungernde nach einem Stück Brot, ganz gleich, welche Hand es austeilt.«
Natalie Haldin
Vorbemerkung des Autors
Es muß zugegeben werden, daß ›Mit den Augen des Westens‹ allein schon durch den Ablauf der Ereignisse eine Art historischer Roman geworden ist; er befaßt sich mit Vergangenem. Diese Überlegung beruht ausschließlich auf den Geschehnissen der Erzählung; da die im ganzen jedoch ein Versuch ist, weniger den politischen Zustand als vielmehr die eigentliche Psychologie Rußlands darzustellen, wage ich zu hoffen, daß das Buch nicht all seinen Reiz eingebüßt hat. In dieser schmeichelhaften Hoffnung werde ich bestärkt, wenn ich sehe, wie in zahlreichen Artikeln über gegenwärtige russische Zustände auf gewisse Äußerungen Bezug genommen wird, die sich auf den folgenden Seiten finden – Bezug genommen in einer Weise, die die Klarheit meiner Anschauung und die Richtigkeit meines Urteils bestätigt. Ich brauche nicht zu sagen, daß ich beim Schreiben dieses Romans kein anderes Ziel hatte, als auf phantasievolle Weise jene allgemeingültige Wahrheit, die der Handlung zugrunde liegt, auszudrücken und zugleich meine Überzeugungen hinsichtlich der moralischen Beschaffenheit gewisser Tatsachen, die der ganzen Welt mehr oder weniger bekannt sind.
Was das eigentliche Schreiben angeht, so darf ich sagen, daß ich zu Beginn eine genaue Vorstellung nur vom ersten Teil hatte, dessen drei Gestalten Haldin, Rasumow und Rat Mikulin mir bereits fest umrissen vorschwebten. Erst nachdem ich diesen Teil beendet hatte, enthüllte sich mir die Handlung in ihrer ganzen Tragik und im Ablauf ihrer Ereignisse als so zwingend und so weitgespannt, daß sie meinen schöpferischen Instinkten und den dramatischen Möglichkeiten des Gegenstandes allen Spielraum ließ.
Der Gang der Handlung bedarf keiner Erläuterung. Ich folgte dabei mehr einem Gefühl als einem Plan, und er spiegelt auch kein besonderes Erlebnis wider, sondern entstammt mehr einem durch ernstes Nachdenken gestärkten Allgemeinwissen. Größte Sorge bereitete mir die Frage, ob ich imstande sein würde, den Ton gewissenhafter Unparteilichkeit zu treffen und durchzuhalten. Die Verpflichtung zu äußerster Fairness ist mir durch Geschichte und Erbgang, durch die besondere Erfahrung meiner Nation und meiner Familie auferlegt und tritt noch zu der mir innewohnenden Überzeugung hinzu, daß einzig die Wahrheit Erfindungen rechtfertigt, die den Anspruch machen, Kunst zu sein, oder die darauf hoffen dürfen, im zeitgenössischen Kulturleben einen Platz einzunehmen. Nie zuvor habe ich mich so um Distanz bemühen müssen: Distanz von allen Leidenschaften, Vorurteilen und selbst von persönlichen Erinnerungen. Bei seinem Erscheinen in England wurde ›Mit den Augen des Westens‹ vom Publikum nicht gut aufgenommen, vielleicht eben gerade dieser meiner Zurückhaltung wegen. Ich erhielt meinen Lohn etwa sechs Jahre später, als ich erfuhr, daß das Buch überall in Rußland Anerkennung gefunden und viele Neuauflagen erlebt hatte.
Auch die verschiedenen Gestalten, die in der Erzählung eine Rolle spielen, verdanken ihr Dasein nicht einem persönlichen Erlebnis, sondern allein dem allgemein vorhandenen Wissen um die Zustände in Rußland und um die moralischen und gefühlsmäßigen Reaktionen des russischen Charakters auf den Druck ungesetzlicher Tyrannei, die sich auf die allgemein menschliche Formel bringen lassen: blindwütige Verzweiflung, verursacht durch blindwütige Unterdrückung. Ich beschäftigte mich hauptsächlich mit der Erscheinung, dem Charakter und dem Schicksal der Individuen, wie sie die westlichen Augen des alten Sprachlehrers sehen. Dieser selbst ist scharf getadelt worden; doch will ich es zu dieser späten Stunde nicht mehr unternehmen, sein Dasein zu rechtfertigen. Er war mir nützlich, und daher glaube ich, daß er auch dem Leser nützlich sein muß, sowohl als Kommentator als auch durch die Rolle, die er für die Entwicklung der Handlung spielt. Da ich wünschte, den Eindruck gegenwärtigen Geschehens zu vermitteln, schien mir ein Augenzeuge der Ereignisse in Genf unumgänglich zu sein. Auch benötigte ich einen Menschen, der Fräulein Haldin Zuneigung entgegenbringt, da sie sonst zu einsam, bar jeder Unterstützung und somit unglaubwürdig gewesen wäre. Es wäre dann niemand dagewesen, den sie einen Blick auf ihre idealische Gläubigkeit, in ihr großes Herz und auf ihre schlichten Gefühle hätte tun lassen können.
Rasumow ist mit Anteilnahme geschildert. Warum auch nicht? Er ist ein gewöhnlicher junger Mensch, gesund, arbeitsfähig und von vernünftigem Ehrgeiz. Er hat ein durchschnittliches Gewissen. Wenn er etwas absonderlich erscheint, dann nur, weil er sich seiner Stellung im Leben ungemein deutlich bewußt ist. Da er keine Eltern hat, empfindet er schärfer als andere, daß er Russe ist – oder gar nichts. Er hat durchaus recht, wenn er ganz Rußland als sein Erbteil betrachtet. Die blutrünstige Sinnlosigkeit der Verbrechen und Opfer, die brodelnd aus der ungeformten Masse aufsteigt, hüllt ihn ein und drückt ihn zu Boden. Ich glaube aber nicht, daß er in all seiner Verzweiflung je monströs wirkt. Niemand wird hier als Ungeheuer dargestellt – weder die einfältige Tekla noch die verbohrte Sofia Antonowna. Peter Iwanowitsch und Madame de S. verstehen sich von selbst. Sie sind die äffischen Bewohner eines unheimlichen Dschungels und finden die Behandlung, die ihre Fratzen verdienen. Und Nikita – der den Spitznamen Nekator trägt –, er ist die perfekte Blüte dieser Wildnis des Terrors. Was mir bei dieser Gestalt die größte Mühe verursachte, ist nicht ihre Ungeheuerlichkeit, sondern ihre Banalität. Seit Jahren sind der Öffentlichkeit in Zeitungsartikeln, Geheimberichten und Sensationsromanen Enthüllungen über diese Gestalt gemacht worden.
Die erschreckendste Überlegung (ich spreche jetzt für mich) ist aber, daß alle diese Gestalten nicht die Erzeugnisse des Außergewöhnlichen, sondern des Gewöhnlichen sind – der alltäglichen Verhältnisse, die seinerzeit in Rußland anzutreffen waren. Die blutdürstige Dummheit einer Selbstherrschaft, die den Gedanken der Legalität von sich weist und sich bewußt auf völlige moralische Anarchie stützt, bewirkt einen nicht weniger stupiden, ebenso blutrünstigen, rein utopischen Drang nach Umsturz, der die Zerstörung durch jedes Mittel will, in der abwegigen Überzeugung, der Einsturz jeder beliebigen, von Menschenhand errichteten Institution müsse von einem Wandel des menschlichen Herzens begleitet sein, Diese Leute sind einfach nicht imstande zu sehen, daß sie bestenfalls eine Änderung der Bezeichnungen herbeiführen können. Unterdrücker wie Unterdrückte sind Russen; und wieder einmal steht die Welt vor der Erkenntnis, daß weder der Tiger seine Streifen noch der Leopard seine Flecken wechseln kann.
1920
J. C.
Erster Teil
Von Anfang an wünsche ich in Abrede zu stellen, daß ich jene großen Gaben der Phantasie und des Ausdruckes besitze, die allein meine Feder befähigt hätten, für den Leser jene Persönlichkeit zu erschaffen, welche sich nach russischer Sitte Kyrill, Sohn des Isidor Rasumow, also Kyrill Sidorowitsch Rasumow nannte.
Falls diese Gaben jemals in mir lebendig gewesen sein sollten, so sind sie bereits vor langer Zeit unter einem Gestrüpp von Wörtern erstickt worden. Wörter sind, wie man sehr wohl weiß, die erbitterten Feinde der Wirklichkeit. Seit vielen Jahren lehre ich Sprachen, und das ist eine Beschäftigung, die mit der Zeit alles an Einbildungskraft, Beobachtungsgabe und Erkenntnisfähigkeit abtötet, was ein gewöhnlicher Mensch mitbekommen haben mag. Dem, der Sprachen lehrt, geschieht es eines Tages, daß ihm die Welt nichts als ein Ort voller Wörter und der Mensch ein sprechendes Tier ist, nicht bewundernswerter als ein Papagei.
Da das so ist, hätte mein Erkenntnisvermögen mich Herrn Rasumow weder sehen noch durchschauen lassen können, und ihn so auszudenken, wie er war, wäre ich schon gar nicht imstande gewesen. Es wäre mir nicht einmal möglich gewesen, mir die nackten Daten seines Lebenslaufes einfallen zu lassen. Doch auch ohne diese Präambel wird der Leser in diesen Blättern Spuren einer Dokumentation entdecken. Und das ist ganz richtig. Mein Bericht stützt sich auf ein Dokument; ich habe nichts weiter beigetragen als meine Kenntnis der russischen Sprache, die für den vorhabenden Zweck ausreicht. Das Dokument ist selbstverständlich eine Art Journal, ein Tagebuch, und ist doch wieder nicht eigentlich ein richtiges Tagebuch. Zum Beispiel sind die Vermerke in den meisten Fällen nicht Tag für Tag erfolgt, wenn sie auch alle datiert sind. Manche Eintragungen beziehen sich auf einen Zeitraum von Monaten und erstrecken sich über Dutzende von Seiten. Der ganze erste Teil ist ein Rückblick in erzählender Form und behandelt ein Ereignis, das etwa ein Jahr zuvor stattgefunden hat.
Ich muß hier erwähnen, daß ich lange in Genf gelebt habe. Ein ganzer Bezirk dieser Stadt wird, der zahlreichen dort lebenden Russen wegen, La Petite Russie genannt – Das Kleine Rußland. Ich besaß damals im Kleinen Rußland ausgedehnte Verbindungen. Allerdings gebe ich zu, daß mir der russische Charakter ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das Vernunftwidrige in der Haltung der Russen, die Willkürlichkeit ihrer Schlußfolgerungen und das bei ihnen zu bemerkende fortgesetzte Eintreten des Außergewöhnlichen sollte jemandem, der zahlreiche Grammatiken erlernt hat, kein Kopfzerbrechen bereiten; und doch muß es da noch ein Hindernis geben, irgendeinen besonderen menschlichen Zug, einen dieser feinen Unterschiede, die dem Blick des simplen Lehrers verborgen bleiben. Eindrucksvoll wird für einen Sprachenlehrer immer die außerordentliche Vorliebe bleiben, welche die Russen für Wörter hegen. Sie häufen sie um sich auf, hätscheln sie förmlich, behalten sie jedoch nicht für sich, sondern sind im Gegenteil immer bereit, sie stunden- oder auch nächtelang mit Begeisterung in so unerschöpflichem Strom und manchmal so treffend von sich zu geben, daß man sich ebensowenig wie beim Anhören gut abgerichteter Papageien des Verdachtes erwehren kann, sie verstünden wirklich, was sie sagen. Ihr Feuer ist von einer Rückhaltlosigkeit, die jeden Gedanken an bloße Geschwätzigkeit vertreibt, und doch ist ihre Rede nicht gebunden genug, um als Beredsamkeit gelten zu können … doch ich schweife ab.
Es wäre müßig, ergründen zu wollen, warum Herr Rasumow dieses Dokument hinterlassen hat. Daß er gewünscht habe, es möge von einem menschlichen Auge gelesen werden, ist unvorstellbar. Hier macht sich ein rätselhafter, in der Natur des Menschen liegender Trieb bemerkbar. Wenn man einmal von Samuel Pepys absieht, der sich auf diese Weise Zutritt zur Unsterblichkeit erzwungen hat, so bleibt festzustellen, daß unzählige Menschen – Verbrecher, Heilige, Philosophen, junge Mädchen, Politiker und Schwachköpfe – zweifellos aus Eitelkeit, doch auch aus anderen, undurchschaubaren Motiven Tagebücher führten, in denen sie sich entblößten. Es muß eine wundervoll beschwichtigende Kraft im Wort liegen, denn sonst hätten sich nicht so viele Menschen im Umgang mit sich selbst des Wortes bedient. Da ich ein stiller Mensch bin, nehme ich an, daß die Menschheit auf der Suche nach einer Form von Frieden, vielleicht auch nur nach einer Formel für den Frieden ist. Jedenfalls schreit sie heutigen Tages laut genug danach. Welche Art Frieden Kyrill Sidorowitsch Rasumow sich von der Niederschrift seines Tagebuches erwartete, das zu vermuten übersteigt mein Vermögen.
Es bleibt die Tatsache, daß er die Aufzeichnungen gemacht hat. Herr Rasumow war ein schlanker, wohlproportionierter junger Mann und für jemanden aus der mittelrussischen Provinz erstaunlich dunkelhaarig. Wenn es seinen Gesichtszügen nicht an einer gewissen Feinheit gefehlt hätte, so hätte man ihn als sehr gut aussehend bezeichnen müssen. So aber war es, als habe man ein kräftig in Wachs modelliertes Gesicht (das sogar an klassische Ebenmäßigkeit heranreichte) nahe ans Feuer gehalten, bis die Strenge der Linien in der Erweichung des Materials verlorenging. Doch sah er trotzdem noch gut aus. Auch seine Manieren waren tadellos. In der Diskussion ließ er sich leicht von Gegenargumenten oder der Autorität des Sprechers beeindrucken. Gegenüber seinen jüngeren Landsleuten war er der undurchschaubare Zuhörer, der dem Sprechenden bis zum letzten Wort lauscht und dann – einfach das Thema wechselt. Dieser Kniff, der entweder von geistiger Unzulänglichkeit oder mangelndem Vertrauen zum eigenen Urteil veranlaßt sein mochte, verschaffte Herrn Rasumow den Ruf, ein tiefschürfender Denker zu sein. Unter überschäumenden Rednern, die sich gewohnheitsmäßig täglich in feurigen Debatten erschöpfen, gilt eine relativ schweigsame Persönlichkeit selbstverständlich als jemand, der über geheime Reserven verfügt. Seine Kommilitonen an der Universität von St. Petersburg hielten Kyrill Sidorowitsch Rasumow, Studenten der Philosophie im sechsten Semester, für einen starken Charakter – einen ganz und gar vertrauenswürdigen Menschen. In einem Lande, in dem eine eigene Überzeugung ein Verbrechen sein kann, das mit dem Tode oder sogar mit noch Schlimmerem geahndet wird, bedeutete das, daß man ihm unbedenklich ketzerische Ansichten vortragen durfte. Man schätzte ihn auch, weil er liebenswürdig und stets bereit war, seinen Kommilitonen unter Hintansetzung der eigenen Bequemlichkeit gefällig zu sein.
Man hielt Herrn Rasumow für den Sohn eines Popen und glaubte, daß er von einem verdienstvollen Aristokraten protegiert werde, der möglicherweise in dem fernen Gouvernement, aus dem Rasumow stammte, ansässig war. Seine Erscheinung stimmte jedoch so wenig mit einer niedrigen Abkunft überein, daß man diese anzweifelte und Herrn Rasumow statt dessen als den Sohn der hübschen Tochter eines Popen bezeichnete – was der ganzen Angelegenheit bereits ein sehr anderes Aussehen verlieh. Diese Theorie erklärte auch, warum der verdienstvolle Aristokrat Herrn Rasumow protegierte. Doch hatte man diesem ganzen Sachverhalt weder im Bösen noch im Guten je nachgespürt. Niemand wußte oder interessierte sich auch nur dafür, wer der fragliche Aristokrat wohl sei. Rasumow erhielt einen bescheidenen, aber durchaus zureichenden Monatswechsel von einem nicht weiter bekannten Anwalt ausgezahlt, der sich in gewisser Weise als sein Vormund zu betätigen schien. Rasumow folgte gelegentlich der Einladung eines seiner Professoren. Weitere gesellschaftliche Beziehungen hatte er, soweit man wußte, in der Stadt nicht. Er besuchte regelmäßig die Pflichtvorlesungen und galt bei den Universitätsbehörden für einen vielversprechenden Studenten. Daheim arbeitete er ganz wie jemand, der vorwärtskommen will, doch tat er das nicht in strenger Zurückgezogenheit. Er war stets erreichbar, und in seinem Leben gab es nichts Rätselhaftes oder Verborgenes.
I
Die Entstehung der Niederschrift des Herrn Rasumow hängt mit einem Ereignis zusammen, wie es für das moderne Rußland bezeichnend ist: mit der Ermordung eines prominenten Politikers – noch bezeichnender übrigens für die korrumpierte Moral einer geknechteten Gesellschaft, in der die edelsten Regungen des Menschen – die Sehnsucht nach Freiheit, glühende Liebe für Vaterland und Gerechtigkeit, das Mitleid und selbst die Treue schlichter Gemüter – den Launen des Hasses und der Furcht dienstbar gemacht werden, diesen untrennbaren Gefährten einer insgeheim von Furcht erfüllten Despotie.
Das oben erwähnte Ereignis ist der erfolgreiche Anschlag auf Herrn de P., den Vorsitzenden der vor Jahren eingesetzten berüchtigten Unterdrückungskommission, den mit Sondervollmachten ausgerüsteten Staatsminister. Die Zeitungen haben sich über diese fanatische, schmalbrüstige Gestalt in goldgestickter Uniform, mit dem Gesicht aus zerknittertem Pergament, den faden, bebrillten Augen und dem Großkreuz des heiligen Prokop um den faltigen Hals, lärmend genug ausgelassen. Man erinnert sich vielleicht, daß es eine Zeit gab, da sein Bild wenigstens einmal in jedem Monat eine der europäischen Illustrierten schmückte. Er diente der Selbstherrschaft, indem er mit gleichbleibendem, unermüdlichem Eifer Männer und Frauen, Junge und Alte einkerkerte, verschickte oder hinrichten ließ. In seiner mystischen Hinnahme des Grundsatzes der Selbstherrschaft war er darauf versessen, die letzte Spur alles dessen auszutilgen, was auch nur entfernt an bürgerliche Freiheit im öffentlichen Leben erinnerte; und so rücksichtslos verfolgte er die aufsteigende Generation, daß man glauben konnte, er habe es auch noch auf die Vernichtung der Sehnsucht nach Freiheit abgesehen.
Es heißt, daß diese abscheuliche Persönlichkeit nicht genug Phantasie besessen habe, um sich den Haß vorzustellen, den sie hervorrief. Das ist kaum zu glauben; Tatsache bleibt indessen, daß der Minister nur geringe Vorkehrungen für seine persönliche Sicherheit traf. In der Einleitung zu einer gewissen berühmten Regierungsverlautbarung hatte er einmal erklärt: ›Der Gedanke der Freiheit kommt in der Schöpfung des Allmächtigen nicht vor. Die Menge kann nie zu etwas anderem raten als zu Revolte und Aufruhr. Revolte und Aufruhr aber stellen in einer Welt, die zu Ordnung und Gehorsam erschaffen wurde, eine Sünde dar. Nicht in der Vernunft, sondern in der Autorität verkörpert sich die Göttliche Absicht. Gott ist der Selbstherrscher im All …‹ Es ist vorstellbar, daß der Mann, der diese Erklärung abgegeben hat, glaubte, der Himmel selbst sei verpflichtet, ihn bei der bedenkenlosen Verteidigung der Autokratie im Diesseits zu schützen.
Zweifellos rettete ihn die Wachsamkeit der Polizei zu verschiedenen Malen; und als seine Stunde schlug, hätten die zuständigen Behörden ihn auch gar nicht warnen können, denn sie wußten nichts von einer Verschwörung gegen den Minister, hatten durch die üblichen Kanäle keine Kunde von einem bevorstehenden Anschlag erhalten, keine verdächtigen Umtriebe, keine gefährlichen Personen bemerkt.
Herr de P. wurde in einem zweispännigen offenen Schlitten zum Bahnhof gefahren, mit Diener und Kutscher auf dem Bock. Es hatte die ganze Nacht hindurch geschneit, und die Pferde kamen auf der um diese Zeit noch nicht geräumten Straße nur schwer vorwärts. Es schneite immer noch heftig. Gleichwohl muß der Schlitten gesehen und erkannt worden sein. Als er vor einer Biegung auf die linke Straßenseite wechselte, bemerkte der Diener einen Bauern, der gemächlich am Rande des Bürgersteiges dahinging, die Hände in den Taschen seines Schafpelzes, die Schultern gegen den fallenden Schnee bis an die Ohren hochgezogen. Als dieser Bauer vom Schlitten eingeholt wurde, wandte er sich plötzlich um und schwang den Arm. Gleich darauf erfolgte ein furchtbarer Schlag, begleitet von einer durch das Schneetreiben gedämpften Detonation; beide Pferde lagen tot und verstümmelt am Boden, und der Kutscher war schrill aufschreiend tödlich verwundet vom Bock gefallen. Der Diener (der überlebte) fand keine Zeit, sich das Gesicht des Mannes im Schafpelz einzuprägen. Dieser war, nachdem er die Bombe geworfen hatte, verschwunden, doch wird angenommen, daß er sich unter die von allen Seiten herzulaufenden Menschen mischte und, um nicht aufzufallen, mit ihnen an den Ort der Explosion zurückkehrte.
In unglaublich kurzer Zeit versammelte sich eine erregte Menge um den Schlitten. Der Ministerpräsident, der unverletzt im tiefen Schnee stand, trat zu dem stöhnenden Kutscher und forderte mehrmals mit seiner schwachen, farblosen Stimme die Zuschauer auf: »Bitte, tretet zurück. Bitte, gute Leute, macht um des Himmels willen Platz.«
Nun betrat ein hochgewachsener junger Mann, der bislang unbeweglich zwei Häuser entfernt in einer Einfahrt gestanden hatte, die Straße, kam schnell heran und warf eine zweite Bombe über die Köpfe der Gaffer hinweg. Diese traf den Ministerpräsidenten, der sich über seinen sterbenden Kutscher beugte, an der Schulter, fiel ihm dann vor die Füße und detonierte mit schrecklicher Wucht, wobei sie ihn tot zu Boden streckte, dem Verwundeten den Garaus machte und im Handumdrehen den leeren Schlitten in Fetzen zerriß. Mit einem Schreckensschrei stob die Menge nach allen Seiten auseinander, ausgenommen jene, die tot oder sterbend in der Nähe des Ministerpräsidenten verblieben, und ausgenommen auch einige andere, die erst hinfielen, nachdem sie schon ein Stück weit fortgelaufen waren.
Die erste Explosion hatte wie durch einen Zauber eine Menschenmenge angelockt, die zweite bewirkte ebenso rasch gute hundert Schritt straßauf und straßab völlige Leere. Durch das Schneegestöber betrachteten die Leute aus der Entfernung das Häuflein Leichen, die neben den Pferdekadavern übereinanderlagen. Niemand wagte sich heran, bis eine Kosakenstreife herzugaloppierte, absaß und die Toten umdrehte. Unter den unschuldigen Opfern der zweiten Explosion, die auf den Bürgersteig gebettet wurden, befand sich die Leiche eines Bauern im Schafpelz; sein Gesicht war jedoch unkenntlich, in den Taschen seiner ärmlichen Kleidung wurde nicht das geringste gefunden, und er war das einzige Opfer, das nicht identifiziert werden konnte.
An jenem Tag war Herr Rasumow zur gewöhnlichen Stunde aufgestanden und hatte den Vormittag in den Universitätsgebäuden mit dem Anhören von Vorlesungen und seiner Arbeit in der Bibliothek verbracht. In der Mensa, wo er sein Mittagsmahl einzunehmen pflegte, hatte er die ersten vagen Gerüchte von so etwas wie einem Bombenanschlag vernommen. Doch handelte es sich nur um geflüsterte Andeutungen, und man lebte immerhin in Rußland, wo es recht ungesund sein konnte, zumal für einen Studenten, den Anschein zu erwecken, man interessiere sich zu sehr für gewisse Gerüchte. Rasumow gehörte zu jenen Menschen, die sich in einer Periode geistigen und politischen Umbruches instinktiv an das normale tägliche Leben halten. Er wußte sehr wohl, daß er in einer Zeit hochgradiger Erregung lebte, er reagierte sogar darauf in einer unentschlossenen Weise. Doch mehr als auf anderes richtete er sein Augenmerk auf seine Arbeit, sein Studium und seine Zukunft.
Da er amtlich und auch in Wirklichkeit weder Eltern noch Verwandte besaß (die Tochter des Popen war längst verstorben), waren seine Ansichten und Gefühle nicht durch den Einfluß der Familie geprägt worden. Er war so allein in der Welt wie ein Mann, der im offenen Meer schwimmt. Das Wort Rasumow war nichts als das Etikett auf einer einsamen Person. Es gab nirgends Rasumows, die zu ihm gehörten. Die Feststellung, daß er Russe war, deutete gleichzeitig an, wo seine nächsten Verwandten zu finden waren. Was er auch vom Leben erwarten mochte – diese Verwandtschaft eben war es, die seine Hoffnungen erfüllen oder enttäuschen würde. Diese ungeheuer zahlreiche Verwandtschaft litt unter inneren Zerwürfnissen, und Rasumow schreckte innerlich vor diesen Zerwürfnissen ebenso zurück, wie ein gutmütiger Mensch sich weigert, in einem heftigen Familienstreit Partei zu ergreifen.
Auf dem Heimweg ging es Rasumow durch den Kopf, daß er nun seine ganze Zeit an die Preisaufgabe wenden könne, da er mit den Vorarbeiten für die nächste Prüfung fertig war. Die silberne Medaille lockte ihn sehr; das Unterrichtsministerium hatte den Preis ausgesetzt, und die Namen der Bewerber wurden dem Minister persönlich vorgelegt. Allein die Teilnahme am Wettbewerb wurde höheren Ortes bereits für verdienstvoll erachtet, und wer den Preis bekam, hatte nach Beendigung des Studiums Anrecht auf einen guten Posten in der Verwaltung. In einem Anflug von Hochgefühl vergaß der Student Rasumow ganz die Gefahren, von welchen jene Belohnungen und Ämter vergebenden Einrichtungen bedroht wurden. Doch als ihm der Preisträger vom vergangenen Jahr einfiel, ernüchterte sich Rasumow, dieser junge Mann ohne Anhang. Er war nämlich zufällig mit etlichen Kommilitonen im Zimmer des stillen, anspruchslosen jungen Studenten anwesend gewesen, als dieser amtlich von seinem Erfolg benachrichtigt wurde. »Entschuldigt«, hatte er gesagt, schüchtern gelächelt und seine Mütze ergriffen. »Ich lasse gleich Wein heraufschicken, aber zuvor muß ich nach Hause telegrafieren. Meine Eltern geben gewiß ein Fest für alle Nachbarn im Umkreis von zwanzig Werst.« Rasumow bedachte, daß sich ähnliches seinetwegen niemals ereignen werde. Sein Erfolg konnte für niemanden von Interesse sein. Doch empfand er keine Bitterkeit gegen seinen adligen Protektor, der übrigens kein Großgrundbesitzer aus der Provinz war, wie allgemein vermutet wurde, sondern kein Geringerer als der Fürst K., ehemals ein glänzender Weltmann, jetzt aber, da seine Zeit um war, Senator und von der Gicht geplagter Invalide, der immer noch ein üppiges, nun jedoch eingezogenes Leben führte. Er besaß heranwachsende Kinder und eine Frau, die adliger Herkunft und ebenso stolz war wie er.
In seinem ganzen Leben war Rasumow nur eine einzige Begegnung mit dem Fürsten vergönnt gewesen.
Sie hatte den Anstrich eines zufälligen Zusammentreffens im Büro des kleinen Anwaltes gehabt. Als Rasumow eines Tages, einer Aufforderung folgend, das Büro betrat, fand er dort einen Fremden – eine hochgewachsene, aristokratisch aussehende Persönlichkeit mit seidenweichem, grauem Backenbart. Der glatzköpfige, verschlagene kleine Advokat hatte in ironisch herzhaftem Ton gerufen: »Treten Sie näher, Herr Rasumow, treten Sie näher.« Und dann mit untertäniger Miene an den Fremden gewandt: »Einer meiner Schützlinge, Exzellenz. Einer der meistversprechenden Studenten seiner Fakultät an der hiesigen Universität.«
Zu seiner ungemeinen Verblüffung sah Rasumow, wie sich ihm eine feingeformte, weiße Hand entgegenstreckte. Er ergriff sie sehr verwirrt (sie war weich und schlaff) und vernahm gleichzeitig ein herablassendes Murmeln, wovon er nur die Worte »zufriedenstellend« und »weiter so« verstand. Das Verblüffendste von allem jedoch war, daß er unvermutet einen deutlichen Druck der wohlgeformten weißen Hand spürte, gerade ehe sie zurückgezogen wurde: einen leichten Druck, der wie ein geheimes Zeichen war. Die damit einhergehende Gefühlsbewegung war ungeheuerlich. Es schien Rasumow, als wollte ihm das Herz in die Kehle steigen. Als er aufblickte, hatte die aristokratische Persönlichkeit die Tür geöffnet, den kleinen Anwalt aus dem Weg gewinkt und verließ schon das Zimmer.
Der Anwalt wühlte ein Weilchen in den Papieren auf seinem Schreibtisch. »Wissen Sie, wer das war?« hatte er plötzlich gefragt.
Rasumow, dessen Herz immer noch wild klopfte, hatte stumm den Kopf geschüttelt.
»Das war Fürst K. Sie fragen sich wohl, was er in der Höhle eines so ärmlichen Rechtsbeflissenen zu tun haben kann, wie ich einer bin? Diese erhabenen Herrschaften sind ebenso sentimental und wißbegierig wie wir normalen Sterblichen. Doch ich an Ihrer Stelle, Kyrill Sidorowitsch«, so fuhr er hämisch und mit besonderer Betonung des Vaternamens fort, »ich würde mich dieser Bekanntschaft nicht weiter rühmen. Das wäre nicht weise, Kyrill Sidorowitsch, oh, nein, das würde im Gegenteil Ihre Zukunft gefährden.«
Die Ohren des jungen Mannes hatten geglüht, und alles war ihm vor den Augen verschwommen. »Dieser Mann!« hatte Rasumow bei sich gesagt. »Er!«
Seitdem bezeichnete Herr Rasumow den Fremden mit dem seidigen grauen Backenbart im stillen mit diesem einsilbigen Wort. Von da an bemerkte er bei seinen Spaziergängen durch die vornehmeren Wohnviertel auch mit Anteilnahme die prachtvollen Gespanne und Kutschen mit den Lakaien des Fürsten. Einmal sah er, wie die Fürstin – sie machte Einkäufe – von zwei Mädchen gefolgt ausstieg, von denen das eine fast einen Kopf größer war als das andere. Blondes Haar fiel ihnen offen nach englischer Art auf die Schultern, sie hatten fröhliche Augen, trugen die gleichen Mäntel, Muffs und Pelzmützchen, und der Frost hatte ihre Nasen und Wangen lustig gerötet. Sie gingen vor ihm über den Bürgersteig, und Rasumow setzte schüchtern lächelnd seinen Weg fort. »Seine« Töchter. Sie sahen »Ihm« ähnlich. Der junge Mann fühlte warme Sympathie für diese Mädchen, die von seiner Existenz nie etwas erfahren würden. Über kurz oder lang würden sie Generale oder Kammerherren heiraten und selber Kinder haben, die dann möglicherweise von ihm hören würden als von einem gefeierten alten Professor, dekoriert, vielleicht zum Geheimrat ernannt, einer Leuchte Rußlands – und nichts weiter! Immerhin stellte ein gefeierter Professor etwas dar. Berühmtheit vermochte das bloße Etikett Rasumow in einen geachteten Namen zu verwandeln. In dem Verlangen des Studenten Rasumow nach Ruhm lag nichts Absonderliches. Das wirkliche Leben eines Menschen ist das, welches ihm andere Menschen in Gedanken zuerkennen, weil sie ihn achten oder ihn lieben. Als er am Tage des Attentates auf Herrn de P. nach Hause zurückkehrte, beschloß Rasumow, sich allen Ernstes um die silberne Medaille zu bemühen.
Während er langsam die vier Treppen des finsteren, schmutzigen Hauses erstieg, in dem er wohnte, war er seines Erfolges gewiß. Am Neujahrstage würde der Name des Preisträgers in der Zeitung veröffentlicht werden. Und bei dem Gedanken, daß »Er« ihn vermutlich dort sehen werde, hielt Rasumow für einen Augenblick auf der Treppe inne und ging dann, seine Aufregung belächelnd, weiter. »Das ist doch nur ein Phantom«, sagte er sich, »die Medaille dagegen wäre ein greifbarer Anfang.«
Ganz in den Gedanken an seine Arbeit vertieft, empfand er die im Zimmer herrschende Wärme als wohltuend und ermunternd. »Ich werde jetzt vier Stunden hintereinander scharf arbeiten«, dachte er. Doch kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, als ein furchtbarer Schrecken ihn durchzuckte. Ganz schwarz zeichnete sich vor dem landesüblich hohen Ofen, dessen weiße Kacheln im Dämmerlicht schimmerten, die Gestalt eines Fremden ab, der einen weitschößigen, enganliegenden braunen Rock samt Gürtel, hohe Stiefel und auf dem Kopf eine Pelzkappe trug. Die Gestalt ragte schlank und straff in die Dunkelheit. Rasumow war zutiefst verblüfft. Erst als die Gestalt zwei Schritte vortrat und mit ernster, gelassener Stimme fragte, ob die Flurtür geschlossen sei, fand er die Sprache wieder.
»Haldin!… Victor Victorowitsch!… Sind Sie es?… Jawohl, die Flurtür ist geschlossen. Was für eine Überraschung!«
Victor Haldin, ein Student, der älter war als die meisten seiner Kommilitonen, gehörte nicht zu den Fleißigen. In den Vorlesungen war er kaum je zu sehen, und bei den Behörden galt er als ›ruhelos‹ und ›unzuverlässig‹ – eine ungünstige Beurteilung. Doch bei seinen Kommilitonen genoß er großes persönliches Ansehen und übte starken Einfluß auf ihr Denken aus. Rasumow hatte nie näher mit ihm verkehrt. Gelegentlich war man sich bei Zusammenkünften auf Studentenbuden begegnet. Einmal war es sogar zwischen ihnen zu einer Debatte gekommen – zu einer jener Debatten, in denen es um Grundfragen geht, Debatten, wie sie jugendliche Heißsporne lieben. Rasumow wäre es lieber gewesen, Haldin hätte sich eine andere Zeit ausgesucht, um auf ein Schwätzchen hereinzukommen. Er fühlte sich gerade aufgelegt, die ersten Striche an der Preisaufgabe zu tun. Da man Haldin aber nicht kurzerhand abweisen konnte, gab Rasumow sich gastfreundlich, bat, Platz zu nehmen und zu rauchen.
»Kyrill Sidorowitsch«, sagte nun der andere und riß sich die Kappe vom Kopf, »wir gehören vielleicht nicht ganz ins gleiche Lager. Ihr Urteil ist mehr das des Philosophen. Sie reden zwar nicht viel, doch bin ich noch niemandem begegnet, der es gewagt hätte, Ihre Großmut anzuzweifeln. Und es eignet Ihnen eine Festigkeit, die ohne Mut undenkbar ist.«
Rasumow begann, sich geschmeichelt zu fühlen und murmelte, er sei ihm sehr verbunden für die gute Meinung, als Haldin die Hand hob.
»Daran dachte ich auf dem Holzplatz am Fluß. ›Der junge Mann hat einen starken Charakter‹, sagte ich zu mir. ›Er trägt sein Herz nicht auf der Zunge.‹ Ihre Zurückhaltung hat auf mich stets einen starken Reiz ausgeübt, Kyrill Sidorowitsch. Ich versuchte also, mich Ihrer Adresse zu entsinnen. Und ich hatte Glück. Ihr Dwornik war gerade aus dem Haus gegangen und sprach mit einem Schlittenkutscher auf der anderen Straßenseite, und auf der Stiege begegnete mir keine Seele. Gerade als ich Ihren Treppenabsatz erreichte, kam Ihre Wirtin aus Ihren Zimmern, doch sah sie mich nicht. Sie ging über den Flur in ihre eigene Wohnung, und darauf schlüpfte ich hier herein. Seit zwei Stunden bin ich nun hier und erwarte Sie.«
Rasumow hatte erstaunt zugehört; doch ehe er noch den Mund öffnen konnte, setzte Haldin mit Bedeutung hinzu: »Ich bin es gewesen, der heute morgen de P. beseitigt hat.«
Rasumow erstickte einen Entsetzensschrei. Das Gefühl, sein Leben sei unwiderruflich zerstört, weil er zu einem solchen Verbrechen in Beziehung gebracht worden war, drückte sich wunderlicherweise in dem boshaften Gedanken aus: ›Jetzt ist die silberne Medaille futsch!‹
»Sie sagen nichts, Kyrill Sidorowitsch! Ich verstehe Ihr Schweigen. Selbstverständlich kann ich bei Ihren kühlen englischen Manieren nicht erwarten, daß Sie mich umarmen. Aber sehen wir einmal von Ihren Manieren ab. Sie besitzen ein Herz, und Sie haben das Schluchzen und Zähneknirschen vernommen, das dieser Mann im ganzen Lande ausgelöst hat. Das allein müßte alle philosophischen Betrachtungen überflüssig machen. Er war dabei, das zarte Pflänzchen herauszureißen. Man mußte ihm Einhalt tun. Er war ein gefährlicher Mensch – ein Mensch von Überzeugungen. Noch drei Jahre so weiter, und wir wären um fünfzig Jahre in die Knechtschaft zurückgeworfen worden – und wie viele Leben, wie viele Seelen wären in dieser Zeit verlorengegangen!«
Seine knappe, selbstbewußte Stimme wurde plötzlich leise und dumpf, als er hinzusetzte: »Ja, Bruder, ich habe ihn getötet. Eine beschwerliche Arbeit.«
Rasumow hatte sich auf einen Sessel sinken lassen. Er erwartete jeden Augenblick Polizisten hereinstürzen zu sehen. Zu Tausenden mußten sie jetzt nach dem Mann suchen, der hier in diesem Zimmer hin und her ging. Haldin sprach schon wieder, zurückhaltend, gefaßt. Ab und an machte er eine bedächtige, von Erregung freie Geste.
Er berichtete Rasumow, wie er ein Jahr lang gegrübelt, daß er seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen hatte. Er und ein ›Anderer‹ waren durch eine ›gewisse Person‹ am Abend zuvor von der geplanten Fahrt des Ministers unterrichtet worden. Er und der ›Andere‹ hatten daraufhin die ›Apparate‹ bereitgemacht und sich vorgenommen, kein Auge mehr zu schließen, ehe nicht die ›Arbeit‹ getan sei. Stumm, ohne auch nur ein einziges Wort zu wechseln, marschierten sie mit ihren ›Apparaten‹ in der Tasche die ganze Nacht im Schneetreiben durch die Straßen. Stießen sie auf eine Polizeistreife, so stützten sie einander und spielten betrunkene Bauern. Sie torkelten und redeten heiser und lallend aufeinander ein. Von diesen seltsamen Ausbrüchen abgesehen, gingen sie stumm und ohne Pause weiter. Ihr Plan stand fest. Bei Tagesanbruch gelangten sie an die Stelle, die der Schlitten des Ministers, wie sie wußten, passieren mußte. Als sie des Schlittens ansichtig wurden, trennten sie sich mit einem gemurmelten Lebewohl. Der ›Andere‹ blieb an der Ecke, Haldin bezog einige Häuser weiter weg Stellung … Nachdem er seinen ›Apparat‹ geworfen hatte, lief er davon und wurde sogleich von den erschreckten Menschen eingeholt, die nach der zweiten Explosion vom Schauplatz flüchteten. Sie waren rasend vor Angst. Ein oder zweimal wurde er angerempelt. Er lief langsamer, um die Menge an sich vorüber zu lassen, und bog nach links in eine Seitenstraße ein. Hier war er allein.
Daß er entkommen war, setzte ihn in Erstaunen. Das Werk war getan. Er vermochte es kaum zu fassen. Er kämpfte gegen einen fast unwiderstehlichen Drang, sich lang auf der Straße auszustrecken und zu schlafen. Doch diese Schwäche – stumpfe Müdigkeit – war schnell vorüber. Er ging rascher, in Richtung auf einen der ärmeren Stadtbezirke, wo er sich mit Sjemjanitsch treffen wollte.
Dieser Sjemjanitsch war, so erfuhr Rasumow, eine Art Ackerbürger, der es zu etwas gebracht hatte; er vermietete Schlitten und Pferde. Hier unterbrach Haldin seine Erzählung mit dem Ausruf:
»Ein wacher Geist! Eine unerschütterliche Seele! Der beste Kutscher in ganz Petersburg! Er hat da eine Troika … Ah, was für ein Kerl!«
Dieser Mann hatte sich bereit erklärt, jederzeit eine oder zwei Personen sicher bis an die zweite oder dritte Station der Südbahn zu bringen. Doch war am Abend zuvor keine Gelegenheit gewesen, ihn zu benachrichtigen. Wie es schien, hielt er sich für gewöhnlich in einer billigen Kneipe am Stadtrand auf. Als Haldin endlich dort angelangt war, hatte man ihn nirgends auftreiben können. Man erwartete ihn auch erst gegen Abend zurück, und Haldin war ruhelos weitergegangen. Er hatte gesehen, daß das Tor zu einem der Holzplätze offenstand, und war hineingegangen, um Schutz vor dem Wind zu finden, der durch die breite, öde Straße pfiff. Die großen, rechteckigen Holzstöße sahen mit ihren Schneelasten aus wie Bauernhäuser. Zunächst hatte der Wächter, der Haldin zwischen den Holzstößen entdeckte, ganz freundlich getan. Er war ein vertrockneter alter Mann und trug zwei zerfetzte Militärmäntel übereinander; sein schlaues kleines Gesicht wirkte komisch, denn Kinn, Stirn und Ohren waren mit einem schmutzigen roten Tuch umwickelt. Gleich darauf wurde er jedoch mürrisch und fing dann ohne jeden Grund zu brüllen an.
»Willst du dich gar nicht von hier verdrücken, du Tagedieb? Wir kennen deine Sorte schon! Fabrikarbeiter! Groß, jung und stark, und nicht mal besoffen! Was willst du hier? Angst kannst du uns nicht machen, und nun verschwinde, du mit deiner schiefen Fresse!«
Haldin blieb vor dem sitzenden Rasumow stehen. Seine geschmeidige Gestalt, die weiße Stirn unter dem blonden Haarschopf wirkten hochmütig und herausfordernd.
»Mein Gesicht gefiel ihm nicht«, sagte er, »und … deshalb also bin ich hier.«
Rasumow rang nach Fassung.
»Entschuldigen Sie, Victor Victorowitsch. Wir kennen einander doch kaum … ich verstehe nicht ganz, wie Sie …«
»Vertrauen«, versetzte Haldin.
Dieses Wort versiegelte Rasumows Lippen, nicht anders, als habe sich eine Hand auf seinen Mund gelegt. In seinem Kopf überschlugen sich die Einwände geradezu.
»Tja … da sind Sie nun«, murmelte er, ohne den Mund recht zu öffnen.
Der andere nahm den ärgerlichen Ton nicht wahr, es fiel ihm gar nicht ein, etwas Derartiges zu vermuten.
»Ganz recht. Und niemand weiß davon, daß ich hier bin. Und falls ich erwischt werden sollte, sind Sie der letzte, den man verdächtigen wird. Das ist immerhin ein Trost. Und überdies … nun, einem überlegenen Geist wie Ihnen darf ich wohl die ganze Wahrheit sagen: es fiel mir nämlich ein, daß Sie keinerlei Verwandte haben, keine Bindungen, niemand, der Ihretwegen leiden müßte, falls dies alles je herauskommen sollte. Es gibt ohnehin bereits zu viele zerstörte Familien in Rußland. Doch sehe ich nicht, wie man je erfahren soll, daß ich hier gewesen bin. Falls man mich festnimmt, werde ich zu schweigen verstehen, ganz gleich was sie mit mir anstellen mögen«, fügte er finster hinzu.
Wieder begann er auf und ab zu gehen, während Rasumow reglos und entsetzt dasaß.
»Sie haben also geglaubt, daß …«, brachte er endlich, beinahe krank vor Empörung, heraus.
»Ganz recht, Rasumow, ganz recht, Bruder. Eines Tages werden auch Sie am Bau mithelfen. Sie sehen jetzt vermutlich in mir einen Terroristen – einen Menschen, der das Bestehende vernichten will. Bedenken Sie aber, daß die wahren Vernichter jene sind, die den Geist des Fortschrittes und der Wahrheit vernichten, nicht die Rächer, die sich darauf beschränken, das Leben derjenigen zu vernichten, die es auf die Menschenwürde abgesehen haben. Männer wie ich werden benötigt, um Platz zu schaffen für unabhängige, denkende Männer, wie Sie einer sind. Nun haben wir zwar unser Leben eingesetzt, doch will ich, wenn möglich, fliehen. Es ist weniger mein Leben, das ich zu retten wünsche, als vielmehr meine Tatkraft. Ich werde nicht müßig sein, o nein! Glauben Sie das ja nicht, Rasumow. Männer wie ich sind selten. Überdies jagt ein Ereignis wie dieses den Bedrückern größeren Schrecken ein, wenn der Täter spurlos verschwindet. Dann sitzen sie in ihren Büros und Palästen und zittern. Sie sollen nichts tun, als mir helfen zu verschwinden. Das ist weiter keine große Sache. Sie brauchen nur nach einer Weile aufzubrechen und Sjemjanitsch in der Kneipe, in der ich heute früh war, eine Bestellung von mir auszurichten. Sagen Sie: Ihr Bekannter möchte, daß ein gutbespannter Schlitten eine halbe Stunde nach Mitternacht auf der Karabelnaja hält, und zwar an der siebenten Laterne links, von oben an gezählt. Falls niemand einsteigt, soll der Schlitten um den Häuserblock fahren und zehn Minuten später an der gleichen Stelle sein.«
Rasumow fragte sich, warum er diesem Menschen nicht längst schon ins Wort gefallen war und ihn hinausgewiesen hatte. War das Schwäche, oder was sonst?
Er kam zu dem Schluß, daß ihn ein gesunder Instinkt leite. Haldin mußte gesehen worden sein. Es war unvorstellbar, daß niemand das Gesicht des Mannes gesehen haben sollte, der die zweite Bombe geworfen hatte. Haldin war eine auffällige Erscheinung. Schon eine Stunde später mußten Tausende von Polizisten seine Personalbeschreibung erhalten haben. Mit jeder Minute wuchs die Gefahr. Jagte man ihn auf die Straße, so mußte er früher oder später verhaftet werden.
Die Polizei würde sehr schnell alles über ihn in Erfahrung bringen. Man würde beginnen, nach Verschwörern zu suchen, und jeder, der jemals mit Haldin verkehrt hatte, wäre gefährdet. Unbedachte Worte, winzige, an und für sich unbedeutende Handlungen würden als Verbrechen gewertet werden. Rasumow fielen gewisse eigene Äußerungen ein, Reden, die er angehört, harmlose Zusammenkünfte, an denen er teilgenommen hatte – es war für einen Studenten unmöglich, sich allem und jedem zu entziehen, ohne bei den Kommilitonen in Verdacht zu geraten.
Rasumow sah sich im Kerker, man setzte ihm zu, plagte, ja mißhandelte ihn vielleicht. Er sah sich als ein Opfer der administrativen Verschickung, sah sein Leben zerstört, hoffnungslos ruiniert. Er sah sich – bestenfalls – eine jämmerliche Existenz unter Polizeiaufsicht führen, in irgendeinem entlegenen kleinen Provinznest, ohne Freunde, die ihm das Notwendigste beschafften oder Schritte taten, um sein Los zu erleichtern. Andere besaßen Väter und Mütter, Brüder und Verwandte, hatten Verbindungen, und man würde ihretwegen Himmel und Hölle in Bewegung setzen – er aber hatte niemanden. Selbst die Beamten, die ihn des Morgens verurteilten, würden schon vor Sonnenuntergang sein Dasein vergessen haben.
Er sah seine Jugend in Elend und Mangel verstreichen – sah seine Kräfte nachlassen, seinen Geist erschlaffen. Er sah sich gebrochen und zerlumpt durch die Straßen schleichen – sah sich einsam in einer verdreckten Schlafhöhle oder auf dem beschmutzten Bett eines öffentlichen Krankenhauses sterben.
Ihn schauderte. Dann senkte sich der Friede einer erbitterten Gefaßtheit auf ihn. Es war das beste, diesen Menschen von der Straße fernzuhalten, bis man ihn mit einiger Aussicht auf Erfolg die Flucht antreten lassen konnte. Etwas Besseres ließ sich nicht tun. Selbstverständlich war Rasumow davon überzeugt, daß seine einsame Existenz von nun an ständig bedroht sein werde. Die Ereignisse dieses Abends konnten jederzeit gegen ihn aufstehen, solange Haldin lebte und das augenblickliche System fortdauerte. Dieses betrachtete er im Augenblick als eine höchst vernünftige und geradezu unzerstörbare Einrichtung. In ihm drückte sich eine überwältigende Harmonie aus – ganz im Gegensatz zu dem schreienden Mißton, den die Anwesenheit dieses Menschen hier verursachte. Er haßte Haldin. Er sagte unbewegt:
»Selbstverständlich werde ich gehen. Geben Sie mir genaue Anweisungen, und verlassen Sie sich im übrigen ganz auf mich.«
»Ah! Sie sind ein Kerl! Unerschütterlich, kühl wie ein Kürbis, ganz der Engländer. Von Ihrer Sorte gibt es nicht viele. Hören Sie zu, Bruder! Menschen wie ich hinterlassen keine Nachkommen, doch sind ihre Seelen nicht verloren. Keine Seele geht je verloren. Sie plagt sich für ihr eigenes Heil – anderenfalls hätten die Selbstaufopferung, das Märtyrertum, der Glaube, die Überzeugungstreue keinen Sinn. Was wird aus meiner Seele, wenn ich so sterbe, wie ich sterben muß – bald, sehr bald vielleicht? Verderben wird sie nicht. Und vergessen Sie nicht, Rasumow: hier handelt es sich nicht um Mord, sondern um Krieg, um Krieg! Meine Seele soll in einem beliebigen russischen Körper den Kampf fortsetzen, bis die Welt von aller Lüge gereinigt ist. Die moderne Zivilisation ist verlogen, doch aus Rußland soll die neue Offenbarung kommen. Ha! Sie schweigen, Sie sind skeptisch. Ich achte Ihren Skeptizismus, Rasumow, aber rühren Sie nicht an die Seele, an die russische Seele, die in uns allen ist. Sie hat eine Zukunft. Sie hat auch einen Auftrag, ganz bestimmt, denn hätte ich sonst bedenkenlos … wie ein Schlachter … mitten zwischen diese harmlosen Leute … den Tod geschleudert – Ich! Ich! Ich, der ich keiner Fliege ein Leid tun könnte!«
»Nicht so laut«, tadelte Rasumow schroff.
Haldin ließ sich auf einen Stuhl fallen, legte den Kopf auf die gekreuzten Arme und brach in Tränen aus. Er weinte lange Zeit. Im Zimmer war es noch dämmriger geworden. Rasumow saß reglos und lauschte verdüstert und staunend dem Schluchzen.
Der andere hob den Kopf, stand auf und gewann mühsam die Beherrschung über seine Stimme zurück.
»Jawohl. Männer wie ich hinterlassen keine Nachkommen«, wiederholte er gedämpft. »Doch habe ich eine Schwester. Sie lebt jetzt bei meiner alten Mutter – zum Glück habe ich sie überreden können, ins Ausland zu fahren. Meine Schwester ist gar kein übles Mädchen. Kein Mensch auf Erden hat so gläubige Augen wie sie. Hoffentlich verheiratet sie sich gut. Gewiß wird sie Kinder haben – vielleicht Söhne. Sehen Sie mich an. Mein Vater war Regierungsbeamter in der Provinz. Er besaß auch etwas Land. Ein schlichter, gottesfürchtiger Mann – in seiner Art ein echter Russe. Für ihn gab es nichts als den Gehorsam. Aber ich gleiche ihm nicht. Man sagt, ich gliche dem ältesten Bruder meiner Mutter, einem Offizier. Der wurde 1828 unter Nikolaus erschossen. Ich sage Ihnen ja, daß wir im Krieg sind, im Krieg … und doch, gerechter Gott, was für eine beschwerliche Arbeit!«
Rasumow sprach, den Kopf in die Hand gestützt, von seinem Stuhl her wie vom Grunde einer Schlucht herauf:
»Glauben Sie denn an Gott, Haldin?«
»Da klammern Sie sich nun an Worte, die man unwillkürlich ausgesprochen hat. Kommt es darauf an? Wie sagte doch jener Engländer … ›In den Dingen wohnt eine göttliche Seele …‹«
»Hol ihn der Teufel, mir fällt sein Name nicht ein. Doch hat er recht. Wenn euer Tag der Denker anbricht, dann vergeßt nicht das, was göttlich ist an der russischen Seele – nämlich die Ergebung. Achtet sie trotz eurer intellektuellen Ruhelosigkeit, und verwässert die Botschaft, die sie für die Welt hat, nicht durch eure arrogante Besserwisserei. Ich rede jetzt zu Ihnen wie ein Mann, der den Strick um den Hals hat. Wofür halten Sie mich? Für einen Empörer? Nein. Ihr Denker seid es, die in ständiger Auflehnung begriffen sind. Ich gehöre zu denen, die sich abgefunden haben. Als ich mich der Notwendigkeit gegenübersah, das schwere Werk auf mich zu nehmen, als ich begriff, daß es vollbracht sein wollte – was tat ich da? Habe ich frohlockt? War ich stolz auf den mir gewordenen Auftrag, auf mein Vorhaben? Habe ich versucht, den Gewinn gegen die Folgen abzuwägen? Nein! Ich ergab mich darein. Ich dachte: Gottes Wille geschehe.«
Er warf sich lang ausgestreckt auf Rasumows Bett, legte die Handrücken über die Augen und blieb stumm und regungslos liegen. Nicht einmal das Geräusch seines Atems war zu hören. Totenstille herrschte im finsteren Zimmer, bis Rasumow schließlich dumpf sagte:
»Haldin.«
»Ja«, antwortete der andere, der reglos und unsichtbar auf dem Bett ruhte, sogleich bereitwillig.
»Wird es nicht Zeit für mich?«
»Ja, Bruder!« hörte man den anderen aus dem Dunkel sagen.
»Es wird Zeit, das Schicksal auf die Probe zu stellen.«
Er verstummte und gab dann wenige, sehr klare Anweisungen in der tonlosen, unpersönlichen Stimme eines Hypnotisierten. Rasumow machte sich bereit, ohne ein Wort der Erwiderung. Als er das Zimmer verließ, sagte die Stimme vom Bett hinter ihm her:
»Geh mit Gott, du schweigsame Seele.«
Im Treppenhaus angekommen, verschloß Rasumow lautlos die Tür und steckte den Schlüssel in die Tasche.
II
Die Worte und Ereignisse jenes Abends müssen sich wie mit einem stählernen Griffel in Herrn Rasumows Erinnerung eingegraben haben, war er doch nach Monaten noch imstande, alles umständlich und genau niederzuschreiben.
Die Aufzeichnung der Gedanken, die ihn überfielen, als er auf der Straße war, ist noch ausführlicher und mehr ins einzelne gehend. Diese Gedanken scheinen sich mit besonderem Gusto auf ihn gestürzt zu haben, nun, da seine Denkfähigkeit nicht länger von Haldins Gegenwart gelähmt war – der gräßlichen Gegenwart eines großen Verbrechens und der betäubenden Kraft eines großen Fanatismus. Wenn ich in Herrn Rasumows Tagebuch blättere, muß ich allerdings zugeben, daß ›Ansturm von Gedanken‹ wohl doch nicht das richtige Bild ist.
Richtiger wäre es, von einem ›Wirrwarr der Gedanken‹ zu reden, was auch dem Zustand seiner Gefühle besser entspricht. Es waren nicht viele Gedanken, sie waren wie die der meisten Menschen gering an Zahl und schlicht, doch können hier nicht alle die abgerissenen Ausrufe wiedergegeben werden, in denen sie sich unablässig und ermüdend wiederholten, denn Rasumows Weg war lang.
Falls sie dem westlichen Leser erschreckend, unangebracht oder sogar unpassend vorkommen sollten, so möge man sich erinnern, daß dies an meiner ungeschliffenen Wiedergabe liegen mag, und im übrigen möchte ich noch einmal betonen, daß diese Geschichte nicht im westlichen Europa spielt.
Es mag wohl sein, daß die Nationen sich ihre Regierungen zurechtschneidern, doch die Regierungen zahlen es ihnen mit gleicher Münze heim. Es ist undenkbar, daß ein junger Engländer sich in Rasumows Lage befinden könnte. Da dies so ist, wäre es müßig sich auszumalen, was er denken würde. Mit Sicherheit kann einzig angenommen werden, daß er anders dächte, als Herr Rasumow in dieser Schicksalskrise dachte. Der junge Engländer hätte weder persönliches noch überkommenes Wissen von den Mitteln, mit denen eine jahrhundertealte Selbstherrschaft Gedanken unterdrückt, ihre Macht schützt und ihr Dasein verteidigt. Eine ausschweifende Phantasie könnte ihm die Vorstellung vermitteln, willkürlich eingesperrt zu werden, doch wenn er nicht gerade Fieberträume hat (und vielleicht nicht einmal dann), könnte es ihm nicht einfallen, sich vorzustellen, daß man ihn zu Verhörs- oder Strafzwecken auspeitscht.
Das ist nur ein grobes, sich aufdrängendes Beispiel für die Andersartigkeit westlichen Denkens. Ich weiß übrigens nicht, ob Herr Rasumow besonders an diese Gefahr dachte. Zweifellos mischte sie sich aber in die allgemeine Angst und das Grauen dieser Krise. Man hat gesehen, daß Rasumow sich sehr wohl der weniger groben Methoden bewußt war, vermittels deren eine despotische Regierung das Verderben des einzelnen herbeiführen kann. Allein die Relegierung von der Universität (das geringste, was er zu erwarten hatte), zusammen mit der Unmöglichkeit, seine Studien anderwärts fortzusetzen, reichte hin, einen jungen Menschen zugrunde zu richten, der ganz auf die Ausbildung seiner angeborenen Anlagen angewiesen war, um sich einen Platz im Leben zu sichern. Er war Russe: belastet zu werden bedeutete für ihn einfach, in die tiefste soziale Schicht abzusinken, Gefährte der Hoffnungslosen und Verarmten, der Nachtvögel der Stadt zu werden.
Bei einer Bewertung seiner Gedanken muß auch Rasumows Herkommen, oder vielmehr der Mangel an Herkommen, in Betracht gezogen werden. Denn auch ihm war dieser Umstand gegenwärtig. Erst eben noch hatte der verwünschte Haldin ihn auf besonders grausame Weise daran erinnert. ›Soll mir denn alles genommen werden, nur weil ich das eine nicht habe?‹ grübelte er.
Er zwang sich, weiterzugehen. Auf der Straße glitten und klingelten die Schlitten geisterhaft durch das flockende Weiß, das auf dem schwarzen Antlitz der Nacht lag. »Denn ein Verbrechen ist es«, sprach er bei sich. »Ein Mord bleibt ein Mord. Wenn allerdings auch etwas liberalere Einrichtungen …«
Schreckliche Übelkeit befiel ihn. »Ich darf den Mut nicht verlieren«, ermahnte er sich. Alle Kräfte hatten ihn plötzlich verlassen. Doch eine mächtige Willensanstrengung brachte sie unvermittelt zurück, denn er fürchtete, auf der Straße ohnmächtig und mit seinem Zimmerschlüssel in der Tasche von der Polizei aufgegriffen zu werden. Man würde Haldin bei ihm finden, und das wäre dann wirklich sein Verderben. Gerade diese Furcht scheint es gewesen zu sein, die ihn bis zum Ende durchhalten ließ. Es waren nicht viele Leute auf der Straße, und die Passanten tauchten unvermutet auf, ragten schwarz im Schneegestöber vor ihm in die Höhe und waren plötzlich, ohne daß man ihre Schritte gehört hätte, verschwunden.
Rasumow befand sich im ärmsten Teil der Stadt. Er bemerkte eine ältliche Frau, die in zerlumpte Tücher gekleidet war. Im Licht der Laterne sah sie aus wie eine Bettlerin, die von der Arbeit kommt. Gemächlich schlenderte sie durch das Schneetreiben, als habe sie kein Zuhause, zu dem es sie zog. Unter dem Arm trug sie einen runden Laib Schwarzbrot wie einen köstlichen Schatz, und Rasumow wandte den Blick ab; er beneidete sie um ihre Gemütsruhe und ihre Gelassenheit.
Dem Leser von Herrn Rasumows Aufzeichnungen erscheint es wunderbar, daß es diesem gelang, die endlosen Straßen eine nach der anderen im stets höher sich türmenden Schnee zu durchwandern. Es war der Gedanke an Haldin daheim in seinem verschlossenen Zimmer, es war der verzweifelte Wunsch, sich von der Gegenwart dieses Menschen zu befreien, der Rasumow vorwärtstrieb. Vernünftige Überlegung hatte an dieser Bemühung keinen Teil. Und daher vermochte er nur töricht zu glotzen, als er, in der Kneipe angekommen, vernahm, der Kutscher Sjemjanitsch sei nicht anwesend.
Der Kellner, ein ungekämmter Jüngling in Schmierstiefeln und rosafarbigem Hemd, entblößte blöde lächelnd seine blassen Gaumen und ließ verlauten, Sjemjanitsch habe sich bereits am frühen Nachmittag vollaufen lassen und sei mit zwei weiteren Flaschen unterm Arm verschwunden – vermutlich, um das Gelage im Stall fortzusetzen.
Der Eigentümer der wüsten Schenke, ein kleiner hagerer Mensch in schmutzigem Kaftan, der ihm bis auf die Stiefel reichte, stand dabei, die Hände im Gürtel, und nickte zustimmend.
Fuseldunst und Gestank von ranzigem Fett erstickten Rasumow förmlich. Er schlug mit der Faust auf einen Tisch und brüllte:
»Ihr lügt!«
Verschwiemelte, ungewaschene Gesichter drehten sich nach ihm um. Ein zerlumpter, sanftäugiger Landstreicher, der am Nebentisch Tee trank, rückte weiter weg. Ein Murmeln der Verwunderung und Beklommenheit erhob sich, aber man hörte auch Lachen und ein hämisch beschwichtigendes »Na, na!«
Der Kellner sah sich um und verkündete laut:
»Der Herr hier will nicht glauben, daß Sjemjanitsch betrunken ist.«
Aus der fernen Ecke grunzte die heisere Stimme eines schauerlichen, schwer zu beschreibenden zerlumpten Wesens, dessen Gesicht so schwarz war wie das eines Bären:
»Der verfluchte Diebeskutscher! Wir brauchen seine feinen Herrschaften nicht, wir sind hier lauter ehrliche Leute.«
Rasumow, der sich die Lippen blutig biß, um nicht in lästerliche Flüche auszubrechen, folgte dem Eigentümer der Spelunke, der ihm zuflüsterte: »Hier entlang, Väterchen«, und ihn in ein Kabuff hinter dem hölzernen Schanktisch führte, von wo Wasserplantschen zu hören war. Ein feuchtes, verschmiertes Wesen, eine Art geschlechtslose, bibbernde Vogelscheuche, spülte hier Gläser und beugte sich beim Schein einer Kerze über den Holzbottich.
»Ja, Väterchen«, sagte der Mann im langen Kaftan jammernd. Er hatte ein bräunliches, schlaues Gesicht und einen spärlichen grauen Bart. In dem Bemühen, eine blecherne Laterne anzuzünden, preßte er diese gegen die Brust und schwatzte unterdessen weiter.
Er wolle dem Herrn den Sjemjanitsch schon zeigen und beweisen, daß er nicht lüge. Er werde ihn auch betrunken vorführen. Es scheine, daß sein Weib ihm letzte Nacht durchgebrannt sei. »Und was war das für eine Hexe! Mager! Pfui!« Er spuckte aus. Immer liefen die Weiber diesem Teufelskutscher davon – und der sei doch nun schon sechzig! Er könne es einfach nicht lernen. Doch jedes Herz habe seinen eigenen Kummer, und Sjemjanitsch sei schon immer ein Narr gewesen. Dann suche er Zuflucht bei der Flasche. »›Wer könnte das Leben in unserem Land auch ohne Schnaps ertragen?‹ sagt er dann. Er ist ein richtiger Russe … das Schwein … geruhen Sie, mir zu folgen.«
Rasumow durchquerte ein tief verschneites, von hohen, mit unendlich vielen Fenstern versehenen Mauern umstandenes Rechteck. Hier und dort hing schwaches gelbes Licht in dem Block von Dunkelheit. Das Haus war ein riesiger, abbruchreifer Slum, in dem es vom Abschaum der Menschheit wimmelte, eine monumentale Wohnstätte des Elends, aufragend über einem Abgrund von Hunger und Verzweiflung.
In einer Ecke ging es steil bergab, und Rasumow folgte dem Licht der Lampe durch eine enge Tür in einen langgestreckten höhlenartigen Raum, der wie ein nicht mehr benutzter Kuhstall aussah. Das trübe Licht der Laterne ließ weiter drinnen die Schatten dreier kleiner, struppiger Pferde erkennen, die unbeweglich mit gesenkten Köpfen dastanden. Das mußte die berühmte Haldinsche Fluchttroika sein. Rasumow blinzelte beklommen ins Dunkel. Sein Führer stocherte mit dem Fuß im Stroh.
»Hier ist er ja, unser Täubchen. Ein echter Russe. ›Ich mag keine schwermütigen Leute sehen‹, sagt er immer. ›Bring die Flasche und schaff mir deine häßliche Fratze aus den Augen!‹ Ha, ha! So ein Kerl ist das.«
Er hielt die Laterne über die lang hingestreckte Gestalt eines Mannes, der offenbar reisefertig angekleidet war. Sein Kopf wurde fast ganz von einer spitzen Kapuze verdeckt. Unten aus der Strohschütte ragten zwei Füße in unförmigen Stiefeln.
»Stets zur Abfahrt bereit«, erklärte der Kneipenwirt. »Ein echter russischer Kutscher. Heiliger oder Teufel, Tag oder Nacht, das ist Sjemjanitsch gleich, wenn er nur keinen Kummer hat. ›Ich frage die Leute nicht nach ihrem Namen, sondern nur nach ihrem Reiseziel‹, sagt er. Er würde den Teufel in die Hölle kutschieren und zurückkommen und seinen Pferdchen schnalzen. Er hat schon manchen gefahren, der heute in den Bergwerken von Nertschinsk mit den Ketten rasselt.«
Rasumow schauderte es.
»Rufen Sie ihn an, wecken Sie ihn«, stammelte er.
Der andere setzte die Laterne ab, trat zurück und holte zu einem Tritt gegen den reglosen Schläfer aus. Diesen ließ der Tritt erbeben, doch regte er sich nicht weiter. Nach dem dritten Tritt grunzte er, blieb aber liegen.
Der Wirt gab es auf und seufzte tief.
»Sie sehen selbst, wie es ist. Wir haben alles für Sie getan, was möglich ist.«
Er nahm die Laterne auf, Tiefe, schwarze Schattenspeichen drehten sich durch den Kreis von Licht. Gräßliche Wut – der rasende Trieb der Selbsterhaltung – packte Rasumow.
»Ah – das elende Vieh!« brüllte er mit unmenschlicher Stimme, vor der die Laterne angstvoll zitterte. »Ich will dich schon wecken! Ich brauche … brauche …«
Er blickte sich wild um, faßte den Stiel einer Mistgabel, stürzte sich auf den regungslos Daliegenden und begann unartikuliert brüllend auf ihn loszudreschen. Nach einem Weilchen verstummte er, und im düsteren, schattenhaften Schweigen des kellergleichen Stalles regnete es Prügel. Rasumow bearbeitete Sjemjanitsch mit unersättlicher Wut und hageldicht niedersausenden Schlägen. Abgesehen von Rasumows heftigen Bewegungen rührte sich nichts – weder der Geschlagene noch die speichenförmigen Schatten an der Wand. Es war ein unheimliches Bild.
Plötzlich gab es einen trockenen Knacks. Der Stiel war durchgebrochen, und ein Teil flog in weitem Bogen in die Dunkelheit außerhalb des Lichtkreises. Gleichzeitig richtete Sjemjanitsch sich auf, Rasumow stand ebenso unbeweglich wie der Mann mit der Laterne, nur arbeitete seine Brust zum Zerspringen.
Endlich mußte eine dumpfe Schmerzempfindung die tröstliche Nacht der Trunkenheit aufgerissen haben, welche die von Haldin so begeistert gepriesene ›prächtige russische Seele‹ umfaßt hielt. Doch nahm Sjemjanitsch offenbar gar nichts wahr. Seine Augäpfel leuchteten einmal, zweimal im Lampenlicht auf, dann erloschen sie. Einen Moment saß er mit geschlossenen Augen und einem befremdlichen Ausdruck tiefen Nachdenkens da, dann sank er geräuschlos nach der Seite um. Nur das Stroh raschelte ein wenig. Rasumow starrte ihn fassungslos an und rang nach Luft. Sekunden später vernahm er bereits ein leises Schnarchen. Er warf den in seiner Hand verbliebenen Teil des Stieles fort und stapfte hastig von dannen, ohne sich umzusehen.
Nachdem er blindlings etwa fünfzig Schritt die Straße entlang gehastet war, geriet er in eine Schneewehe und stand bereits bis zu den Knien darin, ehe er anhielt.
Das brachte ihn wieder zu sich, und als er sich nun umsah, bemerkte er, daß er in die falsche Richtung gegangen war. Er ging den Weg zurück, den er gekommen, diesmal jedoch bedächtiger. Als er an dem Haus vorbeikam, das er gerade erst verlassen hatte, schüttelte er die Faust gegen diesen düsteren Zufluchtsort des Elends und des Verbrechens, der bedrohlich aus dem weißen Boden aufragte. Das Gebäude sah aus, als brüte es vor sich hin. Er ließ den Arm sinken – entmutigt.
Die Verbissenheit, mit der Sjemjanitsch sich seinem Kummer und seinem Trost hingab, hatte Rasumow aus der Fassung gebracht. So war das Volk. Ein echter Russe, diese ›prächtige russische Seele‹ des anderen. Da hatte man sie ja: das Volk und den Schwärmer.
Gegen diese beiden war er machtlos. Zwischen der Trunkenheit des zu jeder Tat unfähigen Bauern und den vergifteten Träumen des Idealisten, der weder die wahren Ursachen der Verhältnisse noch die Natur des Menschen begriff, war Rasumow verloren. Es handelte sich da um eine gräßliche, kindische Verbocktheit. Doch für Kinder gab es immerhin Zuchtmeister. »Ah, der Stock, der Stock und die harte Hand«, dachte Rasumow und sehnte sich nach der Macht, weh zu tun und zu vernichten.
Es freute ihn, daß er den Kerl geprügelt hatte. Von der Anstrengung war ein angenehmes Glühen in seinem Körper zurückgeblieben. Auch der Nebel in seinem Kopf hatte sich verzogen, ganz als habe er sich mit diesem Ausbruch von Gewalttätigkeit von seiner inneren Erregung befreit. Zugleich mit dem unablässigen Bewußtsein einer furchtbaren Gefährdung verspürte er jetzt einen brennenden, unauslöschlichen Haß. Er ging immer langsamer. Und wahrlich, angesichts des Gastes in seiner Wohnung war es kein Wunder, daß er auf dem Heimweg zauderte. Es war ihm, als beherberge er eine pestähnliche Krankheit, die ihn nicht unbedingt das Leben kosten, die ihm aber alles nehmen würde, was das Leben lebenswert machte – eine schleichende Krankheit, die die Erde in eine Hölle verwandeln konnte.
Was er jetzt wohl tat? Lag er wie tot auf dem Bett, die Augen mit den Handrücken schirmend? Rasumow hatte plötzlich eine krankhaft eindringliche Vision von Haldin auf seinem, Rasumows, Bett, das weiße Kissen unter dem Kopf zusammengedrückt, die Beine in den hohen Stiefeln, die aufgerichteten Füße. Und von Abscheu getrieben, beschloß er: »Wenn ich nach Hause komme, werde ich ihn umbringen.« Doch wußte er sehr wohl, daß es so nicht ging. Der Tote würde ihm fast ebenso gefährlich sein wie der Lebende. Da nützte nur ein komplettes Verschwindenlassen, und das war ausgeschlossen. Aber was dann? Mußte man etwa Selbstmord verüben, um dieser Heimsuchung zu entgehen?
Rasumows Verzweiflung war schon so tief von Haß gefärbt, daß er diesen Ausweg nicht mehr wählen konnte.
Der Gedanke, ungezählte Tage mit Haldin zubringen, furchtsam auf jedes Geräusch achten zu müssen, erfüllte ihn mit Grauen. Immerhin – wenn er erfuhr, daß die ›prächtige Seele‹ Sjemjanitsch sich bis zur Bewußtlosigkeit betrunken hatte, würde der Bursche sich samt seiner höllischen Gelassenheit vielleicht woandershin bemühen. Allerdings sah es nicht sehr danach aus.
Rasumow dachte: »Ich werde zermalmt und kann nicht mal weglaufen!« Andere besaßen irgendwo einen Winkel auf dieser Erde, ein Häuschen in der fernen Provinz, wohin sie sich von Rechts wegen mit ihrem Kummer zurückziehen durften. Einen wirklichen Zufluchtsort. Er besaß nichts. Nicht einmal eine moralische Zuflucht – die des Selbstvertrauens. An wen in diesem großen, großen Lande konnte er sich mit seiner Geschichte wenden?
Rasumow stampfte mit dem Fuß auf – und unter dem weichen Schneeteppich fühlte er die harte Erde Rußlands, unbeseelt, kalt, reglos wie eine vergrämte, trauernde Mutter, die ihr Gesicht unter einem Leichentuch verbirgt – seine Heimaterde! Seine eigene Erde – doch ohne einen Herd, ohne ein Herz.
Er blickte auf und blieb verblüfft stehen. Es hatte aufgehört zu schneien, und wie durch ein Wunder sah er über sich den klaren schwarzen Himmel des nördlichen Winters, verziert mit dem prunkvollen Feuer der Sterne. Ein Baldachin, würdig der blendenden Reinheit des Schnees.
Rasumow spürte fast körperlich unendlichen Raum und ungezählte Millionen.