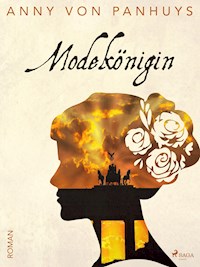
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Elisabeth Tann neun Jahre alt ist, verschwindet ihr Vater Robert Tann plötzlich aus unerfindlichen Gründen und zunehmend übernimmt die heranwachsende junge Frau Verantwortung für ihre Mutter und sich selbst. Elisabeths große Liebe ist ihr Jugendfreund Heino Staufen. Bald wollen der Buchhalter und die angehende Schneiderin heiraten. Aber manchmal und nicht ganz unberechtigt erfindet das Schicksal auch für ein großes Glück Umwege, an der eine sicher geglaubte Jugendfreundschaft erst zu wahrer Liebe reifen kann. Oder ist es Zufall, dass ausgerechnet Elisabeths Vater die große Summe Geld findet, die Heino auf dem Weg zur Bank verliert, dass Robert Tann gerade voller Reue auf dem Rückweg nach Hause ist, während Heino in seiner aufbrausenden Art sich gerade in sein Unglück verrennt? Im Zorn hatte er sich von Elisabeth getrennt, als er erfährt, dass ein großer Modesalon in Berlin ihr ein Angebot gemacht hat, und verliert den Umschlag. Zwar wird er, aus Mangel an Beweisen, vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen. Aber verbittert über das Unrecht geht er ins Ausland. Dramatisch, spannend und hinreißend unwiderstehlich erzählt die Autorin von dem märchenhaften Aufstieg Elisabeths zur Modekönigin in Berlin und Heinos lebensgefährlichen Abenteuern in Spanien. Doch das Schicksal verliert ihrer beiden Glück nicht aus den Augen!Das mondäne Berlin und das gefährliche Pflaster Barcelonas sind der spannende Hintergrund der Lebensgeschichte zweier Menschen, die sich erst verlieren müssen, um sich wirklich zu finden.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Modekönigin
Roman
Saga
Modekönigin
© 1954 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570500
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Elisabeth Tann blickte sich in dem einfachen Zimmer um, in das der Glanz der Morgensonne drang, und ein heimlicher Seufzer hob ihre junge Brust.
Im Armstuhl am Fenster, müde und zusammengesunken, saß ihre Mutter mit fieberhaft leuchtenden Augen und fuhr in der Erzählung ihres Traumes fort: „Und wie ich nun gerade denke, wer kann denn nur geklopft haben, springt die Tür wie von selbst auf und ein ganz feiner Herr steht auf der Schwelle und lacht mich an: Aber Martheken, kennst du mich denn nicht mehr? Da habe ich laut aufgeschrien vor Freude und Überraschung, weil es der Vater war. Denke nur, Liesel, dein Vater war es. Ich aber staunte ihn an und mir war ganz schwindlig vor lauter Glück.“
Das schmale, verhärmte Frauengesicht wandte sich voll der Tochter zu.
„Was meinst du, Liesel, wie der Vater aussah? Wie ein leibhaftiger Graf oder so ein Herr, und an der Hand trug er einen Ring mit einem Brillanten, davon war der ganze Vorplatz unserer Wohnung hell. Er holte eine Brieftasche hervor und sagte: Nun habe ich es doch noch geschafft draußen in der Welt, Martheken, nun bin ich ein reicher Mann und kann dir helfen, du armes Weib.“
Bei den letzten Worten begann sie laut zu schluchzen.
Elisabeth strich sich mit hilfloser Bewegung das leicht gelockte Haar aus der geraden weißen Stirn und erhob sich. Mit zögerndem Schritt trat sie zu der weinenden Frau.
„Mutterchen, quäle dich doch nicht gar zu sehr selbst. Ich bin erwachsen und verdiene schon ganz leidlich, die schlimmste Not ist doch für uns vorbei. Aber es wäre für deine Gesundheit besser, wenn du nicht mehr soviel an den Vater denken würdest.“
Ihre Rechte fuhr leicht und liebkosend über den Scheitel der Mutter. Sie tröstete: „Wir sind ja arm, aber vom Ersten ab bekomme ich von Frau Vollhard Zulage. Ich hoffe, in wenigen Jahren werden wir sehr gut und bequem leben können. Ich mache mich dann selbständig. Und wenn ich Heino heirate, verdiene ich mit dazu und du lebst bei uns, denkst gar nicht mehr an den Vater, der uns in Not und Sorge hat sitzen lassen, als er sich nicht mehr zu helfen gewußt.“
„Sprich nicht so vom Vater“, bat Martha Tann, „du tust mir damit weh. Er war ein gescheiter Kopf, nur zu sehr Draufgänger in seinen Unternehmungen. Überlege einmal, Kind, wie tüchtig er war. Als einfacher Maurer hat er angefangen, in ein paar Jahren saßen wir in unserem eigenen Hause. Als Bauunternehmer glückte ihm viel, bis er sich dann doch verrechnete. Er wollte eben zu gut für Frau und Kind sorgen.“
Elisabeths Augen blitzten empört.
„Er hätte wenigstens alles, was er durcheinander gebracht, möglichst zu ordnen versuchen müssen, statt dessen steckte er sich das noch vorhandene Geld ein und verschwand bei Nacht und Nebel. Die Gläubiger nahmen dir Haus und Möbel und es reichte gerade, um Vaters Verpflichtungen zu genügen. Du gingst in die Häuser fremder Leute und bessertest Wäsche aus, ernährtest uns davon. Zwei Stübchen, eine kleine Küche waren fortan unser Reich und sind es noch. Aber du träumst darin von dem Schloß, das uns Vater erbauen wird, wenn er zurückkehrt.“
Sie seufzte tief.
„Liebes, liebes Muttchen, ich leide sehr darunter, daß du dich nicht mit der Vergangenheit abfinden kannst. Du siehst und hörst nichts von allem, was um dich herum geschieht, du wartest nur auf den Vater. Wenn es zu ungewöhnlicher Stunde, wo du niemand erwartest, an die Korridortür klopft oder klingelt, schreckst du zusammen und meinst, der Vater müsse draußen stehen. Und den Briefträger fragst du schon seit zehn Jahren vergebens, ob er einen Brief für dich hätte. Ich bitte dich, Mutter, füge dich doch endlich in das Unabänderliche! Es tut mir so weh, mitansehen zu müssen, wie du dich härmst.“
„Ich habe den Vater so lieb gehabt“, schluchzte die arme Frau, „und ich kann es einfach nicht fassen, daß ich ihn niemals wiedersehen soll. Du weißt ja nicht, Kind, was es bedeutet, wenn man einen Mann so über jeden Begriff lieb hat. Du weißt nicht, wie dich das schüttelt, wie das in dir brennt, wenn der geliebte Mann plötzlich aus deinem Leben verschwindet. Das geht in deinen Kopf nicht hinein. Und das Herz will erst recht nichts davon wissen. Und dann steigen die Gedanken auf: Wo ist er, wie lebt er, warum bleibt er so lange fort? Das Herz antwortet: Er schafft draußen für Frau und Kind, er ist zu stolz, als armer Schlucker heimzukehren! Ich denke mir, er hat anfangs draußen kein Glück gehabt, aber schließlich wird er es zwingen und dann kehrt er heim. Ich warte seit zehn Jahren auf ihn, ja, aber die Zeit ist mir noch nicht zu lang dabei geworden. Eigentlich scheinen mir die zehn Jahre nur wie ein einziger langer Tag und die Träume sind die Erlebnisse darin.“
Sie schlug die Hände vor das Gesicht und Elisabeth tröstete sie mit immer zärtlicheren Worten.
Das Leid der Mutter war auch das ihre und sie hätte wer weiß was für ein Opfer gebracht, wenn sie der armen vergrämten Frau hätte Vergessen geben können.
Sie selbst empfand keine Sehnsucht nach dem Vater.
Neun Jahre war sie alt gewesen, als er plötzlich verschwand, als die Mutter mit ihr das bequeme Haus mit dem schönen Garten verlassen mußte.
Sie selbst glaubte nicht mehr an eine Rückkehr des Vaters. Zehn Jahre waren eine lange Zeitspanne.
Wahrscheinlich weilte er längst nicht mehr unter den Lebenden.
Endlich, als das Weinen nicht nachlassen wollte, sagte Elisabeth, müde und erschöpft von den vergeblichen Trostversuchen: „Ich glaube, ich habe vorhin unrecht gehabt, Muttchen, ich meine jetzt, dein Traum hat recht. Paß auf, so wird es werden: Eines Tages ist der Vater ganz plötzlich da als reicher Mann und er bleibt dann bei uns.“
Es half ja doch nichts, der Mutter Vernunft zu predigen, mochte sie ihre Illusionen behalten.
Martha Tann ward auch wirklich ruhiger, und als sie die Hände von dem verweinten Gesicht nahm, traf ein dankbarer Blick die Tochter.
„Ich weiß, ich quäle dich oft, zu oft mit meinem Kummer, Liesel. Aber das wird ja alles ganz anders, wenn Vater wieder bei uns ist. Ich fühle es, bald wird er kommen.“
Die alte Schwarzwälderuhr schlug acht.
Elisabeth trat vor den Spiegel und drückte den kleinen bereitliegenden schwarzen Strohhut auf das weiche Haar, das sich nun wie versponnenes helles Gold unter dem kappenartigen Hütchen hervordrängte.
„Ich muß gehen, Mutter, Heino wird schon auf mich warten.“ Sie küßte die Mutter und eilte dann überhastig die vier Treppen des Mietshauses hinunter.
Es war heute morgen etwas später geworden als sonst. Um ein halb neun mußte sie im Schneideratelier sein, in dem sie gelernt hatte und nun seit einem Jahre zu den Gehilfinnen gehörte.
An der Ecke wartete Heino Staufen.
Er war zweiter Buchhalter in der Getreidehandlung von Mosbach, und morgens traf er sich mit Elisabeth und sie gingen ein Stück des Wegs gemeinsam.
Heute kam er gerade von der Bank, wo er zwanzigtausend Mark für seine Firma geholt hatte.
Sie hatten sich lieb und es stand ihrer Ehe kein Hindernis entgegen. Nur wünschte Elisabeth, erst etwas mehr zu verdienen, und Heino wünschte sich dasselbe.
Heino winkte Elisabeth entgegen.
„Hast wohl heute ein bißchen die Zeit verschlafen, Kleine?“
Elisabeth reichte dem hübschen schlanken Manne, dessen blaue Augen ihr mit soviel Liebe entgegenblickten, die Hand.
„Nein, verschlafen habe ich nicht. Aber Mutter hat wieder einmal vom Vater geträumt, nun wartet sie sehnlicher denn je auf seine Rückkehr. Ich mußte sie lange trösten, die Ärmste. Sie tut mir zu bitter leid.“ Sie schaute den neben ihr Gehenden nachdenklich an. „Mutter hat den Vater ganz unbeschreiblich lieb gehabt, sie kann sich nicht darein fügen, ihn als Verschollenen oder Toten zu betrachten.“
Heino meinte: „Möglicherweise trifft ihr Gefühl aber doch das Richtige und er kommt eines Tages wieder.“
Elisabeth zuckte die Achseln.
„Ich glaube es nicht, Heino. Und wenn es wirklich geschähe, wer weiß, ob es für die Mutter gut wäre. Wer weiß, wie er aussieht, was er inzwischen durchgemacht hat.“
Er schwieg und lächelte nach einem Weilchen: „Herr Mosbach hat mir ab Oktober eine monatliche Gehaltserhöhung von fünfzig Mark zugesagt. Ich traf dich gestern abend leider nicht mehr, um es dir zu erzählen.“ Er rückte seinen Hut etwas unternehmend zur Seite. „Liesel, Herzensmädchen, dann wird aber bald geheiratet.“
Seine Züge überschattete tiefer Ernst.
„Im Waisenhause wurde ich großgezogen, danach kam ich zu einer alten Verwandten ins Haus, die mich als höchst überflüssigen Fresser behandelte, und dann kamen die möblierten Zimmer an die Reihe. Das ist meine Vergangenheit. Ach, du kannst es dir ja nicht vorstellen, wie unbändig ich mich freue auf das Zuhause, in dem du schaltest und waltest, das deine Liebe mir zum Paradiese machen soll.“
Über seinem ein wenig herben Gesicht lag jetzt ein solcher Glanz von Zärtlichkeit, daß es Elisabeth wie eine Liebkosung empfand.
Sie gingen durch eine stille Straße der nicht allzu großen Stadt. Die Straße bedeutete einen Umweg für beide, aber dafür durften sie hier auch sprechen, wie sie wollten, kein neugieriger Blick störte ihr Liebesgeplauder.
Elisabeth hatte aber auch eine Überraschung für ihren Heino. Vor einigen Tagen war eine Frau Weilert bei ihrer Chefin zu Besuch gewesen. Die beiden Damen waren gute Bekannte. Frau Weilert nun hatte in Berlin einen Modesalon, der zu den bekanntesten der Stadt zählte. Sie war von Elisabeths Figur und Geschmack entzückt und hatte ihr den Vorschlag gemacht, doch zu ihr nach Berlin zu kommen. Dort hätte sie ganz andere Möglichkeiten – es bestände sogar die Aussicht Starmannequin und später Modekönigin zu werden.
Elisabeth kannte Heinos aufbrausende Art. So versuchte sie mit vorsichtigen Worten ihm diese Möglichkeiten zu schildern. Heino unterbrach sie sofort erregt.
„Wie stellst du dir das vor?! Du, meine Braut, als öffentliche Modepuppe, den Blicken aller Welt preisgegeben! Ha, das wäre ein tolles Stück! Ich ...“
„Heino, beruhige dich bitte! Du siehst alles mit falschen Augen. Du glaubst, daß solche Mädchen verworfen sind und ...“
„Versuche dich nicht zu entschuldigen!“ schrie er und geriet immer mehr in Zorn, denn er spürte, daß sie innerlich bereits entschlossen war, nach Berlin zu gehen. „Ich weiß, was du willst! Das freie ungebundene Leben reizt dich, und mich, mich willst du in Kürze zu Seite schieben ... Es ist eine Schande ...“
Heino Staufen hatte sich so in Hitze geredet und war so laut geworden, daß Vorübergehende bereits aufmerksam wurden. Elisabeth stiegen bei diesen ungerechten Vorwürfen die Tränen in die Augen. Kummer und Schmerz erfüllte sie: War ein solcher Streit nötig, zumal sie sich doch beide so liebten?!
„Es ist eine Schande für dich, Heino, daß du mich so anschreist“, warf sie ihm mit tränenerstickter Stimme vor.
Er aber war außer sich, weil Elisabeth den Vorschlag der Berliner Modistin ernst nahm und darauf eingehen wollte. Sein Zorn flammte heiß empor.
„Du bist das unverständigste Geschöpf, das ich kenne“, schrie er sie an, „komm du nur erst wieder zur Vernunft, dann melde dich bei mir.“
„Schnell schoß er davon, als gelte es, ein sehr wichtiges Ziel schnellstens zu erreichen.
Elisabeth wandte ihm den Rücken und eilte heim mit Augen, die verdunkelt waren von schweren Tränen.
II.
Heino Staufen dachte in seiner grenzenlosen Erregung gar nicht mehr daran, daß er zwanzigtausend Mark, die er in der Brusttasche in einem sorgfältig zugesiegelten Umschlag trug, abgeben mußte, ehe er zum Essen ging. Aber es fiel ihm auch nicht ein, zum Essen in die Pension zu gehen. Er stürmte in seinem heißen Zorn vorwärts und suchte die Einsamkeit.
Er lief durch die Promenade und stürmte in den Wald hinein, der sich schattenspendend vor ihm öffnete, wie ein großer, geheimnisvoller Dom.
Er lief noch ein Stück quer durch den Wald, bis seine Erregung matter wurde. Wie sich Wogen nach dem Sturm beruhigen, so wurde auch in ihm alles friedlicher.
Er war vorhin gleich zu heftig geworden. Er sah das jetzt ein. Elisabeth hatte ihn lieb, sie würde vernünftig sein, wenn er sie so recht von Herzen bat.
Er verwünschte seine Heftigkeit.
Ihm war heiß geworden. Er zog seinen Rock aus. Hier sah ihn ja niemand. Um diese Zeit spazierte wohl außer ihm kein Mensch im Stadtwald herum.
„Nur ich verblendeter Mensch!“ dachte er voll Selbstironie.
Er lächelte weich. Sein liebes kleines Liesel: Modekönigin von Berlin!
Ein Witz war das. Sein Liesel paßte nicht zu solchem Firlefanz, zu solcher Modereklamefigur, zu solcher Eitelkeitsgöttin.
Er schwenkte den Arm, über den er lässig den Rock trug, leicht hin und her. Bei den Schlenkerbewegungen des Armes geriet der Briefumschlag in der Innentasche des Rockes etwas ins Rutschen, aber Heino Staufen, der eben in das Laubdach der Bäume schaute, merkte es nicht. Seine verliebte Phantasie zeigte ihm hoch oben Elisabeths reizvolles Bild und er merkte auch nicht, wie neues Schlenkern des Armes die Katastrophe vollendete.
Der Brief war auf den weichen Waldboden gefallen.
Heino Staufen schritt schneller und kraftvoller aus. Nun sein Zorn verraucht war, fühlte er sich wieder vollständig wohl. Auf das Mittagsmahl verzichtete er gern.
Und da er sich nun doch schon im Walde befand, wollte er noch ein halbes Stündchen hier verweilen.
Als Heino Staufen ein Stück von der Stelle entfernt war, wo er das Geld verloren, kam seitlich durch den Wald ein Mann mit müden Füßen. Man merkte es deutlich seinem Gange an, wie wund diese Füße sein mußten.
Sein Gesicht war nicht häßlich, aber viele Falten und Fältchen durchzogen es und die Mundwinkel senkten sich verbittert nach unten. Seine braunen Augen lagen unter faltigen Lidern und das Haar hing strähnig und grau unter seiner Mütze hervor.
Er schien hungrig und matt, und es war, als ob er mit sich selbst spreche, wenn auch kein Laut über seine Lippen sprang.
Er sank an einem dicken Eichenstamm nieder. Ausruhen wollte er und noch einmal, zum letztenmal überlegen, ob es denn wirklich keine Rettung für ihn gab.
Sein Kopf fiel gegen den Stamm wie haltsuchend und er schloß die Augen.
Zehn Jahre war es her, da war er heimlich, als Frau und Kind schliefen, mit zwei Tausendmarkscheinen, dem letzten baren Geld seiner Kasse, aus der kleinen Stadt, die hinter dem Eichenwalde lag, geflohen. Er hatte Jahre hindurch in der kleinen Stadt Bau um Bau ausgeführt, die Häuser immer wieder mit Vorteil verkauft, bis er sich dann mit seinen Spekulationen verrechnet und ihn die Angst vor der Verantwortung forttrieb. Wohin? In das große Land: „Überall“.
Er war in Brasilien gewesen und in Mexiko, in Argentinien, Kanada und Kalifornien. Ein armseliger Globetrotter, der sich nirgends Halt unter die Füße zu zwingen vermochte.
Und doch war das Wanderleben voll Reiz gewesen. Oft hatte er gehungert, sich aber auch zuweilen satt gegessen, er hatte gearbeitet, was ihm der Zufall an Arbeit geboten, und hatte das Falschspiel erlernt in den verrufenen Hafenschenken von Rio de Janeiro.
Eines Tages, ganz urplötzlich mitten in seinem erbärmlichen Vagabundenleben, überfiel ihn das große Heimweh wild und elementar. Nach zehn Jahren in der Fremde kam es über ihn und schüttelte ihn, wie der Sturm einen schwankenden Baum. Riß ihn über das Meer zurück in die Heima.t Riß ihn bis in die kleine Stadt, in der er vor zehn Jahren Frau und Kind zurückgelassen, wie Gegenstände, die man nicht mehr braucht.
Durch Falschspiel hatte er sich eine jammervolle beschwerliche Überfahrt zusammengespart, und dann war er von Hamburg her in der Richtung seines einstigen Zuhauses gewandert. Durch Städte und Dörfer. Sich immer ein bißchen abseits haltend, den Gendarmen aus dem Wege gehend.
Sein bißchen Essen hatte er sich zusammengeschnorrt.
Und so erreichte er sein Ziel. Wenigstens beinahe erreichte er es.
Er hatte seine Frau aufsuchen wollen, die er fast vergessen da draußen in der weiten Welt, hatte Verlangen verspürt, sein Töchterchen zu sehen, das er unverantwortlich im Stiche gelassen, aber schon ganz nahe dem Städtchen packte ihn Angst.
Er konnte doch nicht urplötzlich wieder auftauchen, noch dazu als Landstreicher.
Mit durchgelaufenen Stiefeln, mit zerrissenem Rock und dem letzten Hemd auf dem Leibe.
Die Heimatluft hatte die Scham in ihm wachgerüttelt und er hatte im letzten Dorf vor dem Wald einen Strick gestohlen.
Einen derben Strick, über den eine Bäuerin Wäsche gehängt hatte. Seife lag in der Nähe und allerlei sonstige Waschutensilien.
Er nahm auch das Stück Seife und rieb den Strick später damit ein, damit sich die Schlinge schnell und glatt zuzog, wenn er Schluß machte mit dem verfehlten Dasein.
Hier im Eichenwalde sollte es geschehen, dicht vor dem Heimatstädtchen.
Wenn man ihn fand und seine Papiere las, dann erfuhren doch Frau und Kind, wie hart er sich selbst gerichtet.
Er sah keinen Ausweg mehr, er durfte den Seinen die Schande nicht antun, so heimzukehren, ihnen zur Last zu fallen.
Er riß die Augen weit auf. Allbarmherziger Himmel, sollte das wirklich seine letzte Stunde sein? War er deshalb so weit über das Meer hergekommen, hatte er sich deshalb auf den Landstraßen die Füße wund gelaufen, nur um hier eines so elenden Todes sterben zu müssen?
Hatte er nicht an die Vergebung seiner Frau, an die zärtlichen Trostworte seiner kleinen Elisabeth gedacht?
Seine kleine Elisabeth war jetzt groß, vielleicht schon verheiratet. Sie würde sich so sehr ihres Vaters schämen müssen. Und Martheken, die so verliebt in ihn gewesen, daß er es oft genug komisch gefunden, würde sich wohl bedanken, den abgerissenen Lumpen als ihren Gatten zu begrüßen.
Es war am besten, er führte seinen Vorsatz aus.
Er erhob sich und zog unter seinem fest zugeknöpften Rock den Strick hervor, den er der Bäuerin gestohlen.
Er betrachtete ihn mit Grauen.
Ein unheimliches Frieren ging über seinen ausgemergelten Körper und seine Lippen bewegten sich, während seine Augen Umschau hielten nach dem geeigneten Ast.
Er dachte, von der Verzweiflung dieser Stunde dazu getrieben: Warum hatte er kein einziges Gebet aus Kindertagen in seinem Gedächtnis festgehalten?
Warum konnte er nicht eins von den vielen, die es gab?
Vielleicht hätte es ihm Hilfe gebracht! Oder wenigstens Trost.
Er schrie plötzlich verzweifelt auf: „Herrgott im Himmel, ich kann nicht beten, aber um meiner armen Frau und um meines armen Kindes willen tue ein Wunder. Damit ich sie beide wiedersehen kann. Die Sehnsucht nach den zweien frißt jetzt in mir wie böses Feuer.“
Ein paar Tränen zogen über seine faltenzerrissenen Wangen, als er stöhnte: „Ich will mich bessern, Herrgott, ich will mich bestimmt bessern. Aber bitte, bitte, tue ein Wunder, ich habe oft gehört, daß du es kannst.“
Noch einmal erinnerte er: „Tue ein Wunder!“ Dann suchten seine Augen wieder den Ast, der ihn aus dem Leben tragen sollte.
Er machte ein paar ziellose Schritte, und die Augen noch immer nach oben richtend, stolperte er über eine vorstehende Baumwurzel und stürzte.
Unwillkürlich stützte er sich dabei mit beiden Händen und fühlte auf dem moosigen Boden unter seiner Rechten ein festes Papier.
Im nächsten Augenblick sah er einen weißen, mit fünf roten Siegeln geschlossenen Umschlag.
Er erhob sich schwerfällig, der versiegelte Umschlag schnitt seine Selbstmordgedanken durch, wie mit einem scharfen Messer.
Er konnte nicht widerstehen, er riß den Umschlag hastig seitlich auf und taumelte, als er den Inhalt erkannte.
Er zitterte vor Überraschung an allen Gliedern und sein erster Gedanke war: Das Wunder, um das er gefleht, war geschehen. Der Herrgott, an den er seit Kindertagen nicht mehr gedacht, hatte ihm geholfen.
Den Strick in der einen Hand, den Umschlag in der anderen, stand er da und sah sich scheu um.
Niemand war weit und breit zu erblicken.
Er zog die Geldscheine aus dem Umschlag, der ihm dabei entglitt, und starrte wie benommen die vielen Scheine an.
Er begann zu zählen, aber mit einem Male, er war gerade bis zehn gekommen, überfiel ihn siedendheiße Angst.
Er dachte, wenn es auch für ihn ein Wunder bedeutete, dieses Geld hier gefunden zu haben, mußte es doch jemand verloren haben. Und der unbekannte Jemand würde seinen Verlust früher oder später bemerken und zurückkehren, den Weg absuchen, den er gegangen.
Jede Minute konnte er auftauchen. Und dann traf er ihn hier mit dem Bündel Banknoten in der Hand und würde es ihm natürlich wieder entreißen.
Blitzgeschwind barg er die Scheine in der Brusttasche seines schäbigen Rockes und eilte, so rasch ihn seine müden, wunden Füße trugen, davon. Wieder tiefer in den Wald hinein.
Er würde sich hüten, jetzt in der Richtung der Stadt zu gehen.
Am besten war es wohl, sich wieder zurück bis Berlin durchzuschlagen.
Dort konnte er sich auffrischen und einkleiden, ein ganz anderer Robert Tann durfte dann an die Wohnung der Frau klopfen, die er vor zehn Jahren heimlich verlassen.
Er stolperte noch ein paarmal und schließlich brach er fast zusammen. Seine Gedanken verwirrten sich, und in einer schmalen Mulde zwischen Gestrüpp und wirr verwachsenem Waldgras fiel er zu Boden.
Ruhen mußte er, schlafen. Nur kurze Zeit, nur ein halbes Stündchen, denn es war ihm nicht möglich, auch nur noch einen einzigen Schritt weiterzugehen.
Der weite Weg, die Hitze, der Hunger hatten seine Kräfte auf das äußerste erschöpft. Dazu gesellte sich die Todesangst.
Die jähe Freude über den Fund hatte ihm den Rest gegeben.
Er lag kaum in der Mulde, die wie ein weiches grünes Bett war, als er schon schlief.
Seine tiefen Atemzüge verrieten, er wußte nichts mehr von seiner Umwelt.
Den Strick aber trug er noch bei sich. Er lag über seinem linken Arm, während Daumen und Zeigefinger seiner Rechten die Schlinge krampfig umfaßt hielten.
Aber er schlief fest und tief.
Inzwischen hatte Heino Staufen seinen Weg fortgesetzt. Schließlich fing er an, laut zu pfeifen, seine Sorge schien ihm jetzt lächerlich. Elisabeth hatte ihn lieb, und sie würden sich beide wieder vertragen. Noch heute! Sein Mädel setzte doch nicht ihr und sein Glück auf das Spiel, um dafür die Aussicht zu gewinnen, vielleicht Modekönigin zu werden.
Heute abend noch wollte er sie wegen seiner Heftigkeit um Verzeihung bitten, wollte lieb und vernünftig mit ihr sprechen.
Auch würde er umkehren müssen.
Schnell warf er einen Blick auf seine Uhr, die er in der Westentasche trug.
Es war sogar die allerhöchste Zeit, kehrt zu machen, wenn er noch ein Täßchen Kaffee trinken wollte, ehe er ins Kontor ging.
Und jetzt fiel ihm auch ein, er hatte ja in seinem Zorn über Elisabeths Vorhaben vergessen, das Geld zur Firma Klymann zu bringen.
Das mußte er aber jetzt gleich tun.
Hoffentlich würde er wegen der verspäteten Ablieferung noch keinen Ärger haben! Sein Chef hatte ihn als Überbringer des Geldes schon vormittags telefonisch bei der Firma Klymann angemeldet.
Er zog den Rock an und starrte im nächsten Moment wie entgeistert die Innentasche an, in die er, wie er genau wußte, den versiegelten Umschlag gesteckt hatte.
Der Umschlag mit dem Geld aber war verschwunden.
Seine Hand fuhr in die Tasche, fühlte so tief hinein, als bestände die Möglichkeit, die vielen Banknoten könnten sich in eine Briefmarke verwandelt haben.
Er untersuchte auch die anderen Taschen und stand dann da, an allen Gliedern wie gelähmt. Er überlegte verzweifelt: Wo war der versiegelte Umschlag mit den zwanzigtausend Mark geblieben?
Er brauchte nicht lange nachzudenken. Er hatte, bald nachdem er den Wald betreten, den Rock ausgezogen und hatte später mit dem Arm, über dem der Rock lag, spielerisch geschlenkert.
Dabei mußte der Umschlag aus der Tasche gerutscht sein.
Er bedurfte seiner ganzen Willenskraft, um die von dem wahnsinnigen Schreck erstarrten Glieder wieder dazu zu bringen, sich zu bewegen.
Er mußte den Umschlag suchen gehen!
Um diese Zeit gab es sicher nicht viele Leute hier im Walde, und wenn er sich eilte, konnte er hoffen, den wertvollen Umschlag wiederzufinden. Nur mußte er auf dem gleichen Weg zurückkehren, auf dem er gekommen.
Er begann zu laufen. Schließlich rannte er, aber immer noch ging es ihm nicht schnell genug.
Doch so sehr er auch nach allen Seiten ausspähte, er sah das Verlorene nicht.
Und dann mit einem Male, als ihm die Verzweiflung schon beinahe die Kehle zuschnürte, erblickte er von weitem etwas Weißes und als er näher kam, leuchtete es wie Blut über dem Weiß auf.
Sein Herz klopfte wie rasend vor Freude. Er hatte deutlich die roten Siegel auf dem weißen Umschlag erkannt.
Er stieß vor Freude einen unartikulierten Laut aus und sein Laufen ließ etwas nach. Es war nicht windig, der Umschlag flog nicht fort. Es war auch niemand in der Nähe, der ihn möglicherweise hätte aufheben können, und der Umschlag mit seinem wertvollen Inhalt war ihm jetzt schon genau so sicher, als wenn er ihn in den Händen hielt.
Aber nie wieder wollte er so leichtsinnig sein, in seinem ganzen Leben nicht.
Er hatte heute über seiner Liebe seine Pflicht vernachlässigt, nein, vollständig versäumt. Das heutige Erlebnis sollte ihm eine bittere Lehre sein für alle Zeit.
Er näherte sich nun der Stelle, wo der Umschlag mit den roten Siegeln lag. Aber noch ehe er sich bückte, wollten seine Glieder schon wieder in die alte Starrheit von vorhin verfallen. Denn jetzt in der Nähe erkannte er, der Umschlag war seitlich aufgerissen worden, die Siegel aber waren fast unverletzt geblieben.
Und er erkannte auch auf den ersten Blick, der Umschlag war leer. Seine Hand streckte sich zögernd aus und nahm den Umschlag hoch. Gleich darauf stellte er fest, es befand sich kein einziger Schein mehr darin, nicht einmal eine von den Banknoten im Werte von hundert Mark.
Der Übergang von der Freude zu der erschreckenden Enttäuschung war zu schroff gewesen.
Sein Herzschlag machte sich so stark fühlbar, daß er ihn zu hören meinte, und in seinen Schläfen drängte sich das Blut zusammen. Es war, als schlage man ihm mit schweren Hämmern breite eiserne Nägel in den Kopf.
Seine Gedanken versuchten sich zu ordnen und gerieten doch immer mehr in ein hilfloses Durcheinander.
Heino Staufen machte mühsam ein paar Schritte, wankte dabei wie ein Trunkener. Er mußte sich an einen Baum lehnen.
Es war derselbe Baum, unter dem sich vorhin Robert Tann flüchtig ausgeruht, ehe er den Umschlag mit dem Geld gefunden.
Heino Staufen grübelte verzweifelt und über alle Begriffe erregt nach, was er jetzt tun sollte.
Hatte es Zweck, den Wald zu durchforschen nach dem Diebe des Geldes? Denn ein Dieb war der Mensch, der die Scheine aus dem versiegelten Umschlag genommen hatte.
Wahrscheinlich hatte er die Richtung nach der Stadt gewählt.
Er erinnerte sich genau, keinem Menschen begegnet zu sein, seit er den Wald betreten.
Er selbst wagte sich nicht in die Stadt zurück, er wagte sich nicht ins Kontor.
Er mußte sich ja in Grund und Boden schämen, wenn er erklären sollte, wie fahrlässig er mit dem ihm anvertrauten Gelde umgegangen.
Und er war nicht imstande, den Verlust zu ersetzen.
Vierhundert Mark Erspartes besaß er. Was bedeutete die kleine Summe aber im Verhältnis zu zwanzigtausend Mark?
Er war völlig ratlos, er war ganz außer sich.
Er stöhnte laut auf, wie bei einem Schmerzanfall.
Was sollte nun werden? Er war ruiniert. Man würde ihn mit Schimpf und Schande entlassen, und wer würde jemand aufnehmen, der so leichtsinnig mit dem Gelde anderer umging?
Er faßte endlich aber doch wieder Mut und lief kreuz und quer durch den Wald, in der Hoffnung, das Geld hier auf irgendeine Weise wiederzuerhalten.
Aber er traf niemand, unheimlich und drohend schien ihm jetzt die doch vorhin so wohltuende Stille des Waldes.
Er fühlte, er war am Ende seiner Kraft, und er sank auf einen Baumstumpf nieder, grübelte verzweifelt in sich hinein: Was sollte er tun? Es mußte doch einen Ausweg aus der entsetzlichen Situation geben, in der er sich befand.
Er saß mit hochgezogenen Knien, seine Ellbogen stützten sich darauf. Sein Kopf lag in den flachen Schalen seiner Hände.
Ihm war zumute, als gäbe es für ihn kein Voran und kein Zurück mehr, als wäre die Vergangenheit tot und die Zukunft in düstere Hoffnungslosigkeit gehüllt, als glotze ihn grinsend die Gegenwart an, diese furchtbare, unbegreiflich furchtbare Gegenwart.
Er stutzte. In sein stumpfes verzweifeltes Grübeln war ein sonderbarer Laut gedrungen, der ihn den Kopf heben ließ.
Wie ein leises Sägen hatte es geklungen.
Jetzt kam der Laut wieder. Ganz deutlich hörte er ihn. Es mußte jemand in der Nähe schnarchen. Denn Schnarchlaute waren es, die sein Ohr getroffen.
Er erhob sich und erblickte unfern in einer schmalen Mulde, etwas vom Gestrüpp verborgen, einen älteren Mann, dessen Armseligkeit sich einem auf den ersten Blick offenbarte.
Heino Staufen sah, der Weltentrückte war ein ganz gewöhnlicher Vagabund. Die Mütze war ihm vom Kopf geglitten, über dem langsträhniges graues Haar lag, das vom Schweiße förmlich angeklebt war.
Seine ausgefransten Hosen ließen elend abgelaufene Stiefel sehen und auf das von vielen Falten durchzogene Gesicht hatte die Not ihren unverkennbaren Stempel gedrückt.
Ein erbarmungswürdiges und verwittertes Gesicht war es, mußte der Beobachter unwillkürlich denken.
Ob dieser Mensch schon lange hier schlief? Ob er vielleicht jemand gesehen hatte, der das Geld aus dem Umschlag genommen haben konnte?
Er schauderte zusammen, denn er entdeckte über dem linken Arm des Schlafenden einen Strick.
Ein Selbstmörder war es also, der da vor ihm lag, dem das Leben so zugesetzt, daß er es nicht mehr ertragen konnte. Daß er ein Ende damit machen wollte.
Vielleicht war er vor Müdigkeit und Hunger eingeschlafen, als er sich zu seiner letzten Arbeit auf Erden rüstete.
Der Strick, den er noch mit zwei Fingern der Rechten festhielt, als fürchtete er, es könne jemand die Absicht haben, ihn darum zu berauben, offenbarte deutlich, was der Schlafende vorgehabt. Was er auch wohl noch vorhatte, wenn er erwachte.
Sollte er den Menschen wecken, ihn befragen, ob er irgendeine Person im Walde getroffen? Um auf diese Weise vielleicht die Spur des Diebes zu entdecken?
Unsinn, er mußte den armen Teufel in Ruhe lassen. Der brauchte seinen Schlaf und der wußte ihm auch bestimmt keinen Wink zu geben.
Er befand sich hier in einem ganz entfernten Teil des Waldes, weitab von der Stelle, wo er den Umschlag verloren.
Und plötzlich zeigte sich ihm eine Hoffnung.
Das Geld war vielleicht gar nicht unterschlagen worden!
Der Finder des Umschlags mochte ihn, weil er keine Anschrift trug, nur aus dem Grunde geöffnet haben, um sich zu überzeugen, was sich darin befand. Und das Geld mochte er längst in der Stadt auf der Polizei abgegeben haben, während er sich hier im Walde herumtrieb und sein armes Hirn bis zur Weißglut erhitzte.
Von dem neuen Gedanken ganz in Fesseln geschlagen, eilte er davon, ohne noch einen einzigen Blick an den Schläfer zu verschwenden.
Er durchraste die Straßen der Stadt, als wäre ihm der Leibhaftige auf den Fersen, und betrat das Hauptbureau der Polizei in erhitztem und atemlosem Zustand.
Ein Schutzmann fragte nach seinem Begehr und hörte ihn etwas ungeduldig an, weil er weitschweifend wurde, weil er sich, ohne daß eigentlich Grund dazu vorhanden, unwillkürlich zu entschuldigen versuchte.
Der Schutzmann unterbrach ihn.
„Mir ist nichts davon bekannt, daß jemand bei uns eine Summe von zwanzigtausend Mark abgegeben hat, aber ich werde mich erkundigen.“
Er stand auf und gleich darauf wurde Heino Staufen in das Zimmer eines sehr energisch blickenden Kommissars gerufen.
Der ließ sich ebenfalls seine Geschichte erzählen und stellte dann allerlei Fragen, die nach Heino Staufens Ansicht gar nicht zur Sache gehörten.
Und schließlich, von den vielen an ihn gerichteten Fragen wie zermartert, war er so klug wie vorher.
Er erklärte erregt: „Ich werde jetzt ins Kontor gehen und mit meinem Chef sprechen.“
Der Kommissar machte eine schroff abwehrende Handbewegung.
„Herr Mosbach wird von mir sofort benachrichtigt werden, Sie aber müssen vorläufig hierbleiben!“
„Weshalb?“ fragte Heino Staufen, von einer jähen bösen Ahnung befallen.
„Weil Ihre Erzählung ein wenig unglaubwürdig klingt“, war die kühle Antwort. „Denn welcher Angestellte, wenn er eine solche Summe bei einer seinem Chef befreundeten Firma abgeben soll, läuft damit in der Zeit, in der die Angestellten sonst zu Mittag essen, draußen im Walde herum! Ich möchte vor allem erst hören, wie sich Herr Mosbach über das Geschehene äußert. Aus dem aufgerissenen Umschlag ist nicht viel zu entnehmen. Den Umschlag kann jeder aufgerissen haben, auch Sie selbst.“
Da schrie Heino Staufen laut auf: „Herr, hüten Sie Ihre Zunge, Sie dürfen mich nicht beleidigen!“
Der Kommissar zuckte die Achseln.
„Besinnen Sie sich, bitte, wo Sie sich befinden. Ich habe nur Tatsachen festgestellt.“
Heino Staufen atmete schwer, ihm war es, als müsse er ersticken und wie zerschlagen sank er auf einen Stuhl nieder.
Den Kommissar rührte die Haltung des ihm verdächtig Scheinenden gar nicht. Er hatte in seiner Praxis schon viel mit Simulanten zu tun gehabt. Sie verstanden es oft, sich so zu verstellen, daß man leicht darauf hineinfallen konnte, wenn man sich nicht mit der Brille des Mißtrauens bewaffnete.
III.
Elisabeth hatte das einfache, aber schmackhafte Essen, das ihr die Mutter vorgesetzt, hinuntergewürgt.
Der Ärger über den Streit mit Heino Staufen war noch nicht abgeflaut und sie mußte sich sehr zusammennehmen vor der Mutter.
Nach dem Essen setzten sich Martha Tann und ihre Tochter stets zu einem Plauderstündchen auf das Sofa. Auch heute blieb es bei der alten Gewohnheit.
Elisabeth benützte die Gelegenheit, der Mutter von dem Angebot der Berliner Modistin zu sprechen und ihr die Vorteile des Angebots klar zu machen.
Die Mutter blickte nachdenklich.
„Vorteile würdest du in Berlin entschieden haben, aber auch mancherlei Unbequemlichkeiten. Schon die Fahrerei morgens und abends ist anstrengend.“
Elisabeth ließ den Grund nicht gelten.
„Ich stehe eine Stunde früher auf und gehe abends eine Stunde später schlafen, damit sind die Unbequemlichkeiten wohl so ziemlich erledigt. Aber bedenke, Muttchen, ich würde dreimal so viel Gehalt beziehen wie bei Frau Vollhard. Auch könnte ich in Berlin noch viel lernen. Ich würde dort die elegantesten Modelle sehen und wertvolle Erfahrungen sammeln können für meine spätere Selbständigkeit. Außerdem habe ich bei Frau Weilert Aussicht, Modekönigin zu werden. Bares Geld bekäme ich dann, vielleicht tausend Mark oder mehr. Wir würden es gut anwenden, nicht wahr, Mutter?“
Die vergrämte Frau nickte.
„Dann müßten wir hier alles ein bißchen hübscher einrichten, damit sich Vater, wenn er kommt, bei uns wohlfühlt.“
Elisabeth seufzte heimlich. Da fing die Mutter richtig wieder mit ihrer fixen Idee an.
Aber widersprechen würde sie der Mutter nicht mehr.
Nach einem Weilchen sagte Martha Tann: „Tue, was du für klug und richtig hältst, Liesel. Die Hauptsache ist ja wohl Heino. Wenn es ihm recht ist, was du vorhast, ist es ja gut.“
„Und wenn es ihm nicht recht wäre, Mutter?“ fragte Elisabeth langsam und mit Nachdruck.
Martha Tann sah sie groß an und in ihren Augen stand ein Leuchten.
„Brauchst du da überhaupt noch zu fragen, Kind? Wenn der Mann, den du liebst, etwas, was du tun willst, nicht wünscht, dann ist es doch ganz selbstverständlich, daß du es unterlassen mußt. Eine Frau, die liebt, denkt gar nicht darüber nach. Was der Vater wollte, das wollte ich stets auch, nie war das anders. Ehe ich heiratete nicht und auch nachher nicht.“
Elisabeth sah nicht recht ein, warum die liebende Frau blind tun sollte, was der Mann wünschte, aber sie widersprach nicht, weil sie es sich vorgenommen.
Aber als sie die Straßenecke erreichte, wo sie Heino Staufen auf dem Weg ins Geschäft zu treffen pflegte, wurden die Worte der Mutter wieder wach in ihr.
Weshalb war Heino aber auch gleich so schroff und rücksichtslos zu ihr gewesen?
Das hatte ihren Trotz herausgefordert.
Sie dachte, wenn er nun hier stände und auf sie wartete, hätte sie ihm wahrscheinlich nachgegeben. Ein bittendes Wort von ihm hätte sie veranlaßt, Frau Weilert für ihren lockenden Vorschlag zu danken.
Sie ging langsamer, kehrte ein Stückchen um, schaute angestrengt in die Richtung, aus der er kommen mußte, aber umsonst, er schien nicht zum Nachgeben bereit zu sein.
Ihr Trotz erwachte wieder.
All die schmeichelhaften Worte, die ihr Frau Weilert vormittags gesagt, wurden lebendig in ihr.
Ihr Köpfchen legte sich etwas selbstbewußter in den Nacken.
Wenn Heino nicht einsah, wie abscheulich er sich benommen, so warf das kein gutes Licht auf seinen Charakter.
Als sie die Nähstube betrat, wo vier Gehilfinnen und zwei Lehrmädchen eben mit ihren Arbeiten beginnen wollten, wurde ihr gesagt, sie möchte gleich zu Frau Vollhard kommen.
Sie fand ihre Chefin mit Frau Weilert im Wohnzimmer beim Kaffee und sie wurde eingeladen, mitzutrinken.
Elisabeth setzte sich schüchtern an den Tisch.
Zum Kaffee gab es Törtchen und süßen Likör. Elisabeth dachte, so gut hatte ihr noch kein Kaffee geschmeckt, aber sie aß daheim auch nur trockene Brötchen dazu, allerhöchstens des Sonntags ein Stückchen Streusel- oder Napfkuchen.
Das Gläschen Likör erzeugte eine eigentümliche Stimmung in ihr.
Als ihr Else Weilert nun genauer erklärte, wie gut sie es bei ihr haben sollte, dachte sie gar nicht daran, die Antwort zu überlegen oder ihre Zusage hinauszuschieben. Sie war sofort mit einem fast jubelnd klingenden Ja bereit zu allem.
Sie fand die Zukunft, wie sie ihr Frau Weilert ausmalte, ganz herrlich.
Aber plötzlich stiegen ihr die Tränen in die Augen. Sie hatte daran denken müssen, daß Heino sie vorhin nicht erwartet hatte.
Else Weilert blickte sie verwundert an.
„Was ist denn mit einem Male mit Ihnen los, liebes Fräulein? Eben sahen Sie noch aus, als wollten Sie die ganze Welt umarmen, und jetzt scheinen Sie Lust zum Weinen zu haben.“
Die Frauen drangen in sie, ihr Herz zu entlasten.
Da erzählte Elisabeth von Heino Staufen.
Die Inhaberin des Berliner Modesalons verzog ein wenig die Lippen.
„Aber, Kind, wie kann man deswegen so aufgeregt sein! Sie sind töricht, Mädel, ein so brutaler Mensch ist es wirklich nicht wert, daß Sie sich seinetwegen die schönen Augen verderben, Überlegen Sie nur, wenn der sich schon jetzt so aufspielt, wie wird er es dann erst in der Ehe treiben! Wenn er Sie lieb hat, gibt er nach und reißt Sie nicht zurück, wenn Ihnen die Gelegenheit geboten wird, zu etwas zu kommen. Aber ich möchte Sie nicht überreden und lasse Ihnen deshalb nochmals Zeit bis morgen, sich meinen Vorschlag zu überlegen. Ich bleibe bis morgen mittag hier und wenn Sie dann wollen, können Sie mich gleich nach Berlin begleiten.“
Elisabeths Erregung ließ nach. Tiefaufatmend dachte sie, nun blieb ihr Zeit, sich doch noch einmal mit Heino über das Thema zu besprechen. In Ruhe wollte sie alles mit ihm überlegen.
Sie rechnete bestimmt damit, er würde sie diesen Abend erwarten.
Aber er erwartete sie nicht.
Wie befremdend das war!
Sie schlief wenig in dieser Nacht. Ihr war es immer, als höre sie seine geliebte Stimme sagen: „Mein Liesel!“ Und danach klang es wieder schroff an ihr Ohr: „Komm du nur erst wieder zur Vernunft, dann melde dich bei mir!“
Auch am folgenden Morgen traf sie Heino nicht. Da siegte ihr Stolz. Wenn er keine Versöhnung wollte, mochte alles zwischen ihnen zu Ende sein.
Sie begleitete Frau Weilert am frühen Nachmittag nach Berlin, das sie bisher nur wenig kannte.
In der Voßstraße, nahe von Tiergarten und Potsdamer Platz, befand sich der Modesalon der Frau Weilert. Als diese die schlanke Elisabeth Tann den anderen Mannequins vorstellte, traf ihr Blick auf wenig freundliche Mienen.
Ein großes, etwas üppiges Mädchen spöttelte halblaut: „Aus was for ‘n Wachsfigurenkabinett is denn die ausjebrochen?“
Hämisches Lachen vereinte sich zu dünnem Chor.
Elisabeth war es, als stände sie mitten unter Feindinnen.
Frau Weilerts kluges Wieselgesicht wurde spitz und böse.
„Emma, wenn Sie sich nicht anständig aufführen, fliegen Sie, ohne daß Sie einen Platz im Flugzeug zu bezahlen brauchen. Ich wünsche nicht, daß Lili Tann von Ihnen oder einer lieben Kollegin hier ‘rausgegrault wird. Sie steht unter meinem ganz besonderen Schutz. Merken Sie sich das alle, ohne Ausnahme.“
Sie wandte sich an die Direktrice.
„Informieren Sie Lili ein bißchen. Sie ist auch eine gute Schneiderin. Und geben Sie ihr einen passenden Geschäftskittel.“
Sie nickte Elisabeth lächelnd zu und ging, sie ihrem weiteren Schicksal überlassend.
Im nächsten Moment sah sich Elisabeth von den Mädchen umringt und jede gab sich Mühe, recht freundlich zu ihr zu sein. Die große Schneiderstube schien förmlich in wohlwollendes Lächeln gebadet.
Auch die üppige Emma lächelte sie an.
„Wenn dir unse Olle so proteschiert, derf man nich mucksen“, sagte sie und ihr hübsches volles Gesicht strahlte vor Liebenswürdigkeit. „Weißt du, Liliken, eijentlich sind wir hier ja eine Rasselbande, aber schlecht sind wir nich. Du wirst schon mit uns auskommen.“ Sie tippte ihr mit der Spitze der sehr glänzend manikürten Zeigefingerkralle an das runde Kinn. „Ziehe man keinen Flunsch, Liliken, et hat keinen Zweck. Wir sind dir ja nich mehr böse, weil du hübscher bist wie wir. Bewahre! Ich wenigstens nicht! Ich werde mir hüten; Ärger macht dünn, un ich muß „vollschlank“ bleiben. So nennen sich doch heuzutage die Dicken, damit sie wat haben, womit sie sich rausreden können aus ihr Fett. Ich bin als „vollschlank“ angaschiert und muß so bleiben.“
Sie blinzelte schlau.
„Ich kann mir denken, uff dir setzt unse Olle die Hoffnung, du wirst den Vogel abschießen bei der Wahl der Modekönigin. Man sah ihr det ja an der verflixt spitzen Nase an. Un du bist ooch ‘n verdeibelt hübsches Vieh. Ich will ehrlich sein, so im ersten Momang, wo ich dir jesehen habe, hat et in mir anjefangen zu kribbeln. Au Backe, hab ich jedacht, die Kleinstadtkruke schmeißt uns alle wie nischt, die hat ‘ne zu süße Visasche! Aber nu habe ich mir beruhigt. Ich jönne es dir, mir zu überstrahlen. Wenn et dir meine Kollejen eben so ehrlich jönnen, det du ihnen überstrahlst, können wir jleich alle dicke Freundschaft schließen. Hier meine Hand drauf.“
Elisabeth nahm die Hand und drückte sie kräftig. Dabei mußte sie lachen. Das Gemisch von Hochdeutsch und Berliner Jargon kleidete die „vollschlanke“ Emma. Sie wirkte drollig in ihrer Art.
Noch immer lachend fragte sie: „Warum sagen Sie eigentlich „du“ zu mir?“
„Habe ich det vielleicht jetan?“ erkundigte sich Emma mit lustig blitzenden Augen. „Ja? Na, denn is et ja jut! So wat tue ick unbewußt, wenn mir jemand sympathisch is. Wenn ich dir sympathisch bin, darfst du auch „du“ zu mir sagen.“
Elisabeth war einverstanden und Emma Winter gefiel ihr wirklich.
Die Direktrice, Fräulein Ina genannt — eigentlich hieß sie Malvine — war sehr blaß, sehr gepudert und sehr onduliert. Sie reichte Elisabeth eine Art große Schürze aus gelblichem Leinenstoff mit bunter Borte.
„Das is unse Uniform“, erklärte Emma, „wenn wir jar nischt darunter anhaben, is et auch ejal. Man schont durch den Lappen die Kleider, Liliken.“
Jetzt fiel es Elisabeth erst auf, daß die meisten der Mädchen in solchen Kitteln steckten.
Sie sah und hörte an diesem halben Tage viel Neues und als sie abends mit dem Zuge heimfuhr, brummte ihr der Kopf.
Nachdem man zur Nacht gegessen, sagte die Mutter merklich zögernd: „Hast du mir gar nichts zu erzählen, Liesel? Ich meine, nichts Besonderes?“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Ich erzählte dir doch schon vorhin, wie es in Berlin gewesen und wie es mir bei Frau Weilert gefallen hat.“
„Das meine ich nicht“, wehrte Martha Tann ab, „ich meine, hast du mir nichts von Heino Staufen zu erzählen?“
Elisabeth antwortete mit einer Gegenfrage.
„Ist er hier gewesen, Mutter, hat er mich sprechen wollen? Und weshalb war er denn weder gestern noch heute an unseren Treffpunkten? Hat er es dir gesagt?“
Ihre Wangen waren ganz heiß. Nun freute sie sich doch, weil er anscheinend seine Heftigkeit bereute.
Die Mutter antwortete mit ihrer immer müden Stimme: „Nein, er war nicht hier. Aber Frau Schulten, die unter uns wohnt, hat mir erzählt, im Blatt stände, er wäre gestern mittag verhaftet worden.“
Ein entsetzter Aufschrei Elisabeths unterbrach sie.
„Verhaftet?! Muttchen, das kann nicht möglich sein. Was soll er denn getan haben?“ Sie umfaßte die Schultern der schmalen Frau mit leidenschaftlicher Heftigkeit. „Bitte, sage mir, daß es nicht wahr ist, bitte, sage es mir!“
Martha Tann schüttelte den Kopf.
„Das kann ich leider nicht. Im Blatt steht, er soll einen plumpen Schwindel mit zwanzigtausend Mark gemacht haben, die er von der Firma Mosbach einer anderen Firma bringen mußte. Es heißt, er hat der Polizei das leere aufgerissene Geldkuvert gebracht und hätte dazu eine Räubergeschichte erzählt. Kurz, man deutet an, er habe das Geld unterschlagen. Jedenfalls sitzt er jetzt im Gefängnis.“ Sie seufzte tief. „Ich traue das Heino Staufen nicht zu, aber er mußte doch anscheinend sehr belastet sein.“
Sie sah, Elisabeth kämpfte gegen einen Schwächeanfall an, weil sie die Hiobspost nicht fassen konnte.
Sie sagte beruhigend: „Ich hätte so gern, ach, so gern geschwiegen, aber ich mußte sprechen. Es ist tausendmal besser, du hörst die häßliche Geschichte aus meinem Mund, als aus dem irgendeiner Klatschbase. Du bist nun wenigstens vorbereitet.“
Elisabeth ging langsam durch das Zimmer, blieb vor der Mutter stehen.
„Ich kann und kann es nicht glauben, was du mir eben mitteiltest, Mutter. Es muß sich um einen Irrtum handeln. Heino hat bestimmt kein Geld unterschlagen.“ Sie schloß hastig: „Ich will gleich zu Frau Schulten hinuntergehen, ich muß es in der Zeitung selbst lesen, sonst glaube ich nicht, daß jemand es wagt, eine so gemeine Lüge zu drucken. Die gemeinste aller Lügen!“
Die Mutter wollte sie zurückhalten, aber Elisabeth hörte ihr Rufen gar nicht mehr, so eilig war sie davongestürmt.
Frau Schulten war eine bescheidene Kleinbeamtenwitwe. Sie lebte von einer knappen Pension und strickte für ein Geschäft Wollsachen. Sie suchte für Elisabeth sofort die betreffende Zeitung heraus.
Gutmütig mahnte sie: „Regen Sie sich nicht zu sehr auf, Liesel, die Männer sind es gar nicht wert, daß wir ihretwegen leiden. Ich weiß, Sie waren halb und halb mit Staufen verlobt, aber wo er nun solche Sachen ausgefressen hat, werden Sie wohl schnell mit ihm Schluß machen müssen, sonst schaden Sie sich.“
Elisabeth zitterte vor Aufregung. Ihre Hand, die das Blatt entgegennahm, flog hin und her, als wäre die wenig umfangreiche Zeitung zu schwer für sie.
Da stand:
„Gestern wurde Heino Staufen, der zweite Buchhalter der Getreidefirma L. Mosbach, auf dem Polizeibureau am Marktplatz verhaftet. Er erschien dort sehr aufgeregt und gab an, im Eichenwald einen versiegelten Umschlag mit zwanzigtausend Mark verloren zu haben den er in der Innentasche seines Rockes aufbewahrt hatte. Als er den Verlust bemerkte, wäre er eilig den Weg, auf dem er gekommen, wieder zurückgelaufen und hätte den aufgerissenen Umschlag leer an der Stelle gefunden, wo er ihn verloren haben müsse. Er erinnere sich, mit dem Arm, über den der ausgezogene Rock hing, hin- und hergeschlenkert zu haben. Er hätte den Rock ausgezogen, weil ihm zu warm geworden. Beim Schlenkern des Armes müsse das Geld, das er völlig vergessen, aus seiner Tasche gerutscht sein. Heino Staufen hat das Geld mittags nach Geschäftsschluß bei der Firma Klymann abgeben sollen. Er zog es statt dessen vor, einen Waldspaziergang zu unternehmen in der Zeit, wo er sonst zu essen pflegte. Staufen genießt sehr guten Leumund, aber seine Erzählung machte einen stark phantastischen Eindruck. Er bestreitet jede Schuld.“
In Elisabeths Augen blitzte es auf, und das Blatt zurückgebend, sagte sie sehr erregt: „Heino Staufen hat Unglück gehabt, auch leichtsinnig ist er gewesen, aber man hatte kein Recht, ihn zu verhaften.“
Die alte Frau nickte.
„Die Liebe glaubt alles, die Polizei ist weniger gläubig.“
Elisabeth hatte einen verzweifelten Blick. Sie vergaß zu grüßen und eilte zur Mutter hinauf.
Sie sank vor der schmalen kleinen Frau in die Knie.
„Mutter, man schmäht Heino, man klagt ihn an. Ich habe es selbst gelesen. Und wenn er auch heftig ist, so lügt er doch nicht. Und er ist auch keiner Unterschlagung fähig. Mich hat er durch seine Heftigkeit gekränkt. Er wollte nicht, daß ich die Stellung in Berlin annehmen sollte. Magst du es nur wissen! Und in der Verzweiflung über unseren Streit lief er mit dem vielen Geld, das er wegtragen sollte, im Stadtwalde herum und verlor es. Irgendein Lump, ein schlechter, unehrlicher Kerl wird dann die Scheine gefunden haben. Der Himmel mag wissen, wohin der Lump mit dem Geld verschwunden ist, und der arme Heino wird nun verdächtigt. Er, der beste und ehrlichste Mensch.“
Sie legte ihren Kopf in den Schoß der Mutter.
„Was soll ich tun? Ich muß ihm beistehen, ihm helfen. Wollen gründlich nachdenken, Mutter, was ich für ihn tun kann.“
Sie sprang auf.
„Morgen früh laufe ich zur Polizei und erzähle von unserem Streit“, rief sie, „dann wird man begreifen, weshalb Heino um die Zeit, wo er sonst zu essen pflegte, wie es in der Zeitung heißt, einen Waldspaziergang unternahm.“
Martha Tann nickte ihr zu.
„Versuche ihn zu entlasten, wie immer du es auch anfängst! Und jetzt gehe zur Ruhe, Kind, versuche zu schlafen. Guter Rat kommt über Nacht.“
Elisabeth hätte wer weiß was dafür gegeben, wenn sie heute nacht ein Schlafzimmer für sich allein zur Verfügung gehabt hätte, wenn sie sich so recht von Herzen hätte ausweinen dürfen. Aber der Schlaf der Mutter sollte nicht gestört werden.
Sie drückte das brennende Gesicht tief in die Kissen, um das mühsam gebändigte Schluchzen zu ersticken, damit die Mutter nichts hörte, deren Bett drüben an der Wand stand.
Die Nacht zeigte ihr Schreckbild um Schreckbild.
Man würde Heino verurteilen, weil man annahm, er habe das Geld unterschlagen, und sie klagte sich an, die Schuld an dem Unglück zu tragen. Hätte sich Heino nicht gestern mittag so sehr über sie geärgert, hätte er seine Pflicht nicht vergessen.
Ihr kam der Gedanke, zu Heinos Chef zu gehen, er mußte den Geliebten entlasten.
Er konnte das wohl am besten.
In aller Herrgottsfrühe erhob sie sich aus dem Bett, das für sie diese Nacht zu einem Marterlager geworden, und wusch sich in der Küche.
Nachdem sie sich fertig angekleidet, setzte sie sich in der Wohnstube ans offene Fenster, um sich die schmerzende Stirn von der Morgenluft kühlen zu lassen.
Immer fester ward ihr Entschluß, zur Firma Mosbach zu gehen und mit Heinos Chef zu sprechen.
Sie atmete tief die erquickende Luft ein, die sie belebte, und versuchte sich damit zu trösten, man könne den Geliebten ja nicht lange festhalten, weil er unschuldig war.
Sie bereitete den Kaffee und nachdem sie später mit der Mutter gefrühstückt, wobei sie nur wenige Bissen genoß, machte sie sich zum Ausgang bereit.
Martha Tann mahnte: „Aber Liesel, du mußt doch nach Berlin fahren, nun du die Stellung angenommen hast.“
Ihre Tochter schien gar nicht daran zu denken, daß sie seit gestern mittag ihre Stellung gewechselt.
Elisabeth drückte das Hütchen tiefer in den Kopf.
„Das ist unwichtig, Mutter, jetzt vermag ich nur an Heino zu denken.“
Die vergrämte Frau, die ihren Mann noch immer liebte, obwohl er leichten Herzens von ihr gegangen, die förmlichen Kultus mit ihrer Liebe trieb, fand Elisabeths Antwort völlig richtig.
Was lag an einer Stellung, wenn es sich um das Wohl des Geliebten handelte?
Wie nebensächlich dagegen alles, einfach alles!
IV.
Die Firma Mosbach war noch geschlossen, als Elisabeth ihr Ziel erreicht hatte. Sie mußte noch beinahe eine Viertelstunde warten, bis Leonhard Mosbach erschien und selbst die Bureauräume aufschloß.
Er war stets der erste hier morgens, aber auch der letzte, der abends fortging.
Elisabeth kannte den reichen Getreidehändler vom Ansehen und nachdem er ein Weilchen das Haus betreten, eilte sie ihm nach.
Mosbach hatte gerade die Rolläden hochgezogen, als es an die Tür des Büros klopfte.
Er zog verwundert die halbmondförmig gewachsenen Brauen hoch, deren Form seinem Gesicht ständig den Ausdruck leichten Erstaunens gab.
„Nanu, wer kommt denn da schon?“ murmelte er verwundert.
Seine Angestellten pflegten doch nicht zu klopfen und es war auch noch gar nicht so spät, daß er sie erwarten konnte.
Er rief laut „Herein!“ und riß die Augen auf, als nun ein wunderschönes Mädchen zur Tür hereinspazierte.
Leonhard Mosbach schritt ihr entgegen und erkundigte sich mit ganz besonderer Höflichkeit nach den Wünschen der frühen Besucherin.
Elisabeth blickte den sehr kleinen, auffallend breitschulterigen Mann bittend an.
„Herr Mosbach, wenn Sie ein wenig Zeit hätten, wäre ich Ihnen für eine kurze Unterredung sehr dankbar“, begann sie.
Sie hatte sich den Satz der Einleitung vorher zurechtgelegt.
Mosbach erwiderte galant: „Für schöne junge Damen habe ich immer etwas Zeit übrig.“
Er öffnete vor ihr die Tür zu seinem Privatkontor, das ziemlich nüchtern, aber bequem eingerichtet war.
Die Glanzstücke darin waren ein riesiger Schreibtisch und zwei braunlederne Klubsessel.
In den einen davon nötigte er die Besucherin, in dem anderen nahm er selbst Platz. Er blickte Elisabeth unaufhörlich an und begriff nicht, daß es so wunderschöne Menschenkinder gab, wie diese junge fremde Dame, die ihn anscheinend kannte, weil sie ihn gleich mit seinem Namen angesprochen.
Elisabeth holte tief Atem.
„Ich heiße Elisabeth Tann, und ich habe mir erlaubt, Sie aufzusuchen, Herr Mosbach, um mit Ihnen über Heino Staufen zu sprechen. Ich möchte Sie nämlich so recht, recht sehr bitten, alles aufzubieten, damit ihm kein weiteres Unrecht zugefügt wird.“
Leonhard Mosbach blickte sehr interessiert.
Dieser vermaledeite Gauner Staufen hatte Glück, dachte er, daß ein so entzückendes Mädchen für ihn bat.
„Was kann ich für Sie tun?“ fragte er und betonte das „Sie“ besonders. „Für Staufen rühre ich keinen Finger, er ist ein Dummkopf. Wenn ich auch der Geschädigte bin, ärgert es mich fast, wie blöde er die Geschichte angefangen hat.“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Sie irren, Herr Mosbach, Heino ist kein Betrüger. Und Sie selbst müßten doch davon am meisten überzeugt sein. Er arbeitet doch seit drei Jahren in Ihrem Geschäft.“
Mosbach lächelte ein wenig, seine wulstigen Lippen zogen sich dabei in die Breite.
„Das sagt gar nichts! Und wenn er zehn Jahre in meinem Geschäft gearbeitet hätte! Man kennt doch seine Angestellten nicht. Was weiß ich, was für aufrührerische Gedanken die Leute haben, die mir grundbrave Biedermänner vormimen. Wissen Sie, zwanzigtausend Mark sind kein Pappenstiel, und wenn einer Gelegenheit hat, soviel Geld an sich zu bringen, bezweifle ich nicht, daß er es tut. Auch Staufen traue ich es zu.“
Elisabeth richtete sich etwas auf.
„Das dürfen Sie aber nicht, Herr Mosbach, nein, das dürfen Sie nicht. Heino Staufen ist grundehrlich, er würde nicht einmal eine Stecknadel unterschlagen.“ Ihre Stimme ward eindringlich: „Sie könnten ihm Ihr gesamtes Vermögen anvertrauen, es wäre sicher und gut bei ihm aufgehoben.“
„Nun, den Beweis dafür hat er erbracht, nicht mal die Zwanzigtausend waren bei ihm sicher“, erwiderte Leonhard Mosbach etwas ärgerlich. „Der Himmel erhalte Ihnen Ihre Kindlichkeit.“ Er nahm eine väterliche Miene an. „Nun reden Sie aber mal: Warum legen Sie sich für Staufen so ins Zeug? Er ist Ihr Liebster, nicht wahr?“
„Er ist mein Bräutigam, Herr Mosbach, wenn wir auch nicht öffentlich verlobt waren“, entgegnete sie, „und ich darf es nicht dulden, daß man ihn einer gemeinen Handlung beschuldigt.“
Ihr fiel es selbst auf, wie schroff ihre Antwort geklungen und sie dachte, wie töricht von ihr, sich so gehen zu lassen, sie wollte sich doch mit Mosbach gut stehen. Er konnte doch am meisten für den Geliebten tun.
Sie fuhr ganz klein und bittend fort: „Wenn Sie bei der Polizei gut von Heino Staufen sprechen, Herr Mosbach, wird man den Verdacht gegen ihn fallen lassen.“
Leonhard Mosbach antwortete nicht gleich, aber er blickte das Mädchen, das ihm gegenüber saß, nur durch ein kleines Tischchen von ihm getrennt, mit verlangenden Augen an.
Ein wundervoll schöner Schmetterling war ihm an diesem Sommermorgen in sein nüchternes Kontor geflogen.
Leonhard Mosbach war fünfzig Jahre, er hatte das gutgehende Geschäft vom Vater geerbt, es durch eisernen Fleiß bedeutend vergrößert, sich aber nie viel Zeit genommen, an sein persönliches Vergnügen zu denken.
Seine Frau war dick und gehörte zu jener unangenehmen Klasse der Weiblichkeit, die sich stets beleidigt fühlt, und er amüsierte sich manchmal ein bißchen in Berlin mit Kellnerinnen und Bardamen dritter Ordnung, fühlte sich dann als Lebemann.
Jetzt durchzuckte ihn der Gedanke, es müsse tausendmal angenehmer sein, so ein wundervolles Geschöpf wie Elisabeth Tann in den Arm nehmen und küssen zu dürfen.
Er nahm einen sehr freundlichen Ton an, wechselte aber das Thema.
„Sie heißen Tann, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe. Sagen Sie, sind Sie irgendwie mit dem früheren Bauunternehmer Robert Tann verwandt?“
Elisabeth neigte leicht den Kopf.
„Ja, ich bin seine Tochter. Aber ich weiß gar nichts von meinem Vater, er ist verschollen.“
Mosbach dachte: Also die Tochter des Bankerotteurs war sie! Er durfte danach wohl annehmen, daß sie nicht gerade auf Rosen gebettet war.
Er lächelte: „Ich kaufte neulich die frühere Villa Ihres Vaters und werde sie im Herbst beziehen. Das ist doch interessant, nicht wahr?“
Elisabeth fand die Mitteilung nicht im mindesten interessant. Ihr schien der Gedanke eher häßlich, daß dieser plumpe unangenehme Mensch das Haus bewohnen würde, in dem sie ihre sorglosen Kinderspiele gespielt.
Sie erwiderte dennoch: „Gewiß, das ist sehr interessant.“ Dann aber sprang sie auf das alte Thema zurück, behielt den ergebenen, bittenden Ton von zuletzt bei.
„Sie waren hoffentlich niemals unzufrieden mit Heino Staufen, Herr Mosbach, nicht wahr? Oder doch? Bitte, seien Sie ehrlich. Ich wäre Ihnen sehr, sehr dankbar für Ihre Antwort.“
Mosbach schmunzelte.
„Ihre Dankbarkeit möchte ich mir schon verdienen, Fräulein Tann. Also, ich war sogar sehr zufrieden mit ihm.“
Elisabeth atmete ein wenig freier.
„Nun, Herr Mosbach, wenn das der Fall ist, dürfen Sie auch kein Mißtrauen gegen ihn hegen. Sie müssen ihn entlasten. Wenn Sie auf der Polizei erklären, Sie glauben, Heino Staufen hat den Umschlag mit dem Geld tatsächlich auf die Weise verloren, wie er angibt, wird er freigegeben werden. Und wenn es der Polizei nicht gelingt, den Menschen aufzuspüren, der das Geld fand und unterschlug, werden Heino und ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ihn aufzuspüren. Irgend jemand muß doch das Geld haben.“
Auf Leonhard Mosbachs Stirn lag eine dicke Falte der Mißstimmung.
„Sie muten mir ein wenig allzu viel Nächstenliebe zu von der Sorte, wenn mir jemand einen Schlag auf die rechte Wange gibt, müsse ich ihm die linke auch hinhalten. Sie muten mir, klarer gesprochen, ganz einfach eine Dummheit zu. Ich habe doch vorgestern nachmittag, als man mich auf die Polizei rief, erklärt, ich hätte es zwar niemals geglaubt, daß mich Staufen derartig beschwindeln könnte, so gemein, so niederträchtig, aber ich habe auch zugleich erklärt, ich bezweifle keine Sekunde, daß er das Geld unterschlagen hat und seine Erzählung Schwindel ist.“
Er rieb seine breiten Hände, die wie Schaufeln waren, energisch aneinander.
„Wenn ihn die Polizei mürbe macht, ihn ordentlich in Angst jagt mit ihrem Ausfragesystem, gesteht er schließlich wahrscheinlich doch, wo er das Geld gelassen hat. Und es kommt doch für mich darauf an, das Geld wiederzukriegen. Ich wäre ja ein Narr, wenn ich mich um seine Freilassung bemühen würde. Außerdem weiß ich nicht einmal, ob es ginge. Nein, Fräulein, den Gefallen kann ich Ihnen leider nicht tun. Mir liegt vor allem daran, mein Geld wiederzukriegen.“ Sein Gesicht erhellte sich. „Wenn ich dagegen Ihnen persönlich einen Gefallen erweisen könnte, bin ich dazu sofort bereit. Sie müssen nämlich wissen, Fräuleinchen, ich bin ’ne Seele von Mensch. Machen Sie Ihrem Herzen Luft, ich würde mich freuen, mich für Ihre persönlichen Wünsche interessieren zu dürfen.“ Seine Stimme bekam einen heiseren Beiklang. „Lassen Sie den Bruder Leichtsinn laufen, trauern Sie dem nicht nach. Sie haben das nicht nötig mit Ihrem Aussehen.“
Er setzte sich in Positur.
„Man ist leider nicht mehr jung, aber man kann sich sehen lassen und das Beste, man ist so situiert, einem netten Mädelchen ab und zu was Hübsches zu schenken.“
Er erhob sich, während Elisabeth wie gelähmt dasaß.
Auf diese Wendung des Gesprächs war sie nicht vorbereitet gewesen.
Er trat näher.
„Sie sind reizend, Kindchen, ganz reizend, viel zu schade für einen solchen Schwindler, wie es Staufen ist!“
Er blinzelte: „Sie sind eine süße Krabbe, ein entzükkendes Pusselchen. Wie wäre es mit unserer Freundschaft? Sie sollten es nicht bereuen.“
Die Schaufelhände streckten sich nach ihr aus, während er lachte: „Komm, Püppchen, gib mir einen Kuß als Vorschuß.“
Elisabeth, die noch eben wie gelähmt dagesessen, erhob sich blitzgeschwind und stieß den Zudringlichen zurück.
„Fassen Sie mich nicht an, Sie ekelhafter Mensch, sonst schreie ich so laut um Hilfe, daß die ganze Nachbarschaft zusammenläuft.“
Ihre Augen funkelten drohend und sie schienen im Zorne fast schwarz. Ihr Gesicht glühte, ihr Atem flog.
Nebenan hörte man eben laut eine Tür schließen.
Auch Leonhard Mosbach hörte es und er trat sofort zurück, sagte so laut, daß man es nebenan im Büro hören mußte: „Es tut mir leid, ich kann nichts für Staufen tun. Der Kerl hat mich um zwanzigtausend Mark geprellt.“
Er lächelte höhnisch, als er leise fortfuhr: „Seien Sie nur vorsichtig, man kann nicht wissen, ob Sie nicht selbst die beste Auskunft geben könnten, wo das Geld geblieben ist.“
Da schlug Elisabeth, ihrer selbst nicht mehr mächtig, dem Schandkerl in das feiste höhnische Gesicht.
Im nächsten Augenblick aber stand sie mit schlaff niederhängenden Armen da.
Wozu hatte sie sich hinreißen lassen!





























