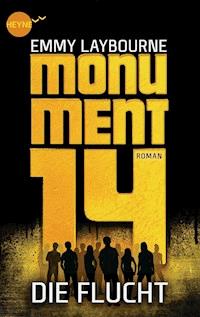
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bist du ganz auf dich allein gestellt
Nachdem ein Tsunami die Ostküste der USA getroffen und weite Teile des Landes verwüstet hat, stranden vierzehn Jugendliche in einem Einkaufszentrum. Der Strom fällt aus, die Zivilisation bricht zusammen, und aus einer nahen Chemiefabrik entweicht eine gefährliche Giftwolke. Dann dringt das Gerücht durch, dass die Überlebenden von Denver aus ausgeflogen werden. Die Jugendlichen bestimmen eine Gesandtschaft, die sich nach Denver durchschlagen soll. Der Rest von ihnen bleibt zurück, darunter der eher schüchterne Dean, der sich früher immer aus allem herausgehalten hat. Als sie von einem gewalttätigen Einbrecher bedroht werden, muss Dean über sich selbst hinauswachsen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Dean, sein jüngerer Bruder Alex und ihre Freunde müssen sich allein durchschlagen, nachdem ein Tsunami die Ostküste der USA verwüstet und ihre Heimatstadt Monument zerstört hat. Nachdem sie erst in einem Einkaufszentrum Zuflucht gefunden haben, bahnt sich ein Grüppchen von ihnen nun seinen Weg durch die Reste der Zivilisation, unter ihnen Alex. Ihr Plan: bis nach Denver zu kommen, denn von dort werden die Überlebenden angeblich ausgeflogen. Doch schon nach kurzer Zeit werden Alex und die anderen überfallen und müssen den Schulbus, in dem sie unterwegs sind, an die Angreifer abtreten. Die Jugendlichen sind gezwungen, ihren mühevollen Weg zu Fuß fortzusetzen. Die Angst treibt sie weiter. Und die Sorge um ihre im Einkaufszentrum zurückgebliebenen Freunde. Werden diese allein zurechtkommen? Und werden sie sich verteidigen können, wenn sie überfallen werden?
Auch der zweite Teil der Bestsellerserie hält die Leser von der ersten bis zur letzten Seite in Atem.
»Einfach unglaublich packend!« Booklist
Die Autorin
Emmy Laybourne arbeitete als Schauspielerin, ehe sie zum Schreiben kam. Über den großen Erfolg von MONUMENT 14, ihrem Debütroman, ist sie noch immer selbst erstaunt. Mit ihrem Mann, zwei Kindern und der australischen Echse Goldie lebt sie im Bundesstaat New York.
EMMY LAYBOURNE
Monument14
DIE FLUCHT
Aus dem Amerikanischen von Ulrich Thiele
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel Monument 14: Sky on Fire bei Feiwel & Friends, New York
Copyright © 2013 by Emmy Laybourne
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Christine Schlitt
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-13174-6
www.heyne-fliegt.de
Immer noch für Sam
An denjenigen, der diesen Brief findet:
Ich hätte da eine Matheaufgabe für Sie.
Acht Kids, die von schrecklichen, psychotischen Krankheitserscheinungen befallen werden, sobald sie sich länger als 30 bis 40 Sekunden der Außenluft aussetzen, wollen in einem Schulbus, der einen nie dagewesenen Hagelsturm und eine Kollision mit der massiven Glastür eines Greenway-Superstores überlebt hat, auf einem dunklen Highway 108 Kilometer zurücklegen.
Dabei dürften sie von einer nicht abschätzbaren Anzahl von Hindernissen, unvorhersehbaren Komplikationen und möglicherweise gefährlichen Angriffen aufgehalten werden, darunter Straßensperren, Wegelagerer oder geistesgestörte Mörder unter Giftgaseinfluss.
Bitte berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit ihrer Ankunft am Denver International Airport, wo man sie (hoffentlich) in Sicherheit bringen wird.
Ich weiß, Ihnen fehlen wichtige Informationen. Sie können die Wahrscheinlichkeit nicht ordentlich kalkulieren. Aber wenn Sie ein bisschen Ahnung von Mathematik und den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben, sollte Ihnen klar sein, wie unsere Chancen stehen: beschissen.
Deshalb schreibe ich diesen Brief. Damit später noch irgendwer weiß, wer wir waren.
Außer mir sitzen noch im Bus:
Niko Mills – unser Anführer. Geht (oder ging) in die 11. Klasse der Lewis Palmer High. Außerdem ist er bei den Pfadfindern. Hat Blutgruppe A, was bedeutet: Kommt er länger als eine Minute in Kontakt mit der Außenluft, entwickelt er einen blutigen Ausschlag und stirbt.
Brayden Cutlass – 11. Klasse. Blutgruppe AB, leidet im Fall des Falles also unter paranoiden Wahnvorstellungen. Aber das ist auch wieder egal – er ist quasi bewusstlos. Wegen ihm (okay, nicht nur wegen ihm) müssen wir nach Denver. Einer der beiden Fremden, die wir in den Greenway-Superstore reingelassen haben, hat ihn in die Schulter geschossen. Das Krankenhaus in Monument ist zu, aber am Flughafen von Denver, wo man uns evakuieren wird, gibt es angeblich Ärzte.
Josie Miller – 10. Klasse. Ebenfalls Blutgruppe AB. Eines der nettesten Mädchen, die ich je kennengelernt habe. Nicht dass das irgendwie wichtig wäre. Nur so, falls jemand das hier liest.
Sahalia Wenner – erst 13, führt sich aber auf, als wäre sie schon auf der Highschool. Blutgruppe B, wie ich. Wir haben keine sichtbaren Symptome, aber dafür werden wir unter »Fortpflanzungsschwierigkeiten« leiden. Keiner von uns wird Kinder kriegen können. Super, was?
Batiste Harrison – 2. Klasse. Blutgruppe B, wie Sahalia und ich. Tut oft sehr heilig. Geht sicher in die Kirche, aber ich weiß nicht, in welche.
Ulysses Dominguez – 1. Klasse. Blutgruppe AB. Englisch nicht so gut.
Max Skolnik – 1. Klasse. Blutgruppe A. Hat wilde Haare, erzählt wilde Geschichten. Aber im Moment kann man seine Haare nicht sehen und seine Geschichten nicht hören, weil er in fünf Schichten Kleidung steckt und eine Gasmaske auf dem Gesicht hat. Wie wir alle.
Das war’s. Mehr sind wir nicht, weil ein paar von uns im Greenway geblieben sind. Zum Beispiel mein dummer 16-jähriger Bruder Dean Grieder.
Dean befindet sich mit den folgenden Personen im Greenway am Old Denver Highway in Monument, Colorado.
Astrid Heyman – 12. Klasse. Blutgruppe null. Das Mädchen der dummen Träume meines dummen Bruders, obwohl sie nicht mal besonders nett ist und ihn wahrscheinlich gar nicht mag, weder als Kumpel noch als irgendwas anderes. Aber ist ja auch egal.
Chloe (Nachname habe ich vergessen) – 3. Klasse. Blutgruppe null. Nervig.
Caroline McKinley – Vorschülerin und
Henry McKinley – Vorschüler. Zwillinge. Blutgruppe AB.
Sollten Sie dieses Notizbuch finden – bitte, bitte retten Sie meinen Bruder und die anderen! Es kann gut sein, dass sie immer noch im Greenway auf Hilfe warten.
Dean behauptet, dass er geblieben ist, weil er, Astrid und Chloe Blutgruppe null haben. Sie verwandeln sich in blutrünstige Monster, sobald sie die Chemikalien einatmen. Aber wir hätten sie gefesselt und betäubt. Es wäre nichts passiert.
Okay. Damit wäre die falsche Entscheidung meines Bruders schriftlich festgehalten. Das heißt, sollten Sie dieses Notizbuch aus dem verkohlten Wrack unseres Busses fischen und sich danach auf den Weg zum Greenway machen, um ihn zu retten, hat er vielleicht doch die richtige Entscheidung getroffen.
Eine Person will ich noch erwähnen: Jake Simonsen – 12. Klasse. Blutgruppe B. Hat uns auf einer Aufklärungsmission den Rücken gekehrt. Trotzdem hat er es verdient, genannt zu werden, denn er war einer von uns, einer der Monument 14.
Das war’s fürs Erste.
Alex Grieder, 13. Blutgruppe B.
28. September 2024.
Erstes Kapitel – Dean
ZWÖLFTER TAG
Es war ein wundervoller Moment: Astrid umarmte die kleine Caroline und den kleinen Henry, während Luna bellte und alle Gesichter abschlabberte, an die sie rankam.
Natürlich hatten wir alle fünf Schichten Klamotten an, um unsere Haut vor den Chemikalien zu schützen. Und ich trug auch noch eine Gasmaske. Und Chloe lag am Rand auf einer Luftmatratze, mit Gasmaske und dick eingemummelt, und träumte ihre Schlaftablettenträume. Aber trotzdem war es einer unserer schönsten Momente im Greenway.
Als Astrid die kleinen, schmutzigen, sommersprossigen Gesichter abküsste, war ich überglücklich. Ich schöpfte wieder Hoffnung. Mir platzte fast das Herz. Wahrscheinlich weil meine eigenen Gefühle für Astrid noch stärker wurden, als ich sah, wie sie die Zwillinge mit Liebe überschüttete.
Dann atmete Astrid tief ein.
Ihre Nasenlöcher blähten sich. Ich wusste, was los war – der Zorn meldete sich. Sie hatte zu tief eingeatmet.
»Warum seid ihr hiergeblieben?«, stöhnte sie. »Ihr dummen, DUMMEN KINDER! WARUM SEID IHR HIERGEBLIEBEN?«
Sie presste die Zwillinge an die Brust. Ihre rechte Hand schloss sich um Henrys rothaarigen Kopf, ihre linke um Carolines.
Ich musste Astrid umreißen und festhalten, und das tat ich auch.
So viel zu unserem wundervollen Moment.
Ich drückte Astrid auf den Boden. Caroline und Henry brachen in Tränen aus.
»Holt ihre Maske!«, brüllte ich.
Astrid schlug nach mir. Sie wehrte sich gegen meine Hände.
Die flauschig weiße Luna bellte wie blöd.
»Caroline!«, schrie ich. Die Gasmaske dämpfte meine Stimme. »Geh ihre Maske holen! Bring sie her!«
Als Astrid die Zwillinge entdeckt und umarmt und abgeküsst hatte, hatte sie die Gasmaske fallen gelassen.
Caroline brachte mir die Maske, während Astrid weiter bockte und mit den Beinen austrat. Ich musste meine letzten Reserven mobilisieren, um sie zu bändigen.
»Setzt ihr die Maske auf!«, rief ich.
Unter Tränen presste Caroline die Maske auf Astrids Gesicht. Henry kam rüber, um ihr zu helfen.
»Beruhig dich endlich!«, brüllte ich Astrid an. »Alles in Ordnung! Du hast bloß eine Ladung Giftgas abbekommen! Ganz ruhig einatmen, okay?«
»Fester«, sagte Henry zu Caroline. Sie nickte. Mit vereinten Kräften drückten die beiden die Maske nach unten.
Astrid blickte uns an. Blickte mich an. Und nach und nach verschwand der Zorn aus ihren himmelblauen Augen. Ihre Lider schlossen sich. Ich spürte, wie sich ihr Körper unter meinem entspannte.
Doch ich blieb auf ihr hocken, bis sie krächzte: »Mir geht’s gut.«
Ich stand auf. Langsam und zögerlich.
Astrid hob die Hand und legte sie auf die Maske, schob die Zwillinge sanft beiseite und setzte sich auf.
Caroline klopfte ihr auf den Rücken. »Schon gut. Wir wissen, dass das nicht du warst.«
Henry nickte. »Ja. Das war Monster-Astrid, nicht die richtige Astrid.«
»Kommt, Leute«, sagte ich. »Wir müssen das Tor reparieren. Sofort!«
Vorhin hatten wir das Tor geöffnet, um den Bus mit Alex, Niko, Josie und den anderen rauszulassen. Die vielen Lagen aus Wolldecken, Plastikplanen und Sperrholz, mit denen wir den Greenway von der Außenluft abgeschottet hatten, waren ein einziges Durcheinander.
Jetzt mussten wir das Tor wieder abdichten und die Luft irgendwie sauber kriegen. Aber wie? War jetzt der ganze Laden verseucht? Wir hatten keine Ahnung.
Ich griff mir die Decken und Planen, die noch halb am Tor hingen, und hielt sie an die Wand. Die Zwillinge schauten mir zu. »Gebt mir mal ’nen Handtacker!«
Die Handtacker lagen ein paar Meter neben mir auf dem Boden herum. Wir hatten sie benutzt, als wir das Tor damals abgedichtet hatten, und sie danach nicht weggeräumt. Jetzt war ich heilfroh, dass wir so schlampig gewesen waren. Oder hatte Niko das Werkzeug absichtlich da drüben deponiert? Wäre ihm zuzutrauen.
Als Astrid sich endlich aufrappelte und die erste Sperrholzplatte rüberschleifte, hatte ich schon die Planen und Decken wieder angebracht.
Ich versuchte, das Sperrholz anzutackern.
Die ersten drei Versuche saßen, doch danach stieß der Tacker nur noch ein hohles Tschick-tschick aus. Die Heftklammern waren alle.
»Scheiße«, murmelte ich.
Die Schachtel mit den Heftklammern war auch alle.
Ich drehte mich um. »Bin gleich wieder da!«
Wegen der blöden Gasmaske musste man dauernd schreien, wenn einen irgendwer verstehen sollte.
Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie Niko und Josie und Alex sich im Bus mit den Dingern im Gesicht verständigten.
Sie hätten nie fahren dürfen. Immer wenn ich aus irgendeinem Grund daran dachte, dass sie gefahren waren, wurde ich wütend.
Aber jetzt brachte es nichts, wütend zu sein. Jetzt musste ich schlau sein. Wir mussten den Greenway abdichten.
Ich lief zum Heimwerkerbedarf.
Auf dem Weg kam ich an Chloe vorbei. Sie lag immer noch auf der Matratze, mit Gasmaske und Klamottenschichten, völlig weg vom Fenster. Die Schlaftablette, die Niko ihr eingeflößt hatte, hatte ganz schön reingehauen.
Mann, würde die sauer sein, wenn sie aufwachte und feststellte, dass Niko und Co. ohne sie gefahren waren.
Das Drama mit Astrid und mir hatte sie verpasst. Sie hatte schon gepennt, als wir den anderen erklärt hatten, dass wir nicht mitkommen konnten. Weil es zu gefährlich war, wegen unserer Blutgruppe.
Und keiner hatte Chloe nach ihrer Meinung gefragt, als Niko sie wieder aus dem Bus getragen hatte.
Aber ich sagte mir, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten. Wir durften nicht raus. Es war zu gefährlich. Astrid hatte eben bloß einen winzigen Hauch Giftgas abbekommen und war augenblicklich ausgerastet. Wir drei, draußen im Freien, auf einer Hundert-Kilometer-Busfahrt nach Denver? Wir hätten die anderen ermordet.
Wir hatten die richtige Entscheidung getroffen. Ich war mir sicher.
Hier im Greenway hatten wir Vorräte für Wochen oder sogar Monate. Die anderen hatten Zeit genug, um zum Flughafen von Denver zu fahren und eine Rettungsaktion ins Rollen zu bringen. Oder wir warteten einfach ab – in drei bis sechs Monaten sollten sich die Chemikalien ja angeblich verflüchtigt haben.
Als ich den Handtacker nachgeladen hatte und zurücklief, sah ich Caroline und Henry vorsichtig auf der Luftmatratze mit der reglosen Chloe herumhopsen. An Chloes Seite hatte sich Luna eingerollt.
Wie drei Zwergaliens, die mit ihrem treuen Hund auf einem Floß auf hoher See trieben.
Da hörte ich ein lautes RUMMS vom Tor.
Astrid zuckte zusammen. Ihre Augen schnellten zu mir.
Noch ein RUMMS.
Und eine Stimme. »Hey!«
»Hallo!?«, erwiderte Astrid.
»Wusst ich’s doch! Wusst ich’s doch, dass da ein Licht war! Hey, Jeff, ich hatte recht! Da drinnen ist wer!«
»Wer sind Sie?«, rief ich.
»Ich heiße Scott Fisher. Macht doch bitte das Tor auf, ja? Das wäre nett!«
»Tut mir leid, aber wir können das Tor nicht aufmachen«, log ich.
»Aber klar könnt ihr es aufmachen! Ihr habt es doch eben erst aufgemacht, vor einer Minute. Wir haben das Licht gesehen! Jetzt kommt schon!«
»Ja, lasst uns rein!«, meinte eine andere Stimme. Das war dann wohl Jeff.
»Junge, du musst uns reinlassen«, sagte Scott. »Wir haben hier draußen einen Notfall!«
Ach was.
»Ich weiß«, antwortete ich. »Aber das geht nicht!«
»Wie, das geht nicht? Warum nicht?«
Astrid trat neben mich und brüllte durch ihre Maske: »Weil wir schon mal zwei Erwachsene reingelassen haben, und einer von denen hat ein Mädchen belästigt und versucht, einen von uns zu erschießen!«
»Okay … aber wir sind ganz anders drauf. Wir sind echt nett!«
»Tut mir leid«, sagte Astrid, klopfte auf die nächste Sperrholzplatte und nickte mir zu – tacker’s fest.
»Kommt schon!«, schrie Scott. »Wir haben Hunger und Durst! Hier draußen sterben die Leute wie die Fliegen! Lasst uns rein!«
»Tut mir leid!«, rief ich.
Ich jagte die erste Heftklammer durchs Holz.
Scott und Jeff rüttelten noch eine Weile am Tor und fluchten, wie man in so einer Situation halt flucht. Doch als die restlichen Platten dran waren, hörten wir sie kaum noch.
Ich betrachtete die fertige Wand und beschloss, eine weitere Schicht Plastikplanen anzubringen, sobald die Luftreiniger liefen.
Doch Astrid zupfte mich am Ärmel. »Wenn wir schon die Klamottenschichten und die Masken anhaben, sollten wir den Typen gleich noch was zu essen vom Dach werfen.«
»Was?«
»Wir sollten ihnen was zu trinken und zu essen runterwerfen!«, rief sie.
»Aber warum?«, fragte ich.
Sie zuckte mit den Schultern. »Weil wir so viel haben und sie gar nichts? Wir müssen ihnen helfen.«
Aarrrghh. Ich wollte nicht aufs Dach. Auf keinen Fall.
Aber Astrid sah mich an, als wäre die Sache sonnenklar. Als gäbe es nichts zu diskutieren.
»Stellen wir wenigstens erst die Luftreiniger auf«, sagte ich.
»Das erledige ich schon mit den Kleinen!«, brüllte sie durch die Maske. »Du gehst mit dem Essen hoch, solange die Typen noch draußen sind!«
»Aber …«
Leider konnte ich nicht so richtig klar denken. Ich konnte ihr nicht begreiflich machen, warum das keine gute Idee war, und am Ende würde sie bloß glauben, ich wäre zu faul oder zu feige, um aufs Dach zu gehen.
»Na gut«, meinte ich deshalb. »Ich bring ihnen was.«
Astrid wandte sich wortlos an die Kleinen. Hätte sie nicht wenigstens Danke sagen können?
»Caroline und Henry!«, rief sie. »Schnappt euch einen Einkaufswagen und kommt mit!«
»Nein«, meinte ich. »Erst die Luftreiniger, dann das Essen.«
Astrid blickte mich an und seufzte.
Okay, hinter dem Plastikvisier einer Profi-Gasmaske ist echt nicht viel zu erkennen. Aber was ich von Astrids Gesichtsausdruck sah, drückte in etwa aus: Alles klar. Der blöde Wichtigtuer will sich nicht rumschubsen lassen und reitet deswegen auf irgendeinem bedeutungslosen Detail herum. Aber egal, dann lass ich ihm halt seinen Stolz. Hast gewonnen, Kleiner.
»Na gut«, erwiderte sie. »Aber Beeilung!«
Der Greenway hatte acht verschiedene Luftreiniger im Angebot, von denen jeweils vier bis sechs Stück vorrätig waren. Astrid und ich stellten die größeren Modelle auf, die kleineren sollten Caroline und Henry im ganzen Laden verteilen.
Zum Glück hatten wir Unmengen Verlängerungskabel, denn Steckdosen gab es praktisch nur an den Wänden.
Danach ging ich zum Pizza Shack. Als uns klargeworden war, dass wir eine Weile hierbleiben würden, hatten wir alle Vorräte in die großen Kühlschränke in der Küche geräumt.
Ich griff mir einige Dosen Thunfisch, einen Haufen altes Brot, eine Handvoll Müsliriegel, die keiner mochte, und ein paar widerliche Eis am Stiel, die nicht mal die größten Allesfresser unter den Kids runterbekamen. Und noch ein paar Riesenflaschen Limo der Greenway-Eigenmarke.
In einer leeren Plastikkiste, die noch von vorhin herumstand, trug ich das Zeug nach hinten in den Lagerraum.
Wir waren erst seit zwei Stunden allein im Greenway, und Astrid kommandierte mich schon herum, als wäre ich eins von den kleinen Kindern. Das entwickelte sich irgendwie alles in die falsche Richtung.
Die Kiste vor dem Bauch, stieß ich die Tür mit dem Hintern auf und schob mich rückwärts in den Lagerraum.
Als ich mich umdrehte, ließ ich fast die Kiste fallen.
Ich hatte so angestrengt über Astrid nachgegrübelt, dass ich gar nicht an die Leichen gedacht hatte.
So viel Blut. Robbie lag halb auf der Matratze, halb auf dem Boden. Die Luft war zum großen Teil raus aus seiner Matratze, sodass sein lebloser Körper auf einer platten Gummimatte ruhte. Die Decke, die wir über ihn geworfen hatten, hatte sich stellenweise mit Blut vollgesogen.
Gleich hinter ihm lag Mr. Appleton. Er war im Schlaf gestorben. Ein friedlicherer Tod, keine Frage, und passenderweise war seine Matratze noch schön aufgepumpt.
Die Fremden, die zu uns gekommen waren und unsere Gruppe gespalten hatten, lagen tot im Lagerraum.
Ich hatte noch keine Zeit gehabt, länger über Robbie und wie er uns hintergangen hatte, nachzudenken.
Er und Mr. Appleton hatten uns angefleht, sie in den Greenway zu lassen, und wir hatten eingewilligt. Doch als sie wieder gehen sollten, wollte Robbie nicht, und Mr. Appleton wurde krank. Und später, noch in derselben Nacht, fanden wir Robbie bei Sahalia.
Es kam zu einem Gerangel. Brayden wurde angeschossen, Robbie getötet.
Ein paar Stunden später starb Mr. Appleton. Dagegen konnten wir nichts tun. Glaube ich.
Aber Robbie …
Eigentlich hätte ich wütend sein müssen, als ich ihn hier liegen sah. Soweit ich wusste, hatte er versucht, mit Sahalia zu schlafen. Ich war mir nicht sicher, ob er sie zwingen wollte oder ob er sie manipuliert hatte, aber so oder so hatte er sein wahres Gesicht gezeigt – ein extrem abstoßendes Gesicht. Ein Fünfzigjähriger (schätze ich) mit einer Dreizehnjährigen? Wenn das nicht ekelhaft war. Wir hatten ihn für einen netten, väterlichen Typen gehalten, doch er hatte sich als Perversling entpuppt.
Und wäre Robbie nicht über Sahalia hergefallen, wäre Brayden nicht angeschossen worden, und Niko und Alex und die anderen hätten nicht nach Denver aufbrechen müssen.
Aber ich war nicht wütend. Ich war bloß traurig.
Robbie und Mr. Appleton waren bloß zwei weitere Tote, die diese Verkettung von Katastrophen gefordert hatte.
Die Kleinen hatten keine Ahnung, was passiert war, und ich musste dafür sorgen, dass es auch dabei blieb.
Deshalb setzte ich einen weiteren Punkt auf meine mentale To-do-Liste: Leichen verschwinden lassen.
Doch erst mal musste ich die dahergelaufenen Fremden vor dem Laden füttern.
Die Dachluke ließ sich leicht öffnen. Niko hatte die Plastikplane davor mit Klettverschluss befestigt, sodass ich einfach ein Stück wegreißen und runterhängen lassen konnte. Dann war da noch das Vorhängeschloss, aber der Schlüssel steckte.
Ich stellte die Kiste auf die Treppe und drückte die Luke auf.
Bei meinem letzten Ausflug aufs Dach hatte ich noch keine Ahnung von den Chemikalien gehabt. Wir hatten gemeinsam zugesehen, wie die Giftgaswolke über dem Hauptquartier des Luftwaffenkommandos NORAD aufgestiegen war, nur fünfzig Kilometer entfernt.
Bei meinem letzten Ausflug aufs Dach hatte ich versucht, meinen Bruder zu töten.
Jetzt war es dunkel. Die Luft schien selbst das bisschen Licht zu schlucken, das aus der Luke sickerte. Über mir hing ein milchig schwarzer Himmel. Keine Sterne, keine Wolken. Bloß schwarzer, schwebender Schlamm.
Ich fluchte. Warum hatte ich keine Taschenlampe mitgenommen?
Aber ich hatte keine Lust, noch mal umzukehren, um mir eine zu holen. Dann musste es halt so gehen. Ich hievte die Kiste aufs Dach, schob sie Richtung Rand und robbte hinterher.
Ich hatte noch weniger Lust, im Dunkeln vom Dach zu stürzen.
Nach einer Minute unwürdigen Schiebens und Robbens stieß die Kiste gegen die Kante des Dachs. Ich kippte sie nach vorne, bis sie über den Rand fiel, und horchte auf den Knall von unten.
»Hey!«, rief Scott Fisher irgendwo unter mir.
»Gern geschehen!«, schrie ich zurück.
Sie würden das Zeug schon finden. Und dann würde ich längst wieder drinnen sein.
Die beiden konnten von Glück sagen, dass Astrid so eine menschenfreundliche Seite hatte. Und dass ich alles mit mir machen ließ.
Langsam kroch ich zurück zur hellen Luke. Ich wollte endlich die blöde Gasmaske abnehmen.
Die Gasmaske an sich war halb so schlimm, doch zusammen mit der Brille machte sie mich wahnsinnig. Die Maske passte schon über die Brille, aber sie saß so eng, dass die Brille in den Nasenrücken einschnitt – und das tat weh, vor allem weil meine Nase ziemlich ramponiert war, seit Jake mich verdroschen hatte. Es tat verdammt weh.
Außerdem wollte ich raus aus den Kleidungsschichten, die sich zunehmend unter meinen Achseln und hinter den Knien zusammenknüllten.
Wieder versuchte ich, nicht an Alex und Niko und die anderen zu denken.
Die anderen mussten 100 Kilometer schaffen, in ihren Klamottenschichten, mit ihren Gasmasken im Gesicht, in einem halb reparierten Schulbus auf einem gefährlichen, dunklen Highway. Und ich nörgelte, weil ich ein paar Stunden mit der ganzen Kleidung und der Maske rumbringen musste.
Ich stand auf und schlich zurück zur Luke. Unglaublich, wie hell das schwache Licht aus dem Inneren des Greenway in dieser dunklen Welt wirkte.
Aber ich ließ mir Zeit. Das Dach war ziemlich uneben, eingedellt von dem Hagelsturm, der uns vor einer Million Jahren in den rettenden Superstore gespült hatte.
Ich dachte an den Hagelsturm. War es nicht ein Wahnsinnsglück, dass Mrs. Wooly, die Grundschulbusfahrerin, nicht nur auf die Idee gekommen war, ihren Bus in den Greenway zu rammen, um die Kleinen aus dem Hagel zu kriegen, sondern danach noch mal umgekehrt war, um uns Highschool-Kids zu retten? Ich dachte an Mrs. Wooly. Wie war es mit ihr weitergegangen? Hatte sie es an einen sicheren Ort geschafft? Hatte sie überhaupt mal drüber nachgedacht, uns abzuholen – das hatte sie uns nämlich versprochen –, oder hatte sie genug damit zu tun, selbst zu überleben?
Als ich an Mrs. Wooly dachte, erlosch plötzlich das Licht hinter der Luke.
Ich stand allein auf dem Dach. Im Dunkeln.
Zweites Kapitel – Alex
98 KILOMETER
Wir kommen sehr langsam voran.
In drei Stunden haben wir knapp 13 Kilometer zurückgelegt.
Die Entfernung zum Denver International Airport beträgt noch fast 100 Kilometer.
Wir werden länger brauchen, als ich gehofft hatte. Wir haben schon 20 Minuten gebraucht, um vom Greenway-Parkplatz auf die Interstate 25 zu kommen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
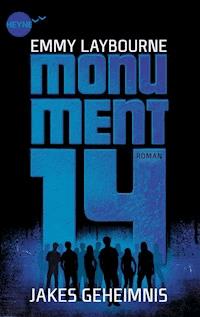
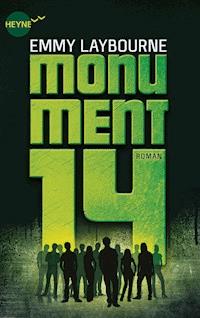
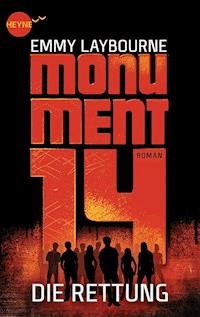
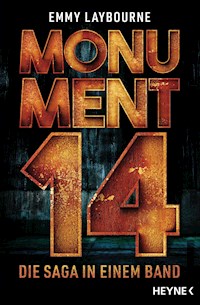













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











