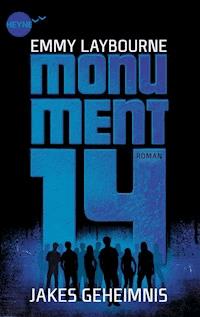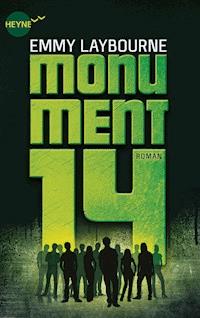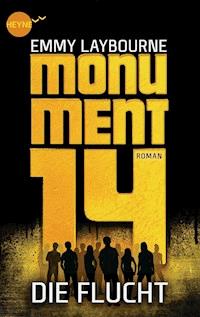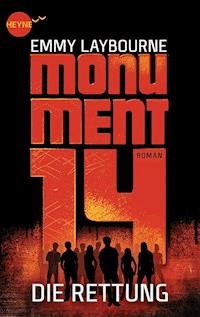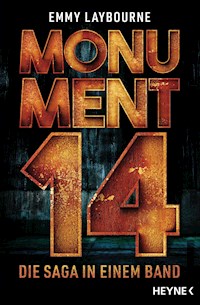
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es ist die größte Katastrophe, die es je in den USA gegeben hat: Ein gewaltiger Tsunami trifft die Ostküste und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Vierzehn Jugendliche stranden in einem Einkaufszentrum. Schnell wird ihnen klar, dass sie völlig auf sich allein gestellt sind. Während der Strom ausfällt und die Zivilisation zusammenbricht, braut sich am Himmel etwas noch viel Furchtbareres zusammen: Eine Giftwolke aus einer benachbarten Chemiefabrik nähert sich dem Einkaufszentrum. Diejenigen, die die Chemikalien einatmen, verändern sich in völlig unerwarteter und beängstigender Weise. Der zurückhaltende Dean, bislang eher ein Außenseiter, muss sich mit den anderen verbünden und um sein Überleben kämpfen …
Alle drei Romane der Erfolgssaga sowie die Bonusgeschichte »Jakes Geheimnis« endlich in einem Band!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1035
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Der Tag, an dem die Welt untergeht, beginnt eigentlich ganz normal: Wie jeden Morgen steigt der schüchterne Dean mit seinem jüngeren Bruder Alex in den Schulbus. Doch ein Orkan von unvorstellbarer Stärke zwingt die beherzte Busfahrerin Mrs. Wooly, in einem Einkaufszentrum haltzumachen. Sie lässt die vierzehn Jugendlichen allein zurück und zieht los, um Hilfe zu holen. Als der Fernsehempfang zusammenbricht, wird ihnen das Ausmaß der Katastrophe bewusst. Die letzte Newsmeldung ist die dringende Warnung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, denn aus einer Chemiefabrik in der Nähe steigt eine giftige Wolke auf. Doch für einige von ihnen kommt diese Warnung bereits zu spät …
Alle drei Romane und die Kurzgeschichte der Bestseller-Saga erstmals in einem Band!
Die Autorin
Emmy Laybourne wurde 1971 in Manhattan geboren und arbeitete nach ihrem Studium als Schauspielerin, ehe sie zum Schreiben kam. Über den großen Erfolg von MONUMENT 14, ihrem Debütroman, ist sie noch immer erstaunt. Mit ihrem Mann, zwei Kindern, einem Hund und sieben raffinierten Hühnern lebt und arbeitet sie in Los Angeles.
Mehr über Emmy Laybourne und ihre Werke erfahren Sie auf:
EMMY LAYBOURNE
MONUMENT 14
DIE SAGA
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgaben:
MONUMENT 14
JAKEANDTHEOTHERGIRL
SKYONFIRE
SAVAGEDRIFT
Aus dem Amerikanischen von Ulrich Thiele
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Ausgabe 04/2022
Copyright © 2012, 2013 by Emmy Laybourne
Copyright © 2022 dieser Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (optimarc, Ink Drop)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28773-3V001
www.diezukunft.de
INHALT
Monument 14
Jakes Geheimnis
Monument 14 Die Flucht
Monument 14 Die Rettung
MONUMENT 14
ERSTES KAPITEL DINGDINGDING
Deine Mutter kreischt, dass du gleich den Bus verpasst. Sie sieht ihn schon kommen. Du bleibst nicht stehen, um sie zu umarmen und ihr zu sagen, dass du sie liebst. Du dankst ihr nicht dafür, dass sie so eine gute, fürsorgliche, geduldige Mutter ist. Natürlich nicht. Stattdessen schießt du die Treppe runter und sprintest zur Straßenecke.
Wenn es das letzte Mal ist, dass du deine Mutter siehst, wünschst du dir irgendwann, du wärst stehen geblieben, um all das zu tun. Sogar wenn du dadurch den Bus verpasst hättest.
Doch der Bus bretterte bereits durch unsere Straße, und so rannte ich los.
Als ich über die Einfahrt hetzte, hörte ich noch, wie Mom nach meinem Bruder Alex brüllte. Sein Bus, der direkt hinter meinem in den Park Trail Drive eingebogen war, kam pünktlich auf die Minute um 7.09 Uhr. Meiner hätte eigentlich um 6.57 Uhr eintreffen sollen, war aber so gut wie immer spät dran. Als wäre der Busfahrer ebenfalls der Meinung gewesen, dass es irgendwie unfair wäre, mich vor sieben abzuholen.
Alex stürmte hinter mir aus dem Haus. Unsere Sneaker klatschten in einem doppelten Stampfrhythmus über den Gehsteig.
»Denk dran«, rief er mir hinterher, »dass wir nach der Schule noch zur Heilsarmee wollen!«
»Ja, klar«, meinte ich.
Mein Busfahrer drückte auf die Hupe.
Nach der Schule sind Alex und ich manchmal rüber in den Secondhandladen der Heilsarmee, um uns nach altem Elektronikkram umzuschauen. Vor der Benzinknappheit hatte ich Alex immer hingefahren. Jetzt nahmen wir die Räder.
Früher hatte ich ihn auch zur Schule kutschiert, doch seit das Benzin knapp wurde, nahm die ganze Schule den Bus, alle, sogar wir Oberstufler. Wir hatten keine Wahl – es war Vorschrift.
Ich hastete die kurze Treppe hoch und war im Bus.
Hinter mir hörte ich, wie sich Mrs. Wooly sarkastisch bei Alex bedankte: »Wie schön, dass du es auch einrichten konntest, Alex.«
Mrs. Wooly fuhr den Grund- und Mittelschulbus seit Urzeiten. In unserer Stadt war sie eine Institution – eine ergraute Institution mit drahtigem Haar, die nach Aschenbecher stank und kein Blatt vor den Mund nahm. Ihr einziger Sinn im Leben war Busfahren, und dafür war sie berühmt-berüchtigt. Sie war schon ziemlich einzigartig.
Mein Busfahrer, der vom Highschoolbus, war dagegen krankhaft fettleibig und nicht der Rede wert. Mr. Reed war für gar nichts berühmt. Höchstens dafür, dass er seinen Morgenkaffee aus einem alten Marmeladenglas trank.
Obwohl der Bus erst kurze Zeit unterwegs war, hielt Jake bereits ganz hinten Hof. Jake Simonsen, der Footballheld, der Obermacker. Jake war vor einem Jahr aus Texas an unsere Schule gewechselt. Zu Hause im Süden, wo sich alles um Football drehte, war er eine Riesennummer, und bei uns wurde er schon genauso verehrt. Mindestens.
»Snacks!«, meinte Jake gerade. »Ich sag’s euch, Leute! An meiner alten Highschool haben ein paar Mädchen Cola und Kekse und Baked Potatoes verkauft, und zwar bei jedem Spiel. Die haben, was weiß ich, Millionen verdient!«
»Millionen?«, fragte Astrid.
Astrid Heyman, die beste Turmspringerin des Schwimmteams, die grausame Göttin, das Mädchen meiner Träume.
»Und wenn schon«, fuhr sie fort. »Ich würde meinen Sport nie aufgeben, um dem Footballteam unter die Arme zu greifen.«
Jake schenkte ihr sein goldenes Lächeln. »Nicht um uns unter die Arme zu greifen, Baby. Um einen Batzen Geld zu machen!«
Sie hämmerte ihm die Faust auf den Arm.
»Au!« Jake grinste. »Mann, hast du Kraft. Du solltest es mal mit Boxen versuchen.«
»Ich hab vier kleine Brüder«, erwiderte Astrid. »Ich boxe jeden Tag.«
Währenddessen kauerte ich mich auf meinen Platz und atmete erst mal durch. Die Lehnen der blattgrünen Kunstledersitze waren so hoch, dass man sich nur richtig hinfläzen musste, um für einen Moment zu verschwinden.
Ich zog den Kopf ein, weil ich mir keine blöden Kommentare über meinen Spurt zum Bus einfangen wollte. Aber Astrid schien nicht mal mitbekommen zu haben, dass ich eingestiegen war. Das war zugleich gut und schlecht.
Hinter mir schmiedeten Josie Miller und Trish Greenstein Pläne für irgendeine Tierrechtsdemo. Die beiden waren so eine Art Hippie-Gutmenschen. Normalerweise hätte ich sie gar nicht richtig gekannt. Doch in der sechsten Klasse hatte ich mich mal freiwillig gemeldet, um Wahlkampf für Cory Booker zu machen, und so waren wir gemeinsam von Tür zu Tür gezogen. Das war eigentlich ganz lustig, aber jetzt sagten wir nicht mal mehr Hi, wenn wir uns sahen.
Fragt mich nicht, warum. Die Highschool veränderte die Leute irgendwie.
Der Einzige, der mich überhaupt wahrgenommen hatte, schien Niko Mills zu sein. Niko beugte sich rüber und zeigte auf meinen Schuh. Er sagte nichts – dafür war er wohl zu cool –, er zeigte nur. Und er hatte recht: Meine Schnürsenkel waren offen. Ich band den Schuh neu und bedankte mich, doch dann schob ich mir sofort die Ohrstöpsel rein und konzentrierte mich auf mein Minitablet. Ich hatte Niko nichts zu sagen und er mir offenbar auch nicht. Sonst hätte er nicht so auf meinen Schuh gedeutet.
Soweit ich wusste, wohnte Niko mit seinem Großvater in einem Blockhaus am Fuß des Mount Herman. Die beiden jagten sich ihr Essen selbst und hatten keinen Strom, und als Klopapier benutzten sie wild wachsende Pilze. Oder so ähnlich.
In der Schule wurde Niko nur »tapferer Jägersmann« genannt, und der Spitzname passte wirklich wunderbar zu seiner perfekten Haltung, seiner dünnen, drahtigen Statur und seiner ganzen Kombination aus brauner Haut, braunen Augen und braunem Haar. Niko hatte etwas Steifes, Stolzes an sich – wie die meisten Leute, mit denen keiner redet.
Ich ignorierte den tapferen Jägersmann und versuchte, mein Minitab hochzufahren. Aber das Teil war tot, was echt seltsam war. Ich hatte es gerade erst vom Ladedock geholt, bevor ich aus dem Haus ging.
Da hörte ich ein leises Geräusch: Dingdingding.Ich nahm die Ohrstöpsel raus und lauschte auf die kleinen Dings. Sieklangen wie Regen, nur metallischer.
Plötzlich verwandelten sich die Dings in DINGS, aus den DINGSwurde Mr. Reeds Schrei: »Verdammte Scheiße!«, und im nächsten Moment dellte sich das Dach ein – WUMM, WUMM, WUMM. Spinnennetzartige Risse schossen durch die Windschutzscheibe. Mit jedem WUMMverwandelte sich die Scheibe wie bei einer Diashow. Je mehr Risse durchs Glas zuckten, desto undurchsichtiger wurde sie.
Ich blickte aus dem Seitenfenster.
Hagelkörner prasselten auf den Asphalt, in allen Größen, von winzig klein bis das-kann-doch-kein-Hagel-mehr-sein.
Autos rutschten über die komplette Straße. Doch im Gegensatz zu den anderen Fahrern stieg Mr. Reed nicht auf die Bremse, sondern aufs Gas. Er war ein geborener Raser.
Unser Bus schlingerte über eine Kreuzung, quer über den Mittelstreifen und auf den Parkplatz des Greenway-Superstores. Der war noch ziemlich leer, weil es gerade mal Viertel nach sieben oder so war.
Als ich mich umdrehte, nach hinten, zu Astrid, schaltete die Welt gleichzeitig auf Zeitlupe und Zeitraffer. Der Bus schlitterte auf dem Eis, brach seitlich aus und geriet ins Schleudern, immer schneller und schneller, bis es mir den Magen in den Hals drückte. Ungefähr drei Sekunden lang wurde mein Rücken gegen das Fenster gepresst wie in einem heftigen Karussell, dann krachten wir gegen eine Straßenlaterne. Ein grässliches metallisches Knirschen.
Ich wollte mich noch an die Lehne vor mir klammern, aber da schmiss es mich schon durch die Luft. Auch ein paar andere flogen durch die Gegend. Ich hörte keine Schreie. Nur Grunzlaute und ab und zu einen dumpfen Aufprall.
Obwohl es mich seitlich weggeschleudert hatte, knallte ich gegen das Dach. Wie war das möglich? Kurz darauf kapierte ich es – der Bus war umgekippt. Er kreischte auf der Seite über den Asphalt. Und kam bebend zum Stillstand.
Der Hagel, der bisher das Dach gnadenlos eingedellt hatte, dellte jetzt uns gnadenlos ein.
Denn jetzt lag der Bus auf der Seite, und durch die Fensterreihe über uns hämmerte der Hagel sofort durch. Viele meiner Mitschüler wurden zugleich vom Hagel und vom Scherbenregen getroffen.
Aber ich hatte Glück. In meiner Nähe hatte sich ein Sitz gelöst, den ich über meinen Kopf zerren konnte wie ein kleines Dach.
Es hagelte Eisklumpen in allen Größen. Manche waren klein und rund wie Murmeln, manche waren riesige knollige Teile, in denen Kies und anderes graues Zeug steckten.
Überall wurde geschrien und gebrüllt. Jeder versuchte, sich möglichst schnell unter einem lockeren Sitz zu verkriechen oder aufzustehen und sich an die Wand zu pressen, also ans ehemalige Dach.
Ein Lärm, als wären wir in einem Sturzbach aus Steinen und Felsblöcken gefangen. Das Hämmern nahm kein Ende. Als würde jemand mit einem Baseballschläger auf den Sitz über meinem Kopf einprügeln.
Ich beugte mich noch weiter vor, um aus den Überresten der Windschutzscheibe nach draußen zu blicken. Durch den weißen Sprühnebel sah ich den Mittelschulbus. Alex’ Bus. Er fuhr tatsächlich noch weiter – mit Vollgas, wie es aussah. Er war nicht ins Schleudern geraten. Anders als Mr. Reed hatte Mrs. Wooly die Kontrolle behalten.
Ihr Bus preschte über den Parkplatz und hielt direkt auf den Haupteingang des Greenway-Superstores zu.
Und ich dachte: Mrs. Wooly fährt das Ding einfach in den Greenway. Ich wusste, dass sie die Kids aus dem Hagel bringen würde, und das tat sie auch. Sie rammte den Bus mitten durch die Glastür des Supermarkts.
Alex war in Sicherheit. Gut.
Im selben Augenblick hörte ich ein leises,erbärmliches Wimmern. Ich schob mich ein Stück vorwärts und spähte um den Fahrersitz herum. Vorne, wo der Bus gegen die Straßenlaterne gedonnert war, hatte es die Karosserie eingedrückt.
Und das Wimmern kam von Mr. Reed. Er war hinter dem Lenkrad eingezwängt. Blut floss aus seinem Kopf wie Milch aus der Tüte. Bald verstummte das Wimmern. Aber darüber konnte ich jetzt nicht weiter nachdenken.
Stattdessen blickte ich zur Tür, hinter der nun eine Wand aus Asphalt lag, und fragte mich, wie wir hier jemals rauskommen sollten. Wir kamen hier nicht raus. Die Windschutzscheibe hatte es gegen die Motorhaube gequetscht.
Der Bus war ein einziges zerknautschtes Knäuel, das auch noch auf die Seite gekippt war. Und wir saßen drin fest.
Josie Miller schrie. Alle anderen hatten sich instinktiv aus dem Hagel verzogen, aber Josie saß immer noch brüllend auf ihrem Sitz und ließ sich von den Eisklumpen verprügeln.
Außerdem war sie voller Blut. Aber es war nicht ihr Blut – sie versuchte, den Arm ihrer Sitznachbarin zwischen zwei übel zugerichteten Sitzen hervorzuziehen. Ich erinnerte mich, wer neben ihr gesessen hatte: Trish. Der Arm war schlaff wie eine Nudel und rutschte Josie immer wieder aus den Fingern. Trish war offensichtlich tot, aber das wollte Josie nicht einsehen.
Brayden war unter einem umgedrehten Sitz in Deckung gegangen. Der Typ war ein Vollidiot, der dauernd damit angab, dass sein Dad beim Luftwaffenkommando NORAD arbeitete. Jetzt holte er sein Minitab raus, um die panische Josie zu filmen, wie sie wieder und wieder nach dem glitschigen Arm griff.
Ein Monsterhagelkorn traf Josie an der Stirn und riss eine lange, pinkfarbene Wunde in ihre dunkle Haut. Blut rann über ihr Gesicht.
Wenn sie da sitzen blieb, im Hagel, würde sie sterben. Das war mir klar.
»Scheiße!«, fauchte Brayden sein Minitab an. »Mach schon!«
Ich musste was tun. Ich musste Josie helfen. Tu was. Hilf ihr.
Doch mein Körper hörte nicht auf mein Gewissen.
Da streckte Niko die Hände aus, packte Josie an den Füßen und zog sie unter einen verbogenen Sitz. Einfach so. Er streckte die Hände aus und zerrte sie an den Beinen zu sich, schützte sie mit dem eigenen Körper und hielt sie fest, während sie schluchzte. Wie ein Pärchen im Horrorfilm.
Irgendwie hatte Nikos Heldentat den Bann gebrochen. Die anderen suchten nach einem Weg ins Freie. Astrid kroch nach vorne – sie wollte die Windschutzscheibe eintreten. »Hilf mir!«, rief sie, als sie mich auf dem Boden kauern sah.
Ich glotzte nur auf ihren Mund. Auf ihren Nasenring. Auf ihre Lippen, die sich bewegten und Laute formten. »Nein«, wollte ich sagen. »Wir können da nicht raus. Wir müssen hierbleiben, im schützenden Bus.« Doch ich bekam die Worte nicht auf die Reihe.
Astrid stand auf und brüllte in Richtung Jake und Co.: »Wir müssen in den Laden!«
»Nein«, krächzte ich endlich. »Das geht nicht. Der Hagel bringt uns um.« Aber da war Astrid schon wieder hinten.
»Versuch’s mit dem Notausgang!«, schrie irgendwer. Hinten zerrte Jake schon seit einiger Zeit an der Tür des Notausgangs, aber er bekam sie nicht auf. Ein paar Minuten lang herrschte pures Chaos. Ich weiß nicht, wie lang genau, denn mir war inzwischen ziemlich seltsam zumute. Als würde mein Kopf hoch über allem anderen schweben, wie ein Ballon.
Bis ich ein sehr merkwürdiges Geräusch hörte: das Piep-Piep-Piep eines zurücksetzenden Schulbusses. Durch das Geschrei der anderen und den krachenden Hagel hörte ich dieses Piepen. Es war Wahnsinn.
Piep-Piep-Piep, als würde der Bus auf einer Exkursion in den Mesa-Verde-Nationalpark am Besucherzentrum einparken.
Piep-Piep-Piep, als wäre alles wie immer.
Mit zusammengekniffenen Augen spähte ich ins Freie – und sah, wie Mrs. Woolys Grund- und Mittelschulbus rückwärts auf uns zusteuerte. Der Bus hatte starke Schlagseite nach rechts, und als er in den Greenway gerasselt war, hatte es die Windschutzscheibe eingedellt. Aber er kam zu uns.
Durch das Loch, aus dem ich schaute, sickerte der erste schwarze Rauch ins Innere unseres Busses. Ölige, dickflüssige Luft. Ich musste husten. Meine Lunge schmerzte, als würde sie brennen.
Ein Gedanke kam mir in den Sinn: Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt einzuschlafen. Der Gedanke erschien mir absolut logisch und überzeugend.
Aber die anderen schrien immer lauter: »Der Bus brennt!«, »Das Ding explodiert gleich!«, »Wir werden sterben!«
Und ich dachte mir: Stimmt. Wir werden sterben. Aber das ist in Ordnung. Das ist richtig so. Wir sollen sterben. Wir werden sterben.
Hinter mir schepperte es. Metall auf Metall.
»Sie will die Tür aufbrechen!«, rief irgendwer.
»Helft uns!«
Ich schloss die Augen. Ich fühlte mich, als würde ich langsam in tiefem Wasser versinken. Ein schläfriges, warmes Gefühl. Ein angenehmes Gefühl.
Vor mir tat sich ein helles Licht auf. Im offenen Notausgang stand Mrs. Wooly, mit einer Axt in der Hand. Sie hatte die Tür aufgehackt.
Und sie brüllte: »Raus aus dem gottverdammten Bus!«
ZWEITES KAPITEL RETTUNGSDECKEN
Aber die Sache war die: Ich war müde. Ich sah zu, wie die anderen nach hinten hasteten, zu Mrs. Wooly, und wie sie ihnen half, auf allen vieren durch den seitlich gekippten Notausgang zu krabbeln.
Um mich herum wurde lauthals gebrüllt. Einer half dem anderen, über die zerfetzten Sitze zu klettern, jeder rutschte auf den Hagelkörnern aus, der ganze Bus war klebrig vom Blut der Kids, die es zerquetscht hatte, von Mr. Reeds Blut und vielleicht auch von Motorenöl und Benzin und… aber mein Gott, mir war schön warm, und ich war müde.
Ich hockte ganz vorne am Boden. In schweren Schlingen legte sich der schwarze Rauch um meinen Kopf, wie Oktopusarme aus Asche.
Niko hastete den Mittelgang hinauf, um zu überprüfen, ob noch jemand im Bus war. Doch ich wurde fast vollständig vom Sitz verdeckt. Erst als Niko schon kehrtmachen wollte, sah er mich.
Mir geht’s gut, wollte ich ihm sagen. Ich war zufrieden, ich fand es hier sehr gemütlich, und es war Schlafenszeit. Aber die Worte waren zu weit weg, um sie auszusprechen. Ich war zu weit weg, um sie zu holen und durch meine Kehle zu meinen Lippen zu zerren.
Niko krallte sich in meine Arme und zog.
»Hilf mir!«, rief er. »Stoß dich ab!«
Ich versuchte, die Beine zu bewegen. Doch sie waren viel zu dick und schwer, richtige Elefantenbeine. Als hätte man meinen Körper von der Hüfte abwärts durch einen Sack Blei ersetzt.
Niko keuchte. Immer dichterer Rauch umgab uns. Mit einer Hand packte er mich am Haar, mit der anderen verpasste er mir eine schallende Ohrfeige. »Stoß dich ab, sonst gehst du hier drauf!«
Niko hatte mich geohrfeigt! Ich konnte es nicht fassen. Auf dem Tab sieht man so was öfter, aber wenn es einem plötzlich selbst passiert, ist es ein echter Schock.
So gesehen hatte die Ohrfeige funktioniert. Ich erwachte aus dem Halbschlaf, ich war zurück im Hier und Jetzt. Ich war wieder da.
Sofort schob ich mich unter dem Sitz hervor und stolperte auf die Beine. Niko schleifte mich halb durch den Hagel, den »Mittelgang« hinunter, der gar kein Mittelgang war, sondern der Bereich über den Lehnen (weil der Bus ja auf der Seite lag).
Währenddessen rauschte und donnerte der Hagel weiter durch die Fenster, doch er war in eine Art Trott verfallen: ein paar Hagelkörnchen, noch ein paar Hagelkörnchen, dann einige Mörderbrocken. Klein, klein, brutal.
Ich sah, wie Niko einen kräftigen Schultertreffer einsteckte. Er zuckte nicht mal zusammen.
Mrs. Wooly hatte ihre Vordertür direkt an unsere Rückseite gesteuert. Als Niko mich durch den Notausgang schob, hievte Mrs. Wooly mich hoch und bugsierte mich die Stufen rauf in ihren Bus.
Jake Simonsen packte mich am Arm, zerrte mich durch den Gang und hockte mich auf einen Sitz. Sekunden später wurde mir schwindlig, Funken sprühten vor meinen Augen, und schon kotzte ich Jake Simonsen voll. Den Footballhelden, den Sexiest Man Alive. Und noch dazu war die Kotze schwarz wie Teer, wie Haferbrei mit Teer. Kein Scherz.
Ich wischte mir über den Mund. »Sorry.«
»Egal«, meinte er. »Bleib sitzen.«
Mrs. Woolys Bus war deutlich besser in Schuss als unserer. In der Decke wölbten sich enorme Dellen, hinten hatte der Hagel die meisten Fenster eingedrückt, und durch die Windschutzscheibe war kaum noch was zu erkennen, so viele Risse zogen sich kreuz und quer durchs Glas. Aber verglichen mit unserem Bus war ihrer die reinste Air Force One.
Josie saß zusammengesackt vor einem Fenster, während Astrid sich bemühte, die Blutung an ihrer Stirn zu stoppen. Brayden hatte sein Tablet wieder aus dem Rucksack geholt und versuchte, es hochzufahren.
In der ersten Reihe fing Niko an, dunklen Schleim hochzuwürgen.
Und mehr waren wir nicht.
Im Bus hatten mindestens fünfzehn Kids gesessen. Hier waren nur Jake, Brayden, Niko, Astrid, Josie und ich.
Mrs. Wooly legte den Vorwärtsgang ein. Der Bus machte einen Satz Richtung Greenway.
Gleichzeitig veränderte sich der Hagel – er verwandelte sich in einen schweren, stillen Eisregen. Ich spürte die plötzliche Stille bis in die Knochen. Ein gleichbleibendes, bleiernes Wuuuuusch.
Angeblich klingeln einem die Ohren, wenn man sich etwas richtig Lautes angehört hat, zum Beispiel nach einem Rockkonzert. Jetzt war da tatsächlich ein ununterbrochenes GONGONGONGONGONG. Die Stille schmerzte genauso wie der Hagel.
Ich musste heftig husten, ein Mittelding aus Husten und Kotzen. Schwarzer Schleim, grauer Schleim, brauner Schleim. Mir lief die Nase, Tränen strömten aus meinen Augen. Kein Wunder – mein Körper musste den Rauch loswerden.
Auf einmal erstrahlte alles in hellem Orange. Die Fenster und Fensterrahmen traten scharf hervor, erleuchtet von einer Silhouette aus Feuer … und WUMM, explodierte unser alter Bus.
Sekunden später stand das Riesending komplett in Flammen.
»So was«, meinte Jake. »Das war knapp.«
Ich lachte. Ich fand das witzig.
Niko sah mich an wie einen Geisteskranken.
Brayden stand auf und deutete aus dem Fenster auf die lodernden Trümmer unseres ehemaligen Schulbusses. »Das da«, sagte er, »gibt eine Eins-a-Sammelklage, Leute. Wetten?«
»Hinsetzen, Brayden«, erwiderte Jake.
Doch Brayden blieb stehen und zählte uns durch. »Sechs. Wir sechs verklagen das Bildungsministerium. Bei meinem Dad in der Arbeit haben sie Pläne für solche Situationen. Notfallpläne. Warum gab es keinen Plan? Keine Übungen?«
Ich wich seinem Blick aus. Brayden war offenbar vorübergehend durchgeknallt, aber das war nur verständlich. Es war sein gutes Recht, ein wenig neben der Spur zu sein.
Wir näherten uns dem Supermarkt. Ich dachte, Mrs. Wooly würde davor anhalten, um uns aussteigen zu lassen. Aber von wegen. Sie machte es wie beim ersten Mal – sie bretterte durch das Loch, wo früher mal die Glastür gewesen war. So kamen wir im Greenway an. Im Bus.
Aus unwirklich wurde noch unwirklicher.
Ich sah keine Angestellten. Wahrscheinlich hatte die Frühschicht noch nicht angefangen. Die Grund- und Mittelschüler standen im Pizza-Shack-Restaurantbereich am Rand der Verkaufsfläche.
Durch das Busfenster entdeckte ich Alex. Er machte gerade einen Schritt nach vorne und kniff die Augen zusammen, als würde er nach mir suchen. Der Bus kam stotternd zum Stehen. Zuerst stieg Mrs. Wooly aus, dann Niko, dann trat ich auf das glänzende Linoleum. Ich torkelte zu Alex – meine Beine wollten immer noch nicht so richtig mitmachen – und drückte ihn mit aller Kraft an mich. Dass ich ihn dabei mit Ruß und Kotze vollschmierte, war mir egal.
Vor der Umarmung war Alex sogar erstaunlich sauber gewesen. Genau wie die anderen aus seinem Bus. Die Kleinsten hatten natürlich Angst, aber Mrs. Wooly hatte sie alle im Eiltempo aus der Gefahrenzone gebracht.
Das sollte ich wohl noch erklären: In Monument lagen Grund- und Mittelschule direkt nebeneinander. Für kleine, abgelegene Viertel wie unseres gab es daher oft nur einen Bus für beide Schulen zusammen. Deshalb durfte Mrs. Wooly sowohl Achtklässler als auch Vorschüler kutschieren.
Alle Kids aus ihrem Bus, von den Fünfjährigen bis zu den Teenagern, hatten die Sache gut überstanden.
Wir nicht. Wir sahen aus, als kämen wir aus dem Krieg.
Mrs. Wooly bellte die ersten Befehle.
Eine Achtklässlerin namens Sahalia schickte sie mit ein paar kleinen Kids in die Apothekenabteilung, um Mullbinden, Wundsalbe und so weiter zu holen. Zwei Vorschüler sollten einen Einkaufswagen voll Wasser, Gatorade und Kekse sammeln.
Niko wollte ein paar Rettungsdecken besorgen, um einem Schock vorzubeugen. Als er das sagte, blickte er zu Josie. Ich wusste, warum.
Josie wirkte extrem mitgenommen. Sie hockte vornübergebeugt auf der Bustreppe, jammerte lautstark und wiegte sich dabei vor und zurück. Die Risswunde an ihrer Stirn lief nicht mehr ganz so schnell aus, doch das dicke Blut hatte ihr Haar verklumpt und war in roten Flecken auf ihrem Gesicht getrocknet. Ein erschreckender Anblick.
Die paar kleinen Kinder, die noch da waren, standen bloß da und starrten Josie an. Also schickte Mrs. Wooly sie ebenfalls los, Sahalia helfen. Dann nickte sie Astrid zu. »Du hilfst mir, sie in den Pizza Shack zu bringen.«
Gemeinsam stellten sie Josie auf die Füße und führten sie zu einer Sitznische.
Alex und ich saßen zusammen in einer Nische. Brayden, Jake und die anderen hatten sich an einzelne Tische sinken lassen.
Alle fingen an zu reden, und alle redeten ungefähr dasselbe: Ich kann nicht fassen, was da passiert ist. Ich kann nicht fassen, was da passiert ist. Ich kann nicht fassen, was da passiert ist.
»Dean«, fragte mich mein Bruder immer wieder, »bist du dir sicher, dass du okay bist?« Und ich sagte immer wieder, dass es mir gut ging.
Aber mit meinen Ohren stimmte irgendwas nicht. Ich hörte ein rhythmisches Klappern. Das Wumm-Wumm-Wumm des Hagels steckte mir noch in den Gliedern.
Sahalia und die Kleinen kehrten mit einem Einkaufswagen voll Medizin und Erste-Hilfe-Kram zurück.
Mrs. Wooly kam rüber, checkte uns einzeln durch und verabreichte uns, was sie für das Beste hielt.
Um Josie kümmerte sie sich am längsten. Als sie die klaffende Wunde an ihrer Stirn sah, machte sie leise »Ts ts ts«.
Durch Josies schokoladenfarbene Haut sah der Riss noch schlimmer aus. Das Rot des Bluts wirkte irgendwie heller.
»Das muss genäht werden, Schätzchen«, sagte Mrs. Wooly zu ihr.
Josie saß nur da, stierte geradeaus und schaukelte vor und zurück, während Mrs. Wooly Wasserstoffperoxid auf die Wunde goss. Die Flüssigkeit warf pinke Blasen, Schaum lief über Josies Schläfe und in ihren Nacken.
Mrs. Wooly tupfte den Riss mit Watte ab und bestrich ihn mit Salbe, bedeckte ihn mit einem großen Mullpad und wickelte eine Mullbinde um Josies Kopf. Vielleicht hatte sie in ihrer Jugend mal als Krankenschwester gearbeitet. Keine Ahnung, aber sie erledigte das ziemlich profihaft.
Niko tauchte mit ein paar silbrigen Wärmedecken auf, wie man sie normalerweise zum Wandern mitnimmt. Eine legte er Josie um die Schultern, eine andere hielt er mir hin.
»Ich stehe nicht unter Schock«, meinte ich.
Er sah mich bloß ruhig an und hielt mir weiter die Decke hin.
Mir fiel auf, dass ich tatsächlich ein bisschen zitterte. Kurz darauf kapierte ich, woher das seltsame Klappern kam, das ich die ganze Zeit hörte: von meinen Zähnen.
Ich nahm die Decke.
Nun kam Mrs. Wooly zu mir. Mit ein paar Baby-Feuchttüchern wischte sie mir Gesicht und Hals ab, ehe sie meinen Kopf von vorne bis hinten abtastete.
Stellt euch das mal vor – die Grundschulbusfahrerin säubert euch das Gesicht mit Baby-Feuchttüchern und wuschelt euch danach ausgiebig die Haare. Es war lächerlich. Aber jetzt war alles anders, und keiner verarschte irgendwen.
Menschen waren gestorben. Wir waren fast gestorben.
Keiner verarschte irgendwen.
Mrs. Wooly gab mir drei Ibuprofen und ein bisschen Hustensaft und stellte mir einen Kanister Wasser hin. Ich sollte trinken, trinken, trinken und erst aufhören, wenn ich am Boden angekommen war.
»Wie geht’s deinen Beinen?«, fragte sie. »Vorhin bist du ein bisschen komisch gelaufen, oder?«
Ich stand auf. Mein Knöchel schmerzte, ansonsten ging’s ganz gut. »Schon in Ordnung.«
»Ich hol uns ein paar Klamotten«, schlug Niko vor. »Dann können wir uns waschen und umziehen.«
»Du setzt dich jetzt mal hin«, befahl Mrs. Wooly.
Langsam ließ Niko sich in eine Nische sinken und würgte schwarze Schmiere auf seinen Ärmel.
Mrs. Wooly checkte ihn durch und wischte ihm Gesicht und Hals ab, wie bei uns anderen. »Ich erzähl der Schule, was du da drin gemacht hast«, flüsterte sie ihm zu. »Das war eine echte Heldentat, Junge.«
Niko wurde rot und wollte schon wieder aufstehen.
Mrs. Wooly drückte ihm eine Gatorade, ein paar Ibuprofen und eine Flasche Hustensaft in die Hand. »Du bleibst sitzen.«
Er nickte und hustete noch mehr Schleim.
Jake stocherte auf dem Bildschirm seines Minitabs herum. »Hey, Mrs. Wooly. Ich krieg kein Signal rein. Als hätte ich keinen Saft mehr. Aber ich weiß, dass es aufgeladen ist.«
Einer nach dem anderen zog ein Minitab hervor und versuchte, es einzuschalten.
»Wahrscheinlich ist das Network zusammengebrochen«, meinte Mrs. Wooly. »Aber probiert’s weiter. Das wird schon wieder.«
Auch Alex holte sein Minitab raus. Es war tot, der Bildschirm schwarz. Er brach in Tränen aus. Heute muss ich fast darüber lachen. Im Sturm hatte er nicht geweint, als er mich halb tot gesehen hatte, hatte er nicht geweint, um die toten Kids aus meinem Bus hatte er auch nicht geweint. Er weinte erst, als wir kapierten, dass das Network zusammengebrochen war.
Das Network war noch nie zusammengebrochen. Noch nie.
Jeder von uns hatte Hunderte Werbespots gesehen, die beteuerten, wie absolut stabil die National Connectivity sei. Und daran mussten wir glauben, denn all unsere Daten – Fotos, Filme, E-Mails, alles – ruhten auf großen Servern »oben am Himmel«.
Ohne Network hatte man keinen Computer mehr, sondern nur leere Tablets, Plastik und Altmetall im Wert von höchstens fünfzehn Dollar. Man hatte nichts.
Angeblich existierten Tausende Back-ups, die das Network gegen jede Naturkatastrophe absicherten, sogar gegen einen Atomkrieg. Gegen alles.
»Was für eine Scheiße!«, meckerte Brayden. »Wenn das Network weg ist, kommt auch keiner, um uns hier rauszuholen. Die wissen nicht mal, wo wir sind!«
Jake schaltete seine tiefe Chill-out-Stimme ein und sagte Brayden, dass er sich beruhigen soll. Dass das schon wieder wird.
Da rutschte Alex aus unserer Sitznische und legte los. Er schrie beinahe. »Das Network kann nicht zusammenbrechen! Das kann nicht sein. Ihr habt keine Ahnung, was das bedeutet!«
In unserer Gegend war Alex eine kleine Berühmtheit, weil er so ein gutes Händchen für Computer und Elektronik hatte. Bei uns zu Hause kamen Leute vorbei, die wir kaum kannten, um ihre defekten Tablets von Alex debuggen zu lassen. An meinem ersten Tag in der Highschool hatte mich der Englischlehrer beiseitegenommen und gefragt, ob ich zufällig Alex Grieders Bruder wäre und ob Alex sich vielleicht mal das Navi seines Wagens anschauen könnte.
Wenn hier einer wusste, was ein Zusammenbruch des Networks bedeutete, dann Alex.
Mrs. Wooly packte ihn an den Schultern. »Grieder junior«, sagte sie, »geht jetzt frische Klamotten für Grieder senior holen.«
Mit Grieder senior meinte sie natürlich mich.
»Sie kapieren das nicht«, jammerte Alex.
»Du besorgst jetzt Klamotten für deinen Bruder. Und für die anderen Jungs. Schnapp dir einen Wagen und los. Sahalia, du gehst mit und holst Sachen für die Mädchen.«
»Aber ich weiß ihre Größen gar nicht«, erwiderte Sahalia.
»Ich komm mit«, meinte Astrid.
Mrs. Wooly öffnete schon den Mund, um ihr zu befehlen, brav sitzen zu bleiben – schloss ihn aber wieder. Mrs. Wooly kannte ihre Fahrgäste. Sie wusste, dass Astrid sich nichts sagen ließ.
Astrid, Alex und Sahalia machten sich auf den Weg.
Ich trank Wasser.
Und gab mir große Mühe, nicht schon wieder zu kotzen.
Ein paar von den Kleinen tatschten auf ihren Minitabs herum. Immer wieder drückten sie auf die toten Bildschirme und legten die kleinen Köpfe schief. Sie warteten, warteten, warteten.
Sie hatten keinen Schimmer, was los war.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, mich zusammen mit Brayden und Jake auf der Toilette umzuziehen. Die Typen waren nicht gerade meine besten Freunde. Jake ging in die Zwölfte, Brayden und ich waren beide in der Elften. Aber die beiden waren in der Footballmannschaft und hatten breite Schultern. Ich war nicht in der Mannschaft und hatte keine.
Jake hatte mich bisher auf seine großmütige Art ignoriert. Brayden war einfach nur gemein zu mir.
Kurz überlegte ich, zum Umziehen in eine Kabine zu gehen. Brayden bemerkte mein Zögern.
»Keine Angst, Geraldine«, meinte er. »Wir schauen dir schon nichts weg.«
Dean … Geraldine … großartig, was?
Mit der Geraldine-Scheiße hatte Brayden schon in der Grundschule angefangen.
In der Achten hatte er sich dann auf meine Frisur eingeschossen. Seiner Meinung nach musste ich dringend »gestylt« werden, und dazu spuckte er sich in die Hände und rieb mir den Speichel ins Haar wie Gel. Gegen Ende des Schuljahrs sabberte er mir einfach auf den Kopf und zermanschte das Zeug mit einer Hand.
Enorm stylish.
Aber mir war klar, dass die Mädchen auf Brayden standen: olivfarbene Haut, die selbst im Winter frisch gebräunt wirkte, dazu braunes, gewelltes Haar und sehr buschige Augenbrauen. Irgendwie neandertalermäßige Augenbrauen, wenn ihr mich fragt, aber auf Mädchen wirkte das wohl wild und gefährlich. Nehme ich zumindest an, weil sie in Braydens Gegenwart immer tuschelten und rumstolzierten, bis ich einen Hass auf die ganze Welt entwickelte.
Soll heißen: Brayden und ich, wir waren keine Freunde.
Ich ging nicht in die Kabine, sondern streifte bloß mein verdrecktes Shirt und meine Jeans ab und säuberte mich am Waschbecken.
»Dieser Hagel …«, sagte Jake. »Unfassbar, was?«
Brayden nickte. »Unfassbar.«
»Absolut unfassbar«, bestätigte ich.
»Du sagst es!«
Jake erkundigte sich nach einem Bluterguss an meinem Arm, den ich einem besonders fiesen Hagelkorn zu verdanken hatte.
»Tut ganz schön weh«, erwiderte ich.
»Du bist schon okay, Dean«, sagte er und schlug mir auf die Schulter, was ebenfalls wehtat.
Vielleicht ließ Jake sich bloß vom Gemeinschaftsgefühl mitreißen. Oder er kümmerte sich um mich, um einen auf Anführer zu machen. Aber selbst wenn er mir nur was vorspielte – ich durfte mich mal ganz normal fühlen, und das war schön.
»Hey, Jake«, meinte ich. »Das mit der Kotze tut mir leid.«
»Kein Ding, Mann. Vergiss es.«
Ich warf ihm das Sweatshirt zu, das Alex mir von einem Kleiderständer im Greenway geholt hatte. »Hier. Hab ich extra für dich ausgesucht. Passt zu deinen Augen.«
Jake lachte auf. Mein Spruch hatte ihn überrascht.
Auch Brayden lachte.
Und so gackerten wir vor uns hin, bis das Ganze völlig außer Kontrolle geriet. Gemeinsam schnappten wir nach Luft, Tränen in den Augen.
Meine Kehle schmerzte – der Rauch hatte sie aufgeraut. Trotzdem lachten Jake, Brayden und ich noch lange weiter.
Als wir frisch angezogen zurückkehrten, hatte Mrs. Wooly alle um sich versammelt.
»Ich schätze, es ist acht oder neun«, erklärte sie. »Das Network ist immer noch nicht wiederhergestellt, und langsam mache ich mir Sorgen um unsere liebe Josie. Wahrscheinlich steht sie nur unter Schock, und das müsste sich in ein, zwei Tagen geben. Aber es könnte auch was Ernsteres sein.«
Alle sahen Josie an, die seltsam distanziert zurückstarrte. Nicht direkt geistesabwesend, eher als könnte sie unsere Gesichter und Namen nicht richtig einordnen.
»Okay«, fuhr Mrs. Wooly fort, »das ist der Plan: Ich gehe rüber zur Notaufnahme und hole Hilfe.«
Chloe, ein rundliches kleines Mädchen, heulte los. »Ich will nach Hause! Bring uns nach Hause! Ich will zu Oma!«
»Wie denn?«, erwiderte Mrs. Wooly. »Der Bus hat zwei Platten. Ich kann euch nirgendwohin bringen. Aber ich hole Hilfe und bin in null Komma nichts wieder da.« Chloe war alles andere als überzeugt, doch davon ließ Mrs. Wooly sich nicht aufhalten. »Noch was, Kinder. Eure Eltern müssen später alles bezahlen, was ihr aus dem Laden nehmt. Also, haltet euch zurück, klar? Wir haben hier nicht Weihnachten.« Eine Pause. »Ich habe beschlossen, Jake Simonsen das Kommando zu übertragen. Bis ich zurück bin, hat er das Sagen. Aber jetzt gehen Sahalia und Alex erst mal mit den Kleinen in die Spielzeugabteilung, ein paar schöne Brettspiele und Puzzles aussuchen.«
Die Kleinen jubelten, allen voran Chloe, die demonstrativ auf und ab hüpfte und in die Patschehändchen klatschte. Was ihre Laune anging, war sie wohl etwas inkonsequent. Und etwas anstrengend war sie auch.
Mit einem entnervten Seufzen stand Sahalia auf. »Warum immer ich?«
»Weil die Großen im Gegensatz zu dir fast umgekommen wären«, zischte Mrs. Wooly.
Die Grund- und Mittelschüler verschwanden Richtung Spielzeugabteilung.
»Hört mal her«, meinte Mrs. Wooly, als die Kids weg waren. »Bis zum Krankenhaus ist es nicht weit. Das schaffe ich wahrscheinlich in einer Stunde, vielleicht auch in einer halben. Und falls mich irgendwer mitnimmt, bin ich sogar noch schneller zurück. Ihr gebt Josie zu trinken und fragt sie öfter mal, was für ein Jahr wir haben, wie sie heißt, was … was weiß ich, was ihre Lieblingslimo ist, ihre Lieblingskekse und so weiter.« Mrs. Wooly fuhr sich durch das drahtige graue Haar. Ihre Augen drifteten zur zerschlagenen Schiebetür des Eingangs ab. »Kann sein, dass bald jemand auftaucht. Aber ihr geht mit niemandem mit außer mit euren Eltern, okay? Das müsst ihr mir versprechen. Ich bin jetzt für euch verantwortlich. Und … nicht dass ich damit rechnen würde, aber falls es zu Krawallen oder Plünderungen oder so kommt, packt ihr alle Kinder hier in den Pizzaladen und bleibt zusammen. Die Großen nach außen und zusammenbleiben. Kapiert?«
Jetzt war mir klar, warum Mrs. Wooly die Jüngeren weggeschickt hatte. Sie wollte ihnen nichts über Krawalle erzählen.
»Eine Frage noch«, meinte Jake. »Was, wenn die Leute vom Greenway kommen?« Er deutete auf den zerbeulten Bus, der zwischen den leeren Einkaufswagen im Eingangsbereich stand. »Die werden ganz schön angepisst sein.«
»Ihr sagt ihnen, dass es ein Notfall war und dass die Schulbehörde für alle Schäden aufkommt.«
»Ich könnte uns notfalls Mittagessen machen«, sagte Astrid. »Ich kenn mich mit den Öfen im Pizza Shack aus. Hab letzten Sommer hier gejobbt.«
Das wusste ich schon. Keine Ahnung, wie viele Streifzüge ich im vorigen Sommer durch den Greenway unternommen hatte. Es waren viele.
»Ein warmes Mittagessen!«, rief Mrs. Wooly. »Das ist doch mal ein Wort.«
Die Kleinen kehrten mit einem Stapel Brettspiele zurück. Mrs. Wooly machte sich startklar.
Währenddessen ging ich zu den Büroartikeln, schnappte mir einen Acht-Dollar-Kugelschreiber und suchte mir das schönste, teuerste, edelste Notizbuch im Angebot aus. Ich hockte mich hin, wo ich war, und schrieb. Ich musste den Hagelsturm zu Papier bringen, solange die Erinnerung noch frisch war.
Ich habe schon immer geschrieben. Egal was passiert, ich muss es nur aufschreiben, und schon ist es okay. Ich setze mich völlig wirr und gestresst hin und lege los – wenn ich wieder aufstehe, ist alles da, wo es hingehört.
Am liebsten schreibe ich mit der Hand in ein Spiralnotizbuch. Ich weiß selbst nicht, warum, aber auf einem Blatt Papier kann ich besser denken als auf einem Tablet. Dabei kritzelt eigentlich kein normaler Mensch noch etwas Längeres als schnelle Notizen von Hand. Wir haben alle im Kindergarten gelernt, mit zehn Fingern zu tippen.
Brayden blieb stehen und sah mir einen Moment zu. »Schreibschrift, Geraldine? Wie retro.«
Alle stellten sich am Eingang auf, um Mrs. Wooly zu verabschieden. Der Himmel war zu seinem Normalzustand zurückgekehrt, einem knackigen, klaren Blau. »Der Himmel über Colorado ist immer noch der schönste«, hätte meine Mom dazu gesagt.
Auf dem Parkplatz lagen etwa dreißig Zentimeter Hagel. Wo der Asphalt abschüssig war, waren die Eisklumpen runtergerutscht und hatten sich in gewaltigen Dünen gesammelt.
Ich weiß, das klingt nach einem genialen Spielplatz – als hätte sich die Außenwelt in ein einziges Bällebad verwandelt. Doch die großen Hagelkörner hatten Beulen und Auswüchse, da steckten Steine und Zweige und anderes Zeug drin. Die Dinger waren scharfkantig und schmutzig. Keiner wollte rausgehen und spielen. Wir blieben lieber drinnen.
Die paar Autos auf dem Parkplatz waren wahnwitzig eingedellt und zermalmt, als wären sie von einem Riesen mit einem Riesenhammer weich geklopft worden. Sie hatten deutlich mehr abgekriegt als Mrs. Woolys Bus.
»Wenn alle Autos in der Stadt so aussehen«, sagte Alex zu mir, »müssen wir nach Hause laufen.«
Nach Hause laufen? Warum eigentlich nicht? Sobald Mrs. Wooly weg war, könnte ich mich einfach auf den Weg machen. Aber sie hatte gesagt, dass wir bleiben sollten, und ich hielt mich an Anweisungen. Außerdem war Astrid Heyman im Greenway und nicht in unserer langweiligen Billighütte in der Wagon Trail Lane.
In unserer Siedlung hießen alle Straßen so ähnlich: Wagon Gap Trail, Coyote Valley Court, Blizzard Valley Lane …
Ich bin unsere Straße wirklich oft runtergelaufen, aber ich habe sie kein einziges Mal mit einem Feldweg durch eine Wild-West-Prärie verwechselt. Keine Ahnung, wie die Baufirma auf die Schwachsinnsidee gekommen ist.
In der Ferne waren Sirenen zu hören. An ein paar Stellen stieg Rauch auf. Auch über unserem ausgebrannten Bus hing eine Rauchsäule. Deshalb konnte ich mir in etwa ausrechnen, woher der andere Rauch kam.
Ich weiß noch, was ich mir damals dachte: Unsere Stadt hat ganz schön was eingesteckt. Ich fragte mich, ob wir staatliche Katastrophenhilfe bekommen würden. Nach dem Erdbeben von ’21 waren Bilder aus San Diego ausgestrahlt worden, wo Kisten voller Kleidung, Spielzeug und Nahrung verteilt worden waren. Vielleicht würden diesmal wir Geschenke kriegen, und die Medien würden unsere Stadt belagern.
Mrs. Wooly schlüpfte in kniehohe Gummistiefel und steckte eine billige Schachtel Zigaretten ein. Sonst nahm sie nichts mit.
»Mrs. Wooly.« Brayden trat einen Schritt vor. »Mein Dad arbeitet bei NORAD. Wenn Sie ihm irgendwie Bescheid sagen können, kann er sicher einen Wagen oder so schicken, der uns hier rausholt.«
Wahrscheinlich war ich der Einzige, der die Augen verdrehte. Wahrscheinlich.
»Keine schlechte Idee, Brayden«, meinte Mrs. Wooly mit ihrer Kratzstimme. »Ich denk drüber nach.« Sie musterte uns. »Okay, Kinder. Ihr hört auf Jake. Jake hat das Kommando. Und Astrid macht Pizza für alle.« Damit trat sie durch den leeren Türrahmen auf den Parkplatz. Nach ein paar Schritten wandte sie sich nach rechts und blickte auf eine Stelle am Boden, die wir nicht erkennen konnten. Sie schien zurückzuschrecken, fast zu würgen, bis sie sich noch mal zu uns umdrehte. »Und jetzt geht ihr rein und bleibt drinnen«, sagte sie energisch. »Bewegung! Hier draußen ist es nicht sicher. Los, rein mit euch. Los. Macht euch was zu essen.« Sie scheuchte uns mit den Händen ins Innere, und weil Mrs. Wooly eine echte Autorität war, gehorchten wir.
Doch im Augenwinkel sah ich, wie Jake einen Schritt ins Freie machte und auf denselben Fleck starrte wie sie.
»Das gilt auch für dich, Simonsen«, meinte Mrs. Wooly. »Das ist keine Peepshow. Rein mit dir.«
Jake ging auf uns zu und kratzte sich am Kopf. Er wirkte etwas blass.
»Was?«, fragte Brayden. »Was ist da draußen?«
»Leichen. Ein paar. Sieht nach Greenway-Angestellten aus«, flüsterte Jake uns zu. »Keine Ahnung, warum sie mitten im Hagel raus sind, aber jetzt sind sie auf alle Fälle tot. Die hat’s komplett zermatscht. Da ragen überall Knochen raus. So was hab ich noch nie gesehen. Außer bei der Scheiße im Bus vielleicht.« Mit einem Bibbern atmete er durch und sah mir und Brayden in die Augen. »Ich sag euch was. Wir bleiben drinnen, bis sie zurückkommt.«
DRITTES KAPITEL STAHLTOR
»Hat irgendwer Lust auf Pizza?«, rief Astrid.
»Ich! Ich! Ich!«, schrien die Kleinen verzückt, und ihre Hände schossen in die Höhe, als wären wir bei der Meisterschaft im Handheben. Sie stimmten sogar einen Gesang an: »Pizza-Party! Pizza-Party!«
Ihre Begeisterung war ansteckend, auch weil Astrid wunderschön aussah, wie sie sich zu ihnen beugte und sich ihre Lieblingspizzen erklären ließ. Der Wind fuhr durch die Spitzen ihres Haars und rötete ihre Wangen.
Ich hatte durchaus mitbekommen, was für eine Tragödie sich hier abgespielt hatte, dass unsere ganze Stadt zerstört war. Ich fragte mich, wie meine Eltern und Freunde den Hagel überstanden hatten. Aber ich muss zugeben, dass ich es genoss, in Astrids Nähe zu sein.
Meine Mom glaubt, dass man sich das Glück herbeiwünschen kann. Über dem Herd hat sie alte, kastanienbraun lackierte Buchstaben aufgehängt, die das Wort MANIFEST ergeben. Angeblich muss man nur darüber nachdenken und davon träumen, wie das eigene Leben sein soll – wenn man das lange genug durchzieht, wird es irgendwann wahr.
Ich hatte meinen Traum schon sehr oft manifestiert: Astrid Heyman, Hand in Hand mit mir, während ihre blauen Augen in meine Augen blicken und ihre Lippen mir irgendwas Wildes, Witziges, Unverschämtes ins Ohr flüstern. Doch sie schien nicht mal mitgekriegt zu haben, dass ich überhaupt existierte. Ein Typ wie ich, mit einem relativ niedrigen Rang in der sozialen Hackordnung der Lewis Palmer High, benahm sich schon idiotisch, wenn er nur davon träumte, von Astrid zu träumen. Davon abgesehen ging sie in die Zwölfte und ich in die Elfte. Also vergiss es.
Aber Astrid strahlte nun mal vor Schönheit: glänzend blonde Ringellocken, Augen wie ein blauer Junihimmel und eine leicht gerunzelte Stirn, als müsste sie sich ständig ein Lächeln verkneifen. Die beste Turmspringerin des Schwimmteams. Sie hätte bei Olympia mitmachen können.
Ach was, Astrid war in jeder Hinsicht olympiareif.
Im Gegensatz zu mir. Ihr kennt sicher auch Typen, die einfach nicht gewachsen sind. In der Siebten und Achten, als alle anderen in die Höhe schossen, musste ich weiter Kindergröße tragen – das waren die Brayden-Gelfrisur-Jahre. Erst letzten Sommer war ich dann urplötzlich gut fünfzehn Zentimeter gewachsen. Ein absurder Wachstumsschub, über den meine Mom dermaßen aus dem Häuschen war, dass sie mich alle zwei Wochen neu einkleidete. Nachts schmerzten meine Knochen, und manchmal knarrten meine Gelenke wie bei einem Rentner.
Zu Beginn des Schuljahrs hatte ich mir deswegen fast ein wenig Hoffnung gemacht. Eventuell könnte ich jetzt, wo ich durchschnittlich groß war – sogar überdurchschnittlich –, auf einer … äh … höheren Ebene in die Gesellschaft zurückkehren? Ich weiß, normalerweise spricht man nicht so offen über Beliebtheit, aber ich war halt schon seit Ewigkeiten in Astrid verknallt. Ich wollte in ihrer Nähe sein, und ich sah keinen anderen Weg, in ihre Nähe zu gelangen, als mich in ihren Freundeskreis einzuschleichen.
Und dabei, dachte ich, könnte mir mein Wachstumsschub behilflich sein. Okay, ich war immer noch spindeldürr, aber vom Gesamtpaket her hatte sich mein Äußeres gesteigert: grüne Augen – ein Pluspunkt. Aschfarbenes Haar – könnte schlimmer sein. Körpergröße – kein Problem mehr. Statur – stark verbesserungsbedürftig. Brille – lästig, aber von Kontaktlinsen bekam ich chronische Bindehautentzündung, was noch beschissener aussah, und Lasern kam erst infrage, wenn ich nicht mehr wuchs, was noch eine Weile dauern würde. Zähne und Haut – in Ordnung. Klamotten – eine ziemliche Katastrophe, aber auf dem Weg der Besserung.
Ich dachte, ich hätte eine Chance. Doch bisher ließ sich die gesamte Kommunikation zwischen Astrid und mir in den zwei Worten zusammenfassen, die sie im Bus zu mir gesagt hatte: Hilf mir.
Und ich hatte ihr nicht geholfen.
Wir gingen alle wieder rein. Astrid warf den Pizza-Shack-Ofen an und schaltete die Slushie-Maschine ein.
Josie saß immer noch in die Rettungsdecke gewickelt in ihrer Nische. Zuerst wollte ich ihr eine Cola vom Zapfhahn holen, aber auf ihrem Tisch standen bereits zwei Gatorades und eine Flasche Wasser.
Die Slushie-Maschine war zu weit oben für die Kleinen. Eine Weile sah ich zu, wie sie auf und ab sprangen und nach den Hebeln grapschten, was süß, aber absolut aussichtslos war. Dann ging ich rüber und erklärte mich bereit, allen den Slushie zu machen, den sie wollten.
Allgemeiner Jubel.
Die Kleinen hatten noch nie gehört, dass man verschiedene Geschmacksrichtungen kombinieren konnte. Deshalb waren sie schwer beeindruckt von meinen mehrschichtigen Slushies.
»Das ist der beste Slushie meines ganzen Lebens!«, lobte ein hellblonder Erstklässler namens Max, der einen aberwitzigen Haarwirbel am Hinterkopf hatte. Sein Haar stand hoch wie ein blonder Fächer. »Und ich hab schon viele Slushies gegessen, weil mein Dad nämlich Fernfahrer ist und mich dauernd auf Tour mitnimmt. Ich hab sicher schon in jedem Staat von Amerika einen Slushie gegessen! Einmal hat Dad mich für eine Woche aus der Schule genommen, da sind wir fast bis nach Mexiko, aber dann hat meine Mom angerufen und gesagt, er soll mich schleunigst zurück nach Monument bringen, sonst kriegt er es mit den Cops zu tun!«
Max war mir sympathisch. Ein Junge, der frei heraus sagte, was ihm durch den Kopf ging.
Bei den Kleinen war auch ein Latino dabei. Ich schätzte ihn auf erste Klasse, vielleicht auch auf Vorschule. Ein pummeliges, fröhliches Kind.
»Wie heißt du?«, fragte ich ihn.
Er lächelte mich bloß an. Da, wo die beiden oberen Schneidezähne hingehört hätten, klafften zwei große Löcher.
»Cómo se llama? Dein Name?«
»Julis«, sagte er.
Julis? Seltsamer Name. Aber ich bin auch kein Experte für Latino-Namen. »Freut mich, Julis.«
»Nein, nein«, sagte er.
»Wie? Wie heißt du denn dann?«
»Julis.«
»Sag ich doch. Julis.«
»Nein. Julis.«
»Äh …«
»Er heißt Ju-liss-ies«, eilte Max mir zu Hilfe. »Wir sind zusammen in der ersten Klasse.«
»Ju-liss-ies?«, fragte ich.
Der kleine Mexikaner wiederholte seinen Namen.
Und endlich kam ich drauf. »Ulysses! Du heißt Ulysses!«
Ob ihr’s glaubt oder nicht, aber spanisch ausgesprochen klingt der Name komplett anders.
Ulysses grinste, als hätte er im Lotto gewonnen. »Ulysses! Ulysses!«
Wir beide hatten einen kleinen, aber hart erkämpften Sieg errungen: Ich kannte seinen Namen.
Chloe, die Drittklässlerin, die vorhin losgejammert hatte, weil Mrs. Wooly Hilfe holen wollte, war mollig, gebräunt und voller Energie. Als ich ihr den blau-rot-gestreiften Slushie überreichte, den sie sich bestellt hatte, hatte sie einiges auszusetzen.
»Die Streifen sind zu dick!«, beschwerte sie sich. »Es soll aussehen wie der Schwanz von einem Waschbären!«
Nach fünf oder sechs weiteren Versuchen dämmerte mir allmählich, wie schwer es ist, einen Slushie mit dünnen Streifen anzufertigen.
Ich überreichte Chloe meinen allerbesten Versuch.
»Das ist kein Waschbärschwanz«, stellte sie fest und schüttelte trübselig den Kopf, als wäre sie meine Lehrerin und ich ein aussichtsloser Fall.
»Waschbäriger krieg ich’s nicht hin.«
»Na gut.« Sie seufzte. »Du hast dein Bestes gegeben.«
An diesem Punkt hatte ich längst beschlossen, dass Chloe eine echte Herausforderung war.
Zufälligerweise waren auch unsere Nachbarn dabei, die McKinley-Zwillinge. Alex und ich schippten ab und zu für ihre Mom die Einfahrt. Die war wohl eine alleinerziehende Mutter.
Auf jeden Fall zahlte sie zwanzig Dollar. Nicht übel.
Die Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, hatten beide rotes Haar und Sommersprossen – überlappende, ineinander übergehende Sommersprossen, sodass sie quasi gar keine andere Haut mehr hatten. Nur hier und da blitzte ein Fleck Weiß durch die dichte Sprossendecke.
Mit ihren fünf Jahren waren die McKinleys die Jüngsten und mit Abstand Kleinsten unserer Gruppe. Ihre Mom war auch klein, und die Kinder waren regelrecht winzig. Vollständige Menschlein, aber nur kniehoch. Die beiden redeten nicht viel, wobei Caroline immer noch mehr plauderte als Henry. Aber vor allem waren die zwei absolut entzückend, um mal ein Wort zu gebrauchen, das eher von Mädchen und alten Jungfern bevorzugt wird.
Leider, leider kommt das Beste diesmal nicht zum Schluss – Batiste, der einzige Zweitklässler, war extrem anstrengend. Batiste sah tendenziell asiatisch aus, mit glänzendem schwarzem, sehr kurz geschorenem Haar. Eine richtige Haarbürste.
Das Problem war, dass Batiste aus einer sehr religiösen Familie stammte und sich deshalb für den Fachmann in Sachen Sünde hielt. In meiner Gegenwart hatte er schon Brayden fürs Fluchen getadelt (»Es ist eine Sünde, den Namen des Herrn zu missbrauchen!«), Chloe verpetzt, nachdem sie Ulysses geschubst hatte (»Schubsen ist eine Sünde!«), und die anderen Kids darüber informiert, dass es eine Sünde sei, ohne Tischgebet zu essen (»Der Herr will, dass wir armen Sünder ihm vor dem Mahl Dank aussprechen!«).
Batistes prüfender Blick traf jeden. Er wartete nur darauf, dass irgendwer Mist baute, um es ihm dann augenblicklich unter die Nase zu reiben. Reizend, nicht wahr? Nur eines hielten seine Leute offenbar nicht für eine Sünde: ein aufgeblasener kleiner Besserwisser zu sein.
Die restlichen Kids aus dem Grund- und Mittelschulbus waren mein Bruder Alex und Sahalia.
Für eine Achtklässlerin war Sahalia schon sehr weit. Modetechnisch war sie sogar ganz vorne mit dabei. Selbst einer wie ich, der bis zur Siebten im Jogginganzug in die Schule gegangen ist – und zwar jeden Tag –, weiß Bescheid, wenn ein wirklich stilsicherer Mensch vor ihm steht. Als das alles anfing, trug Sahalia enge Jeans, die an einer Seite von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden, und ein Muskelshirt mit einer Art Lederweste drüber. Außerdem hatte sie eine Lederjacke mit rotem Karofutter dabei, ein Riesenteil, das ihr viel zu groß war. Sahalia war drei Jahre jünger als ich und um Längen cooler.
Viele Leute waren cooler als ich. Ich nahm es ihr nicht übel.
Anscheinend hatte Sahalia einen Abstecher in die Kosmetikabteilung unternommen. Ich hätte schwören können, dass sie kein Make-up getragen hatte, als wir im Greenway angekommen waren. Jetzt waren ihre Augen schwarz umrandet und ihre Lippen knallrot.
Sie hockte auf der Lehne der Sitznische neben dem Tisch, an dem Brayden und Jake aßen, sah ihnen so halb beim Futtern zu und versuchte gleichzeitig dazuzugehören. Das war ihre Art, sich sozusagen von der Seite her in ihre Bande zu mogeln. Sie setzte sich in die Nähe und hoffte, die beiden würden sie zu sich bitten.
Aber das konnte sie sich abschminken.
Brayden blickte auf. »Hast du ein Problem? Wir haben hier was zu besprechen.«
Sahalia verdrückte sich, um stattdessen in Astrids Nähe rumzuhängen. Sie schlenderte rüber, als wäre ihr alles egal. Oder als hätte sie sowieso vorgehabt, zur Theke zu gehen. Ein bewundernswert gelangweiltes Schlurfen.
Niko aß allein.
Ich hätte ihn zu Alex und mir einladen sollen, aber als ich mit den Slushies fertig war – vor allem mit den sieben für Chloe –, wurde die Pizza aus dem Ofen geholt, und vor lauter Hunger vergaß ich meine Manieren.
Alex und ich schlangen die ersten Pizzastücke runter. So gut hatten mir die schweren, quadratischen Pizza-Shack-Scheiben noch nie geschmeckt. Als ich mir die rote Soße von den Fingern leckte, stand Alex auf und holte Nachschub.
Doch als er zurückkehrte, waren meine Augen an Josie hängen geblieben.
Sie hockte seitlich in ihrer Nische, mit dem Rücken zur Wand. Mrs. Wooly hatte ihr Gesicht und ihre Hände gesäubert, aber an ihren Armen und ihrem restlichen Körper klebte noch getrocknetes Blut, an dem die Rettungsdecke haftete. Sie hatte sich nicht mal umgezogen. Ich hatte Mitleid mit ihr. Alle anderen ließen sich ihre Pizza schmecken, nur sie saß offensichtlich noch im Bus.
Ich nahm mein frisches Pizzastück und setzte mich ihr gegenüber an den Tisch. »Josie«, meinte ich leise. »Ich hab dir Pizza gebracht. Komm schon, iss was. Das wird dir guttun.«
Josie sah mich an und schüttelte wortlos den Kopf. Einer ihrer seitlich abstehenden Haarknoten hatte sich aufgelöst. Die Strähnen hingen windschief in der Luft, wie abgeknickte Äste.
»Nur ein Bissen«, versuchte ich es noch einmal. »Dann lass ich dich in Ruhe.«
Sie drehte sich zur Wand.
»Okay, ich lass die Pizza hier. Falls du’s dir anders überlegst.«
Astrid holte gerade ein Blech scharfe Salamipizza aus dem Ofen. Weil ich immer noch ein bisschen Hunger hatte, ging ich zur Theke.
»Magst du Salami?«, fragte sie mich.
Mein Herz hämmerte.
»Ja«, sagte ich. Wie lässig.
Sie legte mir ein Stück auf einen Pappteller. »Bitte.«
»Danke«, antwortete ich. Enorm lässig.
Ich drehte mich um und ging.
Das war meine zweite Unterhaltung mit Astrid. Wenigstens hatte ich diesmal geantwortet.
Auf dem Rückweg zu unserer Nische hörte ich ein lautes, metallisches Grollen. Ein schweres, rollendes Scheppern.
»Was …«, stotterte Max, »… ist das?«
Vor dem klaffenden Loch am Eingang des Greenway senkten sich drei schwere Stahltore aus der Decke. Eins, zwei, drei Tore unmittelbar nebeneinander. Die beiden an den Seiten entrollten sich vor den Fenstern. Das mittlere, etwas breitere, deckte den gesamten Bereich der ehemaligen Schiebetür ab.
Die Tore hatten Löcher, sodass weiterhin Luft reinkam und wir noch rausschauen konnten. Trotzdem war es irgendwie beängstigend.
Wir wurden eingesperrt.
Die Kleinen rasteten sofort aus: »Was ist da los?«, »Wir sind gefangen!«, »Ich will nach Hause!« und so weiter.
Niko stand auf und sah reglos zu, wie sich die Tore schlossen.
»Wir sollten was drunterschieben!«, rief Jake. »Um … um es zu blockieren!«
Er griff sich einen Einkaufswagen und rollte ihn nach vorne, unter das mittlere Tor.
Doch das Tor schubste den Wagen einfach beiseite.
Mit einem lauten BUMMMMM setzten die Tore auf dem Boden auf. Es klang sehr endgültig.
»Wir sind eingesperrt«, meinte ich.
»Und alle anderen sind ausgesperrt«, ergänzte Niko ruhig.
»Was soll’s.« Jake klatschte in die Hände. »Kann mir einer von euch kleinen Scheißern erklären, wie dieses komische Leiterspiel geht?«
Alex tauchte neben mir auf. »Dean.« Er zupfte mich am Shirt. »Gehen wir mal in die Elektronikabteilung?«
Natürlich waren alle Bigtabs in der Elektronikabteilung tot – sie hingen genau wie unsere Minitabs am Network. Doch Alex machte den einzigen altmodischen Flachbildfernseher ausfindig. Das Ding war ganz unten an der Seite angebracht, knapp über dem Boden.
Ich hatte mich schon immer gefragt, warum man sich heutzutage noch einen normalen Fernseher kaufen sollte. Schließlich konnte man sich für ein paar Dollar mehr gleich ein Bigtab holen, das man zum Fernsehen und Internetsurfen und SMS-Schreiben und Spielen und für Skype und Facebook und tausend andere nützliche Dinge hernehmen konnte. Trotzdem hatte jeder große Laden auch ein paar Fernseher im Angebot – und jetzt wusste ich, warum: Sie liefen ohne National Connectivity. Offenbar empfingen sie ein Signal nur für Fernseher. Ab und zu wurde das Bild ein bisschen körnig und streifig, aber wir sahen gebannt hin.
Alex schaltete auf CNN.
Nach und nach kamen die anderen rüber, wahrscheinlich angelockt vom Sound der Fernsehübertragung.
Ich hatte gedacht, in den Nachrichten würden sie rund um die Uhr von unserem Hagelsturm reden. Irrtum.
Unser mickriger Hagelsturm war gar nichts.
Vor der Kamera saßen zwei Nachrichtensprecher, ein Mann und eine Frau, die ganz ruhig erklärten, was geschehen war. Doch die Frau war komplett durch den Wind. Sie hatte eindeutig geweint, um die Augen herum war ihr Make-up vollkommen verschmiert. Warum hatte das keiner in Ordnung gebracht? Das war immerhin CNN.
Der Mann im blauen Anzug meinte gerade, er würde die Verkettung der Ereignisse nochmals durchgehen, für alle, die sich erst vor Kurzem in die Übertragung eingeschaltet hätten. So wie wir. Dann redete er von einem Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma.
Auf dem Monitor hinter den beiden Sprechern erschienen verwackelte Handkameraaufnahmen: Asche, ein flammender Berg.
Durch den Vulkanausbruch sei die gesamte Westseite der Insel explodiert, berichtete die Dame mit der zerlaufenen Schminke. Eine Lawine aus fünfhundert Milliarden Tonnen Fels und Lava habe sich ins Meer ergossen.
Davon existierten keine Aufnahmen.
Blauer Anzug sagte, die Explosion habe einen »Megatsunami« verursacht.
Eine achthundert Meter hohe Flutwelle.
Die sich mit fast tausend Stundenkilometern bewegte.
Kaputtes Make-up meinte, der Megatsunami habe auf seinem Weg zur amerikanischen Küste an Volumen zugelegt. Sie verstummte, die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. Blauer Anzug übernahm.
Um 4.43 Uhr Mountain Time hatte der Megatsunami die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht.
Boston, New York, Charleston, Miami.
Alle waren betroffen.
Die Zahl der Todesopfer war noch nicht abzusehen.
Ich saß reglos da. Vollständig betäubt.
Es war die schlimmste Naturkatastrophe seit Beginn der Aufzeichnungen.
Der heftigste Vulkanausbruch seit Beginn der Aufzeichnungen.
Der größte Tsunami seit Beginn der Aufzeichnungen.
Wieder wurden Bilder gezeigt.
Es war so schnell gegangen. CNN musste die Aufnahmen in Zeitlupe abspielen, damit man überhaupt etwas erkennen konnte.
Das Empire State Building, von der Straße aus gefilmt, und eine gewaltige Wolke, die sich Bild für Bild nähert. Nein, keine Wolke – eine Wasserwand. Dann erlosch das Bild.
Ein Strand, die Kamera blickt aufs Wasser. Aber da ist kein Wasser, sondern nur ein Boot, das eineinhalb Kilometer weit draußen auf dem trockenen Meeresgrund liegen geblieben ist. Eine Stimme betet zu Jesus. Das Bild bebt, bebt. Ein Donnern. Eine Welle erhebt sich, so hoch, dass das Minitab sie nicht einfangen kann. Und Dunkelheit.
Chloe befahl uns, aufs Kinderfernsehen umzuschalten. Wir ignorierten sie.
Kaputtes Make-up erklärte, die National Connectivity sei zusammengebrochen, weil sich drei der fünf Satellitenzentren an der Ostküste befunden hätten.
Blauer Anzug meinte, der Präsident habe den Notstand ausgerufen. Er befinde sich an einem sicheren, geheimen Ort.
Wir sahen schweigend zu.
Bis auf Chloe. »Ich will Tabi-Teens sehen«, quengelte sie. »Das ist langweilig!«
Ich musterte sie. Die Kleine hatte keine Ahnung von nichts. Sie pulte lustlos an einem Preisschild am Minitab-Regal.
Keiner der Kleinen schien kapiert zu haben, was geschehen war. Sie lungerten hinter uns rum und langweilten sich.
Aber ich konnte den Blick nicht vom Fernseher abwenden. Keine Zeit für die Kids.
Ich fühlte mich grau. Ausgewaschen. Wie ein Stein.
Kaputtes Make-up meinte, der Megatsunami habe zu extremen Wetterlagen im Rest des Landes geführt. Bei »Rest des Landes« stockte ihre Stimme. Sie sprach von überaus starken Stürmen, sogenannten Superzellen, die quer über die Rocky Mountains fegten (also über uns).
Ich warf einen Blick auf Josie. Sie starrte auf den Bildschirm. Caroline war auf ihren Schoß gekrochen, Josie streichelte ihr geistesabwesend den Kopf.
CNN zeigte weitere Aufnahmen von der Ostküste.
Ein Haus, das einen Berghang hinaufgespült worden war. Ein See voller Autos. Menschen, die halb nackt durch Straßen irrten, die früher sicher ausgesehen hatten wie alle anderen Straßen auch. Jetzt ähnelten sie der Kulisse eines Kriegsfilms.
Menschen in Booten. Weinende Menschen. Menschen, die durch Flüsse trieben wie Baumstämme, die zur Sägemühle transportiert wurden. Menschen, die irgendwo gestrandet waren, neben ihren Autos und Garagen, neben Bäumen, Mülltonnen, Fahrrädern und allem möglichen anderen Zeug. Menschen wie Treibholz.
Ich schloss die Augen.
Neben mir weinte jemand.
»Ich will Tabi-Teens sehen!«, nölte Chloe. »Oder wenigstens Traindawgs!«
Ich fasste nach der Hand meines Bruders. Sie war eiskalt.
Wir sahen stundenlang fern.
Irgendwann schaltete jemand den Fernseher aus.
Irgendwann holte jemand Schlafsäcke für alle.
Die Kleinen jammerten viel. Wir Großen hatten wenig Trost auf Lager.
Die Kleinen gingen uns auf die Nerven. Vor allem Chloe und Batiste.
Batiste sprach dauernd vom »Ende der Tage«.
Genau so habe Reverend Grand es vorausgesagt, meinte er. Der Jüngste Tag sei gekommen. Am liebsten hätte ich ihm die schmierige kleine Fresse poliert.
Eigentlich wollte ich nachdenken. Aber ich konnte nicht nachdenken, weil die Kleinen sich die ganze Zeit heulend an uns hängten und irgendwas haben wollten. Konnten die nicht endlich mal den Mund halten?