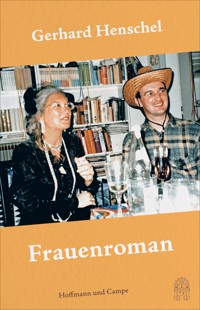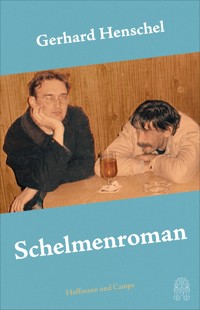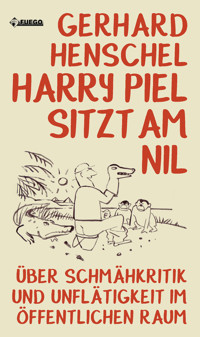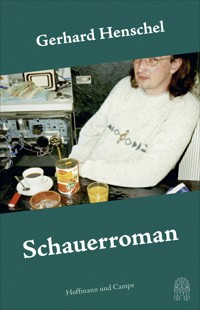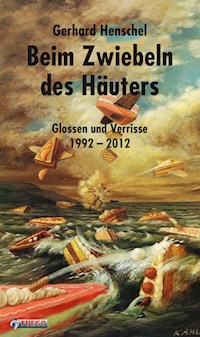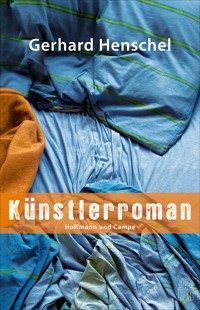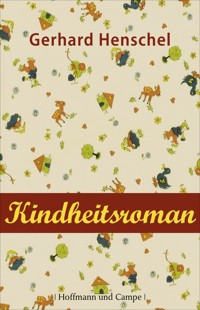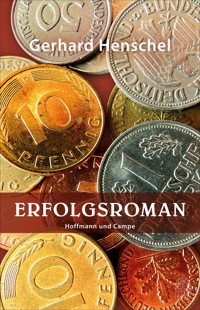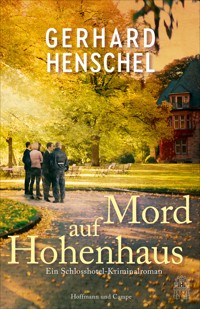
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Auf dem idyllischen Gelände des Schlosshotel Hohenhaus erlebt der Kongress der Dylanologen einen mörderischen Twist, als mit der Statue des Tambourine Man auch eine Leiche enthüllt wird. Nichts könnte schöner sein, als im luxuriösen Schlosshotel Hohenhaus an einer internationalen Dylanologen-Konferenz teilzunehmen. Das glaubt jedenfalls der Berliner Rechtsanwalt und Dylan-Verehrer Michael Ritz. Bis eine Leiche auftaucht, und er in Mordverdacht gerät. Glücklicherweise lernt er im Hotel einen hochbetagten schwedischen Meisterdetektiv kennen, und gemeinsam mit ihm und einer unwahrscheinlichen Ansammlung verbündeter Hotelgäste nimmt er die Ermittlungen auf. Doch er ahnt noch nichts von dem großen Komplott, das dahintersteckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gerhard Henschel
Mord auf Hohenhaus
Ein Schlosshotel-Kriminalroman
Mord auf Hohenhaus
1
The day that they killed him, someone said to me, »Son,
The age of the anti-Christ has just only begun.«
Bob Dylan, Murder Most Foul
Sanft strich der Abendwind durch die Blätter der Blutbuchen, die rings um das Schloßhotel Hohenhaus Wache standen. Aus dem Obsthain in dem Park, der das Hotel umgab, stiegen pflaumenblaue und apfelgrüne Gerüche auf, und in dem Seerosenteich unterhalb der Terrasse des Hotelrestaurants sah sich der Vollmond seine schwefelgelben Wasserfarben an.
Vergilbter Glanz von schönen Sommertagen! An diese Dichterworte dachte der Berliner Rechtsanwalt Michael Ritz, als er auf die Terrasse hinaustrat, um durchzuatmen und allen höheren Mächten, sofern sie existierten, seinen Dank abzustatten. Einer schreienden Schar wilder Gänse, die in Keilformation nach Süden flog, rief er hinterher: »Euch umsäuselt des holden Himmels fruchtende Fülle; euch kühlet des Mondes freundlicher Zauberhauch!«
Er fühlte sich eins mit dem Universum, denn er hatte sehr gut gegessen – einen Blattsalat mit Apfel-Vinaigrette, Bucheckern und gerösteten Brotwürfeln, eine Wildkraftbrühe, ein Kotelett vom Datteroder Wollschwein mit Rotkohlsalat und Kartoffelgratin und zum Abschluß einen Topfenknödel mit Nougatkern und Vanilleeis, begleitet von einem birnigen Grauburgunder –, und nun freute er sich auf den nächsten Tagesordnungspunkt: die feierliche Eröffnung einer internationalen Dylanologen-Konferenz in der Festscheune des Hotels.
Bob Dylan verfallen war Ritz schon ein halbes Jahrhundert zuvor, als ein Freund von ihm auf seinem Kinderzimmerplattenteller das Album »Blonde on Blonde« abgespielt hatte.
With your silhouette when the sunlight dims
Into your eyes where the moonlight swims
And your matchbook songs and your gypsy hymns
Who among them would try to impress you?
Unter »matchbook songs« und »gypsy hymns« hatte sich der zwölfjährige, in Köln aufgewachsene Ritz zwar nicht viel vorstellen können, aber er war sich sicher gewesen, daß er es gewagt hätte, die von Dylan besungene »sad-eyed lady of the lowlands« zum Altar zu führen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber eines Tages eben doch.
Zehn Jahre später, im Juni 1984, hatte er im Müngersdorfer Stadion in Köln zum erstenmal ein Konzert von Dylan besucht und wäre bei dem Song »Every Grain of Sand« fast niedergekniet.
There’s a dyin’ voice within me reaching out somewhere
Toiling in the danger and in the morals of despair …
Seither hatte Dylans Stimme ihn sein Leben lang begleitet, durch dick und dünn, von seiner Heimatstadt Köln bis zu seinem Wohnsitz in Berlin, wo er als Advokat auf den Gebieten des Zivilrechts, des Arbeitsrechts, des Sozialrechts und des Strafrechts tätig war. Die Menschen, die Dylans Stimme nicht leiden konnten, hatte er als jugendlicher Eiferer verachtet und sie barbarischer Ignoranz geziehen, bis ihm aufgegangen war, daß sie an einem schwerwiegenden Defizit litten: Anstatt unmittelbar vom Ohr ins Herz zu gelangen, nahm Dylans Stimme bei ihnen einen Umweg über den nichtsnutzigen Kopf und verhedderte sich dort in absurden Kontrollfiltern. Im Grunde fand Ritz solche Menschen bemitleidenswert. »Man hätt et, oder man hätt et nit«, hatte er sich irgendwann gesagt. Und: »Euch bleiben ja immer noch die Stimmen von Roger Whittaker, Roy Black und David Hasselhoff!«
Gesteigert wurde seine Daseinsfreude an diesem Abend von der Aussicht auf einen weiteren kulturellen Höhepunkt: Am nächsten Vormittag sollte in einem Veranstaltungssaal des Schloßhotels eine Tagung der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser beginnen. Auch an dem Schriftsteller Schmidt hatte Ritz einen Narren gefressen. In einem Bücherregal seiner Eltern war er Ende der siebziger Jahre zwischen allerlei Plunder auf Schmidts Erzählung »Die ler« und darin auf den Satz »der beinerne Mond gaffte aus seinem Hexenring« gestoßen.
Das hatte genügt, um Ritz süchtig zu machen. Für die brave Prosa der meisten deutschsprachigen Zeitgenossen Schmidts war er danach für immer verloren gewesen. Er hatte mehr oder weniger alles von Schmidt gelesen und war sogar einmal zu dessen Haus in Bargfeld in der Lüneburger Heide gepilgert, um Schmidts Bibliothek, Schmidts Schreibmaschine und die Einmachgläser aus Schmidts Nachlaß zu inspizieren.
Wann hat man schon mal die Möglichkeit, so fragte sich Ritz, zwischen einer Dylanologen-Konferenz und einer Schmidtianer-Tagung zu pendeln? Und noch dazu in einer so bezaubernden Umgebung? Er hatte sich dafür Urlaub genommen und war gespannt auf die Vorträge der renommierten Referenten, die eingeladen waren – unter anderem der Musikjournalist Greil Marcus, der Kulturtheoretiker Klaus Theweleit, die Übersetzer Gisbert Haefs und Friedhelm Rathjen, die Bob-Dylan-Biographen Willi Winkler und Clinton Heylin und der Arno-Schmidt-Biograph Sven Hanuschek …
Im warmen Golde flossen aus dem Zwielicht tausend Silberfäden in den Purpur um die Ranken wilder Reben, während Ritz zur Festscheune spazierte.
Ganz in Duft und Dämmerungen will die schöne Welt vergehen, sagte er sich und memorierte auch noch einige andere jahreszeittypische Verse.
The autumn leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold …
In der schummrigen Festscheune tummelten sich bereits zahlreiche Dylanologen. Hier und da glommen Heizpilze, und auf der Bühne rückten Roadies das Equipment für ein Konzert der Sängerin Cat Power zurecht, deren Album »Cat Power Sings Dylan« im Vorjahr in den deutschen Charts Platz 22 erreicht hatte.
Rechter Hand stand vorn eine überlebensgroße, vorläufig noch mit einem weißen Seidentuch verhüllte Bob-Dylan-Statue. Der deutsch-griechische Bildhauer Lysander Diamantopoulos hatte sie aus Naxos-Marmor geschaffen und auf eigene Kosten nach Deutschland einfliegen lassen. In Dylanologenkreisen war er nicht unumstritten, denn es ging das Gerücht um, daß er »Christmas in the Heart« für Dylans bestes Album halte. Mit Skepsis war auch ein Satz aufgenommen worden, den Diamantopoulos in einem Interview mit dem Londoner Journal Art Monthly verkündet hatte: Seine Skulptur von Dylan werde selbst Michelangelos David in den Schatten stellen.
Ritz setzte sich auf einen Klappstuhl in der letzten Reihe und schaute sich um. Die meisten Anwesenden schätzte er auf Ende fünfzig bis Mitte achtzig, doch es waren auch jüngere Leute zu sehen.
»Ever been to a Dylanologist conference before?« fragte ihn ein kahlköpfiger Herr, der neben ihm saß.
»No«, sagte Ritz. »Have you?«
»Not in my wildest dreams«, erwiderte der Herr. Aber sein Freund Steven Van Zandt habe ihm geraten, an dieser Konferenz teilzunehmen.
Ritz stockte der Atem. »Sie sind … ich meine … you’re a friend of Little Steven?«
»Sure! Isn’t he great?«
Das fand auch Ritz. Er wußte, was der Rockmusiker und Schauspieler Steven Van Zandt als Initiator des Projekts United Artists Against Apartheid geleistet und wie überzeugend er den Consigliere des Gangsters Tony Soprano gespielt hatte.
»I’m Michael Ritz«, sagte Ritz und gab dem Mann die Hand.
»Pleased to meet you. I’m Glenn Kirschner.«
Als die beiden näher ins Gespräch kamen, zeigte sich, daß sie in gewisser Weise Kollegen waren, denn Kirschner hatte drei Jahrzehnte lang als Staatsanwalt in Washington gearbeitet, und in seinem Podcast »Justice Matters« kommentierte er seit einigen Jahren heikle Rechtsfragen. Mit Ritz verstand er sich auf Anhieb. Neben der Liebe zur Musik teilte er mit ihm, wie sich rasch herausstellte, eine tiefe Abneigung gegen Donald Trump – »that hateful, prejudiced, racist, xenophobic, misogynistic, orange blowhard«, wie Kirschner sich ausdrückte –, und sie hätten darüber noch lange reden können, aber nun erschien Cat Power mit ihrer kleinen Band auf der Bühne und stimmte den ersten Song an: »She Belongs to Me«.
She’s got everything she needs, she’s an artist
She don’t look back …
»Don’t look back«, das sagte sich leicht, doch paradoxerweise fühlte sich Ritz durch dieses Lied sofort in seine Jugendzeit zurückversetzt … jene Tage der ersten Liebe … »Der Plattenspieler spielt nicht nur ab, er nimmt auch auf«, hatte Klaus Theweleit in seinem »Buch der Könige« geschrieben, und Ritz hätte das bestätigen können. Als er zum erstenmal den Song »She Belongs to Me« gehört hatte, war dem Plattenspieler gar nichts anderes übriggeblieben, als die Gefühlswelt des jungen Ritz aufzunehmen und sie für alle Zeiten zu speichern. Ein mächtiges Durcheinander war das gewesen, so wie ja wohl bei jedem jungen Mann, der etwas auf sich hielt. Aber waren deshalb alle Männer lebenslänglich »Drüsn=Sklawn«, wie Arno Schmidt behauptet hatte? Eröffnete sich aus dem biologischen Triebleben im Hinblick auf die Liebe nicht auch eine spirituelle Perspektive?
In Schmidts Erzählung »Enthymesis« war davon nicht die Rede. Da hieß es ganz brutal:
Kinder sehen noch schlank und am menschlichsten aus. Aber wenn sie erst einmal über 14–15 sind, dann fangen in ihren Leibern die entsetzlichen Drüsen an zu arbeiten; sie behaaren und bebarten sich, ihr Äußeres wird tierischer, und der Rest ihres Daseins bis ins hohe Alter ist nur noch ein unaufhörliches zähnefletschendes Brunstrasen.
Gar nicht wahr, dachte Ritz. Er wollte sich die Liebe nicht miesmachen lassen, nicht einmal von Schmidt. Im Zweifelsfall hielt er sich lieber an Dylan:
Love is all there is, it makes the world go ’round
Love and only love, it can’t be denied …
Ein rauschender Applaus weckte Ritz aus seiner Trance: Cat Power hatte ihr kurzes Set beendet und warf dem Publikum zum Abschied einen Handkuß zu.
»It was pretty impressive«, sagte Kirschner. »Don’t you think so?«
»Doch … ja, durchaus«, gab Ritz zur Antwort, obwohl er mit seinen Gedanken woanders gewesen war. Er straffte sich und richtete sein Augenmerk auf einen als Cowboy verkleideten Herrn, der auf die Bühne hüpfte und um einen kräftigen Beifall für Lysander Diamantopoulos bat.
Der sieht ja aus wie Rübezahl, dachte Ritz, als Diamantopoulos sich zu dem Cowboy gesellte, und das dachten möglicherweise auch andere Konferenzteilnehmer, denn Diamantopoulos trug eine recht wilde Haar- und Barttracht zur Schau.
Um Worte war er nicht verlegen. Seine Bob-Dylan-Skulptur, sagte er, habe einerseits einen »spezifischen Raumbezug« und sei andererseits »als materielle Abgrenzung von der ohnehin fragwürdigen Abbildfunktion« zu verstehen. »Als Bildhauer arbeite ich an der Balance zwischen Sinnlichkeit und Volumen. Das geometrische Formenvokabular ist für mich ein Crossover aus der figurativen Schwellenfunktion des einfachen Hinsehens und den darin visuell verwobenen Widerhaken an der Schnittstelle von Sockel und Vertikale …«
»Und was verbindet Sie persönlich mit Dylan?« fragte der Cowboy.
»Ich denke, daß Bob und ich die gleiche künstlerische Herangehensweise bevorzugen«, sagte Diamantopoulos. »So wie er sich die Folkmusik und den Rock’n’Roll anverwandelt hat, habe ich mir die Figurensprache meiner Vorgänger von der steinzeitlichen Kleinkunst bis zu den skulpturalen Werken der Postmoderne zu eigen gemacht. Bob und ich, wir sind beide wie Schwämme, die Vergangenes aufsaugen und es der Welt in neuer Form zurückgeben.«
»Haben Sie ihn mal kennengelernt?«
»Das nicht, aber mir scheint, daß wir Seelenverwandte sind. Und weil er selbst nie ein Purist gewesen ist, habe ich in den Marmor der Statue auch flüchtigere Werkstoffe eingearbeitet. Dadurch wird der erlebnishafte Gesamteindruck, wie ich glaube, noch plastischer akzentuiert.«
»Na schön«, rief der Cowboy. »Dann wollen wir mal!«
Er zog an einer Schnur, das Seidentuch glitt zu Boden, und ein Raunen ging durch die Scheune.
Bei der Gestaltung der Skulptur hatte Diamantopoulos sich offensichtlich an einem von Dylans Auftritten aus dem Jahr 1976 orientiert: Der marmorne, mit Latex, Mörtelgips und Preßspan beklebte Dylan hielt seine Gitarre so hoch erhoben, daß sein Mund sich gleich neben dem Schalloch befand.
Der Gitarrenhals ragte gen Himmel, und ganz oben, am Gitarrenkopf, klebte eine Leiche mit der Nase fest und baumelte herunter.
»Oh my gosh«, sagte Kirschner.
2
Pause. Offene Münder um den zischelnden Flammenchor.
Arno Schmidt, Kleine graue Maus
Nie zuvor waren so viele Ordnungshüter im Hotel Hohenhaus zusammengetroffen. Die Polizeistation Sontra hatte Verstärkung von der Polizeidirektion Werra-Meißner angefordert, auch die Polizeistationen Hessisch Lichtenau und Witzenhausen hatten sämtliche verfügbaren Beamten aus dem Feierabend geholt, und ein Helikopter mit Ermittlern aus dem Wiesbadener Landeskriminalamt setzte gerade zur Landung an.
Es war keine leichte Aufgabe, die Personalien aller Konferenzteilnehmer und aller Gäste des Hotels zu erfassen, während die Spuren in der Festscheune gesichert wurden und eine Heerschar von Journalisten anrückte. Ein Ü-Wagen nach dem anderen fuhr vor, und die Reporter ließen sich nur schwer wieder einfangen.
Michael Ritz hatte sich unterdessen mit seinem Laptop und einem Glas Dernauer Riesling auf einem Sessel vor dem Kamin im Foyer des Hotels niedergelassen und las die neuesten Nachrichten. Die Hessische/Niedersächsische Allgemeine berichtete unter der Überschrift »Leichenfund im Luxushotel«:
Eine makabre Überraschung für die Teilnehmer:innen der Dylanolog:innen-Konferenz im Fünf-Sterne-Hotel Hohenhaus bei Herleshausen: Bei der Enthüllung einer Statue der Pop-Ikone Bob Dylan kam eine daran festgeklebte Leiche zum Vorschein.
Die Polizei geht offenbar von einem Unfall aus. Auf dem Nachtschränkchen im Hotelzimmer des Toten sind zwei Bücher sichergestellt worden: der Roman »Richter in eigener Sache« von Ivan Klíma und das Sachbuch »Rettet die Wahrheit«, verfasst von dem Journalisten Claus Kleber. »Das sind ziemlich klare Indizien, die für ein Selbstverschulden sprechen«, sagt Hauptkommissar Dominik Schröter von der Polizeistation Sontra, der die Untersuchung leitet. »Allem Anschein nach haben wir hier einen Klimakleber vor uns, der versehentlich erstickt ist, als er versucht hat, seine Nase an die Skulptur zu leimen. Aber wir ermitteln natürlich in alle Richtungen.«
Der Name des Toten ist Tom Roglowski. Er sollte am nächsten Vormittag bei einer literaturwissenschaftlichen Tagung im Relais & Châteaux Hohenhaus einen Vortrag über die aus der Feder des Schriftstellers Arno Schmidt stammende Erzählung »Seelandschaft mit Pocahontas« halten.
Roglowski (39) hatte eine Stelle als Professor im Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Paderborn inne. Zur Stunde ist noch ungeklärt, ob er Kontakte zur Szene der Klimakleber:innen gehabt hat. Diese Frage wird laut Kommissar Schröter »zeitnah geprüft«.
In Fachkreisen bekannt wurde Roglowski 2018 mit seiner Studie
»Religionskritische Motive in den Werken Gottfried Kellers«. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder im Alter von elf und sechs Jahren. Über seinen Todeszeitpunkt herrscht zur Zeit noch Unklarheit.
Darunter stand:
Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina-Rosa Bärlach sorgfältig überprüft.
Nicht sorgfältig genug, dachte Ritz, denn Arno Schmidt hatte die Erzählung »Seelandschaft mit Pocahontas« keineswegs mit einem Füllfederhalter oder gar mit einem Federkiel geschrieben …
Schräg gegenüber nahmen zwei ältere Personen etwas umständlich auf dem großen Sofa vor dem Kamin Platz: ein hochgewachsener Herr mit einem schütteren weißen Haarkranz und eine grazile Dame, die in der linken Hand eine in Silber eingefaßte Lorgnette mit Perlmuttgriff hielt.
»Ist der Weißwein gut, den du da trinkst?« fragte die Dame.
Es wunderte Ritz nur kurz, daß sie ihn nicht siezte, denn er hörte aus ihrer Stimme einen schwedischen Akzent heraus, und er wußte, daß Schweden auch Fremde ohne weiteres duzten. »Laut dem Erzeuger besitzt dieser Wein eine zartgliedrige Säurestruktur und eine feine Zitrusaromatik, und das würde ich jederzeit unterschreiben«, sagte er. »Wenn ihr das mögt, kann ich euch diesen Riesling nur wärmstens ans Herz legen!«
Als ob er es geahnt hätte, schwebte im selben Moment der Hoteldirektor Peter Niemann mit einer Flasche Dernauer Riesling und zwei weiteren Gläsern herbei. Er schenkte ein, und Ritz stieß mit den beiden Schweden an.
Er heiße Kalle, sagte der Mann. »Kalle Blomkvist. Und dies ist meine liebe Frau Eva-Lotta!«
»Angenehm«, sagte Ritz. »Ich heiße Michael!«
Nette Leute, dachte er, und sie erzählten ihm manches aus ihrem Leben. Von Januar 1955 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand hatte Kalle Blomkvist in Bonn als Korrespondent der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter gearbeitet, und von seiner Frau Eva-Lotta war ihm zum neunzigsten Geburtstag eine Rundreise durch Deutschlands beste Hotels geschenkt worden.
»Der Geburtstag liegt schon ein bißchen zurück«, sagte Eva-Lotta. »Wir sind aber noch längst nicht durch mit unserer Tournee …«
Auch Glenn Kirschner ließ sich jetzt in einen der Sessel vor dem Kamin sinken. Den Vorschlag, ein Glas Weißwein zu trinken, wies er jedoch zurück. »I’m a beer guy«, sagte er und wurde flugs mit einem Krug Eschweger Klosterbräu versorgt.
Was könnte es Schöneres geben, fragte sich Ritz, als an einem späten Herbstabend in einer Runde munterer neuer Freunde vor einem flimmernden Kaminfeuer zu sitzen?
Im Wintergarten hinter dem Kamin setzte sich nun der Hotelgast Christian Bruhn an den Flügel und beglückte alle mit einem Potpourri aus Melodien alter Schlager: »Schöne Isabella aus Kastilien«, »Die Liebe ist ein seltsames Spiel«, »Das machen nur die Beine von Dolores«, »In der Bar zum Krokodil« …
Dann wurde die Musik von einem gewaltigen Röhren übertönt.
Klingt nach einem Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114, dachte Ritz, und er hatte recht: Mit einem Motor ebendieser Baureihe war die Harley-Davidson Tri Glide Ultra ausgestattet, von der jetzt vor dem Hoteleingang eine athletische Mittfünfzigerin herunterstieg. Sie nahm ihren Helm ab und befreite einen knapp sechzig Kilo schweren Rottweiler aus dem Hundeseitenwagen.
Nach ihrer Spritztour durch den Nationalpark Hainich wollte sie gern vor dem Kamin die Beine ausstrecken, sich gepflegt unterhalten und dabei einen Single Malt Whisky zu sich nehmen. Peter Niemann empfahl ihr einen achtzehn Jahre alten Lagavulin mit Aromen von Torfrauch, Seetang, Eichentönen, likörgetränkten Rosinen und kandierten Kastanien, und darauf ließ sie sich gern ein.
Von ihrem Rottweiler hielten die meisten Menschen sich gewöhnlich so fern wie nur möglich, aber Kirschner kraulte ihm furchtlos den Nacken, und der Rottweiler schnurrte wie ein Kätzchen.
»What’s his name?« fragte Kirschner die Herrin des Hundes, die in den Sessel neben ihm gesunken war.
»Fitz«, sagte sie. »And you are …?«
»Glenn.«
»Nice to meet you. I’m Jane.«
Während Kirschner den verzückt winselnden Rottweiler knuddelte und ihm versicherte, daß er ein Prachtkerl und ein guter Junge sei, stellte die Herrin sich auch den anderen vor: Sie heiße Jane Penhaligon, habe eine Zeitlang als Detective Sergeant in Manchester für Recht und Ordnung gesorgt und mit Ende dreißig den Fehler begangen, sich in einen Hamburger Staatsanwalt zu verlieben und ihn zu heiraten. »Mittlerweile sind wir geschieden, aber ich bin ihm nicht böse …«
»Er scheint Ihnen auf meisterliche Weise die deutsche Sprache beigebracht zu haben«, sagte Ritz.
»Das mußte er nicht. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter stammt aus Dortmund. Dank ihr kann ich auch viele deutsche Gedichte aufsagen. Zum Beispiel dies von F.W. Bernstein: ›Horch – ein Schrank geht durch die Nacht, / voll mit nassen Hemden … / den hab ich mir ausgedacht, / um Euch zu befremden.‹«
Kirschner fragte, was es da zu lachen gebe, und Ritz konnte ihm mit einer Übersetzung des Gedichts ins Englische dienen. »Die ist von Harry Rowohlt«, sagte er, »und sie geht so: ›Hark! A closet walks by night / Full of shirts so wet. / Did I invent it? Thought you might / Be displeased? You bet!«
Christian Bruhn war inzwischen zu einem düsterer gefärbten Oldie übergegangen und sang leise dessen Text: »Kriminal-Tango in der Taverne / Dunkle Gestalten, rote Laterne / Abend für Abend lodert die Lunte / Brühende Spannung liegt in der Luft …«
»Was sagt ihr denn zu diesem sonderbaren Todesfall?« fragte Kalle Blomkvist. »Ich kann mir nicht recht vorstellen, daß der Mann sich selbst mit der Nase an die Gitarre geklebt hat. Da steckt doch mehr dahinter!«
»Mein Mann hat schon immer eine gute Witterung für verdächtige Vorkommnisse gehabt«, sagte Eva-Lotta, »und ich glaube, daß er auch diesmal recht haben könnte. Müssen wir hier nicht einen Mord in Betracht ziehen?«
Das solle man am besten bei jedem Todesfall tun, sagte Penhaligon. »Weiß man bereits Näheres über den Toten?«
»Es handelt sich um einen Germanisten, der hier morgen vormittag einen Vortrag über Arno Schmidts Erzählung ›Seelandschaft mit Pocahontas‹ halten sollte«, sagte Ritz, und da er nach dieser Auskunft in vier fragende Gesichter blickte, holte er ein wenig aus: »Schmidt war ein deutscher Schriftsteller, der sprachlich etwas experimentierfreudiger gewesen ist als seine Kollegen. Er hat sich auch gern mit der Kirche und der von Adenauer geführten Regierung angelegt, denn die christlich-abendländische Moral ist Schmidt zuwider gewesen. In seiner Erzählung ›Seelandschaft mit Pocahontas‹ reisen ein Schriftsteller und ein Malermeister zum Dümmer See, lachen sich zwei Urlaubsfreundinnen an, gehen mit ihnen paddeln, schwimmen und spazieren, plaudern über Gott und die Welt, vergnügen sich paarweise und gehen wieder ander, und das hat damals schon gereicht, um die Staatsanwälte auf den Plan zu rufen …«
Die Erzählung, berichtete Ritz, sei im Januar 1955 in der schöngeistigen, von Schmidts Freund Alfred Andersch herausgegebenen Zeitschrift Texte und Zeichen erschienen. Bald darauf habe der Literaturkritiker Karl Korn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kundgetan, hier werde »stilistische Subtilität und Gescheitheit an eine dumme, geile und also provinzielle Affaire verwandt«, in der es »unter fadenscheinigen Vorwänden auf nichts weiter als aufs Rammeln ankommt«, und Ende Februar 1955 habe Andersch in einem Brief an Schmidt vermerkt, daß einige christliche Buchhändler im Rheinland über die Erzählung »aus dem Häuschen geraten« seien und dem Verleger der Zeitschrift einen Boykott angedroht hätten. Anfang April 1955 sei Schmidt dann in der katholischen Wochenzeitung Echo der Zeit ausdrücklich »Blasphemie« vorgeworfen worden. »In diesem Artikel hieß es, daß der Tatbestand der Verletzung religiöser Gefühle auch juristisch gegeben sei …«
»Was hat dieser Schmidt denn da so Schlimmes geschrieben?« fragte Penhaligon.
»Eigentlich nichts, was heute noch jemanden groß aufregen würde«, sagte Ritz. »Der Erzähler erklärt da, daß er Atheist sei, so wie ›jeder anständige Mensch‹, und von einer anderen Figur wird das christliche Abendmahl als ›Blutfresserei‹ qualifiziert. Jedenfalls hat dann ein gewisser Dr. jur. Karl Panzer aus Köln-Dellbrück beim Landgericht Berlin eine Strafanzeige gegen den Verleger Eduard Reifferscheid, den Herausgeber Alfred Andersch und den Autor Arno Schmidt erstattet, und zwar wegen Religionsbeschimpfung, Gotteslästerung und Pornographie. Dieser Herr Panzer war ein Justitiar im Kölner Generalvikariat, und er nahm beispielsweise Anstoß daran, daß der Ich-Erzähler die Bibel als ein unordentliches Buch mit fünfzigtausend Textvarianten bezeichnet, dessen Einfluß sich skrupelloser Propaganda und gemeinstem äußerlichem Zwang verdanke, und daß er die Meinung vertritt, ein Gott, ohne dessen Willen kein Sperling vom Dach falle oder Millionen Menschen im KZ vergast würden, müsse schon eine ›merkwürdige Type‹ sein – ›wenn’s ihn jetzt gäbe!‹«
»Aber das fragt sich doch jedes Kind«, sagte Eva-Lotta. »Wenn der liebe Gott gütig und allmächtig ist, weshalb hat er dann Adolf Hitler zwölf Jahre lang gewähren lassen?«
»Die Diskussion über diese Fragen wollte die katholische Kirche in der jungen Bundesrepublik unterbinden«, sagte Ritz und nahm einen großen Schluck Wein, um sich noch besser in Fahrt zu bringen. »In Schmidts Erzählung wird auch eine Nonne erwähnt, die mit ihren ›Ausflugsmädchen‹ von irgendeinem ›heiligen Weekend‹ komme – ›Gestalten‹, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, ›mit wächsernem queren Jesusblick‹ –, und an einer Stelle heißt es über das ›bigotte Rheinland‹, daß es selbst der Wind eiliger habe, wenn er durch Köln komme. Aus der Sicht des katholischen Rechtsanwalts Karl Panzer war damit der Straftatbestand der Religionsbeschimpfung erfüllt.«
»Und worauf hat der Vorwurf der Pornographie abgezielt?« fragte Penhaligon. »Wird in dieser Erzählung auch geschweinigelt?«
»Wie man’s nimmt«, sagte Ritz. »Es kommen darin Sätze vor wie ›Wir ritten sausend aufeinander davon‹ und ›Ich küßte auch in den konkaven Mirabellenbauch‹. Wenn man sich extrem viel Mühe gibt, kann man daraus natürlich etwas Pornographisches heraushören …«
An dieser Stelle unterbrach Kirschner die Diskussion. Er verstehe leider nur die Hälfte oder noch weniger, sagte er, denn er habe nur rudimentäre Deutschkenntnisse, und er würde sich freuen, wenn jemand für ihn den Satz »Ich küßte auch in den konkaven Mirabellenbauch« übersetzen könne.
»I also kissed in the concave mirabelle plum belly«, sagte Penhaligon.
»Oh, I see«, sagte Kirschner. »A rather fancy expression. Please go on!«
Peter Niemann legte Kaminscheite nach, die Funken sprühten, es wurde reihum neu eingeschenkt, und aus dem Wintergarten wehten die Klänge des Evergreens »Hinter den Kulissen von Paris« ins Foyer.
Als pornographisch sei auch der Satz »Das höllenfarbene Mädchen bog den schlanken Stielleib hinüber« angeprangert worden, sagte Ritz, und Penhaligon lieferte für Kirschner die Übersetzung: »The hell-coloured girl bent over the slender stem of her body.«
»Der nächste Satz, den ich zitieren möchte, weil er als pornographisch gedeutet wurde, ist aber leider fast unübersetzbar«, sagte Ritz. »Er lautet: ›Ringelblumen machten Luchsaugen durch Zäune, zuerst nur zwei, dann standen sie förmlich Spalier vor Neugierde, eine steckte sofort den Kopf unter Selmas Rock, daß ich entrüstet pustete: das überlaß ma in Zukunft gefälligst mir, lieber Luteolus!‹«
»No problem«, sagte Penhaligon. »Listen, Glenn. The author Schmidt wrote: ›Marigolds made lynx eyes through fences, at first only two, then they literally stood in a trellis of curiosity, one immediately stuck its head under Selma’s skirt, so that I blew indignantly: leave that to me in future, dear Luteolus!«
»I understand«, sagte Kirschner. »But who is Luteolus?«
Das führe jetzt etwas zu weit, sagte Ritz. »Ich würde lieber noch ausführen, wie es in dieser Strafsache weitergegangen ist. Im April 1955 hat in diesem Fall auch der Kölner Rechtsanwalt Paul Weimann Strafanzeige erstattet, wegen Gotteslästerung und der Verbreitung unzüchtiger Schriften, und um die Frage nach der Kunstfreiheit zu umgehen, hat er die Erzählung nicht als Erzählung charakterisiert, sondern als ›Pamphlet‹. Mit diesem Trick hat sich auch der Anwalt Panzer beholfen. Und es hat sich erst viele Jahre später herausgestellt, daß diese beiden Anzeigen von dem Prälaten Wilhelm Böhler im Erzbistum Köln angeregt worden waren …«
»Ach nein!« rief Kalle Blomkvist. »Meinst du den Böhler, der zu den Gründern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gehört hat?«
»Ja, genau den! Wieso?«
»Na, weil der in den fünfziger Jahren Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um in dem Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau die Vorrangstellung des Mannes festschreiben zu lassen, weil das seiner Ansicht nach der naturgegebenen hierarchischen Ordnung von Ehe und Familie entsprochen hätte. Sein Antrag ist jedoch mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen abgelehnt worden. Und zwar nur, weil ein paar katholische Abgeordnete bei der Abstimmung gefehlt haben. Für Böhler ist das ein ganz schwerer Schlag gewesen …«
»Bist du ihm mal begegnet?« fragte Ritz.
»Leider nicht. Ich hätte ihn gern interviewt, aber im Erzbistum Köln hast du da als kleiner schwedischer Journalist keine Chance gehabt. Im selben Jahr hat übrigens der Bundesjustizminister Fritz Neumayer eine Kommission damit betraut, das Strafgesetzbuch zu überarbeiten, und unser Freund Böhler hat ihr ein Gutachten des Katholischen Arbeitskreises für Strafrechtsreform vorgelegt, um die Liberalisierung des Strafrechts für Homosexuelle zu verhindern.
»Hätte dann für Homos nicht die Todesstrafe durch Verbrennung wieder eingeführt werden müssen?« fragte Penhaligon. »So wie im Mittelalter?«
Der Feuertod für Sodomiten sei sogar noch bis ins späte 18. Jahrhundert üblich gewesen, sagte Ritz, aber in der »Constitutio Criminalis Theresiana« von 1768 sei dann immerhin festgelegt worden, daß sie vor ihrer Verbrennung geköpft werden dürften.
»Und was ist aus den Strafanzeigen geworden?« fragte Eva-Lotta.
Ritz rief sich zur Ordnung. »Richtig! Darauf bin ich ja noch gar nicht eingegangen. Also, Arno Schmidt und seine Frau Alice haben damals in dem rheinland-pfälzischen Örtchen Kastel über der Saar gewohnt, und im August 1955 ist er im Amtsgericht Saarburg vernommen worden. Er hat gesagt, daß es einem Schriftsteller gestattet sein müsse, das Leben realistisch abzubilden, und der Oberamtsrichter Heinz Kemper hat erklärt, daß er Schmidts Erzählung als Katholik für ›Schmutz und Schund‹ halte. Dabei ist auch das Problem der Jugendgefährdung zur Sprache gekommen. Schmidt hat gesagt, daß seine Erzählung wegen ihrer komplexen Sprache Jugendlichen überhaupt nicht zugänglich sei, worauf der Oberamtsrichter Kemper erwidert hat, das mache es ja gerade so gefährlich, daß in dieser hochgezüchteten Sprache so viel verborgen sei …«
»But what about the mirabelle plum belly?« fragte Kirschner. »Has Schmidt also been questioned about that?«
»In der Tat«, sagte Ritz. »Der Oberamtsrichter hat genau wissen wollen, was das Wort ›Mirabellenbauch‹ bedeute, und Schmidt hat gesagt, daß das Mädchen mit dem Mirabellenbauch nun mal zwei Pfund Mirabellen verspeist habe. Man spreche ja auch von einem Bierbauch.«
Wie es der Zufall wollte, spielte Bruhn in diesem Augenblick den Oldie »Ausgerechnet Bananen«. Im Kamin schuhplattlerten die Flammen, der Rottweiler Fitz streckte gähnend alle viere von sich, und Penhaligon orderte den zweiten Lagavulin.
Das sei aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, sagte Ritz. »Arno Schmidts Biograph Sven Hanuschek hat recherchiert, daß der Oberamtsrichter Heinz Kemper von 1943 bis zum Kriegsende als beisitzender Richter an einem NS-Sondergericht an zwei Todesurteilen wegen Diebstahls und Plünderung beteiligt war.«
»Na bitte!« rief Penhaligon. »Das dürfte dann ja gerade der richtige Jurist gewesen sein, der darüber zu befinden hatte, ob das Wort ›Mirabellenbauch‹ pornographisch ist!«
»Ebendeswegen hat Alfred Andersch den Schmidts dazu geraten, ins liberalere Darmstadt umzuziehen«, sagte Ritz. »Das haben sie dann auch getan, und im März 1956