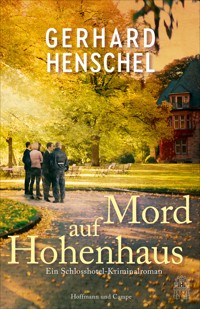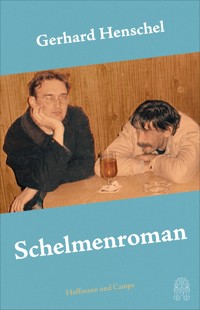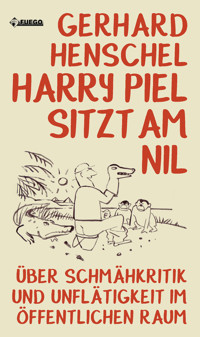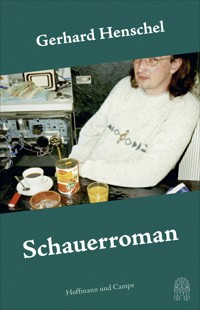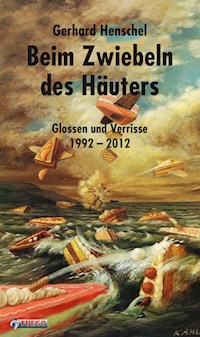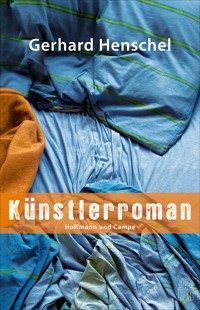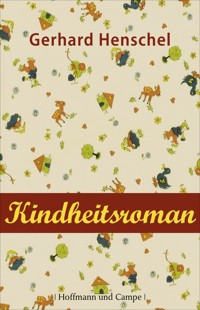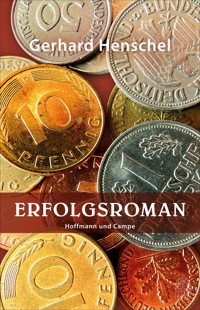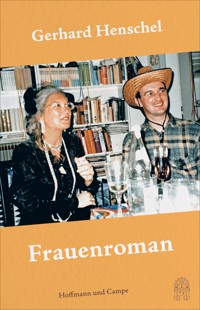
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
"Besonders lang schien es keine Frau mit mir auszuhalten. Aber ich wollte ja auch nicht heiraten." Mitte der neunziger Jahre: Der Schriftsteller Martin Schlosser wohnt im schönen Göttingen und kann nicht klagen. Er ist ausgesprochen erfolgreich – beruflich wie privat. Die Frauen sind gut zu ihm, die Arbeit geht ihm leicht von der Hand. Lesereisen führen ihn quer durch die Bundesrepublik, aber auch nach Zürich, Wien und New York, wo er sein blaues Wunder erlebt. Wäre da nicht dieses Thema, das die Nation in Atem hält: die Rechtsschreibreform. Sternhagelvoll müssen die Kultusminister doch gewesen sein, die diesen Blödsinn verbrochen haben. Eifrig kämpft er gegen die Reformisten an und durchlebt eine turbulente Zeit als Junggeselle, bis er beschließt nach Hamburg zu ziehen und dort die Mutter seiner Kinder zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gerhard Henschel
Frauenroman
Roman
Frauenroman
Aus mir unbekannten Gründen war die Bebelstraße aufgebaggert worden, und damit es in meinem Göttinger Stadtteil auch am Wochenende Rabatz gab, hatte man die Groner Kirmes eröffnet. Bis in die Puppen scholl die Stimme eines Einpeitschers herüber, der immer wieder brüllte: »Loooooooopiiiiiiiiiing!«
Guter Mond, du gehst so stille
In den Abendwolken hin …
Dann rief Renate an: Sie sei mit Nantje in Hannover zu Besuch bei Dagmar. »Und Nantje will hier morgen gern mit dir auf den Flohmarkt gehen! Kannst du das einrichten?«
Der Wunsch meiner Patentochter Nantje war mir Befehl.
Für Eckhard Henscheids, Brigitte Kronauers und meine »Kulturgeschichte der Mißverständnisse« schrieb ich vorher noch ein kurzes Kapitel über die Wirrnisse bei der Erforschung der Folgen der Masturbation. Jedem »Lüstling«, der sich selbst beflecke, standen nach Angaben des Großen Brockhaus aus dem Jahr 1832 schwere Zeiten bevor:
Sein Haar wird struppig, trocken, fällt am Kopfe aus. Seine Nase glänzt, wie überfirnißt, seine Hohlhand schwitzt immer und riecht, gleich seinem fast stets kalten Hautschweiße, säuerlich, wie der von Säuglingen. Die Arme hängen an ihm schlaff herab, Schenkel und Waden schlottern.
Aber wie hätten Kopfhaare feststellen sollen, ob der Samenerguß des Mannes, auf dem sie wuchsen, in seine Hohlhand oder in eine Vagina erfolgt war? Hatte sich das seinerzeit niemand gefragt?
Mich erinnerte das an manche Texte von Ror Wolf, der einmal geschrieben hatte:
Von den Zuständen der Kopfkissen wollen wir gar nicht erst reden.
In einem taz-Interview sprach der scheidende FAZ-Literaturchef Gustav Seibt, der zur Berliner Zeitung wechselte, über ein unlösbares Problem, das seine Macht als Redakteur ihm eingetragen hatte:
Die Äußerungen werden strategisch gelesen, auch wenn man versucht, sich nicht strategisch zu verhalten. Insofern ist es unmöglich, sich nicht strategisch zu verhalten.
Mir hätte es den Schlaf geraubt, wenn ich dazu gezwungen gewesen wäre, bei der Beurteilung von Büchern jederzeit an literaturbetriebsstrategische Fragen zu denken.
In Hannover gab es am späten Samstagvormittag bei Dagmar Ostfriesentee und Jeversche Leidenschaften, und Renate erzählte, daß Onkel Walter und Tante Mechthild zur Zeit eine Moorkur in Tschechien machten.
So wuchs Europa zusammen. Von einer Moorkur in Tschechien hätten bundesrepublikanische Rentner vor dem Zusammenbruch des Ostblocks nur träumen können.
Auf dem Flohmarkt kaufte ich Nantje ein Eis, ein Brettspiel und drei Schlümpfe, und für mich selbst ergatterte ich zwei Bob-Dylan-Bootleg-CDs.
»Ist es nicht wunderbar, daß dieser Mann noch immer von so vielen Menschen geliebt wird?« fragte mich der Verkäufer. »Seit mehr als fünfunddreißig Jahren steht der jetzt schon am Mikro, und die Leute verehren ihn bis heute …«
Vorm Hauptbahnhof übergab ich Nantje an Renate, kaufte mir ein paar Zeitungen und fuhr wieder heim.
Die Rechtschreibreform sei »bankrott«, stellte der Germanist Theodor Ickler in der FAZ fest.
Nur wenigen Zeitgenossen fiel der Widerspruch auf, der zwischen der groß herausgestellten Geringfügigkeit der Änderungen und der Behauptung bestand, die Reform sei längst überfällig und dürfe keinesfalls scheitern. Sehr geschickt wurde auch die Vorstellung von einem Zeitdruck suggeriert, unter dem man stehe.
Die Öffentlichkeit sei zu keinem Zeitpunkt über den vollen Umfang der Reform unterrichtet worden, bevor die jeweiligen Beschlüsse gefaßt worden seien, schrieb Ickler. Und jetzt gehe es plötzlich ums Geld:
Paradox genug: Die Reform sollte »kostenneutral« sein, aber am Ende erwiesen sich die bereits verursachten Kosten als letztes Argument dafür, die Reform doch noch durchzusetzen. »Nicht mehr zu stoppen!« hieß es mit gespielter Schicksalsergebenheit aus den verantwortlichen Kultusbürokratien.
Und dabei war diese Reform vollkommen unnötig gewesen. Sie hatte nur für Konfusion gesorgt.
Henri Nannen war gestorben, der ehemalige Stern-Herausgeber, dessen kerniges Porträt im Editorial ich in meiner Kindheit häufig erblickt hatte.
Wieder einer weniger von der alten Garde.
In einem »Grundsatzpapier« bejammerte die Führung der Kommunistischen Partei Chinas, daß die Geldverherrlichung, die Suche nach Vergnügen und der Individualismus in ihrem Lande zugenommen hätten.
Ich hatte China zwar noch nie bereist, aber infolge der 47jährigen Terrorherrschaft der Kommunisten stellte ich mir die Suche nach Vergnügen dort ungemein schwierig vor. Da hätte sich das Politbüro der KPCh eigentlich keine großen Sorgen machen müssen.
In meiner Lieblingsserie Für alle Fälle Fitz hatte die schöne Polizistin Jane Penhaligon ihren Kollegen Jimmy Beck zuletzt umbringen wollen, weil sie ihn verdächtigte, sie vergewaltigt zu haben, und nun fing die neue Folge damit an, daß seither Monate vergangen waren.
Beck lebte noch – er war in psychiatrischer Behandlung gewesen und trat seinen Dienst gerade wieder an –, und der dicke, kettenrauchende, versoffene und spielsüchtige Kriminalpsychologe Fitz, der in einem Mordfall hinzugezogen wurde, sah, daß seine Frau Judith und Penhaligon sich auf dem Polizeirevier stritten. Nachdem er von seiner Frau sitzengelassen worden war, hatte er sich auf eine Affäre mit Penhaligon eingelassen, vor ihrer Vergewaltigung, aber inzwischen war Judith zu ihm zurückgekehrt, schwanger, mit einem von ihm gezeugten Kind. Zu Penhaligon sagte sie kalt: »Kann ich jetzt den Rest meines Mannes kriegen, nachdem Sie mit ihm fertig sind?«
»Ja«, sagte Penhaligon ebenso kalt.
»Sind Sie mit ihm fertig? Ist es vorbei?«
»Warum fragen Sie nicht Fitz?«
»Ich frage Sie!«
»Sie denken wohl, Sie hätten jetzt alle Trümpfe in der Hand. Die treue, schwangere Gattin und die böswillige Ehebrecherin. Das ist doch alles Blödsinn, Judith. Sie waren gar nicht mehr da. Sie waren ausgezogen! Wir wußten nicht, daß Sie schwanger sind! Wir haben uns absolut nichts vorzuwerfen.«
Und wieder Judith, streng: »Ist es vorbei?«
»Ja«, erwiderte Penhaligon. »Mein Interesse galt ohnehin nur seinem Körper.«
Es ließ mich erschaudern, was Judith darauf zu ihr sagte: »Ich bin selbst erstaunt, so etwas von mir zu hören. Aber es gibt so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Ich meine Ihre Vergewaltigung.«
Fitz hörte davon nichts. Er sah nur, daß Penhaligon und seine Frau miteinander sprachen.
Für die taz schrieb ich einen Artikel, in dem ich log, daß der FC Bayern München im Erdinger Moos eine Stierkampfarena errichten wolle.
In einem Kooperationsabkommen mit der Sielmann-Stiftung wurde vereinbart, daß zwei Prozent der Einnahmen Organisationen zugeführt werden sollen, die dem Tierschutzgedanken nahestehen. Außerdem sollen in den Kämpfen ausschließlich genetisch veränderte Stiere Verwendung finden, deren Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden, deutlich unterhalb der zugelassenen EU-Normen liegt …
Ich glaubte zwar nicht, daß jemand darauf hereinfiel, aber ich erhoffte mir ein Dementi des FC Bayern.
Ein Kärtchen von Nantje:
Hallo Martin! Ich hab am Samstag ganz vergessen dir zu sagen, dass mir im Kölner Zoo ein Affe auf den Kopf gepinkelt hat. Heute war ich im Hannover-Zoo, da ist mir sowas nicht passiert.
Ich bedanke mich sehr für die Schlümpfe und das Spiel. Renate hat sich die Schlümpfe angeguckt und gesagt: »Bah, was haben die denn für Knödel am Hintern?«
Nantje mußte in der Schule bereits eingetrichtert worden sein, daß man »daß« jetzt mit »ss« schreiben müsse.
Weil meine alte Tastatur nichts mehr taugte, kaufte ich mir eine neue.
Ob die Federkiele der Goethezeit wohl länger gehalten hatten als die Tastaturen des ausgehenden 20. Jahrhunderts?
Der Spiegel widmete der Rechtschreibreform eine Titelgeschichte und versicherte seinen Lesern, daß er der neuen Rechtschreibung nicht folgen werde:
Er wird die Reform ignorieren, es bleibt beim gewohnten Deutsch.
An die 300 Millionen Mark, hieß es, werde die Reform die Schulbuchverleger allein die Korrektur der 30000 Schulbuchtitel kosten.
»Verantwortungslos« nennt Michael Klett die Aktion, die ein »Dienstleister« wie sein Verlag »leider« nicht umgehen könne. Auch der Lexikon-Konzern Langenscheidt muß fünf bis zehn Millionen Mark investieren, um rund 3500 Titel überarbeiten zu lassen.
Und Walter Kempowski sagte in einem Spiegel-Interview:
Wer hat überhaupt diese Reform beschlossen? Ich hab’ den Eindruck, das ist so ein Professoren-Mulm, beschlossen von praxisfernen Gestalten, die nicht wissen, wo der Kellerschlüssel liegt, aber klug daherquasseln.
Genauso war’s.
Auf einer der Bootleg-CDs sangen Bob Dylan und Joan Baez gemeinsam den Song »Troubled And I Don’t Know Why«. Eine Aufnahme aus dem August 1963. Wenn sie solo sang, konnte ich Joan Baez nicht gut ertragen, aber im Duett mit Dylan wurde ihr allzu reiner Sopran auf einmal erträglich.
Mit Kathrin Passig hatte ich auf der Buchmesse darüber gescherzt, daß wir doch einmal unter dem Pseudonym einer unehelichen Tochter Che Guevaras eine lateinamerikanische Familiensaga verfassen könnten, und nun schickte ich Kathrin den Plot, den ich mir ausgedacht hatte:
Maria, ein Waisenkind, leckere 16 Jahre alt, lebt in irgendeinem mittelamerikanischen Slum und hat das zweite Gesicht, Erinnerungen an ein früheres Leben in einer Maya-Dynastie. Ein Maya-Forscher aus Europa stößt zufällig auf Maria, die in der Lage ist, Maya-Hieroglyphen auf uralten Tonscherben zu entziffern. Der Forscher, eine miese Brillenschlange, kauft sich Maria und beutet ihr Wissen bei seinen Forschungen im Urwald aus.
Dann werden die beiden von Guerilleros gefangengenommen. Deren Anführer, Felipe, ist der Sohn eines der reichsten Stahlmagnaten des Landes und aus der Art geschlagen: Ödipuskonflikt, Schauspielstudium, Kontakt zu radikalen Gruppen, Untergrund, Guerillakrieg. Maria und Felipe verknallen sich furchtbar ineinander und machen Liebe, bis es Schmetterlinge regnet. Maria erinnert sich dunkel daran, daß sie mit Felipe (oder wie wir den Idioten nennen) auch schon in der Maya-Zeit liiert war, eine Geschichte, die tragisch ausging. Felipe war Maya-Priester, Maria seine Geliebte, und er mußte sie opfern …
Und so weiter. Stilistisch, schrieb ich, sollten wir uns dabei an Isabel Allendes Roman »Eva Luna« orientieren, in dem Sätze wie diese standen:
Sie liebkoste sich mit dem Seiflappen und lächelte, stolz auf die Fülle ihres Fleisches. Ihr Gang war voll herausfordernder Anmut, sehr aufrecht, dem Rhythmus einer geheimen Musik folgend, die sie in sich trug.
Das hätten wir leicht fortspinnen können:
Sie reinigte ihr blühendes Fleisch mit der Brotbaumwurzelbürste und sang den Gesang der Götter …
Oder besser der Göttinnen?
In der Buchhandlung Vaternahm entdeckte ich einen Fotobildband über das Göttingen der fünfziger Jahre. Den kaufte ich, schickte ihn Walter Kempowski zu und stellte mir vor, was er beim Auspacken für ein Gesicht machte und was er dann wohl zu seiner Frau sagte. »Der Martin Schlosser ist doch eine treue Seele« oder so.
Von der FAZ erhielt ich zur Rezension den Roman »Das Gesetz der Liebe« der Mexikanerin Laura Esquivel. Die Heldin ihres Epos war in einem früheren Leben Aztekin gewesen. Wiedergeburt in Lateinamerika: Dieses Thema schien in der Luft zu liegen.
Laura Esquivel bot auch Dämonen und Schutzengel auf, und sie ließ die weiblichen Romanfiguren noch majestätischer einherschreiten, als Isabel Allende es getan hatte:
Ihr stolzer Gang verriet keinerlei Zeichen der Unterwerfung. Er war hochmütig, ja, sogar herausfordernd. Das Schwingen ihrer breiten Hüften erfüllte den Raum um sie herum mit Sinnlichkeit …
Sätze wie Brechmittel. Jedes Wort war gelogen.
Post von Frank Schulz und Eckhard Henscheid, wie schön!
Frank schrieb mir, daß ein mit Püppchen, Schnüllerchen und Kleidchen ausstaffierter Mann in der SAT.1-Talkshow Vera am Mittag damit geprahlt habe, er trage den ganzen Tag Windeln, um sie ordentlich vollzustrunzen und dadurch »ein sexuell-erotisches Vollgefühl« zu erfahren.
Echt wahr! Selbst gesehen!
Und Eckhard:
Interessant Deine Engführung des Großen Brockhaus 1832 mit Ror Wolf. Eine weitere noch seltsamere Ähnlichkeit fiel mir sofort ein: Schiller, Über Anmut und Würde: »Das seelestrahlende Auge wird matt, oder quillt auch gläsern und stier aus seiner Höhlung hervor, der feine Inkarnat der Wangen verdickt sich zu einer groben und gleichförmigen Tüncherfarbe, der Mund wird zur bloßen Öffnung …« Ob Schiller insgeheim auch das Wixeln gemeint hat?
Und ob die Schillerforscher es wohl wagen würden, diesem Verdacht nachzugehen?
Der neue Asterix-Band – »Obelix auf Kreuzfahrt« – grauste die Sau. Nachdem Obelix vom Zaubertrank gekostet hatte, verwandelte er sich in Granit und anschließend in ein Kind. Danach wurde er von den Römern entführt und gelangte nach Atlantis, wo Kinder, hahaha, auf geflügelten Kühen umherflogen, und am Ende war er plötzlich wieder ganz der alte. Und die deutschen Übersetzer ließen Cäsar witzeln:
Leasing?! Lies besser in meinem Bellum Gallicum nach, dann weißt du, was jenen Barbaren blüht, die versuchen, sich ihre Freiheit zu leasen!
Hätte der Zeichner Albert Uderzo doch bloß die Größe besessen, diese ehrwürdige Comicreihe nach dem Tod des Texters René Goscinny nicht mehr fortzusetzen!
Von Renate hörte ich, daß sie ihren Schülern in Bonn bereits seit August die neue Rechtschreibung beibringen müsse, und die Süddeutsche Zeitung meldete:
Die geplante Rechtschreibreform wird trotz aller Proteste weder angetastet noch aufgeschoben. Das hat Bayerns Kultusminister Hans Zehetmair in der Berliner Morgenpost erklärt: »Juristisch und technisch ist die Reform nicht mehr zurückzuholen.« Er wies damit die »Frankfurter Erklärung« von 300 Schriftstellern, Verlegern und Wissenschaftlern gegen das Inkrafttreten der Rechtschreibreform zurück. Es sei unverständlich, warum sich die deutschen Dichter und Denker über die Reform aufregten, sagte der Minister. »Die können doch schreiben, wie sie wollen, da sie literarische Freiheit genießen. Auch nach dem Jahr 2005, wenn die neuen Regeln verbindlich gelten.« Im Zusammenhang mit dem augenscheinlich großen Widerstand gegen die Reform in der Bevölkerung sprach Zehetmair von einer »Stammtischmehrheit«.
Anstatt auch nur einen einzigen Einwand der Reformgegner zu widerlegen, tat Zehetmair sie als Stammtischbrüder ab und sagte: Basta. Aus die Maus. Als ginge es »die deutschen Dichter und Denker« überhaupt nichts an, welche Rechtschreibung er und seinesgleichen für verbindlich erklärten und den Schülern diktierten …
Arroganter konnte selbst der Fürst Metternich seine Bittsteller nicht abgebürstet haben. Und hatte es nicht geheißen, daß die neue Rechtschreibung eine zweijährige Testphase durchlaufen solle? Weshalb war denn dann schon jetzt an der Reform nichts mehr zu ändern?
Barbara Häusler rief an: Seit zwei Tagen, sagte sie, würden die Telefone in der taz-Redaktion heißlaufen, weil Dutzende Tierschützer ihrer Empörung über die angeblich vom FC Bayern München geplanten Stierkämpfe Luft machen wollten. Auch der Deutsche Tierschutzbund habe sich schon gemeldet und gefragt, was da eigentlich los sei. »Dessen Vorsitzender ist völlig verzweifelt, weil er von so vielen Anrufern bestürmt wird …«
Dann war ja alles in Ordnung. Selbst wenn der FC Bayern es gewollt hätte, wären in Deutschland keine Stierkämpfe durchzusetzen gewesen.
Auch das Institut für deutsche Sprache hatte die Kritik an der Rechtschreibreform brüsk zurückgewiesen:
Mit Verwunderung nimmt das Institut für deutsche Sprache die vielen Aufgeregtheiten zur Kenntnis, mit denen zur Zeit Schriftsteller auf die in den deutschsprachigen Ländern längst beschlossene und an der Mehrzahl deutscher Schulen bereits praktizierte Neuregelung der deutschen Rechtschreibung reagieren.
Der Verweis auf die Tatsache, daß die Neuregelung in den Schulen bereits »praktiziert« werde, diente als Ersatz für Argumente. Es ging ja auch nur um »Aufgeregtheiten« und nicht um sachlich begründete Reklamationen, wenn man dem Institut für deutsche Sprache glauben durfte:
Deutlich werden allenthalben verschwommene emotionale Vorbehalte.
Den Reformgegnern warf das Institut »Unrichtigkeiten«, »Verdrehungen« und »Panikmache« vor, ohne auf die Kritik näher einzugehen, und bügelte alle Widerreden mit der Bemerkung ab:
Die orthographischen Sorgen der Schriftsteller sind vermutlich nur Symptom für vielerlei Missbefindlichkeiten, die mit Rechtschreibung wenig zu tun haben.
So lautete der Befund der selbstherrlichen Vertreter des Instituts für deutsche Sprache, die sich von keinem Menschen mehr in ihre Beschlüsse hereinreden lassen wollten: Wer gegen die Reform war, der hatte »verschwommene emotionale Vorbehalte« und litt an »Missbefindlichkeiten«, die nichts zur Sache taten. Und es gab niemanden, der den Reformern ihre Hochnäsigkeit austreiben konnte.
Neben Baggern kamen in der Bebelstraße nun immer mehr Preßlufthämmer zum Einsatz. Hätte ich nicht vielleicht doch besser nach Bargfeld ziehen sollen?
Kurt Scheel hatte mir das Buch »Die Feinde und die Freunde des Islam« seines Freundes Siegfried Kohlhammer zukommen lassen. Darin wurde der britische Politologe Malise Ruthven zitiert, der 1984 zu dem Schluß gekommen war, daß die Re-Islamisierung den Frauen »paradoxerweise« größere persönliche Freiheiten bringen könne:
Die von den Islamisten vorgeschriebene neue Kleidung stelle eine »neue Reife« dar. »Sie demonstriert eine Ablehnung der falschen Koketterie, die frühere, von Kosmetika und teuren Frisuren tyrannisierte Generationen ›verwestlichter‹ Musliminnen kennzeichnete, und dient zugleich als Schutz gegen die Zudringlichkeiten von Männern in einem Milieu, in dem viele, vor allem aus der Provinz zugereiste Männer westliche Kleidung als typische Aufmachung einer Prostituierten betrachten.«
Kohlhammers Kommentar:
Daß es Ausdruck einer neuen Reife ist, sich statt von Kosmetika und Frisuren nun von islamistischen Rüpeln aus der Provinz tyrannisieren zu lassen, leuchtet nicht recht ein.
1992 hatte auch der US-amerikanische Islamwissenschaftler John L. Esposito die Re-Islamisierung schönzureden versucht: In den siebziger Jahren habe eine »Suche nach einer authentischeren Gesellschaft und Kultur« eingesetzt, nach »einer arabischen Identität, die sich weniger am Westen orientiert und stärker in arabischen/islamischen Traditionen und Werten verwurzelt ist«, und viele Bewohner des Mittleren Ostens hätten sich vorgenommen, »ihre Identität stärker in einer autochthonen arabisch-islamischen Vergangenheit zu verwurzeln«. Wozu Kohlhammer anmerkte:
Man ersetze arabisch/islamisch durch deutsch oder französisch, und man könnte dieses Authentizitäts- und Wurzel-Gefasel als eine Beschreibung der Ideologie der Neonazis oder der Nationalen Front Le Pens verstehen.
Einer Fußnote entnahm ich, daß die fundamentalistische Gruppe Al-Djihad 1995 eine Fatwa gegen den Kairoer Fernsehturm erlassen habe: Er verstoße gegen die Scharia, weil er die Ägypterinnen erregen könne.
Der 19. Oktober 1996 war der siebzigste Geburtstag meiner Patentante Gertrud. Ich gratulierte ihr abends telefonisch, und sie sagte, daß Edgar und sie zur Feier des Tages von ihrem Sohn Bodo bekocht worden seien.
Gertrud und ihr eigenbrötlerischer Ehemann Edgar hausten noch immer in dem Bau in Bielefeld-Sennestadt, in dem ich sie Ostern 1973 besucht hatte. Bereits damals hatte Edgar an einem Dachgeschoß gewerkelt, mit dem er dann niemals zu Potte gekommen war, aber ich verkniff mir die Frage, ob es jetzt fertig sei. Ich war einer der letzten von Gertruds Verwandten, denen er noch Telefongespräche mit ihr erlaubte, und dieses Privileg wollte ich nicht verlieren.
Im Deutschen Sportfernsehen hielt ein Moderator anläßlich der Ausstrahlung des WM-Finales von 1966 unverhofft Günther Willens und mein Büchlein »Drin oder Linie? Alles übers dritte Tor« vor die Kamera, und der Studiogast Hans Tilkowski, der bei jenem Spiel das Tor der deutschen Elf gehütet hatte, sagte, er habe das Buch zugeschickt bekommen und noch nicht alles gelesen, doch es sei »sehr amüsant«.
Das tat mir gut. Das Buch schien aber zu floppen, denn sonst hätten Günther und ich sicherlich schon die eine oder andere Erfolgsmeldung vom Leipziger Reclam-Verlag gehört.
Und was ratterte mir da aus meinem Faxgerät entgegen? Mit der Kopfzeile der taz-Redaktion?
Ein Leserbrief war es, verfaßt von jemandem, der im Erftkreis den Bund für Umwelt und Naturschutz vertrat:
Die Tierrechtsszene in unserem Land wird sich frühzeitig den dümmlichen Uli Hoeneß vorknöpfen. Der Manager des Münchener Balltreterclubs sollte seinem eigentlichen Arbeitsauftrag nachkommen, denn seine Kicker werden auch in 1996/97 nicht die Meisterschale küssen können. Die spanische Stierkampfmafia hat sich schon vor vier Jahren bei dem Versuch, das Stiergemetzel in Polen einzuführen, blutige Köpfe geholt, und dies wird in Deutschland noch vehementer sein, denn schon jetzt wetzen wir unsere Trainingsgeräte.
Auch im Erftkreis rührte sich der Widerstand gegen Stierkämpfe im Erdinger Moos. Gut so!
In Für alle Fälle Fitz drehte Jimmy Beck durch: Er kidnappte einen wegen Mangels an Beweisen freigelassenen Prostituiertenmörder, schleppte ihn auf ein Hochhausdach und rief der herbeigeeilten Kollegin Jane Penhaligon noch zu »Ich hab dich vergewaltigt!« und »Verzeih mir, Jane!«, bevor er sich gemeinsam mit dem Mörder in die Tiefe stürzte.
Der Schauspieler, der Beck verkörpert hatte, hieß Lorcan Cranitch. Ob es ihn wohl Überwindung gekostet hatte, einen solchen Schweinehund zu spielen?
Ich war jedenfalls froh über Becks Tod.
Für unsere kleine Geschenkbuchparodie schlug Max Goldt mir telefonisch den Titel »Erntedankfäscht« vor, und damit war ich einverstanden. Uns fehlte bloß noch ein Verlag dafür, und wir mußten auch noch ein paar besserwisserische Gedichte verfassen. Eines kam mir sogleich in den Sinn. Erste Strophe:
Strahlend
zeigt dir ein Kind
sein Zeugnis.
Das Kind ist versetzt.
Zweite Strophe:
Strahlend
zeigt dir ein Kind
sein Gesundheitszeugnis.
Das Kind ist verstrahlt.
Diesem Gedicht gab ich den Titel »Zweierlei Strahlen«, und das nächste nannte ich »Schreie und Flüstern«:
Ihr schreit: Laßt euch nicht BRDigen.
Wir flüstern zurück: Warum denn nicht?
Sollen wir vielleicht
im Rinnstein
verschimmeln?
Dann schrieb ich noch eins mit der Überschrift »Kleine Kassiererin«:
Du hast dicke Finger,
kleine Kassiererin,
vom vielen Tippen
der endlosen
Zahlenkolonnen.
Komm doch heraus
aus deinem Supermarkt,
sieh ins Licht,
schau den Walnußbaum an,
lausche dem Lied der Lerchen,
steck die Füße ins Wasser
und fühle:
Hier ist alles umsonst!
Ich stellte mir das von dem Liedermacher Herman van Veen gesungen vor, aber nur drei, vier Sekunden lang, denn sonst wäre mir schlecht geworden.
Weil der um den Ruf seiner Heimatstadt besorgte Bürgermeister von Bad Orb mehrmals über Achim Gresers und Heribert Lenz’ hübsche, in der FAZ erschienene Zeichnung mit dem Untertitel »Eckhard Henscheid liest vor den Mitgliedern der Mafia-Ortsgruppe Bad Orb« geklagt hatte, faßten der Titanic-Chefredakteur Oliver Schmitt und ich den Plan, vor Ort nach dem Rechten sehen. Lebten in Bad Orb lauter gesetzestreue Bürger? Oder herrschten dort sizilianische Zustände?
Am Dienstag wollten Oliver und ich von Frankfurt aus dorthin aufbrechen. Als ich in der Redaktion eintraf, überreichte er mir jedoch erst einmal einen Brief, auf dessen Umschlag stand:
Titanic
c/o Martin Schlosser
Privat/Persönlich
Brönner Str. 9
60313 Frankfurt am Main
Ohne Absenderangabe auf der Rückseite.
»Ich tippe auf ’ne Unterhaltsklage«, sagte Oliver, doch er irrte sich: Es war ein kurzer Brief von meinem Jugendfreund Hermann Gerdes, mit dem ich mich 1989 zerstritten hatte. Er wäre »gerne mal wieder nostalgisch«, schrieb er. Und:
Ich würde mich freuen, wieder einen Kontakt mit Dir zu haben.
Wenn Du Interesse an einem Treffen hast, melde Dich.
Dein Hermann
Sein erstes Lebenszeichen nach sieben Jahren.
In Köln wohnte er jetzt, wie aus dem Briefkopf hervorging. Auch seine Telefonnummer hatte er angegeben.
Angefreundet hatten wir uns als Achtkläßler in Meppen, 1975, und unsere Versöhnung war mir seit Jahren ein Herzenswunsch gewesen. Mit meiner Antwort auf diesen Brief wollte ich mir aber noch Zeit lassen, bis ich wieder in Göttingen war.
In Bad Orb checkten Oliver und ich im Hotel Teutonia ein. Mein Zimmer war schmal, aber annehmbar. Das einzige, was mir an diesem Abend mißfiel, war die Antwort, die der deutsche Außenminister Klaus Kinkel in Peking auf die Frage gegeben hatte, ob er die Machthaber auf das Thema Menschenrechte angesprochen habe. In der Tagesschau hörte man ihn sagen: »Ich habe Ihnen doch schon zweimal erklärt, daß Sie dazu von mir in dieser Pressekonferenz aus nachvollziehbaren und absolut offensichtlichen Gründen keine Antwort bekommen werden.«
Über die nachvollziehbaren und absolut offensichtlichen Gründe, aus denen er das Thema Menschenrechte nicht ansprechen wollte, äußerte Kinkel sich nicht genauer. Die behielt er für sich.
Die im Hotel Teutonia ausliegenden Prospekte verhießen den Besuchern von Bad Orb Seidenmalereikurse, Bibelgesprächskreise, »Wohlfühl-Wochen« und ein tägliches »Wünsch-dir-was-Frühstück«.
»Gibt’s auch ökumenisches Artischockenbasteln?« fragte Oliver.
Am Mittwochvormittag fanden wir im Kurpark einige hölzerne, als Blumenkübel genutzte Badezuber vor, und Oliver fotografierte meine nackten, hinter einem Baumstamm ausgestreckten Beine, die wir den Titanic-Lesern als »abgehackte Rentnerstümpfe« verkaufen wollten.
Oliver knipste auch Leute, die ihren Vorgarten verschönerten. »Denen können wir dann nachsagen, daß sie da Leichen verbuddeln …«
Im Waldgasthof Haselruhe servierte man uns auf einer rotweißkarierten Tischdecke eine Waldpilzsuppe und einen »Haselruhtopf« mit Hirschgulasch. Bis auf die Energiesparlampen wirkte in diesem Restaurant alles so wie 1959. Oder 1890.
Auf dem Tresen lag eine Lokalzeitung aus. Darin bedichtete eine Lyrikerin namens Ursula Weiß die bepflanzten Badezuber im Kurpark, wenn auch leider mit einigen Komma- und Grammatikfehlern:
Zwar sind sie bis zum Rand voll Erde,
dem neuen Zweck gerecht zu werden.
Mit wunderschöner Blütenpracht,
manchen Betrachter glücklich macht.
So kann aus manchen nutzlos Dingen,
oft etwas Brauchbares gelingen.
Einst heilt sie körperliche Pein,
nun will sie Balsam für die Seele sein.
Gemeint war: die Badewanne.
»Da hastes«, sagte Oliver. »In Bad Orb wird auch der Satzbau vergewaltigt. Und dahinter steckt die Cosa Nostra!«
Wir begutachteten die Solequellen, aßen Apfelstrudel im Café Sprudel und flanierten durch die Einkaufsmeile, auf der sich Kurschatten mit Hüftschäden herumdrückten.
Hier herrsche eine »königliche Langeweile«, stellte Oliver fest, und da gab ich ihm recht.
Nachdem wir einem Plakat entnommen hatten, daß der Schriftsteller Hanns D. Knoop am Abend im Martin-Luther-Haus aus seinem Buch »Jenseits von Kirchenmauern« lesen werde, fragten wir uns zum Lesungsort durch, und ein mürrischer Mann sagte zu uns: »Da gangese hier die Straß raff!«
Im Martin-Luther-Haus wurde auch für andere Veranstaltungen geworben. Laut einem Aushang erbot sich ein Dr. Friedrich Thiele, Pfarrer im Ruhestand, Alleinstehende zu beraten:
Wenn gewünscht, kann auch die Frage der Sexualität bei Alleinstehenden mit angesprochen werden.
Was mochte dieser Pfarrer seinen Schäfchen wohl antworten, wenn er auf die Frage der Sexualität »bei« Alleinstehenden angesprochen beziehungsweise »mit« angesprochen wurde?
Oliver tippte darauf, daß er ihnen raten werde, sich nach Kräften einen von der Palme zu wedeln.
Zu der Lesung fanden sich außer Oliver und mir nur sieben mucksmäuschenstille ältere Damen ein.
Knoop, ein älterer, einen Rollkragenpullover tragender Herr, sagte eingangs, daß bei ihm »ruhig einmal geschmunzelt werden« dürfe. »Meine Literatur will aber kein Spiel sein, wo es Sieger und Verlierer gibt. Nein, so sehe ich meine Literatur nicht!« Er bringe, sagte er, allerlei kleine Schwächen von Menschen, die der Gnade bedürften, augenzwinkernd und satirisch-karikierend auf den Punkt, und die Geschichte, die er vortragen werde, richte sich »gegen überlieferte Rollenklischees«.
Es ging darin um eine Konfirmationsfeier. Die Figuren trugen Namen wie »Gottfried«, »Johanna«, »Pastor Gottlieb«, »Richard Tandler« und »Onkel Eduard«, und sie unterhielten sich in einer weltfremden Kunstsprache: »Nun, Johanna, was meinst du dazu? Sag etwas! Du hast doch die Hauptlast mit der Konfirmation!« Worauf erwidert wurde: »Typisch Importkaufmann! Du kannst Gerrits Konfirmation nicht wie die letzte Kiste Bananen abhaken!«
Den Lesungsbesucherinnen war das Schmunzeln da bereits im Halse steckengeblieben. Auch sie wirkten gnadebedürftig. Und obendrüber britzelten die Martin-Luther-Haus-Quadratleuchten.
Einen jähen Höhepunkt erreichte die Story, als Knoop referierte, was der Konfirmand geschenkt bekam: fünf Schlafanzüge, zehn Kulturbeutel, einen Videorecorder und ein Rennrad »mit Fünf-Gang-Schaltung«, worin Knoop den Gipfel des Konsumterrors zu erblicken schien.
Der Mann habe wahrscheinlich ungefähr 1963 zum letztenmal aus dem Fenster gekuckt, tuschelte ich Oliver zu, und dann trat ein peinlicher Moment ein, denn einer der Damen war ihr Brillenetui auf den Boden gefallen.
In der Geschichte klingelte kurz darauf ein Telefon. Pastor Gottlieb nahm ab, horchte und schwieg eine Weile, bevor er sagte: »Meckfessel. Willi Meckfessel ist tot.« Und Richard Tandler rief aus: »Was? Meckfessel? Unser Polsterer? Meckfessel steht auf meinem Terminkalender fest eingeplant! Alle Polstermöbel muß er bis zur Konfirmation aufarbeiten …«
»Prädikat Vollmeise«, sagte ich zu Oliver, und er prustete los.
Wir verließen schleunigst den Saal, um uns draußen vor Lachen ausschütten zu können.
Beim Bier kamen wir dann auf die Idee, unter dem Pseudonym Caricaturus Federspitz in einem Bilderbuch die Sittengeschichte der Bundesrepublik Deutschland zu erzählen, von der Verabschiedung des Grundgesetzes und der Wiederbewaffnung über den Mauerbau, die Spiegel-Affäre, die Einführung des Farbfernsehens und die Affäre Guillaume bis zum Orwell-Jahr 1984 und zur Wiedervereinigung, und zwar in stümperhaften Ferkelzeichnungen von Ärschen, Muschis, Brüsten, Kopulationen und Männern mit tropfenden Pimmelnasen. In eine Furzblase schrieb ich »Hallstein-Doktrin«, während Oliver in einen ansehnlichen, aus dem Hals eines mit »Europäischer Rechnungshof« beschrifteten Rammlers spritzenden Schwall Kotze die Worte »Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze« schrieb und auf den Hodensack desselben Mannes »KSZE-Konferenz«.
Aber welcher Verlag würde es wagen, dieses revolutionäre Werk zu veröffentlichen?
Als ich am Donnerstag wieder in Göttingen war, rief meine Freundin Tanja aus Leipzig an und fragte, ob sie mich am Samstagabend besuchen könne. Nachdem ich ihr zugesagt hatte, rief Barbara Häusler an und fragte, ob sie mich am Freitagabend besuchen könne. Ich sagte auch ihr erfreut zu, wies sie aber darauf hin, daß ich am Samstag noch einen anderen Damenbesuch erwartete, und dann rief meine alte Freundin Kerstin an und fragte, ob sie mich am Sonntagnachmittag besuchen könne. Sie sei dann auf der Durchreise von Frankfurt nach Berlin.
Ich traute mir zu, das alles zu koordinieren, und nahm mir für Freitagnachmittag einen Großeinkauf vor.
In meiner Bad-Orb-Reportage phantasierte ich von Drive-by-Shootings, grausigen Leichenfunden, grimmigen Ureinwohnern, denen ihre Schuld ins Gesicht geschrieben stehe, und der Krake des organisierten Mädchenhandels, in deren Würgegriff das süße kleine Spessartstädtchen ächze. Diese Retourkutsche hatte sich der Bürgermeister von Bad Orb selbst zuzuschreiben.
Es sei eigentlich nicht ihre Art, sich irgendwelchen Schriftstellern an den Hals zu werfen, sagte Barbara, als wir mit einem Taxi vom Bahnhof zu dem französischen Restaurant fuhren, das ich liebgewonnen hatte. »Aber für dich mach ich mal ’ne Ausnahme …«
Unterwegs sah sie Sperrmüll an der Straße stehen und hätte, wie sie sagte, gern darin herumgewühlt. Sie sei nämlich Sammlerin und keine Wegwerferin, und damit hatten wir für den Rest des Abends ein ergiebiges Thema gefunden. Ich erzählte von dem Sammelzwang unseres einstigen Vallendarer Nachbarn Rautenberg, der in seinem Haus zur Verzweiflung seiner Frau rauhe Mengen kaputter Spülmaschinen und Kühlschränke gehortet hatte, und Barbara erzählte mir, daß ein Freund von ihr und sie einmal 94 versinterte Ferkeltröge aus Steingut erworben hätten.
In meiner Wohnung konnte Barbara sich später davon überzeugen, daß auch ich kein Wegwerfer war, als ich ihr die rund einhundert Aktenordner zeigte, die den brieflichen Nachlaß meiner Eltern enthielten.
»Du liebe Güte«, sagte sie. »Was sind dagegen vierundneunzig Ferkeltröge?«
Am Samstag unternahmen wir mit Barbaras Auto einen Ausflug zur Plesseburg und zur Wilhelm-Busch-Mühle in Ebergötzen, die ich früher schon einmal besichtigt hatte.
Wie bedauerlich, daß man dort nicht mehr bei einem Glas Rotwein mit dem alten Busch zusammensitzen konnte! Ich hätte ihn sonst gern gefragt, ob er den US-amerikanischen, von seinen Bildergeschichten inspirierten Comic strip The Katzenjammer Kids kenne und ob er nicht auch der Ansicht sei, daß Kaiser Wilhelm II. einen schweren Dachschaden gehabt habe.
Sie würde lieber noch länger bleiben, sagte Barbara, als wir voneinander Abschied nahmen. Es schnitt mir ins Herz, aber ich freute mich auch auf Tanja, und ich konnte mich ja nicht verdoppeln oder halbieren …
Die Zurücknahme der Rechtschreibreform würde der »Glaubwürdigkeit deutscher Bildungspolitik im In- und Ausland schaden«, unkte der Reformer Hermann Zabel in einem Leserbrief in der Süddeutschen Zeitung. Ja, man sah sie förmlich vor sich, die Bulgaren, die Australier und die Kenianer, die den Glauben an die deutsche Bildungspolitik verloren, wenn man die Verben »kennenlernen«, »bekanntmachen« und »vollkotzen« wieder in einem Wort schreiben durfte und niemandem mehr beigebracht wurde, daß der Satz »Er war ihm Spinnefeind« korrekt geschrieben sei.
In einer »Dresdner Erklärung« hatten die Kultusminister die Kritik an der Rechtschreibreform zurückgewiesen:
Schriftsteller und Publizisten waren aufgefordert, sich in den demokratischen Entscheidungsprozess einzuschalten, haben diese Chance aber nicht wahrgenommen und beklagen nun das Ergebnis eines Willensbildungsprozesses, dem sie sich verweigert haben. Nun ist der demokratische Entscheidungsprozeß für die Neuregelung der Rechtschreibung im ganzen deutschsprachigen Raum abgeschlossen. Daran kann auch der verspätete Protest der Schriftsteller und Publizisten nichts ändern.
Welcher demokratische Entscheidungsprozeß hätte das denn bitte schön gewesen sein sollen? Die Reformer hatten ihre Entscheidungen hinter den Kulissen ausgeknobelt und die Öffentlichkeit dann mit Regeln überrumpelt, über die in keinem Parlament diskutiert worden war. Und nicht einmal vor einer Lüge schraken die Kultusminister zurück:
Kein einziges deutsches Wort geht durch die Neuregelung der Rechtschreibung verloren.
Oder wußten sie nicht, daß zum Beispiel die Wörter »wiederaufbereiten«, »wiederaufnehmen«, »wiederbeleben«, »wiedererkennen«, »wiederfinden«, »wiedergeboren« und »wiedergutmachen« von den Reformern ausgemerzt worden waren?
Im reformierten Duden kam auch das Verb »wiedersehen« nicht mehr vor. Da hieß es »wieder sehen«, was aber nach Auskunft der Reformer auf eine falsche Auslegung der neuen Regeln zurückging. Doch wieso durfte man noch immer »wiedersehen« schreiben, wenn statt »wiedererkennen« auf einmal nur noch »wieder erkennen« richtig sein sollte?
Auf solche Fragen waren die Kultusminister nicht eingegangen. Sie hatten lieber vor den Folgen einer Rückkehr zur klassischen Rechtschreibung gewarnt:
Schaden nehmen würden auch die Kinder in unseren Schulen, die bereits vielerorts nach der Neuregelung unterrichtet werden.
Den Kultusministern war es offenkundig schnuppe, daß die Kinder jetzt unsinnige Sätze wie »Hilfe tut Not« und »Er tat mir Leid« von der Tafel abschreiben mußten. Hatte überhaupt einer dieser Minister sich irgendwann einmal genauer mit der Neuregelung befaßt?
Auch mit Tanja dinierte ich in dem französischen Restaurant, und ich rechnete es dem Kellner hoch an, daß er mich nicht fragte, wo denn meine gestrige Tischdame geblieben sei.
»Rank und schlank«, sagte ich zu Tanja voller Bewunderung, als sie sich nackt auf mich setzte, und das schien ihr zu gefallen.
Sie war so unbeschreiblich schön, daß mir der Atem stockte, aber jenseits der Bettkante wurden wir miteinander nicht warm.
Um 13.16 Uhr reiste Tanja am Sonntag ab, und um 17.38 Uhr kam Kerstin an. Sie habe Zeit bis zur Abfahrt ihres Zugs um 21.16 Uhr, sagte sie. »Und von mir aus können wir einfach vögeln gehen, ohne vorher was zu essen. Obwohl du für mich ja kein Frischfleisch mehr bist …«
So liebte ich Kerstin. Sie vertrat die Interessen der Natur.
Nachdem wir uns ausgetobt hatten, las ich ihr einige neue Absätze aus dem schmierigen Lateinamerika-Roman vor, den ich mit Kathrin Passig zuwege bringen wollte: »Es war Miguel, der Maria in die Kunst des Schachspiels einweihte. Miguel war krank, er litt an Krätze, und der Gott der Wellen, der das Leben gab und nahm, hatte ihm nur eine einzige Begabung mitgegeben auf den kurzen Weg, den Miguel beschritt und der vom Schachbrett direkt in die Hölle führen sollte, in die Hölle des Rauschs und der Selbstaufgabe, wo ihn die Fühler und Greifer des schweren, schwarzen, unersättlich nach Menschenfleisch und Menschenseelen hungernden Falters der Angst und der Verlorenheit umfingen und nicht mehr losließen, bis alles Blut aus ihm entwichen war …«
»Schon gut«, sagte Kerstin. »Wird bestimmt ’n Welterfolg.«
Als ich wieder allein war, rief ich Hermann an, um ihm mitzuteilen, wie sehr ich mich über seinen Brief gefreut hätte. Es war zwar nur der Anrufbeantworter dran, aber auch dem erzählte ich gern, daß ich am 7. November eine Lesung in Düsseldorf hätte und tags darauf zu einem Besuch nach Köln kommen könne, falls es passe.
Hinterher schilderte ich Eugen brieflich meine jüngsten Abenteuer, und als auch das erledigt war, sah ich mir die Videoaufzeichnung der neuen Folge von Für alle Fälle Fitz an. Da stand ein heruntergekommener Mann im Verdacht, seine Frau ermordet zu haben. Fitz versuchte ihm ein Geständnis zu entlocken, aber der Mann riß sich das Hemd auf und rief: »Hier! Da hab ich mir was reinmachen lassen, um vom Saufen wegzukommen, aus Liebe zu ihr!«
Man sah eine Operationsnarbe.
»Ein Implantat«, sagte Fitz.
»Ja«, erwiderte der Mann und sackte schluchzend in sich zusammen.
Fitz wandte sich bestürzt von ihm ab, stand auf und sagte zu Detective Chief Inspector Charlie Wise: »Ich glaube, der war mir sympathischer, als ich ihn noch für schuldig hielt …«
Am Montag rief Jörg Schröder mal wieder an, der mythenumrankte Gründer des leider nicht mehr existierenden März-Verlags, und sagte, daß alte und junge Nazisäcke seiner Freundin Barbara Kalender und ihm in Fuchstal-Leeder die Fenster eingeschmissen hätten. »Und jetzt ziehen wir nach Augsburg um. Uns reicht’s!«
Ich fragte mich ja, wie die beiden es überhaupt so lange ausgehalten hatten in Fuchstal-Leeder im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech.
Um ihn in der Titanic-Rubrik »Humorkritik« besprechen zu können, las ich den zwanzigsten Band der Kurt-Tucholsky-Ausgabe, der gerade im Rowohlt-Verlag erschienen war (»Briefe 1933–1934«). Am 16. Dezember 1934 hatte Tucholsky an seine Freundin Hedwig Müller geschrieben:
Ich kann mich nicht besinnen, irgendwo gewohnt zu haben, wo nicht gebaut würde – nun hasse ich nichts so wie Holzgepolter auf Holz.
Und:
Schade, daß meine Ohren es alles aufriechen müssen.
Auch in der Bebelstraße gab es mit den Ohren so manches aufzuriechen. Sie wurde jetzt nicht mehr nur aufgebaggert, sondern auch ausgeschaufelt, entkernt und mit Schützengräben versehen.
Zugeschickt worden war mir vom Rowohlt-Verlag auch der vierte Band der Tucholsky-Werkausgabe (»Texte 1920«). »Bier, Bums, Mensur und Ludendorff«, das sei die Weltformel der völkischen Mehrheit der Studenten von Rostock, hatte er im Juni 1920 in einer Zeitung namens Freie Welt geschrieben. Seinen Artikel hatte er mit Aufnahmen von Graffiti an den Lokuswänden der Universität Rostock illustriert – »Du beschnittener Rotzjude!«, konnte man da lesen, »Antisemiten-Zelle!« und »Hier werden in Zukunft Juden immatrikuliert« – und festgestellt:
Die Inschriftenmaler sind unsere künftigen Richter, Beamten, Staatsanwälte, Priester …
Und die tüchtigsten von ihnen waren dazu ausersehen gewesen, zwei Jahrzehnte später über jüdische »Rassenschänder« zu Gericht zu sitzen. Vielfach hieß es ja, daß es unmöglich gewesen sei, die Verbrechen der Nationalsozialisten vorherzusehen, aber Tucholsky hatte dafür bereits 1920 bloß mal eben einen längeren Blick in eine Latrine werfen müssen.
Dann rief Hermann an. Meinem Besuch in Köln stehe nichts entgegen, sagte er. »Laß uns das Kriegsbeil hier am Rheinufer begraben!«
Meine Mitteilung, daß ich jetzt in Göttingen wohnte, wo er als Student auch selbst gehaust hatte, belustigte ihn, und von sich selbst berichtete er mir, daß er seit einigen Jahren im weitesten Sinne auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe tätig sei.
How many a year has passed and gone …
Auf unser Wiedersehen freute ich mich sehr.
In seinem Buch »Politische Korrekturen« stellte der Journalist Diedrich Diederichsen fest, »von der ebenso inhaltlich geschenkten bis taktisch bekloppten Gutemenschenverspottung« lebe »mittlerweile ein ganzes satirisches Genre, das Leute wie Martin Schlosser und Wiglaf Droste berühmt und konsensfähig von ›Konkret‹ bis zur ›FAZ‹ in Lohn und Brot gesetzt hat«.
Inhaltlich geschenkt und taktisch bekloppt war es demnach, das Gesülze jener Meinungsführer zu kritisieren, die sich irgendwie als links und fortschrittlich verstanden, aber nur Blech redeten und der Linken damit schadeten, so wie der als Dichter dilettierende Pfarrer Friedrich Schorlemmer (»Spiel das Spiel / Sieh das Ziel / Streu die Saat / Steig aufs Rad / Und sag es weiter«) oder der PDS-Bundestagsabgeordnete Gerhard Zwerenz, der sich irrtümlich als Reinkarnation von Kurt Tucholsky begriff. Glaubte Diederichsen wirklich, daß man sich als Linker aus taktischen Gründen mit Leuten wie Schorlemmer und Zwerenz solidarisieren müsse?
Seinen Gegnern verübelte Diederichsen auch deren »Phallogozentrismus«. Daraus hätte man einen netten Song machen können:
Oh, Baby, Baby, ich liebe nur dich allein,
und ich werde niemals wieder phallogozentrisch sein …
Meine Jalousien waren elende Staubfänger. Als ordnungsliebender Hausmann hätte ich ihnen alle paar Tage mit einem Staubwedel und nassen Tüchern zu Leibe rücken müssen, aber dafür war mir meine Zeit zu schade. Wenn die Lamellen sich unbedingt elektrostatisch mit Staub aufladen wollten, waren sie selbst schuld.
Die FAZ meldete, daß der Verband der Schulbuchverlage dem »Bekenntnis« der Kultusminister zur Reform der deutschen Rechtschreibung widersprochen habe:
Diese hatten nach ihrer Konferenz in der vergangenen Woche verbreiten lassen, durch die neunjährige Übergangsfrist für die Neuregelung könnten die Schulbücher »weitgehend im normalen Erneuerungsturnus ersetzt werden«. Der Verband weist demgegenüber darauf hin, daß die ihm angeschlossenen Verlage bis zum Ende dieses Jahres 45 Millionen Mark für die Reformierung von Schulbüchern aufwenden. Der zusätzliche Gesamtaufwand, den die Branche für »Kuss« statt »Kuß« aufbringen müsse, liege nach wie vor bei etwa 300 Millionen Mark.
Und zwar für nichts und wieder nichts.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach hielten ganze zwölf Prozent der Deutschen die Rechtschreibreform für sinnvoll, 13 Prozent waren unentschieden, und 75 Prozent lehnten sie ab. Weshalb mußte sie dem Volk dann aufgenötigt werden?
Mit Konrad Adenauer hatte Helmut Kohl nun gleichgezogen: Er war seit 5144 Tagen im Amt. Und was hatten wir seither nicht alles erlebt, der Kanzler und ich!
In konkret zitierte der Herausgeber Hermann L. Gremliza die Vorwürfe, die Wiglaf Droste und mir von dem Schriftsteller Jürgen Fuchs gemacht worden waren, nachdem wir ihn in unserem Roman »Der Barbier von Bebra« in einem Shampoofaß ertränkt hatten:
Sie haben gut getroffen, sie haben in die Eier und ins Gemüt gehauen. Die Stasi plante Liquidierungen, Vernehmer im Knast höhnten wie Droste und Schlosser. »Zersetzungspläne« wurden fabriziert und durchgeführt … Droste, Schlosser, auch Gremliza von KONKRET und Anderson vom MfS haben eigentlich immer ganz gut getroffen und »sensible Zonen« erkannt. Ich lernte Kasernenhof, Knast, Stasimaßnahmen und letztes Jahr auch die Krebsstation des Virchow-Krankenhauses kennen …
Dazu merkte Gremliza an:
Droste und Schlosser mögen ihr Geständnis eigenhändig ablegen, ich beeile mich, bevor die Gesellschaft für das bedrohte Volk die Massengräber der von mir bis zur Schlachtreife gefolterten und ermordeten Bürgerrechtler öffnet, zuzugeben, daß ich dem Fuchs mehrfach in die Eier bzw. ins Gemüt (wo immer das bei ihm sitzt) gehauen, ihn erst geköpft und dann gehangen, verhöhnt und liquidiert habe. Hier jedoch ist Schluß mit lustig. Gegen ein Meta-Stasi-Opfer, das mit seinen Karzinomen nach einem schmeißt, läßt sich nicht polemisieren.
Ich hatte es zuvor auch noch nicht erlebt, daß mir jemand seine Krebserkrankung vorwarf. Und Gremliza legte noch eine Schippe drauf:
Da wir gerade dabei sind: Droste und Schlosser schreiben in ihrem Buch ab und zu Sachen, die sie zwar ab-, nicht aber ihren Urhebern zuschreiben, wie diesen Satz über einen Zonendichter:
Die Stasi ist mein Neckermann.
Auf dieser Seite (und nachgedruckt in »Ganghofer im Wunderland«) hatte ich Erich Loest, der behauptet hatte: »Die Stasi war mein Eckermann«, geantwortet: »Die Stasi war sein Neckermann.« Immerhin, man wird gelesen.
Das hatte auch Wiglaf gerade gelesen, als er mich anrief, um mich zu fragen, ob ich es nicht lustig fände, daß Gremliza das Copyright auf einen Klosettspruch aus der DDR erhebe.
Postalisch und telefonisch meldete sich aus Dresden die schöne Nadja zurück. Sie war mit einem extrem eifersüchtigen Freund verbandelt und hatte mir den Laufpaß gegeben, aber jetzt schickte sie mir wieder Ansichtskarten von roten Rosen und schnurrte mir fernmündlich zu.
Ich sagte ihr, daß Wiglaf Droste und ich vorhätten, am 20. November in Dresden zu lesen, und daß ich zu jeder Schandtat bereit sei.
Gegen die heißumstrittene Verlängerung der Ladenöffnungszeiten von Montag bis Freitag bis 20 Uhr hatte ich nichts einzuwenden. Von mir aus hätten die Geschäfte täglich 24 Stunden lang geöffnet bleiben dürfen.
Eugen Egner machte sich Sorgen um mich:
Meine Fresse! Dein Damen-Fahrplan nötigt einem aber Respekt ab. Wie Du das hinkriegst, sozusagen »wie am Schnürchen« … Bist Du hernach mental und physisch nicht völlig ausgeschlachtet, »ausgekernt«? Das zehrt doch? Vielleicht sind diese meine Fragen und Staunungen aber auch nur neurasthenische Kurzschlüsse, die ich konstitutionell monogamer Eheerpel mit verschlissenem Kräftehaushalt, unbillig von mir auf andere schließend, ziehe? Allerdings habe ich den Eindruck, daß Dir sotanes Treiben frommt. Dann ist es gut, so soll es sein. So entschädigt Dich der Weltgeist für die Bauwut ringsum.
Ich wußte ja auch nicht, wie das noch werden sollte.
In der Süddeutschen Zeitung mokierte sich ein Kritiker namens Jörg Burger über eine Lesung von Wiglaf Droste in den Hamburger Kammerspielen:
Die Schauspieler sind gerade erst abgegangen, da schwingt sich ein junger Mann auf die Bühne und wirkt sofort unendlich fehl am Platz. Über der Handwerkerhose quillt der Bauch aus dem zu engen T-Shirt, die geweiteten Augen verraten die Furcht vor dem Publikum. Hilflos starrt der Jammerlappen zur Decke, und er wirkt dabei so komisch, daß der bloße Anblick die Zuschauer zum Lachen bringt.
Als ob Wiglaf sich vor seinem Publikum jemals gefürchtet hätte!
In diesem Artikel wurde er auch als »Bübchen« sowie als »Nischenhanswurst einer ganzen Generation« bespöttelt. Auf dem gleichen Niveau hätte man Burger als »Kritikerlein« und als »Hinterzimmerkasperle« verunglimpfen können.
Im südhessischen Pfungstadt lasen Christian Schmidt, Oliver Schmitt und ich in einem Veranstaltungsort namens »Bureau für Nichts« zwei Stunden lang aus den verquasten Memoiren des Wienerwald-Gründers Friedrich Jahn (»Ein Leben für den Wienerwald. Vom Kellner zum Millionär – und zurück«). Peter Edelmann, der Veranstalter, war rührend um uns bemüht, aber das nur aus einer Handvoll Personen bestehende Publikum ließ uns abblitzen, obwohl wir diesmal auch den herrlichen Abschnitt zum besten gaben, in dem Jahns einstiger Rechtsanwalt Albert Schmid sich über Jahns Hutlosigkeit äußerte:
Eine seiner gravierendsten und für jeden sichtbaren Eigenheiten war und ist seine Hutlosigkeit. Hat er schon nicht allzuviele Haare, die bei Regen naß werden könnten, so ist er dennoch ein Todfeind jeglicher Kopfbedeckung, ob in Florida bei 40 Grad die Sonne niederbrennt oder in Europa 20 Grad Kälte herrschen. Er geht immer ohne Hut. Einmal hat er mir eine Wette angeboten, daß er in seinem Leben noch keinen Hut getragen habe. Ich wußte, daß er mit dem Ratskellerwirt Albert Wieser aus München als junger Mann auf der Hotelfachschule in Salzburg gewesen war. Ihm erzählte ich von meiner Wette, und er sagte dann, daß das grundsätzlich richtig sei, was Jahn da von sich gegeben habe, er habe aber ein Foto, das das Gegenteil beweist. Das hat er mir mitgegeben, und ich habe es Jahn gebracht. Er hat es sich angeschaut und sofort zerrissen, denn er hatte ja noch nie einen Hut getragen.
Für superlangweilige und daher um so komischere Anekdoten wie diese hatte in Pfungstadt leider niemand Sinn.
In der neuen Folge von Für alle Fälle Fitz ging Fitz’ Ehe scheint’s endgültig in die Brüche, und unerklärlicherweise schredderte seine Ex-Geliebte Penhaligon die Tagebücher von Jimmy Beck, aus denen hervorging, daß er sie vergewaltigt hatte, doch aus Fitz und ihr wurde noch immer kein Paar.
Da wäre ich gern eingeschritten, aber wie?
Artur Axmann war gestorben, Adolf Hitlers »Reichsjugendführer«, der in der Schlußphase des Zweiten Weltkriegs Hunderte von Hitlerjungen in den Tod geschickt hatte. Aus dem Nachruf des FAZ-Herausgebers Friedrich Karl Fromme ging jedoch hervor, daß Axmann auch seine guten Seiten gehabt habe:
Vielen Hitlerjungen von damals imponierte es, daß Axmann sich bei Kriegsausbruch zur Wehrmacht meldete; zuletzt war er Leutnant. Kurze Zeit war er 1941 im Krieg gegen die Sowjetunion, wurde schwer verwundet; er verlor den rechten Arm. Ins Bedenkliche geriet sein Wirken mit der Aufstellung des »Volkssturms«. Es gab da vier Aufgebote. Die beiden ersten umfaßten ältere Männer bis zu Greisen, die gelegentlich die 60 schon überschritten haben konnten. Das dritte Aufgebot war für die NS-Führung das Interessanteste: Es umfaßte die Hitlerjugend-Jahrgänge, bis hinunter zum Alter von 15 Jahren.
Die Formulierung »Ins Bedenkliche geriet sein Wirken« hätte Fromme sich patentieren lassen sollen. Die wäre noch in vielen anderen Nachrufen auf alte Nazis verwendbar gewesen.
In der FAZ war auch eine Todesanzeige zum Gedenken an Artur Axmann erschienen, in der es hieß:
Sein sozialer Einsatz für die Jugend war Vorbild.
Dafür danken wir ihm.
Gegen die Würdigung des vorbildlichen Mißbrauchs der Jugend als Kanonenfutter für die Nazis schien die Anzeigenredaktion der FAZ keine Einwände zu haben.
Andreas Schäfler von der Edition Nautilus faxte mir die Nachricht, daß »Der Barbier von Bebra« inzwischen viertausendmal verkauft worden sei.
Das war doch ganz ordentlich. Zu verdanken hatten wir das vor allem der bündnisgrünen Bundestagsabgeordneten Vera Lengsfeld, die Wiglaf Droste und mich als Faschisten bezeichnet und zum Boykott der taz aufgerufen hatte, als der Roman darin auszugsweise veröffentlicht worden war.
In einem Runderlaß des schleswig-holsteinischen Kultusministeriums hieß es im Hinblick auf den Rechtschreibunterricht:
Generell werden überholte Regeln und Schreibungen nicht mehr eingeführt und nicht mehr geübt.
Offiziell galten die alten Regeln und Schreibungen zwar noch bis zum 1. August 1998, und bis dahin sollte die reformierte Rechtschreibung angeblich auf der Bewährungsprobe stehen, aber die Kultusminister wollten um jeden Preis dafür sorgen, daß nichts mehr rückgängig gemacht werden konnte.
Ich begrüßte es, daß Bill Clinton wiedergewählt worden war. Die Demokraten mochten ja korrupt sein, aber die Republikaner waren noch zehnmal korrupter, und ihr Präsidentschaftskandidat Bob Dole unterstützte die faschistische Miliz Renamo in Mosambik.
220 Mark gab ich für eine Bahncard aus. Damit kosteten alle Fahrten in der zweiten Klasse bloß noch die Hälfte. Eine Anschaffung, die sich rentieren würde, denn es kamen viele Reisen auf mich zu.
»Der Herr Droste hat leider seinen Flieger verpaßt«, sagte man mir im Düsseldorfer Schauspielhaus, in dem Wiglaf und ich aus dem »Barbier« lesen sollten. »Er hat aber den nächsten genommen und könnte so gegen neun oder halb zehn zu Ihnen stoßen. Wollen Sie schon mal ohne ihn anfangen?«
Ich klärte das Publikum darüber auf, daß Wiglaf irgendwo über uns kreise, und las erst einmal solo alles vor, von der Erstechung des stellvertretenden SPD-Chefs Wolfgang Thierse mit einer Klarinette bei einem Jazzfrühschoppen bis zum Zementfußbad für den christdemokratischen Pfarrer Rainer Eppelmann.
In der Halbzeitpause kam Wiglaf in die Garderobe gekeucht und bat mich um Entschuldigung: Er sei momentan nicht gut drauf, denn er habe gerade erfahren, daß er wahrscheinlich achtzigtausend Mark Steuern nachzahlen müsse …
Danach lief er trotzdem zu großer Form auf, und wie sehr das Publikum ihn liebte, zeigte sich, als er die zwei schönsten Verse aus einem Gedicht vorlas, das er den Vegetariern gewidmet hatte: »Siehst du eine Taube trudeln: / Laß sie leben. Komm! Iß Nudeln!« Da wurde gejubelt.
Nach der Lesung stürzten wir uns mit mehreren Lesungsbesucherinnen ins Düsseldorfer Nachtleben. Eine von ihnen behauptete, achtzehn Jahre alt zu sein, obwohl sie deutlich jünger wirkte. Nachdem sie fünf oder sechs Glas Whiskey in sich hineingeschüttet hatte, taumelte sie zur Damentoilette und fiel dort in Ohnmacht, wie man uns zutrug, woraufhin Wiglaf die Kabinentür von außen mit einem Fahrtenmesser entriegelte und der jungen Dame Erste Hilfe leistete.
Eine andere unserer Begleiterinnen hatte einen Boxerhund dabei und machte mich zwischen zwei Tequilarunden mit dem Sachverhalt vertraut, daß Boxer Hunde seien, die sich für Menschen hielten, aber irgendwie fanden Wiglaf und ich danach noch relativ zügig ins Hotel.
In Köln bewirtete Hermann Gerdes mich in seiner Wohnung würdig mit Berentzen aus der Kornbrennerei Haselünne und – mir zu Ehren – einer Kiste Jever Pilsener.
»You got old and wrinkled«, sagte er. »I stayed seventeen!«
Doch auch an ihm waren die rund sieben Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Ein wenig eckiger als früher sah er aus.
Von seiner Freundin Marita hatte er sich bereits vor langer Zeit getrennt. »Die hatte irgendwann was mit ’nem Mexikaner, und ich hab das Feld kampflos geräumt und bin seither ein überzeugter Single«, sagte er. »Und du?«
»Ich auch«, sagte ich und verriet ihm, daß es mir sogar geglückt sei, meine alte Freundin Andrea, die sich 1989 von mir getrennt hatte, vier Jahre danach in Frankfurt zu meiner Putzfrau zu machen. »In Heribert Lenz’ und meiner kleinen Männer-WG. Aber wir haben Andrea übertariflich bezahlt, und sie hat mir gesagt, daß sie noch nie ’ne lustigere Putzstelle gehabt habe …«
Beruflich hatte Hermann enorme Fortschritte gemacht. Er war jetzt für ein Unternehmen tätig, das die Kreditwürdigkeit von Firmen in aller Welt prüfte. Seine jüngsten Dienstreisen hatten ihn nach Brasilien und Pakistan geführt. »Du glaubst es mir vielleicht nicht«, sagte er, »aber in Pakistan bin ich einmal von einem Chauffeur, der nur Urdu sprechen konnte, von einer Wüstenstadt in die andere gefahren worden. In allen beiden hat’s riesige Waffenlager gegeben. Und dann hat da am Straßenrand ein nackter Mann gesessen, von dessen Unterarmen und Händen nur noch die Knochen vorhanden gewesen sind …«
»Und der hat noch gelebt?«
»Ja. Der hat da einfach so gesessen und sich seine Knochen angesehen.«
»Dann sollten wir ja wohl dankbar dafür sein, daß wir nicht in der Dritten Welt geboren worden sind.«
»Das sag ich dir.«
Hermanns Eltern erfreuten sich noch immer einer guten Gesundheit, während meine inzwischen gestorben waren. Er könne sich gar nicht vorstellen, wie es sei, ohne Eltern zu leben, sagte er.
Wir drehten eine Runde durch die Stadt und meldeten uns unterwegs von einer Telefonzelle aus bei unserem alten Schulfreund Ralle, von dem Hermann wußte, daß er sich als Arzt in Dortmund niedergelassen hatte, aber Ralle war von unserem Anruf nicht entzückt. »Seid ihr betrunken?« fragte er, obwohl wir nur ganz leicht beschwipst waren. »Und weswegen genau ruft ihr jetzt an?«
Was die Weltpolitik betraf, stimmten wir in vielem überein: Der Säufer Boris Jelzin sollte aufs Altenteil abgeschoben werden, von den Chinesen war auch unter der Herrschaft des Reformers Deng Xiaoping nichts Gutes zu erhoffen, in Zimbabwe hatte der Revolutionär Robert Mugabe alle von uns in ihn gesetzten Erwartungen enttäuscht und eine Autokratie errichtet, in Nicaragua hatte nicht der Sozialismus gesiegt, sondern die Vetternwirtschaft, und für den Nahen Osten sahen wir beide schwarz.
Von Köln fuhr ich nach Hamburg zu Max Goldt, um mit ihm zu dichten, aber er wollte vorher noch mit mir quer durch den Friedhof Ohlsdorf spazieren, wo unter anderem Hans Albers, Gustaf Gründgens, Heinz Erhardt, Wolfgang Borchert, Julius Campe und Karl-Heinz Köpcke begraben lagen.
Wir fuhren in einem über und über mit Graffiti beschmierten Linienbus dorthin und wanderten im Nieselregen zwischen Grüften und Mausoleen umher, bis wir genug davon hatten.
Viel vergnüglicher war es, bei dem einen oder anderen Glas Bier etwas Konsumkritisches zu dichten. Erste Strophe:
Neues Hemd!
Neue Schuh’!
Neue Strümpf’!
Zweite Strophe:
Doch du selbst
bist immer noch
der oder die Alte.
Und:
Koa Sünd gibt’s auf der Alm,
nur Zigarettenqualm.
Wo einst ’s Fensterln uns erfreute,
rauchen jetzt die reichen Leute.
In einem anderen Gedicht sprach Max vom »ornithologischen Wetterfroschdienst« einer niedrig fliegenden und dadurch Regen verheißenden Schwalbe, was mir sehr gut gefiel, und in einem »Zwiegespräch« betitelten Gedicht geißelten wir den Krieg:
Ich bin der Vater aller Dinge,
sagt der Krieg.
Schade nur, daß sie nicht mehr leben,
erwidert Mutter Natur.
Und ob ich noch lebe,
sagt der Krieg
und feuert eine Salve ab.
Unter leben stelle ich mir aber was anderes vor,
erwidert Mutter Natur, bevor sie ächzend stirbt. –
Recht hat die Frau!
Auch am technischen Fortschritt krittelten wir herum:
Auf den Datenhighways
winken uns die Cyberpornolakaien
in die Führerhäuschen ihrer Daten-Brummis …
Doch wie weiter?
»Hier gehen sogar die Codes auf den Strich«, sagte ich und erschauerte vor der Blödheit dieser Aussage, an die sich zwei ebenso blöde Zeilen anschließen ließen:
Schöne neue Welt
der CD-ROM-Gegenwart.
Max rundete das wundervoll ab:
Trotzdem freut sich deine
alte, abgedroschene Mutter
über einen Blumenstrauß.
Nach so vielen feinfühligen Versen zogen wir auch einmal plump über Helmut Kohl her:
Du ewiger Enkel,
was soll das Geplänkel,
das Goethe mit Goebbels vergleichen,
Parteinahme stets für die Reichen,
falsches Stellen der politischen Weichen,
das Aussitzen von Problemen und die Stütze zusammenstreichen?
Zuviel Kohl macht Blähungen, Alter.
Wie fühlt man sich denn so als
Elefant im Porzellanladen Europa?
Alle sollen nach deiner dicken Pfeife tanzen
in diesem unserem Erdteil
(Kontinent Eurasien-West).
You think you’re simply the best.
Doch dich hat Tina Turner nicht gemeint.
Max war dafür, »Tina Türner« zu schreiben statt »Tina Turner«, und das war mir recht.
Aber die Eiserne Lady
wird dir schon noch rechtzeitig einen Tritt
in deinen Saumagen verpassen.
Soviel zum Thema Mantel der Geschichte.
Bitburg, Krakatau, Harrisburg,
Oder-Neiße-Linie abgewürgt,
davor hat dich die Gnade der späten Geburt
nicht bewahren können in diesem unserem Lande,
sehr geehrter Herr Dr.Dr.h.c. Helmut Kohl!
Diesem Gedicht gaben wir die Überschrift »Einem gewissen Politiker aus Oggersheim ins Stammbuch«. Dumpfer ging es nicht.
Immer wieder lachen mußte ich über die Worte »Alle sollen nach deiner dicken Pfeife tanzen«, auch als ich bereits in den Federn lag. Mit seinem Teerkocher hatte Kohl ja tatsächlich seit Jahrzehnten ganz Deutschland den Weg in die Zukunft gewiesen.
Während Max am Montag einen Plattenladen durchstreifte, entnahm ich in einem Café der Fernsehvorschau im neuen Spiegel, daß die Serie Für alle Fälle Fitz am Sonntag enden werde:
Es heißt Abschiednehmen von einer außergewöhnlichen englischen TV-Reihe. Nach dieser Episode mit dem bulligen Polizeipsychologen Fitz (Robbie Coltrane) wird es keine kriminalistische Rückkehr mehr in die sozialen und seelischen Wüsten Liverpools geben. Autor Jimmy McGovern, von dem der Großteil der Geschichten stammt, hält den Plot für auserzählt.
Eine bittere Pille. Aber in meinem Videorecorder wartete ja noch die erste Hälfte des letzten Zweiteilers dieser Serie auf mich, und dann konnte ich mich immer noch auf die zweite freuen …
Aus dem Plattenladen kehrte Max mit einer CD des Musikmärchens »Peter und der Wolf« zurück, nacherzählt von David Bowie, was mich an eine der langweiligsten Stunden meiner Kindheit erinnerte. Mit der Fadheit der Langspielplatte »Peter und der Wolf« konnten sich nur jene schwarzweißen Fernsehstunden messen, in denen die Verschiffung von Konrad Adenauers Leichnam auf dem Rhein gezeigt worden war.
Bei Zanderfilets im Sesammantel klagte Frank Schulz uns abends in einem Restaurant sein Leid: Bereits seit drei Jahren tüftele er an seinem neuen Roman und komme damit nicht weiter.
Wir schlugen ihm vor, mal etwas Kürzeres zu schreiben, aber diesen Rat wies er ab: »Kurz kann ich nun mal nicht!«
Hinterher machte Max in seinem Wohnzimmer noch zwei Flaschen Bier auf, und wir schrieben ein der Völkerverständigung dienendes Gedicht.
Aachen, Trier,
kennen wir.
Pokernde Muselmanen
sitzen im Keller,
von unserer Polizei
gottseidank beschützt.
Wie lange hoffentlich noch?
Sie verpokern ja nicht unsere Renten,
sondern nur ein paar rostige Uralt-Drachmen
Heia Safari!
»Was ist eigentlich der Plural von Ghanaer?« fragte Max.
»Ghanäer«, schlug ich vor, aber Max fand »Ghaneen« besser und schrieb:
Ghaneen blicken durch die verdreckten
Butzenscheiben, ganz friedlich.
»In Ghana pokert man nicht«,
erklären sie uns später freundlich.
Da müssen wir uns staunend schämen.
Am Ende hängten wir noch etwas mit einem anderen Plural an:
Wir laden die Ghanaer auf einen Kirschtee zum Itaker ein.
Hier der Sultan, dort der Kalif, in der Mitte
der Globetrotter mit den freundlich blitzenden Zähnen,
von denen wir nur lachend lernen können.
Viele Farben hat der Mensch ’88.
Das sei mir doch wohl klar, sagte Max, daß alle diese Gedichte im Jahr 1988 spielten.
Ganz angetan war ich von seinem Vorschlag, einmal gemeinsam eine Kur anzutreten. Vier Wochen Rohkost, Selters, Wechselbäder, Schlammpackungen, Liegestütze und Dampfsaunieren im Allgäu oder im Schwarzwald. »So ’ne richtige Generalüberholung …«
Auf der Reise von Hamburg nach Lübeck las ich am Dienstag in der taz, wie Wiglaf ein Zitat des katholischen Geistlichen Joseph Kardinal Ratzinger kommentiert hatte.
Ratzinger:
Die erste Reform, die wir brauchen, ist die, der Botschaft Jesu Christi treuer und ähnlicher zu werden.
Wiglaf:
Willst du sein wie Jesus Christus / Nimm den Hammer, und dann bist du’s!
Und:
Vergiß die langen Nägel nicht / denn du bist kein Leichtgewicht.
Mir selbst war schleierhaft, worin die Botschaft Jesu Christi in der Interpretation des Kardinals Ratzinger eigentlich bestand, wenn man von der Empfehlung der katholischen Kirche absah, niemals ohne Zeugungsabsicht zu vögeln. Von der Feindesliebe, dem Hinhalten der anderen Wange und dem Armutsgelübde hatten Ratzingers Glaubensbrüder sich ja schon im frühen Mittelalter losgesagt.
Als ich mich im Lübecker Pressezentrum einfand, reichte Wiglaf mir ein Flugblatt, in dem gegen unsere für diesen Abend vorgesehene Lesung protestiert wurde:
Wir fordern das Lübecker Pressezentrum nachdrücklich auf, die Veranstaltung mit dem Frauenhasser, Verharmloser sexueller Gewalt und – schlicht und ergreifend – sexistischen Kotzbrocken Wiglaf Droste abzusagen!
Für den Fall der Zuwiderhandlung erinnerten die Verfasser an einen anderen Lesungsboykott:
In Kassel kippten Frauen und Männer Scheiße vor seinen Lesungsort.
Unterstützt wurde dieser Protest, wie ich hörte, von einem Verein namens »Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.« und einer obskuren »Initiative für unkonventionelle Bewegungen« sowie vom Parteivorstand der Bündnisgrünen in Lübeck.
An der Kasse lag ein offener Brief an das »Bündnis gegen eine Lesung im Pressezentrum mit Wiglaf Droste« und die kommunalen Bündnisgrünen aus, in dem die Angestellten und die Geschäftsleitung des Pressezentrums den Zensoren ausführlich widersprachen. Unter anderem hieß es da:
Wohin soll solches Handeln führen? Werden wir morgen von einem neuen Bündnis aufgefordert, angeblich »sexistische« Literatur zu entfernen? Müssen wir uns dann vor Autonomen fürchten, die anfangen, Bücher von Charles Bukowski, Henry Miller, Vladimir Nabokov: Lolita und James Joyce: Ulysses (war da nicht ein Pornografievorwurf im Jahre 1920?) oder eben auch Wiglaf Droste in unserem Geschäft zu beschädigen, zu zerreißen, auf der Straße eine Mahnwache mit einem kleinen Buchfeuerchen entfachen?
Mit etwas Weißwein tranken wir uns in einem oberhalb des Pressezentrums gelegenen Zimmer etwas Mut an. Vom Fenster aus war unten aber nur ein drei oder vier Personen starkes Häuflein von Demonstranten zu erspähen.
Funny van Dannen habe es richtig gemacht, sagte Wiglaf. »Der ist nach einem unserer Auftritte mal auf die Wüteriche zugegangen, um ihnen zu gratulieren: ›Ich finde das ganz, ganz toll, daß ihr jungen Menschen den Mut habt, euch politisch zu engagieren!‹ Da waren sie natürlich völlig verdattert …«
Von Wiglaf erfuhr ich auch, daß die Veranstalter vorgehabt hätten, uns in ein Doppelzimmer zu stecken. Das habe er aber abbiegen können.
Schön war’s in Lübeck und schön auch wieder daheim, wo seit Sonntag auf Video die neue Folge von Für alle Fälle Fitz auf mich wartete. Da sah man Fitz in seiner verquarzten Praxis bei dem Versuch, einer Klientin die Nennung zwanzig guter Eigenschaften ihres Ehemannes abzuringen. Sie kam jedoch gerade mal auf vier, brach das Experiment ab, drückte Fitz fünfzig Pfund in die Hand und bedankte sich bei ihm dafür, daß er ihr die Augen geöffnet habe.
Als Fitz auch dem wütenden, von seiner scheidungswilligen Ehefrau enttäuschten Detective Chief Inspector Charlie Wise den Rat gab, zwanzig gute Eigenschaften seiner Frau aufzuzählen, wurde Wise klar, von wem sie gegen ihn aufgehetzt worden war.
Wise: »Genau das hat sie gesagt! Zwanzig gute Eigenschaften, und sie wußte nur vier!«
Fitz (entgeistert): »Wer sagt das?«
Wise (ihm ein Foto von sich und seiner Frau vorzeigend): »Sie sagt das! Renee Wise, verdammt!«
Fitz: »Ach du Scheiße …«
Wise: »Fünfzig Pfund die Stunde! Du hast wohl den Arsch offen! Du bist gefeuert! Los, hau ab! Mach, daß du wegkommst!«