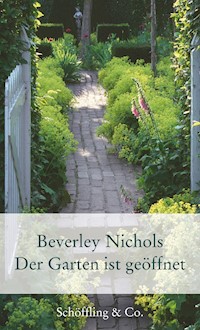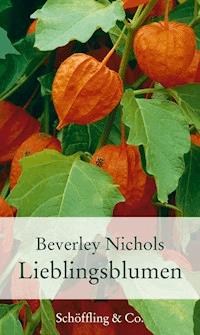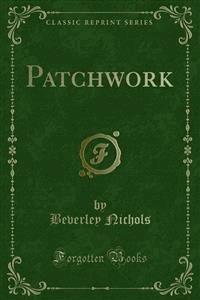3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Er erpreßt seinen Partner mit einem Mord, den dieser gar nicht begangen hat. Und als das «Opfer» plötzlich wiederauftaucht, gerät er in tödliche Panik … Horatio Green, der berühmte Detektiv, leuchtet hinter die Kulissen dieses Mörder-Theaters – und ihm bleibt der Atem weg … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Ähnliche
Beverley Nichols
Mord im Dreivierteltakt
Aus dem Englischen von Karin Holm
FISCHER Digital
Inhalt
1
»Der makaberste Mord des Jahrhunderts.« So nannte ihn der Kriminalreporter des Seabourne Herald in der Morgenausgabe des darauffolgenden Tages, und die kleine Schar erschreckter Fremder, die sich in den Fall hineingezogen sahen, wären die letzten gewesen, die an dieser Bezeichnung etwas auszusetzen gehabt hätten.
Makaber. Das war das richtige Wort. Kein anderes hätte besser gepaßt. Dieser Mord wirkte so wohlüberlegt düster, als wäre er von einem Schriftsteller für das Grand Guignol geschrieben worden.
Und doch hätte man sich keinen englischeren Schauplatz vorstellen können. Der große Pier von Seabourne ist gleichsam eine kleine Welt für sich, die sich zusammensetzt aus den Überbleibseln des elisabethanischen England. Von den vielen farbigen Lichtern strahlend hell erleuchtet, streckte der Pier seinen juwelenbesetzten Arm in die dunklen Wellen hinein. Von den Drehkreuzen auf der Promenade, die der hereinströmenden Menschenmenge wegen klapperten wie Kastagnetten, bis zur eine Viertelmeile entfernt liegenden rosabeleuchteten Konzerthalle war lärmende Musik zu vernehmen: Trompetengeschmetter und Violinengeschluchze, abgehackte Jazzklänge aus dem Tanzpalast, silbernes Klingeln des Musikkastens aus der Automaten-Arkade. Alle diese Melodien stießen aufeinander und bekämpften sich in wildem Durcheinander, und doch empfand man sie, dank des immerwährenden Rauschens der See, als eine seltsame Harmonie.
Es war wohl diesem unaufhörlichen Auf und Ab der Musik, die in jeder Bude und in jeder Galerie widerhallte, zuzuschreiben, daß an jenem schicksalsschweren Tag keiner der Passagiere der Geisterbahn mit völliger Sicherheit behaupten konnte, den Schuß gehört zu haben. Und auch wenn jemand ihn tatsächlich gehört hätte, wäre seine Aussage doch von zweifelhaftem Wert gewesen; denn die Geisterbahn lief neben einer Schießbude aus, wo die fröhlichen jungen Männer von Seabourne beim andauernden Knattern der Gewehrsalven ihre Geschicklichkeit an farbigen Zelluloidbällen übten, die auf emporschießenden Wasserstrahlen tanzten.
Die Geisterbahn liegt am Ende des Piers, gegenüber der Konzerthalle; links von ihr steht die Schießbude und rechts die Hütte der Phrenologin Madame Tamara. Die Bahn befindet sich in einem langen, einer bemalten Scheuer ähnlichen Holzbau, dessen Rückseite der See zugewendet ist. Ihr Geleise schlingt unzählige Schleifen und überschneidet sich so oft, daß ihre Passagiere eine lange Fahrt zu machen glauben, obgleich die ganze Länge des Baus kaum zwanzig Meter beträgt.
Es gibt nur einen Eingang – durch das Drehkreuz. Man bezahlt einen Shilling, betritt einen Bahnsteig und wartet dort, bis die Bahn aus dem Karton-Tunnel heransaust und die kreischenden und laut lachenden jungen Leute, die ihre Kleider zurechtzupfen und ihr Haar glätten, ablädt. Mit Mühe und Not erwischt man einen freien Platz, und los geht’s.
In jener betreffenden Nacht – man schrieb den zwanzigsten August – war jeder Wagen voll besetzt. Der Kassierer Bill brauchte sich nicht aus seiner Glaskabine hinauszulehnen, um der Menschenmenge zuzurufen: »Hereinspaziert, hereinspaziert!« und schaurige Andeutungen über die Schrecken, die ihrer warteten, fallenzulassen; er war viel zu sehr damit beschäftigt, das Kleingeld abzuzählen. Und Mac, der Betreuer der Maschinen, der mit seinen Spannern und Schraubenziehern schwitzend unter den stöhnenden Fußplanken herumhantierte, schwor sich, Gehaltsaufbesserung zu verlangen, wenn noch mehr solche Nächte kommen sollten.
Genau fünf Minuten nach neun Uhr ertönte er – der Schrei, der allen Lärm verstummen ließ. Er klang so schrill, so tierisch in seinem Entsetzen, daß er den Höllenspektakel der Musik und des Gelächters noch übertönte und Bill zu Mac hinunterrief: »Schalte den Strom aus!« Als Bill auf den Bahnhof stürzte, sah er, daß er richtig gehandelt hatte. Das Mädchen, das schrie – wollte es denn nie mehr aufhören? –, stand im hintersten Wagen der Bahn, die Hände an den Mund gepreßt, und starrte reglos vor Entsetzen auf den Körper einer Frau, die zusammengesunken, mit seitwärts hängendem Kopf, im Sitz neben ihr lag. Ein scharlachroter Fleck verbreitete sich rasch über die weiße Satinbluse der Toten. Sie sah aus wie eine billige Puppe, über die jemand rote Tinte ausgegossen hatte.
»Ich will sie zu Hause haben, ich will sie zu Hause haben!« schluchzte der kleine Mann und streckte die Hand nach der Segeltuchplane aus, die man über ihren Körper geworfen hatte.
»Tut mir sehr leid, Mr. Fothergill.« Die rauhe Stimme des jungen Konstablers klang, als meine er wirklich, was er sagte.
»Tut mir leid. Aber es ist unmöglich, ganz einfach unmöglich.«
»Sie war meine Frau«, sagte der kleine Mann beharrlich. »Es ist nicht recht, sie wegzubringen, und schon gar nicht an einen solchen Ort!«
Es war fünfundzwanzig Minuten später, und die Dinge gingen rasch vonstatten. Die tote Frau war als Gattin Henry Fothergills identifiziert worden, der nun, neben der Leiche kniend, erbärmlich schluchzte. Er wohnte schon seit langer Zeit in Seabourne und beaufsichtigte die Automaten auf dem Pier. Er war ein ganz und gar unauffälliger Mensch, klein und farblos, mit einem schwachen Kinn und blassen, vorstehenden Augen.
Das Mädchen, das geschrien hatte, als der Zug ins Licht der Neonröhren – und damit auch ins Licht der Öffentlichkeit – gerasselt war, hieß Doris Eyre und war Stenotypistin in Hammersmith, von wo aus sie einen Tagesausflug nach Seabourne unternommen hatte. Sie hatte nicht das geringste über das Verbrechen auszusagen, da sie überhaupt nichts damit zu tun hatte.
Bei der kleinen Gruppe, die in Erwartung der Ambulanz herumstand, befand sich auch ein Mann von ungefähr sechzig Jahren, ein Dr. Mickleham, der in der Nähe der Geisterbahn herumgeschlendert war, als diese den schicksalhaften Tunnel verlassen hatte. Alles an Dr. Mickleham war glatt und weich, angefangen bei seiner gepflegten Mähne bis hinunter zu den Lackschuhen. Die Untersuchung von Leichnamen des unteren Mittelstandes war nicht seine Spezialität; seine Tätigkeit bewegte sich in anderen, einträglicheren Bahnen; aber er hätte nicht gut über ein Unglück hinwegsehen können, das sich direkt vor seiner Nase ereignete. So hatte er denn seine Dienste angeboten, die allerdings bereits überflüssig waren. Sogar ein Kind hätte einen solchen Fall diagnostizieren können: sofortiges Eintreten des Todes, verursacht durch einen Schuß ins linke Ohr.
Dr. Mickleham trat zu Traill, dem jungen Konstabler. Er empfand die Nähe des tränenreichen Mr. Fothergill als ziemlich unangenehm. »Wann erwarten Sie den Kommissar?« begann er, sah aber gleichzeitig, daß seine Frage bereits beantwortet war. Kommissar Cobb durchschritt soeben die Schranke, gefolgt von zwei Männern der Ambulanz. Traill ging zu ihm und sprach leise auf ihn ein. Cobb nickte, blickte zu Mr. Fothergill hinüber und stieß einen Seufzer aus. Er war nur allzu vertraut mit solchen Umständen, da verstörte Verwandte um den Besitz des geliebten Körpers kämpften. Er trat zu dem kleinen Mann, legte ihm die Hand auf die Schulter und klärte ihn freundlich, aber bestimmt über die Maßnahmen auf, die in solchen Fällen vom Gesetz vorgeschrieben sind: von der Überbringung des Leichnams ins Leichenhaus bis zu der Leichenschau durch den Pathologen und schließlich dem Urteil des Kronrichters. Er sprach absichtlich mit eintöniger und gedämpfter Stimme, und zwischendurch gab er den Ambulanzführern ein Zeichen, auf das hin sie lautlos die Bahre hoben und davonschlichen.
Mr. Fothergill widersprach nicht mehr. Er schien wie betäubt zu sein, und wahrscheinlich hatte er es gar nicht erfaßt, daß die Männer seine Frau weggetragen hatten.
Dann fuhr er plötzlich auf. »Weshalb unternehmen Sie nichts?« schrie er. »Weshalb verfolgen Sie ihn nicht?«
»Wen denn?«
»Doyle, so hieß er. Julian Doyle. Den Mann, mit dem sie heute abend zusammen war.«
Cobb warf Traill einen scharfen Blick zu. »Was meint er damit?«
»Wie kann ich das wissen, Sir?« erwiderte Traill. »Er erwähnt den Namen zum ersten Mal.«
Cobb wandte sich wieder an Fothergill. »Woher wissen Sie, daß sie mit diesem Mann zusammen war?«
»Weil sie es mir sagte.«
»War er unter den Passagieren der Geisterbahn? Hat ihn jemand gesehen?«
Traill schaltete sich ein. »Alle Passagiere stoben auseinander wie erschreckte Kaninchen, sobald sie sahen, was geschehen war. Ausgenommen diese junge Dame hier.« Er wies auf die tränenüberströmte Doris Eyre.
»Sie war bestimmt mit Doyle zusammen«, wiederholte Fothergill. »Sie sagte es mir.«
»Wissen Sie etwas über ihn? Wo könnte man ihn finden?«
»Natürlich kenne ich ihn. Er ist Nigel Fleets Klavierbegleiter.«
»Du mein Gott!« Der Ausruf kam von dem geschniegelten Dr. Mickleham. Der Name des berühmten Nigel Fleet, des leuchtenden Sterns am Firmament der Unterhaltungskünste, ließ ihn die Ohren spitzen. »Du mein Gott!« wiederholte er. »Mr. Fleet ist einer meiner Patienten. Und ich glaube, ich habe auch Mr. Doyle einmal kennengelernt.«
Cobb nickte kurz. Er rief Traill zu sich und gab ihm Anweisungen. Der junge Mann salutierte schneidig, schwang sich über die Schranke und verschwand in der Dunkelheit. In diesem Augenblick vernahm Cobb einen Laut, als hätte jemand einen Sack Mehl fallen lassen. Er drehte sich um und sah, daß Mr. Fothergill ohnmächtig geworden war.
Nun war es gut, daß Dr. Mickleham hier war und seine kleine Tasche bei sich trug. Es war auch gut, daß er den von Cobb befürchteten hysterischen Anfall Fothergills verhindern konnte, als dieser wieder zu sich kam. Aber da Fothergill ein schwächlicher Mann war, dauerte es mehr als eine halbe Stunde, bis der Arzt ihm erlaubte, den Kommissar auf die Polizeiwache zu begleiten.
Cobb blickte auf die Uhr, als er der zusammengesunkenen Gestalt seinen Arm bot. Viertel nach zehn. Die selige Mrs. Fothergill befand sich nun seit genau einer Stunde und zehn Minuten in der anderen Welt. Der Mörder, der sie dorthin befördert hatte, war ihnen ein gutes Stück voraus. Er erinnerte sich des ersten Satzes in dem klassischen Werk seines Helden, Mr. Horatio Green:
Nach der Begehung eines jeden Verbrechens sind die Entdeckungen der ersten vierundzwanzig Stunden vermutlich ergebnisreicher für den Untersuchenden als die der nächsten vierundzwanzig Monate.
Sie mußten sich also beeilen.
Er umfaßte Mr. Fothergills Arm fester und beschleunigte seine Schritte. Der Arzt trippelte, seine Tasche schwingend, hinter ihnen her; seine Lackschuhe spiegelten die schimmernden Lichter wider.
Das Licht in Kommissar Cobbs Büro war erbarmungslos; es fiel aus einer Kugel an der Decke auf die Gesichter der Männer und verlieh ihnen eine kreidige Blässe. Mr. Fothergill sank auf einen Stuhl und bedeckte mit zitternder Hand seine Augen. Cobb bemerkte es und löschte das Licht. Nun brannte nur noch das Licht unter dem weichen grünen Lampenschirm auf seinem Schreibtisch.
»Mr. Fothergill«, sagte er, »es ist mir sehr unangenehm, aber wir müssen nun darüber reden.«
»Darüber reden!« Fothergill rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. »Und während wir darüber reden, kann er uns entwischen, und wir werden ihn nie zu fassen kriegen …«
»Hören Sie, Mr. Fothergill, wir sitzen nicht nur hier und reden. Dieser Mann, von dem Sie sagen, er sei heute abend mit Ihrer Frau zusammengewesen …«
»Er ist mit ihr zusammengewesen …«
»Das muß erst bewiesen werden. Und wenn es wirklich stimmt, habe ich nicht die geringsten Zweifel, daß wir ihn finden werden. Eben jetzt verfolgen zwei meiner besten Männer seine Spur. Wenn wir ihn heute abend nicht finden, werden wir Scotland Yard hinzuziehen. Mehr können Sie gewiß nicht verlangen.«
Fothergill seufzte und sank in seinen Stuhl zurück. »Es tut mir leid«, stammelte er. »Es ist nur so hart für mich, einfach stillzusitzen.«
»Ich verstehe Sie sehr gut. Ich werde es so kurz wie möglich machen.« Er langte nach einem Notizblock auf seinem Schreibtisch. Es standen bereits einige Notizen in Traills Handschrift darauf.
»Ich möchte vorläufig nur einige Tatsachen festhalten. Berichtigen Sie mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage.« Er las vor: »Henry Fothergill, 45 Jahre alt, wohnhaft Shingle Road 9, Seabourne. Stimmt das?«
»Ja.«
»Angestellt auf dem Pier zur Betreuung der Automaten …«
Mr. Fothergill setzte sich mit einem Ruck gerade auf und räusperte sich. Auch in seinem großen Schmerz wußte er, was er seiner Würde schuldig war: »Oberaufseher der automatischen Unterhaltungsapparate, wenn wir schon genau sein wollen.«
»Verzeihung.« Cobb gab vor, etwas auf das Papier zu kritzeln.
»Und das bin ich seit zwanzig Jahren, im kommenden Oktober. Ich begann als Junge bei den Schokolade-Automaten.«
»Gut. Und heute abend taten Sie die ganze Zeit über Dienst?«
»Jawohl.«
Cobb starrte auf den Notizblock. »Es ist sehr schmerzlich für Sie, aber ich muß Sie nun über Ihre Frau befragen.«
Fothergill rutschte auf seinem Stuhl herum. »Fangen Sie an«, sagte er. »Ich kann es ertragen. Ich denke, es muß sein.«
»Die Notizen hier besagen, daß sie zweiunddreißig Jahre alt war …«
»Dreiunddreißig. Sie war nur zwölf Jahre jünger als ich.«
»Dreiunddreißig. – Weiter, daß Sie seit zwei Jahren verheiratet waren.«
»Aber seit zehn Jahren verlobt. Wir hatten die ganze Zeit vor zu heiraten, und auch unsere Familien waren damit einverstanden, aber irgendwie kam immer wieder etwas dazwischen.«
»Verzeihen Sie die offene Frage: Führten Sie eine glückliche Ehe?«
»Sie war so glücklich wir nur möglich.«
»Was meinen Sie damit?«
Mr. Fothergill seufzte. »Ich mit meinem Aussehen bin alles andere als ein guter Fang. Und Rose – nun, sie war eine hübsche Frau.«
»Meinen Sie damit, daß sie andere Männer hatte?«
»Nein, Sir, bestimmt nicht. Rose flirtete vielleicht oft ein bißchen, aber sie … sie mochte mich gern, zutiefst in ihrem Herzen. Und sie achtete ihr Ehegelöbnis. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr sie auf einer richtigen weißen Hochzeit bestand. Und wenn sie’s nun mal ein wenig zu weit zu treiben schien, machte ich keine große Sache daraus.«
»Wann erwähnte sie Julian Doyle zum ersten Mal?«
»Das war letzten Dienstag. Rosie war schon immer versessen aufs Theater. Früher dachte sie mal daran, Schauspielerin zu werden, aber es kam nie dazu. Sie las immer den Theaterklatsch in den Zeitungen, schnitt Bilder heraus und so weiter. Als sie hörte, daß Nigel Fleet nach Seabourne käme, wollte sie unbedingt hingehen. Ich mußte ihr eine Eintrittskarte kaufen, sonst hätte sie mir keine Ruhe gelassen.«
Der Kommissar nickte verständnisvoll. Mr. Fothergill war nicht der einzige Gatte in Seabourne, der Grund hatte, die Ankunft Nigel Fleets zu scheuen.
»Ich kaufte ihr also eine Karte, und sie ging hin.«
»Allein?«
»Ja. Ich hatte Dienst. Und auch wenn ich frei gewesen wäre, hätte ich für mich nicht soviel Geld verschwenden wollen.«
»Weiter bitte.«
»Als sie zurückkam, war sie schrecklich aufgeregt. Ich habe sie seit Jahren nie so gesehen. Nicht, seit …« – er hielt inne und zerrte verlegen an seinem Taschentuch – »… nicht, seit sie an jenem Abend zurückkam … nachdem wir geglaubt hatten, sie erwarte ein Baby. Aber das gehört nicht hierher.« Er straffte mit offensichtlicher Anstrengung die Schultern.
»Ich fragte sie, wie die Vorführung gewesen sei, und sie sagte, wundervoll, und dann sagte sie: ›Was glaubst du, wen ich auf der Bühne gesehen habe? Julian Doyle persönlich, als Klavierbegleiter Nigel Fleets.‹ Da fragte ich sie natürlich, wer dieser Julian Doyle sei, und sie antwortete: ›Sei nicht albern, ich habe dir doch schon erzählt, daß wir früher mal befreundet gewesen sind. Damals, als ich noch Krankenpflegerin war.‹ Sie war eine diplomierte Pflegerin, nur übte sie ihren Beruf seit einiger Zeit nicht mehr aus.«
»Einen Augenblick.« Cobb beugte sich vor. »Hatte sie Ihnen wirklich einmal erzählt, sie habe ihn schon früher gekannt?«
Fothergill kratzte sich am Kopf. »Ganz sicher bin ich nicht. Es scheint mir nur, sie erwähnte diesen Namen einmal. Sie können sich denken, daß nichts Ernsthaftes dahintersteckte, sonst würde ich mich erinnern.«
»Fragten Sie sie nach Einzelheiten?«
»Ja. Ich fragte sie, wo sie sich kennengelernt hätten, und sie zuckte die Achseln und sagte, als sie Krankenpflegerin war.«
»Als sie Krankenpflegerin war. Das kann viel heißen. Sagte sie es so, als hätte sie ihn selbst gepflegt?«
»Sie sagte nichts Derartiges. Nur daß sie ihn schon früher gekannt habe.«
»Und auf Grund dieser früheren Bekanntschaft ging sie dann zum Bühneneingang und sprach ihn an?«
»So erzählte sie es.«
»Sagte sie, wie er sie empfing? Ob er sich ihrer erinnerte?«
Fothergill wandte sich rasch um. »Weshalb stellen Sie mir alle diese Fragen?«
»Aus einem ganz einfachen Grund, Mr. Fothergill. Innerhalb kürzester Zeit hoffen wir, diesen Mr. Doyle befragen zu können. Und als erstes werden wir festzustellen versuchen, ob seine Geschichte mit der Ihren übereinstimmt. Mit anderen Worten: Die Fragen, die wir ihm stellen werden, hängen größtenteils von Ihren Antworten auf unsere Fragen ab. Ist Ihnen das klar?«
»Verzeihung. Ja, das ist mir klar. Wenn ich mich nur besser erinnern könnte!«
»Ich will Ihnen dabei ein bißchen zu helfen versuchen. Als sie zum Bühneneingang kam, ließ sie sich da melden?«
»Nicht daß ich wüßte. Sie sagte nur, sie hätte draußen gewartet.«
»Bat Doyle sie in seine Garderobe, als er sie sah?«
»Darüber sagte sie nichts. Weshalb hätte er es auch tun sollen? Sie sind auf der falschen Fährte. Sie wollte ihn nur sehen, weil er beim Theater ist. Schon daß sie am Bühneneingang mit ihm schwatzen durfte, ließ ihr Herz schneller schlagen. Und sie hätte ja sogar Nigel Fleet selber begegnen können.«
»Das war nicht der Fall?«
»Daß sie Nigel Fleet begegnet ist?« Zum ersten Mal während des Gesprächs lächelte er. »Das ist ungefähr das einzige, was ich sicher weiß, dann hätte ich nämlich von der ganzen Sache überhaupt nichts zu hören bekommen.«
»Soviel wir wissen, waren bei diesem Zusammentreffen keine Zeugen zugegen, nicht wahr?«
»Der Bühnenreporter war doch bestimmt dort.«
»Nicht unbedingt; sie hat sich ja nicht melden lassen. Aber das können wir nachprüfen. Und nun, Mr. Fothergill, sind Sie sicher, daß Sie sich an nichts anderes mehr erinnern?«
Der kleine Mann schüttelte den Kopf.
»Sah sie ihn nicht wieder zwischen letztem Dienstag und heute abend? Nein? Wie können Sie das so sicher wissen?«
»Ganz einfach, weil ich meine Rosie kannte«, antwortete er.
»Ich wußte immer, wenn jemand zwischen uns war. Aber das war diesmal nicht der Fall.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Dann sagte Fothergill: »Warten Sie mal. Als ich ihr heute morgen den Abschiedskuß gab, sagte sie so etwas wie: Sie hoffe, er werde nicht grob zu ihr sein.«
»Welch merkwürdiger Ausdruck! Was meinte sie damit?«
»Weiß der Himmel!«
»Erinnern Sie sich an die genauen Worte?«
»So ähnlich wie: Sie hoffe, er werde nicht grob zu ihr sein und ihr nicht den Kopf abbeißen.«
Der Kommissar zog verblüfft die Brauen zusammen. Dann machte er achselzuckend eine letzte Notiz.
Es klopfte an der Tür.
»Herein!«
Traill kam ins Zimmer und schlug die Absätze zusammen.
Fothergill sprang von seinem Stuhl auf. »Haben Sie ihn?«
Traill blickte von Fothergill zu seinem Chef und sagte zu diesem: »Doyle ist nach London gefahren. Mit dem Zehnuhrdreißigzug.«
»Ich hab’s Ihnen ja gesagt!« schrie Fothergill. »Er ist Ihnen entwischt.«
Cobb klopfte scharf auf sein Pult. »Bitte, Mr. Fothergill. So helfen Sie uns kein bißchen. Und Sie helfen auch … ihr nicht.« Die ruhige Autorität in seiner Stimme ließ Fothergill verstummen.
Cobb wandte sich zu Traill. »Hat Doyle eine Londoner Adresse?«
»Jawohl, Sir. Er hat eine Wohnung in Chelsea.«
»Hoffen wir, daß er dort ist.« Cobb streckte die Hand nach dem Telefon aus.
Traill deutete diese Bewegung richtig; sein Chef gedachte, Scotland Yard hinzuzuziehen. Der Konstabler trat einen Schritt nach vorn. »Ich könnte den Elfuhrfünfzigzug nehmen«, stieß er schwer schluckend hervor.
»Daran zweifle ich.« Cobb blickte auf seine Uhr. »Es ist schon zwanzig vor zwölf. Und auch wenn Sie ihn erwischten, könnte es doch schon zu spät sein.«
»Es wird zu spät sein«, murmelte Fothergill.
Cobb beachtete den Einwurf und Traills flehenden Blick nicht. Einige Minuten später sprach er bereits mit Scotland Yard. Die Jagd hatte begonnen.
2
»Das ist ein bißchen stark«, brummte Kommissar Waller.
»Ausgerechnet jetzt, da ich meinen Urlaub antreten wollte, bekomme ich einen solchen Fall an den Hals.«
Auch sein junger Assistent, Polizeiwachtmeister Bates, fand es ein bißchen stark, daß sein Chef nicht wie jeder vernünftige Mensch in Urlaub ging und die Angelegenheit ihm überließ. Dann klingelte das Telefon, und Bates nahm den Hörer ab. »Ihr Wagen wartet unten, Sir«, meldete er.
Waller eilte ihm voran die Treppe hinunter. Auf der Fahrt nach Chelsea ging er in Gedanken noch einmal durch, was die Polizei von Seabourne Bates mitgeteilt hatte. Eine unbedeutende Frau war in der Dunkelheit erschossen worden. Ihr ebenso unbedeutender Mann hielt einen gewissen Doyle für den Täter, auf Grund der Annahme, daß Doyle die Frau am Abend hätte treffen sollen – eine Annahme, für die es keinen Beweis gab als das Wort des Ehemannes. Der ganze Fall war recht unklar und langweilig. Das einzig Interessante daran war Doyles Beziehung zu Nigel Fleet, wodurch die Sache automatisch auf den Titelseiten der Zeitungen erscheinen würde. Fleet nahm in der Öffentlichkeit einen so hervorragenden Platz ein, daß alle, die sich in seiner Nähe bewegten, von dem ständig auf ihn gerichteten Scheinwerferlicht ebenfalls erfaßt wurden.
Obwohl es erst kurz nach Mitternacht war, hatte Waller bereits alle Räder der großen Maschine von Scotland Yard in Bewegung gesetzt, um die kleinste strafbare Spur aus Doyles Vergangenheit aufzustöbern. Es gab keine solche. Trotzdem hatte er jeden nur erdenklichen Ausgang der gesamten Insel bewachen lassen, um Doyle abfangen zu können, falls der plötzlich Lust verspüren sollte, den Kanal zu überqueren.
Plötzlich hielt der Wagen mit einem Ruck an. Sie waren in der Oakley Street angelangt. Als Waller ausstieg, sah er, daß in einem Fenster des Erdgeschosses hinter den zugezogenen Vorhängen noch ein gedämpftes Licht brannte.
Er drückte auf den Klingelknopf unter dem Namen Julian Doyle und wartete. Die Straße war sehr ruhig, und es hatte zu regnen begonnen.
Die Tür wurde aufgerissen; im Halbdunkel erkannte Waller einen jungen Mann mit schwarzem, zerzaustem Haar, der ihn anblinzelte, als wäre er soeben aus dem Schlaf aufgestört worden. Seine Hände steckten in den Taschen seines alten, buntgestreiften Schlafrocks, und er schien nicht allzu sicher auf den Füßen zu stehen.
»Was zum Teufel …?« begann er.
»Mr. Doyle?« unterbrach ihn Waller.
»Jawohl. Aber ich möchte wissen …«
Waller schnitt ihm das Wort ab. »Wir sind Polizeibeamte«, sagte er. »Und wir möchten Sie etwas fragen.«
»Wenn es sein muß«, erwiderte Doyle gelangweilt.
Er führte sie den Korridor hinunter und zu einer rechts liegenden Tür. Als Waller eintrat, sah er mit Staunen, wie groß dieses Studio war. Es mußte mindestens zwölf Meter lang sein, und ein riesiger Spiegel an der gegenüberliegenden Wand ließ es noch länger erscheinen. Es waren nur einige Möbel da: ein großer Flügel, ein Büfett, ein Diwan, ein oder zwei Tische und ein Wandschirm, der das Waschbecken verbarg. Trotzdem bot das Zimmer einen Anblick entsetzlicher Unordnung; eine Unmenge Notenpapier und Musikhefte bedeckte den Flügel und lag verstreut längs der Wände, unter den Tischen und auf den Fensterbänken.
Im ganzen Raum gab es nur zwei Gegenstände von persönlicher Bedeutung oder verschönernder Wirkung. Sie standen auf dem Kaminsims. Der eine war eine Büste, die Waller als diejenige Beethovens erkannte. Der andere war ebenfalls eine Büste, die einen älteren Mann mit blicklosen Augen darstellte. Ja, es mußte die Büste eines Blinden sein; der Bildhauer hatte dies vorzüglich zum Ausdruck gebracht. Ein sehr schönes Gesicht, fand Waller. Vielleicht das eines Heiligen. Es paßte so wenig zu seiner Umgebung!
»Trinken Sie etwas?« fragte Doyle.
»Nein, danke.«
Er schenkte sich ein Glas Whisky ein und warf sich auf den Diwan. Er bot den beiden Männern keinen Stuhl an.
»Und nun«, sagte er, »würden Sie mir vielleicht erklären, was das alles zu bedeuten hat?«
»Gewiß. Kennen Sie eine Mrs. Rose Fothergill?«
»Ich kenne kein weibliches Wesen dieses Namens. Es ist ein sehr gewöhnlicher Name.«
»Sind Sie sicher?«
»Vollkommen. Warum?«
»Weil Rose Fothergill heute abend auf dem Pier in Seabourne ermordet worden ist.«
Doyle hob seine Augenbrauen. »Tatsächlich? Und was geht das mich an?«
»Wir haben Grund anzunehmen, daß sie heute abend mit Ihnen zusammen war.«
Doyles Augenbrauen hoben sich noch mehr. Sonst war ihm keinerlei Gemütsbewegung anzusehen. »Das ist ganz unmöglich.«
»Können Sie uns sagen, wo Sie um neun Uhr waren?«
»Gewiß. Ich war beim Pier. Oder, besser gesagt, darunter.«
Waller blickte ihn fragend an, und Doyle antwortete ihm mit einem unverschämten Lächeln. »Bei Ebbe gibt es dort unten einige hübsche Plätzchen im Sand. Und außerdem ist es finster wie in einem Walfischbauch. Merken Sie sich diesen Ort.«
»Waren Sie allein?«
»Mein lieber Herr, würden Sie allein im Stockfinstern unter einem Pier sitzen?«
»Können Sie uns den Namen Ihrer Gefährtin mitteilen?«
»Nein, das kann ich nicht. Ich hatte keine Zeit, sie danach zu fragen. Ich weiß nur, daß sie Französin war. Und zwar so französisch, wie eben nur eine Französin sein kann.« Plötzlich lachte er leise vor sich hin. »Ich muß sagen, es wäre komisch, wenn sie Rose geheißen hätte. Sie könnte vielleicht sogar Ihre Rose gewesen sein. Aber ich denke, das ist unmöglich; Ihre Mrs. Sowieso klingt typisch englisch.«
»Mrs. Fothergill war Engländerin, das stimmt. Würden Sie uns einen Tip geben, wie wir Ihre Freundin ausfindig machen könnten?«
»Ich gab ihr meine Karte, und sie sprach vage davon, sie würde mich einmal anrufen. Ich glaube jedoch nicht, daß sie es tun wird. Ich weiß auch nicht, ob es mir lieb wäre.«
»Es wäre für Sie sehr nützlich, Mr. Doyle, wenn sie es täte.«
»Nützlich? Wollen Sie damit wirklich sagen, daß …« Er hielt inne, dann erhob er sich rasch. Zum erstem Mal schien er den Ernst der Lage zu erfassen.
»Wer war denn diese verdammte Frau? Und weshalb glauben Sie, ich hätte etwas mit ihr zu tun gehabt?«
»Wir haben die Aussage ihres Gatten.«
»Wer ist er? Darf man das erfahren?«
»Er ist der Oberaufseher für die Automaten am Ende des Piers.«
»Ich war noch nie dort. Was sagt dieser Herr Gemahl?«
»Er sagt, daß seine Frau letzten Dienstagabend ziemlich aufgeregt von einer Vorführung im Regency-Theater zurückkam und ihm erzählte, sie hätte beim Bühneneingang auf Sie gewartet …«
»Weshalb soll sie das getan haben?«
»Sie sagte, sie hätte Sie früher einmal kennengelernt.«
»Früher einmal? Wo? Wann?«
»Das sagte sie nicht. Es muß zu der Zeit gewesen sein, als sie noch ihren Beruf als Krankenpflegerin ausübte. Bringt Sie das weiter?«
»Nein. Die einzige Krankenpflegerin, die ich kannte, war die, die mich als Kind nach meiner Blinddarmoperation pflegte. Diese Rose war wohl ein bißchen verdreht. Was sagte sie sonst noch?«
»Daß Sie herauskamen und mit ihr plauderten und eine Verabredung für heute abend mit ihr trafen.«
»Warum? Suchte sie eine Stelle oder so was?«
»Wir wissen darüber so wenig, wie … wie Sie selber zu wissen scheinen.«
»Ich weiß nur, daß das alles ein kompletter Unsinn ist. Ich nehme noch einen Drink. Und Sie?«
Waller schüttelte den Kopf.
Doyle schenkte sich das Glas wieder mit Whisky voll. »Übrigens«, sagte er, »Sie haben mir nicht einmal erzählt, wie sie getötet wurde.«
»Sie wurde erschossen. Auf der Geisterbahn.«
Doyle brach in lautes Gelächter aus. »Sie scherzen! Das ist ja das reinste Melodrama.« Er schob sein Kinn vor. »Eigentlich sollte ich beleidigt sein, daß man mich mit einer solchen Affäre in Verbindung bringt, sie liegt so gar nicht auf meiner Linie.«
Er leerte in einem Zug sein Glas. »Was nun? Gedenken Sie hier alles nach verborgenen Pistolen zu durchsuchen, wie?«
»Hätten Sie etwas dagegen?« fragte Waller.
»Dagegen? Aber nein, ich gestatte es mit Freuden.«
»Wir haben keinen Durchsuchungsbefehl und sind deshalb auf Ihre Mithilfe angewiesen.«
»Ich bin sehr zu haben für Mithilfe. Es sieht ganz so aus, als kriegte ich euch Herren in nächster Zeit recht viel zu sehen, so kann ich ebensogut schon jetzt meinen guten Willen zeigen. Nur los! Sie werden nicht lange zu tun haben.« Er deutete auf eine Tür. »Dort ist das Schlafzimmer. Es ist nichts darin als das größte Bett von Chelsea. Wenigstens behaupte ich immer, es sei das größte, und ich habe schon in recht vielen geschlafen.«
Waller nickte Bates zu, und dieser verschwand durch die Tür. Doyle legte sich auf den Diwan zurück, verschränkte die Arme und sagte, Waller spöttisch anblickend: »Ich habe nur diese zwei Zimmer. Tun Sie, als wären Sie zu Hause.«
Als Waller zum Büfett hinüberging, weil es ihm das offensichtlichste Objekt für eine Durchsuchung schien, stieg ein plötzlicher Widerwille gegen seinen Beruf in ihm hoch. Dieser Mr. Doyle mit seiner Blasiertheit und seinem spöttischen Lächeln bewirkte, daß er sich lächerlich vorkam. Und in gewissem Sinne war diese Durchsuchung in der Tat lächerlich. Falls Doyle der Mörder war, würde er seine Pistole kaum herumliegen lassen. Und da dieses Verbrechen ganz zweifellos vorsätzlich begangen worden war, hätte er sich bestimmt die Mühe genommen, alle belastenden Gegenstände zu beseitigen. Aber etwas, das wenig wahrscheinlich war, durfte man deswegen nicht einfach außer Betracht lassen. Also fuhr Waller in seiner Suche fort. Da wurde er von Bates unterbrochen.
»Verzeihung, Sir. Hinter dem Waschbecken im Schlafzimmer befindet sich ein Wandsafe. Dürften wir Mr. Doyle wegen des Schlüssels bemühen?«
Doyle erhob sich lässig vom Diwan. »Ich muß sagen, Sie sind wirklich eine Spürnase. Ich hätte nie gedacht, daß jemand ihn jemals finden würde. Kostete mich eine schöne Stange Geld, ihn anbringen zu lassen.« Er wandte sich zu Waller. »Müssen Sie den Schlüssel unbedingt haben?«
»Wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben.«
»Ich denke nur an unsern jungen Freund hier. Unsern sehr jungen Freund.« Er lächelte Bates boshaft zu. »Es sind nämlich eine Menge sehr französische Postkarten drin, und ich möchte nicht, daß der junge Mann verdorben wird.«
Da er keine Antwort erhielt, zuckte er die Achseln und zog einen Bund Schlüssel aus seiner Tasche. »Es ist der kleinste«, sagte er und warf sie durchs Zimmer. Bates fing sie geschickt auf und verschwand wieder im Nebenraum.
»Ich hoffe nur, meine Bilder schaden seiner Moral nicht«, höhnte Doyle. Dann drehte er sich um und rief über die Schulter zurück: »Mein Paß liegt übrigens auch im Safe.«
Einen Augenblick später erschien Bates wieder. Sein hübsches junges Gesicht war dunkelrot. Er sagte zum Kommissar: »Es war nichts drin außer … außer einigen Bildern. Und hier ist der Paß«, fügte er hinzu und hielt ihn Waller hin. Dieser zögerte.
»Nur los«, rief Doyle vom Diwan her. »Nehmen Sie ihn.«
Waller zögerte immer noch. Er hatte keinen Durchsuchungsbefehl, und die Beschlagnahme eines Passes war eine schwerwiegende Sache.
»Brauchen Sie denn das verdammte Ding nicht?« fragte Doyle und setzte Wallers Zögern ein Ende, indem er zu seinem Schreibtisch ging und dort etwas hinkritzelte. »Hören Sie zu!« rief er und las vor, was er geschrieben hatte. »›Ich bestätige hiermit, daß ich aus eigenem freiem Willen meinen Paß Nr. 704836, ausgestellt im Foreign Office in London am 9. Juli 1954, der Polizei ausgehändigt habe, um sie meiner künftigen Mithilfe zu versichern.‹ Das wäre es. Mehr können Sie nicht verlangen, wie?«
»Vielen Dank, Sir.« Waller nahm den Paß entgegen.
»Was geschieht nun weiter?« fragte Doyle.
»Ich werde diese Frage morgen besser beantworten können. Unterdessen, falls wir Sie wieder benötigen sollten …«
»Regency-Theater, Seabourne. Während der nächsten Wochen werde ich fast Tag und Nacht dort zubringen.«
Es regnete heftig, als sie ins Auto stiegen. Trotzdem öffnete Bates auf seiner Seite das Fenster.
»Stört es Sie, Sir? Ich habe ein bißchen frische Luft nötig.«
»Nicht gerade Ihr Typ, dieser Doyle, wie?«
Bates kräuselte angewidert die Lippen. »Wenn Sie diese Fotografien gesehen hätten …«
Einige Zeit herrschte Schweigen, und die beiden Männer starrten auf die regennasse Straße.
Dann sagte Waller: »Sie können die Operation Exit rückgängig machen, nun da wir seinen Paß haben.«
»Jawohl, Sir.«
»Und auch Ihre persönliche Operation ›Blonde Vera‹ von morgen abend. Es ist doch Operation Vera jeden Sonntagabend, nicht wahr?«
Bates leugnete es nicht. Er murmelte nur: »Gut, Sir.«
»Wir werden morgen in aller Frühe nach Seabourne fahren. Aber vorher erwartet mich noch Arbeit.«
»Kann ich Ihnen dabei behilflich sein?«
»Nein. Ich muß nur verschiedene Telefonanrufe erledigen.«
Es war schon ein Uhr vorbei, als Waller zu telefonieren begann. Die erste Nummer war Bayswater 0031, und er hegte nicht den geringsten Zweifel, daß jemand antworten würde. Lee Marcus – Theateragent, Klatschreporter und Kritiker – ging immer erst gegen Morgen zu Bett. Waller konnte ihn sich vorstellen, wie er in seinem alten samtenen Dinnerjacket seine sechzigste Zigarette des Tages rauchte und neue Klatschschnipsel in einen seiner gewaltigen Sammelbände voller Zeitungsausschnitte klebte.
»Lee, ich brauche eine Information.«
»Mein lieber Junge«, Lees Stimme klang wie die eines Shakespeare-Schauspielers, »ich hoffte im Gegenteil, Sie könnten mir welche vermitteln. Meine Spalte ist noch fast leer.«
»Ein andermal. Wissen Sie etwas über einen Mann namens Julian Doyle?«
»Sitzt er in der Tinte?«
»Möglicherweise.«
»Du liebe Güte!« Waller glaubte beinahe zu hören, wie der alte Mann sich die Lippen leckte. »Können Sie mir Einzelheiten geben?«
»Später. Wissen Sie etwas über ihn?«
»Nur daß er Nigel Fleets Klavierbegleiter und ein fabelhafter Musiker ist.«
»Ja, ja«, sagte Waller ungeduldig.
»Schließlich«, fuhr Lee fort, »wenn Julian nicht gewesen wäre, hätte Nigel mit dieser wundervollen Musik nicht solchen Erfolg gehabt. Erinnern Sie sich noch an den Kavalierwalzer?«
Durchs Telefon drangen, von Lee mit schmachtender Stimme gesungen, die Anfangstakte des Walzers. Er hatte offenbar einen Schwips.
»Geben Sie mir Auskunft über die Rollenverteilung«, unterbrach ihn Waller.
»Über die Rollenverteilung?«
»Ja, von Serenade; so heißt doch die neue Operette, in der Fleet auftritt, nicht wahr? Welche Rolle spielt er? Welche Frauen sind dabei, und so weiter. Alles, was Ihnen gerade in den Sinn kommt.«
»Das ist kein kleiner Auftrag. Ich werde meine Zeitungsausschnitte zu Hilfe nehmen müssen.«
Es trat eine Pause ein. Es war deutlich zu hören, wie Marcus »seine Zeitungsausschnitte« zu Hilfe nahm, indem nämlich das laute Zischen einer Sodawasserflasche verriet, daß ein frisch gefülltes Glas ihm diese Hilfe leistete.
Dann kam er zurück. »Da bin ich wieder«, sagte er mit etwas schwerer Zunge. »Serenade, eine neue Operette von Nigel Fleet, wird soeben im Regency-Theater in Seabourne einstudiert. Die Premiere ist für den 26. September vorgesehen.«
»Welche offizielle Stellung hat Doyle?«
»Die eines musikalischen Direktors. Das heißt, er dirigiert, korrepetiert und besänftigt gleichzeitig die Harfinistin, die sich immer und ewig übergangen fühlt. Alle diese Fäden liegen in seiner Hand, verstehen Sie?«
»Vollkommen. Ist das seine einzige Arbeit?«
»In Serenade wohl. Nebenbei ist er Fleets Klavierbegleiter in Persönliches Erscheinen.«
»Persönliches Erscheinen?«
»Mein lieber Waller, wo waren Sie während der letzten Jahre? Es ist eine Art Luxuskabarett, das Nigel selber ins Leben gerufen hat und das jede Woche einen Reingewinn von einigen tausend Pfund verbuchen kann. Die Mitwirkenden sind zwei Schwestern, ein mittelmäßiger Schauspieler, Sylvia Lincoln und er selber. In Seabourne gastiert er nur für einen Monat. Das wird ihm die Hotelrechnung begleichen.«
»Sylvia Lincoln, wer ist das?«
Ein tiefer Seufzer folgte dieser Frage. »Ich komme mir ja beinahe vor wie ein Aufklärer der unerfahrenen Jugend. Mein lieber Waller, seit fünfundzwanzig Jahren ist Sylvia Lincoln die wilde Rose des Musicals in England, und sie steht immer noch zuoberst auf der Leiter, auch wenn sie nun schon einige Blütenblätter eingebüßt hat. Seit fünfundzwanzig Jahren ist sie außerdem die chère amie des Earls of Lancing, der die Show finanziert …«
»Lancing, sagten Sie? Finanziert die Show?«
»Na ja. Hat das bei Ihnen irgend etwas zum Klingen gebracht?«