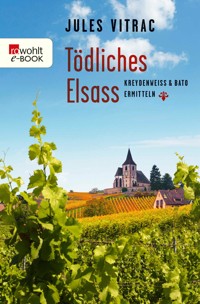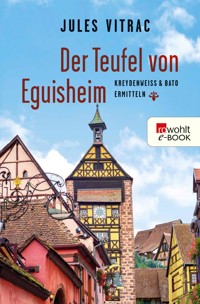4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Elsass-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein schwüler Sommertag im Elsass ... Die Bewohner von Eguisheim tragen heute Schwarz: Sie erweisen Madeleine Béranger, der Frau des Bildhauers, die letzte Ehre. Und finden sich danach im Wirtshaus ein, wo sie mit Wein und elsässischen Köstlichkeiten die Trauer zu verarbeiten versuchen. Doch die Ruhe im sonst so beschaulichen Ort will sich auch in den nächsten Tagen nicht einstellen: Mitten auf dem Marktplatz steht ein Sauerkrautfass mit einer Leiche. Kurz darauf findet man eine Tote in der «Bäckertaufe», einem Eisenkäfig am Eingang des Heimatmuseums. Schnell wird ein Muster klar: mittelalterliche Bestrafungsmethoden. Doch wer ist der Täter? Und wie wählt er seine Opfer aus? Noch bevor es eine Spur gibt, geschieht ein dritter Mord. Der schlimmste von allen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Jules Vitrac
Mord im Elsass
Kreydenweiss & Bato ermitteln
Kriminalroman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein schwüler Sommertag im Elsass ...
Die Bewohner von Eguisheim tragen heute Schwarz: Sie erweisen Madeleine Béranger, der Frau des Bildhauers, die letzte Ehre. Und finden sich danach im Wirtshaus ein, wo sie mit Wein und elsässischen Köstlichkeiten die Trauer zu verarbeiten versuchen.
Doch die Ruhe im sonst so beschaulichen Ort will sich auch in den nächsten Tagen nicht einstellen: Mitten auf dem Marktplatz steht ein Sauerkrautfass mit einer Leiche. Kurz darauf findet man eine Tote in der «Bäckertaufe», einem Eisenkäfig am Eingang des Heimatmuseums. Schnell wird ein Muster klar: mittelalterliche Bestrafungsmethoden.
Doch wer ist der Täter? Und wie wählt er seine Opfer aus?
Noch bevor es eine Spur gibt, geschieht ein dritter Mord. Der schlimmste von allen ...
Über Jules Vitrac
Jules Vitrac ist Journalist und hat als Korrespondent für eine französische Tageszeitung u.a. in Straßburg und Paris gearbeitet. Heute lebt er mit seiner Familie in der Nähe von Montpellier.
Dieses Buch ist meinem grauen Sofa gewidmet, das mich während der Entwicklung der Geschichte liebevoll und geduldig ertragen hat.
Et toujours et toujours
M. & C.
«Wer hat den Samen der Bitternis in mich hineingepflanzt, wo ich doch ganz das Werk eines gütigen Gottes bin? War der Teufel der Urheber? Doch woher der Teufel? Woher kam der böse Wille, durch den er zum Teufel geworden ist?»
Augustinus
1
Der Brunnen plätscherte unnatürlich laut in der ungewohnten Stille. Obwohl es bereits kurz vor halb neun war und ein ganz normaler Werktag, schien das kleine elsässische Örtchen Eguisheim wie ausgestorben. Sowohl die Metzgerei als auch die Bäckerei hatten noch geschlossen, ebenso das Café am Marktplatz, und es war kein einziges Auto zu hören. Der malerische Platz, der im Westen ganz von der im neuromanischen Stil erbauten St.-Léon-Kapelle beherrscht wurde, war menschenleer. Auf dem Kopf der Statue des berühmtesten Sohnes des Ortes, dem späteren Papst Leo IX., saß eine einsame Krähe und putzte sich das glänzend schwarze Gefieder. Die wenigen Touristen, die so früh am Vormittag schon im Ort unterwegs waren, traten zögernd, fast ehrfürchtig aus einer der ringförmig angeordneten Gassen auf den verlassenen Platz.
Dann, völlig unerwartet, begannen die vier mächtigen Glocken der St.-Peter-und-Paul-Kirche zu läuten. Das Dröhnen der Glocken hallte von den bunt gekalkten Fassaden der alten Fachwerkhäuser wider, die sich, eng gedrängt wie Küken um ihre Glucke, um den blumengeschmückten Brunnen scharten, und ließ die klare Morgenluft erzittern. Die Krähe gab ein unwilliges Krächzen von sich und flog davon. Überrascht warfen die Touristen einen Blick auf ihre Uhren und gingen dann, vom Geläut der Glocken unwillkürlich angezogen, in Richtung Kirche. Dort stießen sie auf den Trauermarsch, der sich bereits in Bewegung gesetzt hatte, und blieben in respektvollem Abstand stehen, während der nicht enden wollende Zug schwarz gekleideter Menschen hinter dem Sarg die Straße entlangschritt.
Die Tote in dem Sarg, der von sechs Männern aus der Kirche getragen wurde, war Madeleine Béranger, die Frau des Bildhauers, doch das wussten die Touristen nicht. Sie sahen nur, dass sich nahezu das gesamte Dorf auf den Weg gemacht hatte, um ihr das letzte Geleit zu geben. Die Glocken läuteten weiter, begleiteten den Zug auf seinem Weg über den Marktplatz hinaus zum Friedhof an der Rue de Malsbach und verstummten dann so abrupt, wie sie begonnen hatten.
In der plötzlichen Stille traten die Touristen zögernd durch das Portal der alten Kirche, atmeten den Geruch von Weihrauch, Kerzen und Tod, und die schweren Türflügel schlossen sich fast behutsam hinter ihnen. Der Marktplatz lag wieder schweigend im hellen Licht des Vormittags, und die schwarze Krähe erhob sich vom First eines etwas entfernter liegenden Hauses und flog zurück auf den Kopf von Papst Leo, um ihre unterbrochene Morgentoilette fortzusetzen.
«Eguisheim trägt heute Schwarz», hob der Pfarrer vor dem offenen Grab zu seiner Ansprache an, «unsere liebe Madeleine hat uns verlassen.» Jemand schluchzte, Taschentücher wurden gezückt, Augen getupft. Der Witwer, Frédéric Béranger, und seine drei erwachsenen Kinder standen in einigem Abstand zu den anderen Eguisheimern vor dem offenen Grab. Sie harrten reglos aus, berührten sich nicht, waren wie erstarrt. Nur die jüngste, Aimée, deren blondes Haar in der Sonne leuchtete, suchte nach einer Weile die Hand ihres Vaters und drückte sie.
Céleste Kreydenweiss, Chef de Police von Eguisheim, stand in ihrer steifen, dunkelblauen Galauniform unter den Trauergästen und kämpfte mit den Tränen. Sie schniefte leise und wischte sich dann mit dem Handrücken über die Augen. Luc Bato, ihr junger Kollege, der neben ihr stand, hielt ihr ein Taschentuch hin.
Céleste nahm es dankbar an und musste bei dem Anblick beinahe lächeln: Es war ein altmodisches hellblaues Stofftaschentuch, sorgfältig gebügelt und zu einem kleinen, akkuraten Viereck zusammengelegt – alte Leute hatten solche Taschentücher. Doch Luc war jung, Mitte zwanzig. Eguisheim war seine erste Stelle nach der Polizeischule, und wenn es nach ihm ginge, würde er von hier wohl auch nicht mehr weggehen. Er hatte als Jahrgangsbester abgeschlossen und durfte sich daher, anders als die Absolventen mit den schlechten Noten, die man gerne in die Banlieues der Großstädte schickte, seinen Einsatzort aussuchen. Wie Céleste stammte Luc aus der Gegend, allerdings nicht aus Eguisheim, sondern aus einem Dorf in den Vogesen, wo seine Familie einen Bauernhof hatte, und er konnte diese Herkunft nicht verleugnen. Groß und kräftig, bedächtig, ja fast ein wenig linkisch in seinen Bewegungen, mit dunklen Haaren und Augen und der Gesichtsfarbe eines Mannes, der sich viel im Freien aufhält, hatte er mehr Ähnlichkeit mit einem Bauern als mit einem Polizisten. Céleste wusste, dass er an den Wochenenden regelmäßig nach Hause fuhr, um dort auf dem Hof mitzuarbeiten und sich von seiner Mutter bekochen und betüteln zu lassen. Céleste stellte sich vor, wie seine Mutter diese Taschentücher für ihn wusch und bügelte und sie ihm dann am Sonntagabend, wenn er wieder nach Eguisheim zurückfuhr, in die Tasche packte.
Diese Vorstellung rührte sie, und sie warf dem jungen Kollegen einen kurzen Blick zu, während sie sich unauffällig schnäuzte und dabei den leichten Lavendelgeruch des Stoffes wahrnahm. Luc schien zu spüren, dass sie ihn musterte, und es machte ihn offenkundig nervös. Er zupfte an der Krawatte, wechselte das Standbein und schien nicht zu wissen, wohin mit seinen großen Händen. Céleste wandte sich ab und versuchte, sich auf die Ansprache des Pfarrers zu konzentrieren.
Als ein verspäteter Gast durch das Tor des Friedhofs trat, kam eine gewisse Unruhe unter den Trauergästen auf. Die Leute stießen sich gegenseitig an und begannen zu flüstern. Es war Louis Balzac, der Müllmann von Eguisheim, der jetzt mit unsicherem Schritt herantorkelte.
Louis Balzac war im Dorf bekannt wie ein bunter Hund. Wenn er nicht gerade Mülltonnen leerte und Straßen kehrte, trank er und das nicht zu wenig. Louis Balzac hatte sich zeit seines Lebens verpflichtet gefühlt, dem berühmten Schriftsteller, dessen Nachnamen er trug, Ehre zu machen und auch Schriftsteller zu werden, doch leider ohne Erfolg. Seine Geschichten wurden nie irgendwo gedruckt, und so beschränkte er sich darauf – von einigen kleinen Büchlein einmal abgesehen, die er selbst binden ließ –, seine Balladen und Gedichte sowie die zahlreichen Stegreifgeschichten, die er erfand, mündlich zum Besten zu geben. Wenn der Kunst Genüge getan war, widmete er sich wieder der Sauberkeit von Eguisheim. Nach vierzig Jahren im Dienst der Abfallentsorgung konnte man mit Fug und Recht sagen, dass er diese Aufgabe mit Bravour meisterte. Er war sozusagen die Müllabfuhr in Person, denn mit Ausnahme von Abdel Farouk, den er vollmundig seinen ‹Assistenten› nannte und großzügig unter die Fittiche genommen hatte, gab es niemanden in Eguisheim, der auch nur annähernd die gleiche Kompetenz und Erfahrung auf diesem Gebiet hatte wie er.
Madeleines Tod nun hatte Louis besonders erschüttert, was den Alkoholpegel schon am frühen Morgen rechtfertigte. Er war ihr sehr zugetan gewesen, nicht zuletzt deswegen, weil sie sich immer wieder hatte erweichen lassen, Louis’ selbstgebundene Bücher in ihrem Laden zum Verkauf anzubieten. Es wurde allgemein vermutet, dass sie sie alle aus Mitleid nach und nach selbst gekauft hatte, denn anders konnte man sich in Eguisheim den Louis’ Angaben zufolge «reißenden» Absatz der Werke nicht erklären.
Jetzt mäanderte er langsam heran, noch in staubiger Straßenkehrerkleidung, eine weiße Rose in den Händen. Die Trauergemeinde machte ihm Platz, als er unsicheren Schrittes auf das Grab zusteuerte, eine gewaltige Schnapsfahne im Schlepptau. Während weder Louis’ Erscheinen noch sein Zustand die übrigen Anwesenden überraschte, runzelten Nathalie, die elegante ältere Tochter der Verstorbenen, und ihr Bruder Laurent die Stirn. Nathalie zog scharf die Luft ein, als Louis direkt auf sie zusteuerte, und öffnete empört den Mund, um zu protestieren, doch ihre jüngere Schwester Aimée zupfte sie forsch am Ärmel, bevor sie etwas sagen konnte, und schob sie beiseite, um für Louis Platz zu machen.
Jeder trauert auf seine Weise, und Louis Balzac, der verkannte Dichter von Eguisheim, musste die Gelegenheit bekommen, gebührend von Madeleine Abschied zu nehmen. Das verstanden alle hier, und Aimée, die – im Gegensatz zu ihren älteren Geschwistern – schon immer ein Herz für die Verrückten und Zukurzgekommenen dieser Welt gehabt hatte, umso mehr.
«Meine liebe Freundin …», hob Louis mit schwerer Zunge an, als er endlich schwankend vor dem offenen Grab stand. Ein Schluckauf unterbrach seine Konzentration, und er rieb sich mit der Hand mehrmals das Gesicht, um sich wieder zu sammeln. «… in guten wie in schlechten Zeiten … bis dass der Tod …» Ihm fiel auf, dass er etwas vom Thema abgekommen war, zögerte und schloss dann abrupt, jedoch mit einigermaßen klarer Stimme: «Ruhe in Frieden, liebe Madeleine, vergiss nicht, die Hölle, das sind die anderen …»
«Ist das von Honoré oder von Louis Balzac?», wollte Luc wissen.
«Weder noch. Das ist von Jean-Paul», gab Céleste leise zurück.
Luc sah sie verunsichert an.
«Sartre», ergänzte Céleste lächelnd.
Jetzt hob Louis zum Abschied die Hand mit der Rose zu einem kämpferischen Gruß. «Au revoir! Vive la République …» Er geriet ins Schwanken, verlor das Gleichgewicht und fiel mitsamt der Blume kopfüber in Madeleines Grab.
Louis’ spektakulärer Sturz sorgte beim nachfolgenden Leichenschmaus im Lieblingsrestaurant der Eguisheimer, dem La Grenouille Grasse – dem Fetten Frosch, das Célestes Mutter Catherine gehörte –, für viel Gesprächsstoff und trotz des traurigen Anlasses sogar für den einen oder anderen Lacher. Man speiste elsässisch-üppig, wie es auch die Verstorbene geschätzt hatte. Es gab Sauerkrautsuppe mit Speck als Vorspeise und als Hauptgang Baeckeofe, einen deftigen, aufwendig geschmorten Fleischeintopf mit Teigkruste, der im Elsass fast alle wichtigen Ereignisse kulinarisch begleitete. Ein saftiger Apfelkuchen mit süßem Eiermilchguss rundete das Mahl ab. Dazu wurden nicht unerhebliche Mengen feinsten Rieslings getrunken, gestiftet von Célestes Großvater Théo, der, schon fast achtzigjährig, mit tatkräftiger Hilfe von Céleste seinen kleinen Weinberg in exquisiter Lage noch immer selbst bewirtschaftete und bisher auch erfolgreich gegen alle Kaufambitionen der großen Kellereien der Gegend verteidigt hatte. Normalerweise hütete er seinen guten Tropfen so eifersüchtig, dass selbst Catherine, die den Wein exklusiv in ihrem Restaurant verkaufen durfte, um jede Flasche kämpfen musste. Heute jedoch hatte Théo freiwillig gleich mehrere Kisten spendiert, was davon zeugte, dass auch er Madeleine sehr geschätzt hatte, selbst wenn er Bücherlesen generell für Zeitverschwendung hielt.
Am frühen Abend dann, die trauernde Familie und auch der Pfarrer waren längst gegangen, fand die Beerdigungszeremonie ihren inoffiziellen Höhepunkt, als Louis Balzac mit leicht zerschrammtem Gesicht auf einen Stuhl stieg und unter Tränen ein selbstgeschriebenes Gedicht zu Ehren von Madeleine zum Besten gab, das den Titel «Ich scheiße auf den Tod» trug. Das noch anwesende Publikum klatschte begeistert Beifall, und Luc und Céleste halfen dem Redner anschließend vom Stuhl herunter, damit es am Ende nicht zu einem zweiten Sturz käme. Célestes Mutter verabreichte dem untröstlichen Dichter noch eine starke Tasse Kaffee, und dann brachten ihn die beiden Polizeikollegen mit vereinten Kräften heim in sein altes Häuschen, das, nur wenige hundert Meter vom Fetten Frosch entfernt, windschief und zusammengesunken an der massiven Rückseite der Kellerei Dopfer lehnte. Spötter vermuteten, dass es gar nicht Louis’ Nachname war, der an seinem kleinen Alkoholproblem schuld war, sondern vielmehr die Lage des Hauses. Tür an Tür mit den riesigen Mostbottichen, die einen so intensiven Geruch nach gärendem Alkohol verströmten, dass einem allein vom Riechen schwindlig wurde, konnte man womöglich gar nicht anders, als sich bereits zum Frühstück ein erstes Glas zu gönnen.
An der Tür umarmte Louis Céleste noch einmal ungestüm und jammerte: «Alles aus und vorbei! Niemand wird jetzt jemals mehr meine «Ballade vom traurigen Mörder von Eguisheim» kaufen. Nie mehr!»
Céleste klopfte ihm tröstend auf den Rücken, dann löste sie sich aus seiner Umarmung und holte den Schlüssel aus dem Versteck unter dem Keramikzwerg neben dem Fußabstreifer, während Luc Louis an die Wand lehnte und festhielt, damit er nicht umfallen konnte. Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Louis nach Hause brachten.
«Warum ist der Mörder in deiner Geschichte eigentlich traurig?», fragte Céleste, während sie die Haustür aufsperrte. Sie selbst hatte den Text nie gelesen, kannte aber, wie so gut wie jeder in Eguisheim, den Anfang, da Louis die ersten Zeilen der in Versform verfassten Geschichte ständig irgendwo zum Besten gab.
«Weil … er seine Liebe verloren hat», nuschelte Louis undeutlich und schlurfte dann ins Haus. «Aber im Grunde ist doch jeder …» Er sprach nicht weiter, sondern schloss grußlos die Tür hinter sich. Es rumpelte, man hörte ein Fluchen, und dann ging hinter einem der winzigen Fenster im Erdgeschoss das Licht an. Halbwegs beruhigt, machten Luc und Céleste kehrt.
Auf dem Weg zurück zum Fetten Frosch rätselte Luc: «Was hat er wohl gemeint? Dass jeder traurig oder jeder ein Mörder ist?»
Céleste überlegte. Nach einer Weile sagte sie: «Ich glaube, er wollte sagen, dass jeder Mörder im Grunde traurig ist.»
2
Der nächste Morgen war einer jener seltenen Tage, an denen die Müllabfuhr von Eguisheim versagte. Louis Balzac hörte weder den Wecker noch seinen braven Assistenten Abdel, der eine gute Viertelstunde lang an seine Haustür klopfte und dann aufgab. Nachdem Louis im Besitz des Autoschlüssels für das Müllauto war, schien es wenig sinnvoll, alleine und nur mit einem Besen bewaffnet auf Tour zu gehen, und so machte Abdel kehrt, um seinerseits wieder ins Bett zu gehen und sich zur Feier des unerwarteten freien Morgens noch eine Weile an seine Frau zu schmiegen, bevor diese ebenfalls zur Arbeit musste.
Es blieb also still an diesem Morgen, kein Müllwagen brummte durch die schmalen Gassen, keine Abfalltonne klapperte, und ganz Eguisheim lag noch in tiefem Schlummer, als sich Lucie Pouliotte wie jeden Morgen auf den Weg durch das Dorf machte, um die Zeitungen auszutragen. Sie trug eine Jogginghose und darüber ein weites Sweatshirt, und ihre kurzen, in einem grellen Pink gefärbten Haare standen, noch mehr oder weniger ungekämmt, vom Kopf ab. Verschlafen fuhr sie auf einem alten, schwarzen Herrenrad samt Anhänger durch die Gassen in Richtung Marktplatz, die Ohren fest verstöpselt mit ihrem Smartphone, und nickte mit halb geschlossenen Augen zur Musik. Das brauchte sie so früh am Morgen. Die volle Dröhnung, sonst wurde sie nicht wach.
Eigentlich arbeitete sie als Kassiererin im Supermarkt am Rande von Eguisheim, doch das zusätzliche Einkommen, das sie mit den Zeitungen verdiente, konnte sie gut gebrauchen. Seit sie vor knapp drei Jahren mit gerade einmal sechzehn aus Mulhouse abgehauen war, hatte sie nie genug Geld. Von ihrem Vater bekam sie keinen einzigen Cent. Er sprach nicht einmal mehr mit ihr. Und das Leben war ja verdammt teuer, sogar in einem Kaff wie Eguisheim, auch wenn man nur zur Untermiete in einem winzigen Zimmer ohne Bad wohnte und zum Duschen einen Stock tiefer gehen musste. Sie versuchte nämlich auch noch zu sparen. Für später und so. Immerhin hatte sie es bereits geschafft, den Führerschein zu machen, und vor einem knappen halben Jahr hatte sie sich sogar ein Auto geleistet. Zwar war es uralt und klapprig, aber es fuhr brav die 80 km bis Straßburg, und das war das Wichtigste, denn mindestens einmal die Woche musste sie raus aus dieser Einöde und tanzen gehen. Außerdem hatte sie seit kurzem einen neuen Freund, und der wohnte ebenfalls in Straßburg.
In Gedanken bei Yannicks wurde sie gleich ein bisschen munterer und fuhr mit einem eleganten Schwung über den Marktplatz. Dabei wäre sie fast mit dem großen Fass kollidiert, das überraschenderweise mitten auf dem Platz stand. Erst in letzter Minute konnte sie ihr Fahrrad abbremsen, der Anhänger mit den Zeitungen kam ins Schlingern, kippte um, und die druckfrischen Nachrichten dieses Tages verteilten sich über das Kopfsteinpflaster.
Mit einem herzhaften Fluch sprang Lucie vom Rad und musterte das Fass mit finsterem Blick. Welcher Idiot hatte hier ein Fass abgestellt? Sie nahm die Stöpsel aus den Ohren und ging um das Holzfass herum. Es war groß und wuchtig, aus altem, gedunkeltem Holz und mit einem Deckel verschlossen. Irgendwie kam es ihr bekannt vor. So als hätte sie es schon einmal gesehen, an einem anderen Ort, bestimmt jedoch nicht im Morgengrauen mitten auf dem Marktplatz. Sie betrachtete es genauer, schnupperte – und verzog verächtlich das Gesicht. Es roch unangenehm. Offenbar ein Sauerkrautfass. Im Gegensatz zum Rest des Dorfes, das voller verrückter Sauerkrautliebhaber war, verabscheute Lucie dieses Gericht von ganzem Herzen. Sie konnte nicht verstehen, was man an diesem stinkenden, vergilbten Kraut finden konnte. Jetzt verlor sie endgültig das Interesse. Sollte sich um dieses eklige alte Ding kümmern, wer wollte, sie musste jetzt weiter. Doch gerade als sie sich bückte und begann, ihre Zeitungen aufzuklauben, hörte sie es. Das Geräusch, das vielleicht schon zuvor in ihr Unterbewusstsein gedrungen war und das sie, noch zugedröhnt von der Musik in ihren Ohren, nicht sofort wahrgenommen hatte: Das Fass tickte.
Das hartnäckige Zwitschern eines Vogels drang in Célestes Träume. Sie blinzelte verschlafen und warf einen Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch. Noch nicht Zeit aufzustehen. Von ihrer Wohnung bis zur Dienststelle in der Mairie waren es zu Fuß keine zehn Minuten. Sie konnte also mindestens noch eine halbe Stunde weiterschlafen. Schon wieder halb weggenickt, zog sie sich die Decke über die Ohren und drehte sich vom Fenster weg. Als sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm, stutzte sie. Der Anblick des rostroten Haarschopfes auf dem Kopfkissen neben ihr schaffte, was der Gesang der Amsel nicht vermocht hatte: Céleste wurde schlagartig wach. Sie war ja gar nicht zu Hause, sie war bei Yves.
Als ob ihr Gelegenheitsliebhaber ihre Gedanken gespürt hätte, drehte er sich zu ihr um, ohne jedoch aufzuwachen, und gab Céleste damit die Möglichkeit, ihn ungestört zu betrachten. Ihr Blick glitt über die kupfernen Bartstoppeln, die schmale Wangen und ein kräftiges Kinn bedeckten, über seine dichten, ebenfalls rötlichen Wimpern, und verharrte schließlich bei den dunklen Augenbrauen, die er immer so theatralisch bittend nach oben zog, wenn er etwas von ihr wollte. Sie lächelte, doch in ihren Blick mischte sich eine gewisse Wehmut, die sich jedes Mal einstellte, wenn sie bei Yves war. Sie würde auch heute alleine frühstücken. Es war besser so.
Leise stand sie auf, klaubte ihre Turnschuhe, die Jeans und ihr zerknittertes weißes Lieblingshemd, gegen das sie die ungeliebte Galauniform gestern sofort nach der Beerdigung eingetauscht hatte, vom Boden auf und schlich sich ins Bad. Müde Augen blinzelten ihr aus dem kleinen Spiegel entgegen. Es war kühl und ungemütlich in Yves Badezimmer. Sie beschloss daher, lieber zu Hause zu duschen, und spritzte sich nur ein paar Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht, um etwas frisch zu werden. Mit den noch feuchten Fingern versuchte sie ebenso halbherzig wie vergeblich, ihre lockigen dunkelbraunen Haare zu entwirren, und flocht sie zu einem losen Zopf. Das musste genügen. Schminkzeug hatte sie, wie üblich, nicht dabei. Sie benutzte es ohnehin kaum. Fertig angezogen, halbwegs munter und vor allem unbemerkt verließ sie wenig später Yves Wohnung, die nicht mehr als ein abgetrennter Teil seiner Werkstatt war, wo er ohnehin die meiste Zeit verbrachte. Ein großer Teil seiner Leidenschaft galt nämlich alten Autos, die er mit viel Akribie, Geduld und Begeisterung restaurierte, um sie dann – äußerst widerwillig – weiterzuverkaufen. Was von seiner Leidenschaft danach noch übrig war, verschenkte er großzügig an die Frauen, und das hieß derzeit vor allem an Céleste. Die nahm dieses Geschenk zwar gerne an, blieb aber trotzdem lieber auf der sicheren Seite und frühstückte alleine. Sie war nicht gewillt, aus dieser luftig leichten Beziehung etwas Ernsteres werden zu lassen. Und ein gemeinsames Frühstück war definitiv etwas Ernsteres.
Als sie in die Morgensonne hinaustrat, schloss sie für einen Moment die Augen und atmete tief ein. Es war gut so, wie es war. Es war fast perfekt. Zufrieden schlenderte sie zu ihrem Auto, einem liebevoll restaurierten silbergrauen Citroën DS mit roten Ledersitzen, den sie vor einiger Zeit von Yves gekauft hatte. Es war eine gute Idee gewesen, gestern Abend noch zu ihm zu fahren. Die Beerdigung von Madeleine hatte sie stärker mitgenommen als erwartet, und deshalb hatte sie nicht lange überlegt, als sie Yves’ Nachricht auf dem Handy gelesen hatte. Yves war nicht nur ein aufregender Liebhaber, er verstand es auch ausgezeichnet, sie aufzuheitern, wenn sie in trauriger Stimmung war.
Sie wollte gerade den Schlüssel in das Zündschloss stecken, als ihr Handy klingelte. Es lag auf der Mittelkonsole, wo sie es gestern Abend offenbar vergessen hatte. Es war Luc Bato, und ein Blick auf das Display zeigte ihr, dass es schon sein dritter Anruf war. Céleste schüttelte verwundert den Kopf. Ihr Dienst begann erst um acht. Was mochte wohl so dringend sein, dass es nicht bis dahin warten konnte? Für gewöhnlich waren ihre Tage nicht gerade von übermäßigem Stress gekennzeichnet. Als Chefin der Police Municipale von Eguisheim war sie, zusammen mit ihrem Kollegen, Brigadier Luc, verantwortlich für die kommunale Sicherheit in Eguisheim, was kein sehr nervenaufreibender Job war. Im vergangenen Jahr hatte es – neben den üblichen Verwaltungsaufgaben der Gemeinde, den Verkehrsunfällen und nervtötenden nächtlichen Alkoholkontrollen – drei Fahrraddiebstähle, ein aufgebrochenes Touristenauto, sechs Fälle von Sachbeschädigung, fünf behandlungsbedürftige Betrunkene nach dem jährlichen Weinfest und drei Prügeleien gegeben. Außerdem noch zwei entlaufene Katzen, einen streunenden Hund und einen entflogenen Papagei, der Célestes Vermieterin, Madame Denis, gehörte und alle paar Monate das Weite suchte. Wobei «das Weite» immer nur der Apfelbaum in Madame Denis’ Garten war. Céleste stieg dann jedes Mal mit Hilfe einer Leiter auf den Baum und fing Dodi wieder ein. Danach saß sie dann in Madame Denis’ Salon und bekam Kaffee und glasierten Gewürzkuchen und Gugelhupf kredenzt, bis sie meinte, nicht mehr aufstehen zu können. Ach, und dann war da noch der arme Monsieur Truffe gewesen, der sich beim Reinigen seines Jagdgewehrs versehentlich selbst erschossen hatte. Nicht schön, aber auch nicht wirklich spektakulär.
Mehr Aufregung gab es hier nicht, und genau das schätzte sie an ihrem Beruf. Einen ruhigen und doch abwechslungsreichen Tagesablauf, bei dem man ohne großen Stress seine Arbeit erledigen und sich danach den schönen Dingen des Lebens widmen konnte. Yves zum Beispiel. Und natürlich Max … Kurz und gut, sie konnte sich nicht vorstellen, was so dringend sein mochte, dass ihr Kollege um kurz nach sieben bereits zum dritten Mal versuchte, sie zu erreichen.
Als sie sich meldete, fiel er ihr ohne Begrüßung ins Wort: «Chef? Wo stecken Sie denn?»
«Erst mal guten Morgen … und sagen Sie verdammt noch mal nicht immer Chef zu mir! Warum nicht einfach Céleste oder Kreydenweiss oder von mir aus Chefin …»
«… ich habe bei Ihnen zu Hause angerufen, Chef, aber da ging niemand ran.»
Céleste seufzte. Sie sollte es endlich aufgeben, sich an dem Wort zu stören. In diesem Punkt war ihr Brigadier so störrisch wie ein Ochse. «Ja. Das liegt daran, dass ich nicht zu Hause bin.»
«Ach so, ja dann …»
In Lucs Stimme schwang so etwas wie eine Frage mit, aber Céleste gab keine weiteren Erklärungen ab. Sie hatte keine Lust, ausgerechnet ihrem Brigadier Auskunft über ihr Liebesleben zu geben. Er glaubte unverbrüchlich an die einzige, wahre und ewige Liebe und missbilligte die Tatsache zutiefst, dass sich Céleste neben ihrer langjährigen Fernbeziehung mit dem deutschen Journalisten Max noch hin und wieder etwas Spaß mit Yves gönnte.
«Was ist denn los?», fragte sie daher nur, ohne weiter auf ihren momentanen Aufenthaltsort einzugehen.
Luc zögerte.
Céleste konnte ihn förmlich vor sich sehen, wie er sich durch die Haare fuhr und erst einmal überlegte. In dem winzigen Bauerndorf mitten im rauen, einsamen Nirgendwo der Vogesen, aus dem er stammte, hielt man offenbar nicht viel von überflüssigem Gerede, denn nur so konnte Céleste es sich erklären, dass Luc die Angewohnheit hatte, jeden Satz, jedes Wort so genau auszuwählen, als gälte es, es sich zu Hause in die Vitrine zu stellen. Céleste zwang sich zur Geduld und wartete schweigend.
«Etwas Seltsames …», sagte er schließlich. «Besser, Sie kommen her. Ich warte am Marktplatz.»
«Aber was …», wollte Céleste nachhaken, doch er hatte schon aufgelegt. Sie seufzte. Batos wortkarge Art war mitunter etwas anstrengend.
«Ich bin gleich da», sagte sie zu ihrem stummen Handy und startete den Wagen. Also keine Dusche und wohl auch kein Frühstück, bevor nicht geklärt war, was Luc so «seltsam» fand. Sie fischte sich eine Zigarette aus der Packung Gauloises auf dem Beifahrersitz, zündete sie an und gab Gas. «Die Göttin» heulte unwillig auf. Madame war eine so raue Behandlung nicht gewohnt.
Rouffach, wo Yves wohnte, war ein Nachbarort von Eguisheim, und Céleste brauchte für die zehn Kilometer knapp acht Minuten. Als ihr Wagen über das Kopfsteinpflaster holperte und sie am Rande des Marktplatzes aus dem Auto stieg, kam Luc bereits auf sie zugelaufen. Er schien aufgeregt, und seine Mütze saß etwas schief.
«Gut, dass Sie da sind, Chef», sagte er und sah sich nervös um. «Ich weiß nicht, ob die Absperrung ausreicht …»
Céleste folgte seinem Blick und bemerkte erst jetzt das gestreifte Absperrband, das großräumig den Platz um den Brunnen herum abriegelte. Sie hob die Brauen. «Können Sie mir verraten, was Sie hier machen?»
Luc warf ihr einen unsicheren Blick zu. «Die Zeitungausträgerin hat es entdeckt, Lucie Pouliotte, neunzehn, wohnhaft in der Rue de Riesling 3 …», erklärte er nach einem Blick auf seine Notizen und deutete auf eine junge Frau mit pinkfarbenen Haaren, die mit mürrischem Gesichtsausdruck hinter der Absperrung stand, wo sich bereits einige Schaulustige versammelt hatten. Neben ihr war ein Fahrrad mit Anhänger abgestellt. «Ich wusste nicht genau … und dachte, erst einmal absperren, ist nie verkehrt. Aber vielleicht reicht es nicht …?»
«Was hat sie entdeckt? Wovon sprechen Sie, Bato?», fragte Céleste ungeduldig. Sie hatte noch nicht einmal gefrühstückt, ihre Haare sahen aus wie ein alter Besen, und ihr hochmotivierter Kollege machte einen auf Großeinsatz.
«Na, das Fass!» Er deutete auf die Mitte des Marktplatzes.Célestes Blick folgte seinem ausgestreckten Finger. Dort, unweit des Brunnens, stand ein großes Holzfass. Sie schüttelte ungläubig den Kopf: «Das ist nicht Ihr Ernst. Sie haben mich wegen eines verdammten alten Weinfasses angerufen?»
«Sauerkraut.»
«Was?»
«Sauerkraut, kein Wein. Es ist ein Sauerkrautfass.»
«Ah. Das ändert natürlich die Sachlage gewaltig.»
Luc warf ihr einen erschrockenen Blick zu. «Meinen Sie? Inwiefern?»
«Nein, natürlich nicht!» Céleste verdrehte die Augen. Ironie war nicht gerade Batos Spezialgebiet. «Warum um Himmels willen die Absperrung?», fragte sie und deutete auf die großzügig gespannten Flatterbänder. «Sie haben fast den ganzen Marktplatz abgesperrt. Wegen eines Sauerkrautfasses?»
«Ja, natürlich! Stellen Sie sich vor, es explodiert! Ich habe mir schon überlegt, die Häuser drum herum evakuieren zu lassen, das wäre wohl das Sicherste. Aber ich wusste nicht … sagen Sie, Chef, sind wir dafür überhaupt zuständig? Oder brauchen wir die Terrorabwehr? Dédé habe ich schon angerufen, er muss jeden Moment da sein.»
«Terrorabwehr?» Céleste war versucht, ihrem jungen Kollegen die Hand auf die Stirn zu legen, um zu prüfen, ob er Fieber hatte, beherrschte sich jedoch. «Und was bitte sollte die Terrorabwehr mit diesem Scheißsauerkrautfass anstellen?», schnauzte sie ihn stattdessen an und überlegte, ob sie nicht einfach umkehren und wieder zurück zu Yves fahren sollte. Er schlief sicher noch. Sie würde sich einfach wieder dazulegen und noch einmal die Augen schließen …
«Äh, ich weiß nicht …» Luc war bei ihren Worten zusammengezuckt. Es schockierte ihn immer, wenn sie fluchte. Dann sagte er eingeschüchtert: «Ich dachte ja nur, weil das Fass tickt …»
Céleste starrte ihn an. «Es tickt?»
Luc nickte. «Sagte ich das nicht?»
«Nein …» Céleste atmete tief ein.
«Es könnte doch eine Bombe drin sein, oder?», legte Luc ihr seinen Gedankengang dar. «Bomben ticken …»
Céleste kam nicht dazu, etwas zu erwidern, denn nun stürmte ein kleiner, rundlicher Mann mit Halbglatze auf sie zu. André Ginglinger, genannt Dédé, der Bürgermeister.
«Was ist los?», rief er ihnen entgegen und strich sich die spärlichen Haare auf der Glatze glatt.
Céleste hob schwach die Hand. «Salut, Monsieur le Maire. Wir haben ein …»
«… tickendes Sauerkrautfass», ergänzte Luc eifrig.
Céleste überließ es Luc, dem verwirrten Bürgermeister die Sachlage zu schildern, und beschloss, sich zunächst einmal ein eigenes Bild zu machen. Die Schaulustigen machten ihr bereitwillig Platz, als sie sich unter dem Absperrband hindurchbückte. Kritisch musterte sie das alte Fass, das da still und harmlos in der Morgensonne stand. Es war kein Ticken zu hören. Weiß der Himmel, was dieses pinkfarbene Mädchen sich da zusammengereimt hatte, dachte sie unwirsch. Aber da war noch Luc, der angeblich das Ticken auch gehört hatte, und der hatte normalerweise keine so blühende Phantasie. Überhaupt keine Phantasie, um genau zu sein.
Als sie mit gespitzten Ohren näher heranging, hörte sie Lucs besorgte Stimme hinter sich und winkte ab. Wenn es hier im Dorf ein tickendes Sauerkrautfass geben sollte, dann wollte sie sich mit eigenen Ohren davon überzeugen. Und tatsächlich, als sie direkt davorstand, hörte sie es auch. Gedämpft und nicht besonders laut, aber unverkennbar ein Ticken. Es klang wie ein Wecker. Als ob es ihre Gedanken bestätigen wollte, drang aus dem Fass plötzlich ein grelles Klingeln. Sie fuhr zurück, und hinter ihr kreischten ein paar Frauen auf. Doch es passierte nichts. Das Fass schrillte ein paar Sekunden durchdringend, was ein bisschen wie frühmorgens zu Hause klang, wenn ihr Wecker sie unsanft aus dem Schlaf riss, dann verstummte das Klingeln, und das Fass tickte wieder leise und unschuldig weiter, ganz so, als ob nichts gewesen wäre. Céleste wandte sich zu Luc um, der zusammen mit Dédé hinter der Absperrung stand und sie erschrocken ansah.
«Ein Spaß!», rief sie und grinste, um den Schrecken zu überspielen. «Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt!» Sie klopfte auf das Fass und winkte ihrem Kollegen zu. «Kommen Sie her, wir schauen mal rein.»
Luc kam mit dem Werkzeugkasten, den sie für alle Fälle im Kofferraum ihres gemeinsamen Dienstautos, einem ziemlich in die Jahre gekommenen Megane, verstaut hatten. Um das Absperrband herum hatten sich jetzt schon etliche Schaulustige mehr versammelt, und als Luc ein kleines Stemmeisen und einen langen Schraubenzieher auspackte, verstummte das Gemurmel der Zuschauer. Gespanntes Schweigen legte sich über den Marktplatz. Sie setzten die beiden Werkzeuge an gegenüberliegenden Stellen des Deckels an, und es ging überraschend leicht, ihn zu öffnen. Wer auch immer das Fass zugenagelt hatte, hatte kein Interesse daran gehabt, es dauerhaft zu verschließen.
Céleste warf Luc einen kurzen Blick zu. «Die Büchse der Pandora», sagte sie mit einem spöttischen Lächeln.
Er sah sie verwirrt an. «Es ist ein Fass … Aber ja, klar …»
Céleste verdrehte gutmütig die Augen und sagte nichts mehr. Gemeinsam hoben sie den Deckel und spähten hinein.
Als Erstes nahm sie den Gestank wahr, der herausdrang. Nach verdorbenem Fleisch, Blut, Innereien. Dann hörte sie ein Ächzen wie von einem umstürzenden Baum – es kam von Luc.
«Ein Wecker …», sagte er langsam.
Doch der große, altmodische Wecker, glänzend rot und geschäftig tickend, auf den Luc mit zitterndem Finger deutete, war nicht das Entscheidende. Entscheidend war, dass er einer Leiche um den Hals hing. Es war ein Mann, der mit glasig starrem Blick in dem Fass kauerte. Außer einem kreisrunden dunklen Fleck auf der Stirn schien er unversehrt zu sein, und es war nicht zu erkennen, woher der penetrante Gestank kam. Céleste wünschte, sie hätte die Zigarette vorhin nicht geraucht. Nicht, ohne vorher wenigstens einen Kaffee getrunken zu haben. Sie wandte sich ab und atmete ein paar Mal tief durch den Mund ein. Als sie die Augen wieder öffnete, traf ihr Blick den von Luc. Sein sonst so gesund wirkendes Gesicht hatte jede Farbe verloren, und seine Augen waren vor Schreck weit aufgerissen. Er schwankte leicht.
Sie sah sich um. Die Menschen hinter der Absperrung hatten mittlerweile begriffen, dass sich etwas Ungewöhnliches in dem Fass befinden musste. Es herrschte noch immer eine atemlose Stille, doch in so manch erwartungsvolle Miene hatte sich inzwischen Furcht geschlichen.
Sie wandte sich an Luc und sagte leise:
«Schicken Sie die Leute nach Hause, Bato.» Er nickte, ganz offensichtlich erleichtert, weg von dem Fass und seinem Inhalt zu kommen. Céleste sah ihm nach, wie er unsicheren Schrittes auf die wartende Menge zuging, und murmelte ein «Versuchen Sie es wenigstens» hinterher, wohl wissend, dass sich die Eguisheimer nicht so leicht würden vertreiben lassen, erst recht nicht von einem Grünschnabel wie Luc Bato. Aber besser, der Brigadier hatte etwas zu tun, als dass er noch neben ihr umkippte. Dann leistete sie noch insgeheim Abbitte, da er, auch wenn er eigentlich mit etwas ganz anderem gerechnet hatte, jedenfalls die Umsicht besessen hatte, das Fass weiträumig abzusperren. So würden sie sich wenigstens nicht von den Beamten der Brigade Criminelle aus Colmar, die man jetzt zu benachrichtigen hatte, anpflaumen lassen müssen, man habe die Spuren versaubeutelt.
Wie Céleste vermutet hatte, waren Lucs Versuche, die Eguisheimer zum Nach-Hause-Gehen zu bewegen, vergeblich. Er erntete dafür nur verständnislose Blicke. Kein Einziger wich auch nur einen Zentimeter von seinem Logenplatz am Absperrband zurück. Sie winkte Dédè zu, der wartend zwischen den anderen stand. «Könnten Sie mal herkommen?»
Der kugelförmige Bürgermeister musterte einen Augenblick die Absperrung und entschied sich dann klugerweise dafür, unter dem Band durchzuschlüpfen, anstatt mit seinen kurzen Beinen unelegant darüberzuklettern und womöglich eine lächerliche Figur abzugeben, und kam eilig zu ihr. Sie deutete stumm auf das Fass, und er sog scharf die Luft ein, als er die Leiche sah. Hastig zog er ein Taschentuch aus seiner Brusttasche, hielt es sich abwechselnd vor die Nase und wischte sich damit über die Stirn.
«Das ist … nicht gut, Kreydenweiss», sagte er, nur flach atmend, und Céleste nickte. Daran bestand wohl kein Zweifel.
«Wir brauchen die Kriminalpolizei», fügte Dédé nach kurzer Überlegung hinzu, und wieder nickte Céleste. Auch das war zweifellos richtig. Er seufzte tief. «Diesen Neuen, Wolflinger, habe ich nicht gerne bei uns hier.»
«Wolfsberger», korrigierte ihn Céleste.
«Auch gut, von mir aus Wolfsberger, er ist ein jedenfalls ein Idiot.»
Céleste nickte ein drittes Mal, dieses Mal nachdrücklicher. Bereits in den wenigen Monaten, die Didier Wolfsberger nun der neue Leiter der Kriminalpolizei in Colmar war, hatte er sich in beeindruckender Weise unbeliebt gemacht. Céleste hatte es bisher vermeiden können, ihn persönlich zu treffen, aber sie hatte von ihrer Freundin Sandrine schon einige recht üble Geschichten gehört. Sandrine war Rechtsmedizinerin in Colmar, und sie nahm selten ein Blatt vor den Mund. «Arroganter Affenarsch», hatte ihr ebenso knappes wie vernichtendes Urteil über Didier Wolfsberger gelautet.
Während Dédé noch besorgt grübelte, wie er einen Unruhestifter wie Wolfsberger in seinem friedlichen Dorf unter Kontrolle halten sollte, und Luc sich weiter bemühte, sich gegenüber den Eguisheimern durchzusetzen – seine Stimme war inzwischen energischer geworden, offenbar war er nicht mehr in Gefahr, in Ohnmacht zu fallen –, warf Céleste mit angehaltenem Atem einen genaueren Blick in das stinkende Fass und sagte:
«Bürgermeister, ich glaube, das ist …», begann sie, ehe Dédé, der ihrem Blick angewidert gefolgt war, sie erschrocken unterbrach: «Mon Dieu, das ist Philippe! Philippe Rouffacher!» Dédés lauter Ausruf veranlasste Luc, sich umzudrehen und zu den beiden zurückzukehren. Die Eguisheimer standen noch immer ungerührt herum, tuschelten leise und reckten die Hälse.
«Sie gehen einfach nicht …», sagte er mit zerknirscht ausgebreiteten Armen, doch Céleste winkte ab.
«Nicht wichtig.» Sie deutete auf den Toten. «Kennen Sie ihn?»
Luc warf zuerst aus der Ferne einen vorsichtigen Blick in das Fass und kam dann zögernd näher, um dem Toten ins Gesicht zu blicken. Nach einer Weile sagte er langsam: «Ist das nicht dieser Biobauer? Wie heißt der noch mal …»
«Rouffacher.» Der runde Kopf des Bürgermeisters wackelte bekümmert hin und her. «Ja, er ist es, kein Zweifel.»
Philippe Rouffacher war ein Schweinezüchter, der in der Nähe von Eguisheim seinen Hof hatte. Einen Vorzeigebiobauernhof, mit Schweinen, Hühnern, Katzen und blühenden Apfelbäumen sowie allerlei ökologischen Gütesiegeln. Im letzten Jahr war er sogar vom Verband «Genussregion Elsass» ausgezeichnet worden. Es hatte einen großen Zeitungsartikel darüber in der regionalen Tageszeitung L’Alsace gegeben.
Céleste hatte den kleinen stämmigen Bauern mit dem zu Lebzeiten immer roten Gesicht nur flüchtig gekannt. Ihre Mutter hatte früher immer ihr Fleisch für den Fetten Frosch bei ihm gekauft, bis sie irgendwann damit aufgehört hatte. Seit einiger Zeit fuhr sie, jedenfalls soweit Céleste wusste, auf einen anderen Hof. Catherine war wählerisch und anspruchsvoll und wechselte oft ihre Lieferanten, auch wenn sie sie noch kurz zuvor über den grünen Klee gelobt hatte.
Dédé deutete auf die kreisrunde Wunde auf der Stirn. «Und was ist das? Eine Schusswunde?»
Céleste beugte sich weiter hinunter. «Könnte sein», sagte sie zögernd. «Es sieht allerdings ein bisschen merkwürdig aus …»
Luc war ihrem Blick gefolgt. «Ich denke, es ist …» Er verstummte.
«Was?», fragte Céleste nach. «Was meinen Sie, Bato?»
Luc wurde rot. «Wir haben doch einen Bauernhof zu Hause und …»
«Ja und weiter?»
«Es … es sieht ein bisschen so aus wie bei unseren Schweinen, also wenn wir eines schlachten wollen …» Er machte eine kurze Handbewegung, und Céleste verstand.
«Sie meinen ein Bolzenschussgerät? Er wurde mit einem Bolzenschuss in die Stirn getötet?» Ihre Stimme hob sich unwillkürlich ein wenig. «Wie ein Schwein?»
Luc nickte, nunmehr etwas sicherer. «So sieht es jedenfalls aus, finde ich.»
«Was?» Dédé starrte ihn entsetzt an und zückte wieder sein Taschentuch. «Das glaube ich nicht! So etwas … nein … also bitte!»
«Eigentlich betäubt man damit das Schwein nur, das geht sehr schnell und tut nicht weh», präzisierte Luc. Dann dachte er einen Augenblick nach und fügte hinzu: «Wobei man das ja nicht wissen kann, nicht wahr? Wurde ja noch kein Schwein befragt, also …»
«Hören Sie auf, Bato!» Dédé schnitt ihm mit einer knappen Handbewegung das Wort ab. «Schluss damit. Rufen Sie in Colmar an. Ich kümmere mich einstweilen um die Leute hier.» Er wischte sich noch einmal mit dem Taschentuch über das Gesicht, stopfte es in die Hosentasche und rannte dann beinahe zurück zur Absperrung.
Mit einer gewissen Genugtuung stellte Céleste fest, dass die Eguisheimer trotz der unbestreitbaren Autorität des Bürgermeisters auch jetzt keinerlei Anstalten machten, den Marktplatz zu räumen. Im Gegenteil. Céleste wusste zwar nicht, was Dédé zu ihnen gesagt hatte, aber es schien sie eher noch darin zu bestärken, auszuharren und zu warten, was sich als Nächstes ereignen würde. Sie deutete mit dem Kinn auf den Bürgermeister und meinte tröstend zu ihrem Kollegen: «Der schafft es auch nicht.»
Luc betrachtete den kurzbeinigen Bürgermeister, der jetzt heftig gestikulierend auf seine stoischen Bürger einredete, und nickte. «Die sind ganz schön stur», sagte er, und es klang eher bewundernd als frustriert.
3
Céleste verzog verächtlich den Mund, als Didier Wolfsberger, Capitaine der Brigade Criminelle von Colmar, seine glänzend polierten Schuhe aus seinem protzigen BMW schwang, ausstieg und auf sie zukam. Er trug ein blassrosa Hemd mit weißem Kragen, und sein nach hinten geschniegeltes, sandfarbenes Haar war im Nacken etwas zu lang. Seine Augen verdeckte eine verspiegelte Sonnenbrille, die er erst abnahm, als er unmittelbar vor Céleste stehen blieb. Sie hob das Kinn und stellte sich und Luc knapp vor.
«Kreydenweiss, Bato, soso», sagte er mit einem leicht überheblichen Lächeln und fragte dann, Célestes Rang geflissentlich ignorierend: «Was ist hier passiert, Brigadier?»
«Stimmt etwas nicht, Capitaine?», fragte Céleste, ohne auf die Frage einzugehen.
Wolfsberger hob die Brauen. Sie waren gezupft. «Wie bitte?»
«Stört Sie an unseren Namen etwas?»
Wolfsberger lächelte. «Aber nein. Ich fand es nur, sagen wir, putzig, dass Sie anscheinend erwarten, dass ich mir Ihre Namen merke.»
Céleste schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und sagte: «Oh, natürlich, wie dumm von mir.» Sie wandte sich an Luc: «Brigadier, wären Sie bitte so freundlich, den Capitaine ins Bild zu setzen?»
In Wolfsbergers Augen glomm Ärger auf. Er schien zu spüren, dass Céleste ihn auf den Arm nahm, wusste aber nicht, wie er reagieren sollte.
In dem Moment trat Dédé zu ihnen und reichte Wolfsberger förmlich die Hand. «Capitaine Wolfacher? Ich bin André Ginglinger, der Bürgermeister von Eguisheim. Auf gute Zusammenarbeit.»
«Ich heiße Wolfsberger», sagte der Capitaine, und sein Blick schnellte zu Céleste, der es gerade noch gelang, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen.
«Ach ja, richtig!», sagte Dédé unbekümmert. «Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, wissen Sie, das dürfen Sie mir nicht übelnehmen. Man trifft ja so viele Leute, da kann man sich nicht alle Namen merken …» Er nickte ihnen zu und ging weiter.
Wolfsberger sah ihm mit einem wenig intelligenten Gesichtsausdruck nach, und Céleste wandte schnell den Blick ab. Als Luc schließlich in seiner bedächtigen, gewissenhaften Art mit der Schilderung begann, unterbrach ihn Wolfsberger bereits nach wenigen Sätzen. «Gut, den Rest sehe ich mir an. Sie können gehen.»
«Wie, gehen?» Luc runzelte verständnislos die Stirn. «Wie meinen Sie das?»
«Na, gehen, Brigadier. Links, rechts, links, marsch, die Beine in die Hand nehmen, abhauen und sich wieder um Ihre Arbeit kümmern. Wir wollen schließlich nicht, dass die Eguisheimer frech werden und ihre Parkgebühren nicht bezahlen, nur weil Sie hier sinnlos in der Gegend rumstehen, nicht wahr?» Er lachte.
«Aber … brauchen Sie uns nicht für …»
Luc schien noch immer nicht zu verstehen. Céleste bedeutete ihm mit einem Blick, es gut sein zu lassen, doch Wolfsberger beachtete die beiden ohnehin nicht mehr. Er hatte sich bereits abgewandt und winkte den Leuten von der Kriminaltechnik, die gerade gekommen waren und ihre Gerätschaften auspackten.
Luc und Céleste sahen schweigend zu, wie die Beamten das Fass untersuchten, Fotos machten und schließlich den Toten heraushoben. Bei der Aktion fiel das Fass um, und es wurde allen Beteiligten schlagartig klar, woher der unerträgliche Gestank kam. Das Fass war mit Schlachtabfällen gefüllt gewesen. Blutiges Gedärm, Knochenreste und undefinierbare glitschige Brocken ergossen sich in einem Schwall über das Kopfsteinpflaster, und die Zuschauer, die dem Geschehen am nächsten standen, schrien vor Abscheu auf. Dünne Rinnsale Blut suchten sich ihren Weg durch die Fugen zwischen den unebenen Steinen, und der widerlich süßliche Geruch nach Fäulnis und Verwesung, der sich jetzt über den ganzen Platz ausbreitete, schaffte, was zuvor weder Luc noch dem Bürgermeister gelungen war: Schockiert und angeekelt gleichermaßen, begann sich die Menge zu zerstreuen.
Luc warf Céleste einen unsicheren Blick zu. «Und was machen wir jetzt, Chef?», fragte er.
Céleste deutete auf das Café du Marché, das sich direkt am Marktplatz befand. «Wir gehen jetzt frühstücken.»
«Frühstücken?», wiederholte Luc und sah sie entgeistert an. «Wir können doch jetzt nicht …», stotterte er, «… nachdem … einfach so …»
«Doch, Bato. Können wir. Einfach so. Ich habe Hunger.»
Als Céleste mit dem völlig konsternierten Luc im Schlepptau auf das Café zusteuerte, kam sie noch einmal an Wolfsberger vorbei, der mit angewidertem Gesichtsausdruck die Bescherung betrachtete. Seine dunkelblauen Hosenbeine waren von Blutspritzern besudelt und auf der Spitze seines linken Schuhs klebte ein undefinierbarer gelblich-roter Klumpen.
Céleste deutete darauf. «Sie haben da was, Capitaine», sagte sie und grinste, als er hastig ein Taschentuch herausholte und mit spitzen Fingern versuchte, seinen Schuh zu säubern.
Das Café du Marché war ein etwas altmodisches Bistro mit einer langen Theke, gepolsterten Bänken, zweifarbig geflochtenen Stühlen und runden Marmortischen und ein beliebter Treffpunkt der Eguisheimer. Sie kamen an der Bar auf ein Glas Picon oder Crémant zusammen, um die Neuigkeiten des Tages auszutauschen. Henri Breton, der Wirt, war ein melancholischer Mann Ende vierzig, lang und dünn mit einem fast grotesk hervorstehenden Adamsapfel. Da er eine Stirnglatze hatte, wirkte sein Kopf mit der hohen Stirn noch länger und schmaler, als er ohnehin war. Mit seinen hängenden Schultern und den eher breiten Hüften erinnerte er Céleste, die ihn seit ihrer Kindheit kannte, immer an einen großen, traurigen Vogel, dem jemand die Schwanzfedern ausgerissen hatte.
Sie bestellte sich Milchkaffee und zwei Brioches, und Henri warf Luc einen fragenden Blick zu. «Und für Sie, Brigadier? Dasselbe?»
Luc schüttelte heftig den Kopf. «Nur ein Wasser, bitte.» Er war noch immer um einiges blasser als sonst.
«Es täte Ihnen gut, etwas zu essen», meinte Céleste. «Nach dem Schock.»
Luc warf ihr einen peinlich berührten Blick zu und schüttelte noch einmal den Kopf.
«Dann nicht.» Sie zuckte mit den Schultern, und gemeinsam setzten sie sich an einen Tisch etwas abseits der Fenster.
«Schlimme Sache da draußen», rief Henri von der Theke her und deutete mit dem Kinn in Richtung Marktplatz, während er die Brioches aus der Glasvitrine auf der Theke nahm, zusammen mit einer Stoffserviette liebevoll auf einen Teller bettete und mit ein wenig frischem Puderzucker bestäubte.
Céleste nickte. «Kann man wohl sagen.»
Luc schwieg.
Henri ging um die Theke herum, stellte ihre Bestellung auf den runden Bistrotisch und blieb dann neben dem Tisch stehen. «Ich habe gehört, Philippe Rouffacher steckte da drin?»
«Von wem hast du das denn schon wieder gehört?», wollte Céleste wissen.
Henri zuckte vage mit den Achseln. «Hab es eben gehört. Von irgendwem. Stimmt es denn?»
Céleste nahm einen Schluck Kaffee. «Da musst du schon irgendwen fragen.»
Henri sah sie beleidigt an.
«Was hört man denn noch so?», fragte Céleste.
Henri zögerte. «Man hört, er sei abgeschlachtet worden wie ein Schwein», sagte er schließlich und wiederholte dann noch einmal wie zur Bekräftigung: «Wie ein Schwein.»
«Würde mich schon interessieren, wer so etwas erzählt», sagte Céleste.
«Stimmt es denn?», hakte Henri nach, und sein ohnehin langer Hals wurde noch länger, während er zuerst Céleste, dann Luc neugierig ansah.