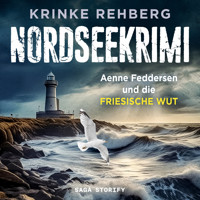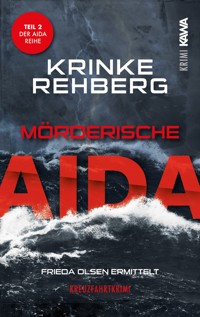
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampenwand Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kreuzfahrtkrimi
- Sprache: Deutsch
MÖRDERISCHE KREUZFAHRT AUF DER NORDKAPROUTE Krimispannung auf der AIDAluna Eigentlich wollte Frieda Olsen sich auf der Nordkap-Route an Bord der AIDAluna erholen, aber bereits beim ersten Landgang auf den Orkney-Inseln stirbt eine Passagierin. Was wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Mord und Kapitän Johannson bittet Frieda um Hilfe. Zwei weitere Leichen, ein längst vergessenes Verbrechen und zahlreiche Abgründe der menschlichen Seele bringen Frieda dem Täter gefährlich nah. Dem Kapitän und ihr bleibt nur wenig Zeit, bevor die Behörden in Reykjavik den Fall und das Schiff übernehmen. »MÖRDERISCHE AIDA« ist der zweite Kreuzfahrtkrimi mit um Frieda Olsen. Jeder Fall ist in sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN: 978-3985109135
© 2022 Kampenwand Verlag
Raiffeisenstr. 4 · D-83377 Vachendorf
www.kampenwand-verlag.de
Text: Krinke Rehberg
Umschlagfotos: ©Oleg_Yakovlev/shutterstock, ©Busara/shutterstock, ©andrejs polivanovs/shutterstock, ©Gordan/shutterstock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
AUCH WICHTIG!
Die Geschichte ist frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen und/oder realen Handlungen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieses Buch steht in keinem Zusammenhang mit der AIDACruise und der Carnival Maritime GmbH.
Lediglich die Handlung spielt auf einem der AIDA Kreuzfahrtschiffe.
Für Sabine
Sie weiß, weshalb.
PROLOG
Kinderaugen sehen die Welt wie durch eine Lupe. Wo Schönheit ist, sehen sie das Paradies, im Krieg sehen sie Ungerechtigkeit und dort, wo Ungerechtigkeit herrscht, erblicken sie die Hölle.
Kinder für ein System oder einen Nutzen zu erziehen, ist ein Verbrechen an der Zukunft, denn wenn ein Kind leidet, stirbt ein Stück Hoffnung.
Wir müssen sehr genau überlegen, was wir in die Seelen unserer Kinder pflanzen, denn die Saat kann sowohl ein Geschenk als auch einen Fluch bedeuten.
Frieda Olsen
1
Groß Köris, DDR – 1980
Niemand, der aus dem Loch zurückkehrte, sprach darüber.
Nun hockte sie auf dem kalten, feuchten Boden in absoluter Dunkelheit. Die Schwärze ließ keinen Gedanken an Hoffnung zu.
Sie war mitten in der Nacht an den Haaren aus dem Bett gezerrt und barfuß die Treppen hinunter geschubst worden, mit nichts als dem dünnen Nachthemd am Körper. Wie immer hatte der dicke Erich gepetzt. Er war der Liebling der alten Gerlach. Irgendwann würde sie es ihm heimzahlen!
Ihre nackten Füße hatte sie sich an den scharfkantigen Betonstufen blutig gestoßen, doch sie spürte keinen Schmerz. Zu groß war die Panik.
Und all das nur, weil sie sich gewehrt hatte.
Die Schwärze um sie herum lähmte ihre Gedanken, die Angst umhüllte sie wie ein arktischer Wind und dann spürte sie warmen Urin ihre Schenkel hinab rinnen.
Lautlos liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Sie wollte gerade flehen und rufen, da hörte sie eine kräftige Stimme.
»Hör auf zu heulen! Damit gibst du ihnen, was sie wollen! Wir müssen stark sein!«
Sie war nicht allein! Ein zaghaftes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
2
Orkney-Inseln, Schottland – 21. Juni 1919
In wenigen Augenblicken würden auf sein Kommando hin 74 Schiffe versenkt werden. Den Flaggencode hatte er die Besatzung immer und immer wieder durchgehen lassen.
Nicht, dass es für die Flaggenübermittlung auf den Schiffen der Kaiserlichen Hochseeflotte Übung bedurfte, aber dieses Signal würde ihr letztes sein.
Ludwig von Reuter stand in seiner Paradeuniform auf der Brücke der SMS Emden und schaute in die Bucht von Scapa Flow vor den schottischen Orkney-Inseln. Es war der 21. Juni 1919 und seine Armbanduhr zeigte 11:02 Uhr. Backbords überblickte er die gesamte Flotte. Es war ein erhabener Anblick. Die Dampfkessel der Schiffe rauchten, um die Notsysteme aufrechtzuerhalten.
Gleich würde er den Befehl geben.
Der Code, auf den sie sich geeinigt hatten, lautete: Paragraph elf.
Die Uhrzeit hatte er in Gedenken an Kapitän Fritz Lüdecke von der SMS Dresden gewählt.
Dieser hatte fünf Jahre zuvor in der Cumberland-Bucht, 150 Meilen vor Santiago de Chile, die Ventile seines Schiffes fluten lassen und es vor den Augen der Briten versenkt.
Heute würde er es dem alten Fritz, den er aus seiner Zeit auf der SMS Amazon kannte, gleichtun. Nur würde er den Befehl zur Versenkung von 74 Schiffen geben.
Diese Politiker, die in Versailles die Kapitulation des Deutschen Kaiserreiches aushandelten, verstanden nichts von Ehre und Vaterlandstreue!
Die gesamte Flotte in die Hände des Feindes zu übergeben, war Hochverrat!
Das konnte er nicht zulassen.
Die 1800 Mann starke Notmannschaft der Hochseeflotte stand geeint hinter ihm.
Sie würden sich lieber selbst versenken, als ihre Flotte den Siegern zu überlassen.
Der Zeitpunkt war günstig. Die Briten lenkten ihre Aufmerksamkeit auf ein eigenes Manöver und gerade die Sicherheit, die sie als Siegermacht hatten, gab von Reuter den Freiraum, diesen Coup auszuführen.
Am frühen Morgen, als Nebel über der Bucht gelegen hatte, war er den junge Maschinisten Georg Müller mit einer Dokumentenmappe an Land gegangen.
Müller sprach akzentfreies Englisch und hatte somit die größte Chance, das feindliche Gebiet zu durchqueren.
Ihm blieb nicht viel Zeit, die brisanten Dokumente bei den Friedensverhandlungen in Versailles an die deutschen Delegierten zu übergeben. Der Inhalt würde die Siegermächte spalten und die Position der Briten entscheidend schwächen.
Von Reuter kapitulierte nicht. Er würde die Kaiserliche Flotte, die als Reparationszahlung zu einem Großteil in britischen Besitz übergehen sollte, versenken.
»Paragraph elf. Bestätigen!«, gab er den Befehl und auf der SMS Emden schwärmten die Matrosen aus und gaben das Flaggensignal weiter.
Zeitgleich öffnete die verbliebene Besatzung der bereits entwaffneten kaiserlichen Kriegsschiffe die Ventile und Schotten und begab sich in die bereitgestellten Rettungsboote.
Bereits eine Stunde später ragte von der SMS Friedrich der Große nur noch die Spitze des Parademastes aus den Fluten heraus.
Die Briten hatten keine Möglichkeit, die Schiffe zu retten. Das Überraschungsmoment dieser tollkühnen Tat war auf von Reuters Seite.
Sechs Stunden später ging schließlich das 210 Meter lange Schlachtschiff der Kaiserlichen Flotte, die SMS Hindenburg, in der schottischen Bucht unter.
Konteradmiral Ludwig von Reuter und seine 1770 Mann Besatzung kamen in britische Kriegsgefangenschaft.
Geschichtlicher Nachtrag
Konteradmiral Ludwig von Reuters eigenmächtige Aktion verzögerte die Ratifizierung des Friedensvertrags von Versailles um eine Woche.
Maschinist Georg Müller erreichte das französische Festland nicht und die brisanten Dokumente blieben mit ihm verschollen.
Bis heute, 100 Jahre später.
3
Vor 3 Monaten
Und Sie haben diese Unterlagen aus dem Safe eines gesunkenen Kriegsschiffes aus dem Ersten Weltkrieg?« Richard Franke hob die Augenbrauen.
»Korrekt!«
»Was sind Sie? Wracktaucher?«
Martin Kammerer ließ ein kurzes Grinsen um die Mundwinkel kreisen.
»Das Schiff wurde 1930 vor Schottland geborgen und der Schiffstresor war sozusagen eine Trophäe der Bergungsfirma und stand jahrelang in deren Büro.«
Franke war von Natur aus neugierig und skeptisch zugleich. Das brachte sein Beruf mit sich.
»Und die Dokumente existieren wirklich?«
Kammerer nickte eifrig.
»Ist das alles, was sie haben?« Franke wollte mehr Informationen.
»Ja, die Notiz des Schiffslogs und einige Aufzeichnungen des Admirals von Reuter befanden sich im Tresor.«
»Und?«, fragte Franke gespannt.
»Von Reuter erwähnt in seinen Aufzeichnungen den jungen Maschinisten, den er kurz vor der Versenkung der Flotte mit einer Mission betraut hatte, um die Friedensverhandlungen in Versailles 1919 platzen zu lassen.«
»Und dieser Maschinist ist Ihr Mann?«
Kammerer nickte.
»Irgendwelche Verwandten?«
»In der Tat!« Ein erneutes Grinsen huschte über sein Gesicht. »Die Tochter lebt in Potsdam und hat sich bereiterklärt, mit mir zu sprechen. Wie es scheint, ist sie im Besitz eben dieser Dokumente, die von Reuter dem Maschinisten übergab.«
»Worauf warten Sie dann?«
»Die Dame will vor einer Zusammenarbeit noch einmal auf die Orkneys und zwar mit dem Schiff.«
Franke runzelte die hohe Stirn. »Das glaube ich jetzt nicht! Mit dem Schiff?«
»Sie geht auf die 80 zu und fliegt nicht mehr.« Kammerer zuckte mit den Schultern.
»Und ich soll Ihnen die Schiffspassage bezahlen?«
»Es ist eigentlich keine Passage, sondern eine Kreuzfahrt!«
Mit frostigem Blick starrte Richard Franke sein Gegenüber an und sagte nichts. Er wägte die Chancen ab.
»Ich mache einen Standardautorenvertrag mit Ihnen. Ein Drittel vorab, ein Drittel bei Manuskripteinreichung und ein Drittel nach Veröffentlichung.«
»Wieviel ist das?«, fragte Kammerer. Seine Barschaft belief sich auf knapp 100 Euro und als bislang erfolgloser Autor war mit Einkünften vorerst nicht zu rechnen. Ohne das Geld für die Kreuzfahrt würde er seinen Plan nicht durchführen können.
»Es wird vielleicht für eine Innenkabine reichen, aber mehr nicht!«
»Akzeptiert!«, erwiderte Kammerer und rieb sich insgeheim die Hände. Er hatte die erste Hürde genommen. Diese fixe Idee der alten Stolzenfels, unbedingt mit einem Schiff auf die Orkneys zu fahren, um ihm auf der Reise ihre Geschichte zu erzählen, war eine glückliche Fügung des Schicksals.
Auf einer Schiffsreise konnte ein Passagier schon mal über Bord gehen …
4
Heute – Nordsee vor der Südküste Norwegens
Die AIDAluna lag am Ostseekai in Kiel. Die Matrosen an Land hoben die schweren Stahltrossen über die wuchtigen Poller, die wie stählerne Pilze auf dem Pier wuchsen. Die kräftigen Winden im Schiffsinneren holten die Festmacher geräuschvoll ein.
Die AIDAluna war klar zum Auslaufen und im nächsten Moment schäumte das Wasser zwischen dem Schiffsrumpf und der Kaimauer auf. Die Bug- und Heckstrahlruder drückten den 252 Meter langen Kreuzfahrtriesen behutsam von der Kaimauer weg.
Kapitän Johannson stand backbords auf dem Brückennock und wachte über das Ablegemanöver seines Schiffes.
Oben an den Decks lehnten hunderte Gäste an der hochglanzpolierten Teakreling und beobachteten das Manöver, während die AIDA-Hymne aus allen Lautsprechern erklang.
Eine Person allerdings bekam von all dem nichts mit, obwohl sie ebenfalls dort stand und hinab auf das brodelnde Wasser starrte. Ihre Gedanken drehten sich nur um eines.
War es das Richtige?
Würde sie sich nach all den Jahren des Schweigens endlich dazu entschließen? Sie fragte sich, ob es ihr eigener Entschluss war oder ob sie lediglich dem Druck nachgeben wollte? Fast wäre alles in Vergessenheit geraten und jetzt würde sie es wieder an die Oberfläche zerren. So wie der Schlick, der von den Schiffsschrauben aus der Tiefe vom Meeresgrund aufgewirbelt wurde.
Vielleicht sollte es niemals ans Licht kommen, denn sie selbst hatte Jahre gebraucht, um die grausige Tat zu verarbeiten. Und so sehr sie den Mord auch verurteilte, ohne ihn wäre sie nicht hier.
Sie dachte an ihren Großvater, stellte sich zum tausendsten Mal vor, wie er wohl gewesen sein mochte.
Mit zunehmendem Alter kamen die quälenden Gedanken zurück. Welche Last hatte ihr Vater tragen müssen, welche Zerrissenheit hatte seine Seele ausgehalten? Er war ein sehr liebevoller Vater für sie gewesen. Sie erinnerte sich an zahlreiche Begebenheiten aus der Zeit in Stromness. Alle hatten ihn den schweigsamen Ingenieur genannt, aber sie hatte ihn als redseligen und lustigen Vater erlebt. Allerdings nur zuhause. Außerhalb ihrer vier Wände war er zu ihrer Verwunderung wortkarg und eigenbrötlerisch gewesen.
Erst sein Tod hatte ihre Welt auf den Kopf gestellt und sie war noch nicht bereit, ihm zu vergeben.
Natürlich trug sie nicht die Verantwortung für das Verbrechen ihres Vaters, dennoch würde sie dieses schreckliche Familiengeheimnis lüften. Sie konnte das Wissen um einen ungesühnten Mord nicht mit ins Grab nehmen!
Frieda lauschte auf der Veranda ihrer Bugsuite den Decklautsprechern.
Enyas ‹Sail away› ertönte, während sich der Bug mit dem roten Kussmund und dem Auge langsam vom Pier schob.
Die Fahrt aus der Kieler Förde war sehenswert und obwohl Frieda den Anblick ihrer Heimatstadt vom Wasser aus von zahlreichen Fahrten mit dem Fördedampfer kannte, genoss sie die Aussicht in der erhabenen Höhe von Deck 9.
Ob Enya sich jemals gedacht hatte, dass dieser Song zur AIDA-Hymne avancieren würde?
Die Melodie verkörperte so viel Dynamik und passte zu dem Auslaufmanöver wie keine andere.
Der Bug schob sich durch die Innenförde, vorbei an den Kieler Werften und den Schleusen zum Nordostseekanal, bevor an Steuerbord das Marine Ehrenmal in Laboe querab lag.
Kapitän Johannson, ein Schwede, kommentierte die Ausfahrt aus der Kieler Förde.
»Am Fuße des 72 Meter hohen Turms steht am Strand vor Laboe seit 1972 das ausgemusterte U-Boot aus dem 2. Weltkrieg, die U-995.«
Frieda empfand es als surreal, auf ein aufgebocktes Unterseeboot herabzublicken.
Der graue Rumpf reflektierte die untergehende Sonne und bot ein willkommenes Fotomotiv für die Passagiere der auslaufenden AIDAluna.
Sie holte ihr Handy heraus, machte ebenfalls eine Aufnahme und schickte diese an ihren Sohn Klaas. Prompt vibrierte ihr Handy und sie las seine Antwort: »Viel Spaß und erhole dich!« Sie hatte sich eine Weißweinschorle mit auf die Suite genommen und sah auf die in der Dämmerung liegende Kieler Förde.
Vor ihr lagen 18 Tage Kreuzfahrt. Die Route führte über die schottischen Orkney-Inseln, Spitzbergen, zum Nordkap und zurück nach Kiel an Norwegens und Schwedens Küste entlang. Sie würde sich ausschließlich ihren Büchern und dem grandiosen Ausblick widmen – und natürlich den Mahlzeiten!
Das letzte halbe Jahr hatte deutliche Spuren bei ihr hinterlassen.
Seit sie im letzten Herbst den Mord auf der AIDAbella im Roten Meer aufgeklärt hatte, war sie in verschiedenen Talkshows zu Gast gewesen. Eine Agentur hatte versucht, sie unter Vertrag zu nehmen und ein Verlag wollte Friedas Geschichte als Buch herausbringen. Beides hatte sie abgelehnt.
Aus dem Leid und Tod der Beteiligten wollte sie kein Kapital schlagen. Das war ihr mit zunehmendem Rummel um ihre Person klar geworden. Anfangs hatte sie sich geehrt gefühlt, dann aber schnell festgestellt, dass sie für den großen Zirkus nicht geschaffen war.
Deshalb befand sie sich jetzt auch nicht auf der AIDAbella, die unter dem Kommando ihres Sohnes in Asien fuhr, sondern hier auf der Nordkaproute. Der Besatzung der Luna war sie zwar ebenfalls bekannt, aber nur vom Hörensagen. So war ihr eine gewisse Anonymität beschieden, die sie dringend zum Ausspannen benötigte.
Natürlich bewohnte sie auch auf der AIDAluna ihre gewohnte Juniorsuite am Bug. Veränderungen bedeuteten in ihrem Alter das Gegenteil von Erholung und diese Suite glich der auf den Schwesterschiffen wie ein Ei dem anderen. Hier würde für die nächsten 18 Tage ihr kleines Refugium sein.
Frieda freute sich darauf, keine Post oder Anrufe mit Anfragen zu bekommen, sondern die Seele baumeln lassen und die vergangenen Monate mental verarbeiten zu können.
Sie zog den Kragen ihres beigen Wollmantels höher, steckte ihre Haarspitzen unter die Kaschmirmütze und hielt ihre Nase in den Wind.
Die Temperatur betrug an diesem Abend im April lediglich 10 Grad und die Nordroute würde laut Wettervorhersage eher kühl werden.
Daher hatte Frieda Mantel, Daunenjacke, Handschuhe, Schals und sogar Skiunterwäsche im Gepäck.
Sie wollte die atemberaubenden norwegischen Fjorde an Deck erleben und hatte dementsprechend ihren Koffer gepackt.
Die AIDAluna würde in wenigen Minuten am Leuchtturm Kiel vorbeifahren.
Diesen ersten Abend würde sie mit einem italienischen Abendessen im Rossini feiern.
Frieda tauschte ihren Kaschmirpullover gegen eine Bluse mit floralem Muster und einen marinefarbenen Blazer. Sie legte eine Perlenkette an, die sie zu ihrem 70. Geburtstag von Klaas bekommen hatte und schminkte sich dezent. Dann warf sie einen Blick in den Spiegel. Was sie dort sah, machte sie stolz. Sie war eine rüstige ältere Dame und fühlte sich rundum wohl.
Ein Blick auf die Uhr gab ihrem grummelnden Magen Recht, es war Zeit fürs Dinner!
Das Rossini-Gourmet-Restaurant befand sich am Heck auf Deck 11 und war zahlungspflichtig, aber Frieda wusste um den Vorteil, den ersten Abend an Bord in einem der Bezahlrestaurants zu essen.
Sie hatte nichts gegen die Küche der All-Inklusive- Restaurants einzuwenden, ganz im Gegenteil, nur war es dort am ersten Abend immer hektisch und laut.
Das lag daran, dass viele Gäste sich direkt nach der Einschiffung nicht auf Anhieb zurechtfanden und gerade in den Buffetrestaurants war diese Aufregung deutlich spürbar.
Eine Kellnerin führte sie zu ihrem reservierten Platz am Fenster und stellte eine Karaffe Wasser auf den Tisch.
Frieda liebte das kontrastreiche, schwarz-weiß- dunkelbraune Ambiente des Rossinis, außerdem war die hausgemachte Pasta ein Gedicht und zerging wie Butter im Mund.
Sie hatte zu 20:30 Uhr einen Tisch reserviert. Der erste Ansturm war vorüber und sie genoss die Ruhe und Zuvorkommenheit des Personals.
Die Tische waren mit Rosenblüten geschmückt. Ein Kellner brachte ihr einen kleinen Brotkorb, drei verschiede Sorten Butter und eine gläserne Salzmühle, gefüllt mit Sal de Fleur.
Frieda inspizierte die Weinkarte, während sie das warme Ciabatta mit Salbeibutter bestrich.
Am Tisch neben ihr hatte eine ältere Dame Platz genommen. Ihr pechschwarzes Haar war streng zurückgebunden und Frieda spürte einen stechenden Blick aus kalten, grün schimmernden Augen. Unvermittelt kroch eine Gänsehaut über ihre Unterarme. Offensichtlich speiste die Dame allein, denn ein Kellner nahm das zweite Gedeck vom Tisch.
Als Frieda den Blick hob, sah die Frau sie immer noch an und nickte ihr wortlos zu.
»Guten Abend!«, erwiderte Frieda den Gruß, erhielt jedoch keine Antwort.
Dann eben nicht, dachte Frieda. Was kümmerte es sie, ob andere Gäste freundlich waren oder eben nicht. Sie würde sich ihre Ravioli und ein Glas Montepulciano munden lassen und sich dann auf ihrer kleinen Veranda einen Espresso zubereiten.
Frieda lächelte, als ihr bewusst wurde, welch ungewohnte Freiheit sie hier an Bord genoss. Die letzten Jahre war sie auf der AIDAbella Stammgast gewesen, schließlich war Klaas dort Kapitän. Dort war sie es gewohnt, dass sowohl das Hotelpersonal als auch die Besatzung sie kannten.
Hier aber spürte sie eine Anonymität, die befreiend auf sie wirkte. Sie musste nicht damit rechnen, angesprochen zu werden und die Verbeugungen der philippinischen Housekeeping-Mitarbeiter abwehren.
Natürlich hatte sie diese Bekanntheit auf der AIDAbella durchaus genossen, aber jetzt stellte sie fest, dass eine unterbewusste Anspannung von ihr abfiel.
Sie prostete sich zu, lächelte und nahm einen Schluck des samtigen Rotweins.
Die Ravioli in Sauce Gremolata schmeckten himmlisch. Das Zusammenspiel von Petersilie, Knoblauch und Zitrone harmonierte perfekt mit den Ricotta-Ravioli.
Sie wandte den Blick hinaus auf die nächtliche Ostsee. Das Mondlicht spiegelte sich in den Wellen wider und nur die glitzernden Schaumkronen der Bugwellen, die im Mondschein reflektierten, ließen erkennen, dass das Schiff Fahrt machte.
Die Nachspeisenkarte las sich äußerst verlockend, doch dafür war es zu spät. Mit zu vollem Magen schlief sie schlecht. Frieda hatte im Laufe der Jahre gelernt, was sie ihrem Körper zumuten durfte und was nicht, also winkte sie dem Kellner, setzte ein großzügiges Trinkgeld auf die Abrechnung und unterschrieb den Bon, als ein paar Tische weiter der hysterische Schrei einer Frau wie eine schrille Sirene durch das Rossini erscholl.
Alle erstarrten und für einen Augenblick war es totenstill.
5
Ein Dutzend Rosenblätter auf jedem Tisch wirkten wie bunte Farbtupfer auf der weißen Tischdecke. Die beigen Servietten, das feine Porzellan und die kristallenen Gläser versprachen schon rein optisch eine Gourmetküche. Der Ruf des Rossinis auf den AIDA-Schiffen war ausgezeichnet.
Der Kellner geleitete das Paar an den Zweiertisch am Fenster und rückte den Stuhl für die Dame zurück, damit sie Platz nehmen konnte.
Eine zweite Kellnerin servierte lächelnd ein Brotkörbchen, drei Butterschälchen und eine gläserne Salzmühle.
Er hatte diese Kreuzfahrt von langer Hand geplant und seine Frau nur widerwillig überzeugen können, in den Urlaub zu fahren. Es war an der Zeit, es musste endlich etwas geschehen.
Bernd Pohlmann, Anfang 50, mit seinem Bauchansatz und dem Haarkranz weit entfernt von einem sportlichen Aussehen, war der Ansicht, es wäre der richtige Augenblick. Als er seine Frau ansah, erschrak er und fragte besorgt:
»Irene, was hast du?«
Sie sagte kein Wort und starrte mit weit aufgerissenen Augen an ihm vorbei.
»Irene?«
Er wurde unruhig.
»Irene, sag doch was!«
Irene Pohlmann zitterte am ganzen Körper, Schweißperlen rannen ihr von der Stirn und im nächsten Moment entwich ein spitzer, schriller Schrei ihrer Kehle.
Das gesamte Restaurant verharrte für einen Moment wie in einer Zeitblase. Alle drehten sich nach ihnen um und dann fiel Irene Pohlmann, von Krämpfen geschüttelt, vom Stuhl. Auf dem Boden liegend, wand sie sich unkontrolliert.
Bernd Pohlmann sprang auf und kniete sich neben seine Frau.
»Schnell! Einen Arzt!«, rief er verzweifelt.
Sofort waren zwei Stewards zur Stelle. Einer zog sein Jackett aus, faltete es zusammen und legte es als Kissen unter den Kopf der Frau. Der andere griff sich eine gerollte Serviette vom Tisch und steckte sie zwischen ihre Zähne, damit sie sich nicht die Zunge abbiss.
»Irene!«, rief Herr Pohlmann immer wieder. Er hielt ihre Hand. In seinem Blick lag vollkommene Hilflosigkeit.
Sie waren seit über 15 Jahren verheiratet und noch nie hatte sie einen solchen Anfall gehabt. Irene war organisch kerngesund, hatte allerdings starke Depressionen, die sie mit einem Cocktail an Antidepressiva in den Griff bekam.
Diese Depressionen waren auch der Grund für ihre kinderlose Ehe. Sobald sie über Familienplanung gesprochen hatten, war Irene der Meinung gewesen, sie würde ihrer Mutterrolle nicht gerecht werden. Eine Begründung dafür sah er in dem schlechten Verhältnis zu ihrer Mutter. Er hatte seine Schwiegermutter nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Das war, als sie noch nicht verheiratet waren, aber schon seit Jahren zusammen wohnten. An einem Einkaufssamstag mitten in Berlin wurden sie damals von einer alten, ungepflegten Frau angesprochen. Ein widerlicher Geruch nach kaltem Rauch war von ihr ausgeströmt.
Im ersten Moment hatte er sie für eine Bettlerin gehalten.
«Irene, mein Kind! Bist du es wirklich?», hatte die Alte gelallt.
Den Blick, mit dem Irene diese Frau bedachte, vergaß er nie wieder. Alle Wut des Universums hatte sich darin widergespiegelt.
»Bernd, das ist meine tote Mutter!«, hatte sie damals mit frostiger Stimme zu ihm gesagt.
Er war vollkommen irritiert gewesen. Irene hatte immer in der Vergangenheit von ihrer Mutter gesprochen und er war fest davon ausgegangen, dass sie verstorben sei.
»Ich weiß, du wünschtest, ich wäre tot!«, hatte die alte Frau resigniert gesagt.
»Dann sei doch bitte ein einziges Mal eine gute Mutter, nur ein einziges Mal, und stirb!«
Daraufhin war Irene einfach weiter gegangen. Er war völlig perplex noch einige Sekunden stehengeblieben, bevor er ihr nachgeeilt war. Die Szene war schrecklich grausam gewesen.
Wann immer er Irene in den folgenden Jahren auf ihre Mutter ansprach hatte, reagierte sie schroff und erstickte jedwede Diskussion im Ansatz mit den Worten: »Meine Mutter ist tot!«
Eigenartig, dass ihm das gerade jetzt einfiel, wo er ihre Hand hielt, während sie sich, von einem epileptischen Anfall gebeutelt, am Boden des Restaurants wand.
Von weitem hörte er eine Stimme.
»Lassen Sie mich durch! Ich bin Arzt!«
Im nächsten Moment kniete ein kleiner, untersetzter Mann mit Haarkranz neben ihm am Boden. Er trug eine weiße Uniform mit vier goldenen Streifen auf den Schulterklappen. Um seinen Hals baumelte ein Stethoskop.
Der Doktor sah Frau Pohlmann an und verharrte in der Bewegung.
»Meine Frau, sie ist plötzlich zusammengebrochen«, erklärte Bernd Pohlmann, aber der Doktor schien ihn nicht wahrzunehmen. Für einen Moment sah es so aus, als wolle er nichts tun, um der Frau zu helfen. Er sah sie nur an, bis seine Assistentin ihn am Arm berührte.
Sofort winkte er ab, öffnete Irene Pohlmanns Mund, tastete ihren Hals ab und leuchtete mit einer Stablampe in ihre Pupillen. Neben ihm öffnete seine Assistentin einen Koffer und zwei Unteroffiziere bahnten sich mit einer Trage den Weg durch das Restaurant.
»Leidet Ihre Frau an Allergien?«, fragte der Doktor.
Bernd Pohlmann war irritiert.
»Reagiert Ihre Frau auf irgendetwas allergisch, hat sie etwas gegessen?«
»Nein, nichts. Sie ist nicht allergisch, äh, wir haben noch gar nichts bestellt.«, stotterte Pohlmann aufgeregt.
»10 mg Midazolam!«, wies der Doktor seine Assistentin an.
Die Zuckungen stellten sich augenblicklich nach Verabreichung des Medikaments ein und Irene Pohlmanns Körper kam zur Ruhe. Ihrem Mann liefen Schweißperlen von der Stirn.
Während seine Frau auf die Trage gelegt, in Decken gehüllt und hinausgebracht wurde, liefen Bernd Pohlmann dicke Tränen übers Gesicht.
»Wo bringen Sie sie hin?«
»Auf die Krankenstation!«, erwiderte der Doktor.
»Das ist meine Assistenzärztin, Dr. Göpping. Sie wird sich um Sie kümmern!«
Die Ärztin nahm den schockierten Ehemann am Ellenbogen und verließ mit ihm das Restaurant.
Der Doktor sprach mit zwei der Kellner und mit den Herrschaften am Nachbartisch, ob die Frau unmittelbar vor dem Anfall irgendetwas zu sich genommen habe. Alle schüttelten verneinend den Kopf oder zuckten unwissend mit den Schultern. Dann schaute er sich im Rossini um und sein Blick blieb bei der Frau an Friedas Nachbartisch hängen. Irritiert registrierte Frieda, dass er zusammenzuckte. Dann trafen sich ihre Blicke endlich und ein überraschtes Lächeln huschte über sein Gesicht.
»Frau Olsen?« Er kam zu Friedas Tisch.
»Sie habe ich hier nicht erwartet!« Der Doktor schien ein wenig verwirrt.
»Das Gleiche wollte ich gerade sagen, Dr. Böhm!«
»Seit Sie letztes Jahr den Mordfall auf der AIDAluna aufgeklärt haben, wimmelte es dort von schaulustigen und neugieren Gästen, die alles ganz genau wissen wollten. Deshalb habe ich um Versetzung auf ein anderes Schiff der Flotte gebeten.«
Frieda nickte. »Die Talkshows und Zeitungsinterviews haben ein enormes Interesse an der AIDAbella geweckt, Klaas berichtete mir von Buchungsrekorden!«
Der Schiffsarzt sah auf seine Armbanduhr. »Ich muss zurück auf die Krankenstation. Haben Sie irgendetwas mitbekommen?«
Frieda schüttelte den Kopf. »Tut mir leid!«
»Falls Ihnen noch etwas einfällt oder Sie etwas benötigen sollten, können Sie mich über das Bordtelefon jederzeit erreichen.«
»Das ist sehr freundlich, Dr. Böhm, vielen Dank.«
»Ich muss!«, sagte er entschuldigend, drehte sich um und blieb vor dem Nachbartisch stehen. Die Frau bedachte ihn mit einem strengen Blick ihrer stechenden Augen und wandte sich, ohne ihn weiter zu beachten, wieder ihrem Teller zu.
Böhm blieb tapfer an dem Tisch stehen. Frieda zwinkerte ihm aufmunternd zu, jedoch starrte Böhm auf den Boden und bemerkte es nicht.
»Was?« Der Tonfall der Frau war schroff.
»Äh, Verzeihung, ist Ihnen die Frau aufgefallen, haben Sie etwas bemerkt?«
»Ich esse hier!«
Böhm nickte und schluckte einen Kloß hinunter. Offensichtlich war die Frau nicht besonders gesprächig, dachte Frieda. Ihr tat der gute Dr. Böhm leid.
»Ich hatte nur vermutet, Sie hätten vielleicht etwas bemerkt …«, stotterte Böhm wie ein Schuljunge.
»Spreche ich undeutlich? ICH ESSE HIER!«, leise und schneidend äußerte die Frau diesen Satz, ihren Blick fest auf den Teller gerichtet.
Der Doktor verließ schnellen Schrittes das Restaurant. Im Hinausgehen drehte er sich noch einmal um und winkte Frieda zu.
Was war nur mit Doktor Böhm los? Er schien seit ihrem letzten Treffen vor knapp sechs Monaten um Jahre gealtert und irgendwie gehetzt. Er hatte ja sogar noch um diese Uhrzeit seine Sonnenbrille auf dem Kopf sitzen! Bestimmt hatten ihn die Ereignisse auf der AIDAbella genauso gestresst wie sie selbst. Allerdings hatte Frieda das Gefühl, dass sie ihm mit der Verarbeitung der Geschehnisse deutlich voraus war. Vielleicht würde es ihm helfen, sich mit ihr in Ruhe zu unterhalten?
Frieda hatte nicht damit gerechnet, hier an Bord auf Dr. Böhm zu treffen, andererseits war die AIDA-Welt ein kleines Dorf und die Besatzung wechselte oft zwischen den Schiffen hin und her.
ImRossini herrschte mittlerweile wieder normaler Betrieb, die Bedienung hatte den Tisch bereits abgeräumt und ein anderes Paar dort Platz nehmen lassen.
Die Dame am Nebentisch war gegangen und als Frieda das Restaurant durchquerte, um sich auf ihre Suite zu begeben, blieb ihr Blick an einer älteren Frau hängen, die am anderen Ende der Tischreihe saß und meditativ auf die Wand starrte. Ihr Gesicht war aschfahl und die Haut um die verkrampften Fingerknöchel schien so dünn, als würde sie jeden Moment aufreißen.
Vor der Brust hielt sie mit beiden Händen einen Gegenstand fest umschlossen. Er hing an einer Kette um ihren Hals, wahrscheinlich war es ein Anhänger oder Medaillon.
Im Grunde genommen ruhte Friedas Blick nur deshalb ein paar Sekunden auf ihr, weil sie irgendwie verlorener als die anderen alleinstehenden Frauen wirkte, denen sie sonst auf Kreuzfahrten begegnete.
Menschen gingen aus unterschiedlichsten Beweggründen auf eine Kreuzfahrt und wer weiß, weshalb es diese Frau an Bord gezogen hatte. Frieda verließ das Rossini in Richtung Treppenhaus, ließ die Fahrstühle links liegen und nutzte die Treppen, um den Weg über das Außendeck 12 nach vorn zum Bug zu nehmen.
Ein paar Schritte an Deck würden ihr nach dem Essen guttun. Sie hielt ihre Nase in den Wind und spürte, wie die salzige Luft in ihre Lungen strömte.
Auf einem anderen Deck platzte in diesem Moment eine alte, längst vergessene Wunde auf. Unzählige Erinnerungsfetzen bahnten sich ihren Weg durch die dunklen und versteckten Kammern verlorener Gedanken. Gedanken, die sorgsam weggeschlossen waren. Doch brachen sie jetzt hervor, ähnlich einem Vulkan, der jahrmillionenaltes Gestein ausspuckte.
Diese schmerzlichen Bilder, die tiefsitzenden Verletzungen und Schuldgefühle waren so präsent wie vor 35 Jahren. Nein, diesmal würde der Schmerz sich nicht wegsperren lassen. Diesmal würde er seinen Tribut fordern.
6
Orkney-Inseln, Schottland – 21. Juni 1919
Das winzige Boot glitt lautlos durch die spiegelglatte, nebelverhangene See. Ende Juni war eigentlich Hochsommer, aber vor der Küste Schottlands kletterte das Thermometer so gut wie nie über 15 Grad. Das Beiboot der SMS Emden war vor der Dämmerung ins Wasser gelassen worden.
Müller steckte in einer viel zu weiten Hose, die durch Hosenträger davon abgehalten wurde, ihm über die Hüften zu rutschen. Ein kratziges schottisches Fischerhemd, eine zerschlissene Wolljacke, eine dunkle Wollmütze und sein akzentfreies Englisch sollten ihn davor bewahren, als Angehöriger der Kaiserlichen Kriegsmarine entlarvt zu werden.
Als der Admiral vorgestern ausgerechnet ihn in sein Quartier beorderte, war ihm nicht bewusst gewesen, welche Chance sich ihm bieten würde.
Von wichtigen Dokumenten, Kapitulation und Friedensverhandlungen in Versailles war die Rede gewesen. Diese Dokumente sollten den Weltkrieg wieder aufflackern lassen und einen Frieden in weite Ferne rücken.
Admiral von Reuter hatte verächtlich auf die Siegermächte gespuckt.
Müller war ein einfacher Maschinist, der wie hunderte andere Werftarbeiter mit Kriegsbeginn zur Kaiserlichen Kriegsmarine eingezogen worden war.
Sein Vater hatte ihn schon als Kind mit zur Werft genommen. Im Alter von 12 Jahren arbeitete der junge Georg bereits auf der TecklenborgWerft in Geestemünde in der Segelmacherei. Das Werftgelände war so unüberschaubar wie eine eigene Stadt und die Maschinenhallen so groß wie Kirchen. Dorthin, wo die Dampfmaschinen und Schiffskessel entstanden, hatte es ihn immer getrieben. Diese Monster aus Eisen und Stahl waren für ihn technische Wunderwerke.
Seine Mutter war bei seiner Geburt gestorben und während sein Vater tagsüber in der Werft arbeitete, hatte sich die benachbarte Witwe Mrs. Haring um ihn gekümmert. Sie war mit einem Engländer verheiratet gewesen und sprach ausschließlich englisch mit Georg.
Seine Begeisterung für die Technik und seine Zweisprachigkeit hatten ihm nach drei Jahren eine der seltenen Lehrlingsstellen eingebracht. Sein Vater war unheimlich stolz auf ihn. Werftarbeiter gab es Tausende, aber nur Meister und Lehrlinge konnten es im Schiffsbau zu etwas bringen. Sein Sohn würde es besser haben als er.
Georg Müller konnte notdürftig schreiben und lesen, aber Baupläne und technische Zeichnungen erschlossen sich ihm sofort. Diese Ära war eine Zeit des Aufbruchs in eine neue Welt. Die Dampfturbinen als Antrieb für die Schiffe wurden von den Dieselmotoren verdrängt und immer, wenn Schiffsbauer aus Holland und Großbritannien zu Gast auf der Werft waren, wurde Georg dazugeholt, um zu übersetzen. Auch wenn er die physikalischen Formeln nicht verstand, so erlangte er in diesen Jahren umfassende Kenntnisse von Motoren und Schiffsbau.
In dem kleinen Ruderboot sitzend, das im Frühnebel lautlos Richtung Küste glitt, überkamen ihn die Erinnerungen. In seiner gesamten Zeit bei Tecklenborg konnte er sich nicht an einen Tag erinnern, an dem er nicht öl- und teerverschmiert nach Hause gegangen war. Er hatte es geliebt, an den haushohen Maschinen zu arbeiten.
Die mannshohen Kolben und Schieber, die Ventile und kolossalen Dampfkessel, all das hatte ihn begeistert.
Als Belohnung für herausragend gute Leistungen durfte er seinen Lehrmeister 1912 begleiten, als die Rolandseck vom Stapel lief. Sie war das erste deutsche Motorschiff mit Einschraubenantrieb.
Auf der Werft galt die Rolandseck als Sensation. Hunderte neue Mitarbeiter wurden eingestellt und es begann die Kiellegung dutzender neuer Schiffe mit Dieselmotor. Und als mangels Nachfrage die Segelmacherei aufgegeben wurde, fand auch Georgs Vater eine andere Arbeit auf der Werft.