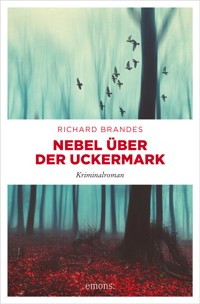
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Carla Stach
- Sprache: Deutsch
Eine rätselhafte Geschichte, packend und geheimnisvoll. Kriminalhauptkommissarin Carla Stach wird mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert: Eine Hellseherin behauptet, einen Mord vorhergesehen zu haben. Kurz darauf wird eine junge Frau als vermisst gemeldet, und ihr Aussehen gleicht exakt dem des Mordopfers, das die Hellseherin beschrieben hat. Carla ist skeptisch, denn sie glaubt nicht an derlei Hokuspokus – und doch wird sie unruhig. Schließlich wurde ihr auch prophezeit, dass sie selbst in Gefahr geraten wird ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Richard Brandes ist Psychotherapeut mit eigener Praxis und arbeitet hauptsächlich mit Paaren und Jugendlichen. Er schrieb bereits zahlreiche Drehbücher für Krimiserien als Storyliner und Dialogautor. Richard Brandes lebt in Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: arcangel.com/Dirk Wustenhagen
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-093-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Albert Einstein
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.
Shakespeare, »Hamlet«
Prolog
Krankenhaus Gransee, im Winter 1996
Es war eine finstere Nacht, stürmisch und bitterkalt. Lore Kaiser fuhr jedes Mal zusammen, wenn heulende Böen um das Gebäude fegten und das kleine Fenster erbeben ließen. Sie hatte ihren Wollmantel anbehalten, denn trotz aufgedrehter Heizung fror sie in dem winzigen Zimmer. Als wehe der Hauch des Todes, dachte sie.
Nun hatte es auch noch zu schneien begonnen, es waren die ersten Flocken in diesem Jahr. Sie tanzten im Lichtkegel einer Laterne, setzten sich auf die Fensterscheibe und flogen beim nächsten Windstoß wieder fort. Unterhalb der Laterne, am gegenüberliegenden Gebäude, war ein rundes, bullaugenartiges Fenster, das im Schneesturm so aussah wie eine Fratze. Lore schauderte bei dem Anblick. Schon als Kind hatte sie eine lebhafte Phantasie gehabt.
Sie saß bei Opa Bertram, ihrem Schwiegervater, der zum Fenster gewandt lag und ihr den Rücken zugedreht hatte. Ihre Hand ruhte auf dem steif gemangelten Oberbett, das den alten Mann zudeckte. Es ging zu Ende mit ihm. Eine Infusion tropfte ruhig und gleichmäßig, über dem Kopfende brannte eine Röhrenlampe, die ein kühles Licht abgab.
Jenseits des Bettes saß Lores Tochter Maria. Sie drückte die Hand ihres Großvaters und schluchzte herzzerreißend. Es schmerzte Lore, wie sehr ihr Kind unter dem drohenden Verlust des Opas litt. »Du darfst dich nicht so aufregen«, sagte sie. »Der Tod gehört zum Leben. Wir müssen damit umgehen, dass es irgendwann einmal vorbei ist.«
»Nein, Opa darf nicht sterben«, sagte Maria und sah flehend zu Lore in der Hoffnung, sie könne etwas tun, um den Tod abzuwenden.
Lores andere Tochter Lene, mit zehn Jahren nur ein Jahr älter als Maria, ging gefasster mit der Situation um. Sie stand am Fußende und verfolgte das Sterben mit mehr Zurückhaltung. Ihre Bindung zu Opa Bertram war nicht so eng, wie es bei Maria der Fall war; außerdem war sie von ihrem Charakter her nüchterner und pragmatischer als Maria. Die Mädchen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Lene war die Hübschere und Klügere von beiden; sie war selbstbewusst, durchsetzungsfähig und im Sommer zur Klassensprecherin gewählt worden. Maria war leicht übergewichtig und nicht besonders gut in der Schule. Wegen ihrer sensiblen und oft auch weinerlichen Art hatte sie es schwer bei ihren Mitschülern, die sie oft hänselten.
Lores Gedanken wurden unterbrochen, weil Opa Bertram plötzlich etwas Unverständliches flüsterte. Sachte erhob sie sich und beugte sich über den alten Mann, der den Blick starr zum Fenster gerichtet hatte.
»Da draußen ist jemand«, sagte er schwach. »Er schaut zu mir rüber.«
Zugleich begann Maria so heftig zu atmen, als hyperventilierte sie. Lore nahm ihren Stuhl, setzte sich zu ihrer Tochter, legte den Arm um sie und streichelte ihren Kopf. »Er phantasiert«, flüsterte Lore. »Das ist ganz normal, wenn der Tod naht. Bei Uroma Lotte war es genauso gewesen und bei Oma Christa auch.«
Doch Maria konnte sich nicht beruhigen, sie schnappte unentwegt nach Luft. »Da draußen ist wirklich jemand«, sagte sie. »Ein Mann. Er will Opa holen. Ich hab ihn auch gesehen.«
»Du meinst bestimmt das runde Fenster da drüben. Durch den Schnee sieht es aus wie ein Gesicht.«
Maria drehte den Kopf und schaute nach draußen. »Nein, ich meine den Mann. Er winkt Opa zu.«
»Aber das ist unmöglich«, sagte Lore und sah zu Lene hinüber, die genervt mit den Augen rollte. »Wir sind hier im ersten Stock. Wie soll da jemand am Fenster stehen.«
Lore seufzte. Das Verhalten ihrer Tochter beunruhigte sie. Was war nur los mit dem Kind? Seit dem Autounfall, der Opa Bertram in diese fürchterliche Lage gebracht hatte, war Maria auf eine seltsame, fast unheimliche Weise verändert. Sie faselte etwas von Toten, die nachts in ihr Zimmer kämen, und dass sie in Träumen Dinge erlebte, die sich tatsächlich ereigneten. Lore dachte ernsthaft darüber nach, ärztliche Hilfe hinzuzuziehen, für das Kind, aber auch für sich. Es schien, als verliere Maria den Verstand. Konnte der Tod eines nahen Angehörigen eine solche Geisteskrankheit auslösen? Vielleicht glaubte Maria plötzlich an jenseitige Dinge, weil sie ihrem Opa auf diese Weise für immer nah sein konnte. Er war für sie die wichtigste Bezugsperson seit dem Tod von Lores Mann Peter, dem Vater der Kinder. Er war an Leukämie gestorben, da war Maria fünf Jahre alt gewesen.
Lore drückte Maria fest an sich, während sie ihr durch die braunen Locken strich. Dabei warf sie einen Blick zu Lene, die gereizt den Kopf schüttelte. Sie glaubte, dass Maria mit ihrem theatralischen Benehmen bloß Aufmerksamkeit erlangen wollte.
»Bitte helft mir«, sagte Opa Bertram, und Lore horchte auf. So laut und deutlich hatte sie ihn seit Tagen nicht sprechen gehört. Sie stand auf und streichelte ihm über die eingefallenen Wangen.
»Was können wir für dich tun?«, flüsterte sie, während ihre Augen nass wurden. Der Tod ihres Schwiegervaters schmerzte auch sie. Sie vergaß es nur manchmal, weil Marias Trauer so übermächtig war.
Opa Bertram stierte noch immer zum Fenster. Er hob eine Hand, sie zitterte. »Bitte helft mir«, sagte er. »Ich muss auf die andere Seite.«
»Sollen wir dich umdrehen?«, fragte Lore und überlegte, wie sie es am besten bewerkstelligen konnten, ohne ihrem Schwiegervater wehzutun.
»Ich muss auf die andere Seite«, sagte Opa Bertram erneut und mit Nachdruck.
Lene kam hinzu, um Lore beim Umlagern zu helfen. Sie schlugen die Decke zurück und nahmen die Stützkissen beiseite, die zwischen den Beinen und am Rücken des alten Mannes lagen.
»Ihr braucht ihn nicht umzudrehen«, sagte Maria, die auch aufgestanden war und mit einem Mal eine ungewöhnliche Ruhe und Beherrschtheit ausstrahlte. »Er meint etwas anderes. Er will, dass wir ihm über den Fluss helfen.«
»Was für ein Fluss?« Lore verstand nicht, wovon Maria sprach, und auch Lene zuckte mit den Schultern. Es war wieder eine dieser rätselhaften Äußerungen des Mädchens.
Vorsichtig drehten sie den Sterbenden, wobei Lore darauf achtete, den Infusionsschlauch mitzunehmen. Als sie es endlich geschafft hatten und Opa Bertram zudeckten, merkte Lore, dass es merkwürdig still im Raum geworden war. Ihr Schwiegervater atmete nicht mehr. Lore hielt ihre Hand unter seine Nase und fühlte seinen Puls, aber sie spürte kein Lebenszeichen.
»Er ist auf der anderen Seite angekommen«, sagte Maria, und Lore war zu verwirrt, um etwas erwidern zu können.
1
Jeta schreckte schreiend aus dem Schlaf.
Als sie die Augen öffnete, brauchte sie eine Weile, um sich zu orientieren. Sie lag im Laub und blickte an Bäumen hoch, die von Nebel eingehüllt waren, sie hatten ihre Herbstblätter bereits verloren. Kein Windhauch wehte, es war totenstill. Die Luft war kühl, aber der Wollmantel, den sie trug, wärmte sie. Wie war sie in diesen Wald gekommen? Sie musste bewusstlos gewesen sein, in ihrem Kopf herrschte eine seltsame Leere.
Verwirrt setzte sie sich auf und zupfte sich das Laub aus den Haaren, die bis über ihre Schultern reichten. Wie viele Stunden sie hier wohl gelegen hatte? An ihrem Mantel fehlten zwei Knöpfe, sie waren abgerissen worden, die Fäden hingen noch heraus. Auch war ihre Handtasche nicht da, ohne die sie normalerweise nie das Haus verließ. Sie kniete sich hin und tastete mit beiden Händen das Laub ab, aber sie konnte die Tasche nirgends finden. Was war geschehen, wie kam sie hierher?
Sie ließ sich zurück auf ihren Po fallen und versuchte, sich mit geschlossenen Augen zu konzentrieren. Wann war sie von zu Hause fortgegangen, und wo hatte sie hingewollt? Was hatte sie letzte Nacht, am Tag zuvor oder vergangene Woche getan? Es fiel ihr nicht ein, die Erinnerung war ausgelöscht. Sie musste ihr Gedächtnis verloren haben. Lediglich ihre Identität war ihr bekannt. Dass sie Jeta Seferi hieß, sechsundzwanzig Jahre alt war und aus Albanien stammte. Und dass sie in Fürstenberg an der Havel lebte, in einer Wohngemeinschaft mit Tilly, einer guten Freundin und Kollegin.
Tilly, sie musste sie anrufen.
Hastig kramte sie nach ihrem Smartphone, das in ihrem Mantel stecken musste, aber sie fand es nicht, auch in den Hosentaschen war es nicht. Wahrscheinlich hatte sie es in ihre Handtasche getan. Nun war sie nicht einmal in der Lage, Hilfe zu holen. Einer von zwei Ohrringen war verschwunden, ein silbernes Kreuz. Es musste einen Kampf gegeben haben. War sie angegriffen worden? Hatte sie sich mit jemandem gestritten? Sie wusste es nicht, und es fühlte sich schrecklich an, es nicht zu wissen.
Der Nebel um sie herum war so dicht, dass sie nur wenige Meter weit schauen konnte. Sie stand auf, schloss ihren Mantel mit den noch verbliebenen Knöpfen und stolperte verunsichert über Wurzeln und heruntergefallene Äste in eine beliebige Richtung. Irgendwo musste es einen Ausgang aus dem Wald geben. Sie beruhigte sich damit, dass die Wälder in Brandenburg zwar riesig sein konnten, aber sie dennoch früher oder später auf eine Ortschaft, eine Landstraße oder zumindest einen Spazierweg stoßen musste.
Doch warum war sie so sicher, in Brandenburg zu sein? Vielleicht war sie ganz woanders, weit weg von zu Hause. Solange sie unter dieser Amnesie litt, konnte sie nichts wissen.
Als sie eine Weile durch den Wald geirrt war, hörte sie plötzlich in der Ferne eine Stimme.
»Jack!«
Sie blieb stehen, ihr Herz schlug bis zum Hals. Gott sei Dank war sie nicht allein in diesem Wald.
»Jack! Wo steckst du denn? Hierher! Jack!«
Es klang, als riefe eine Frau nach ihrem Hund. Jeta lief in Richtung der Rufe, aber sie kam nur schwer voran, weil die Bäume dicht beieinanderstanden und ihr die Zweige ins Gesicht schlugen.
»Jack! Wo bist du? Jack!«
Es tat ungemein gut, diese Stimme zu hören, die immer lauter wurde, die sich immer mehr näherte.
»Jack, hierher! Bei Fuß!«
Jeta erreichte einen umgestürzten Baum, dessen Stamm feucht und glatt war. Vorsichtig versuchte sie, darüberzuklettern, doch sie rutschte aus und stürzte ins Laub. Als sie hochsah, erschrak sie so sehr, dass sie einen Schrei ausstieß. Vor ihr stand ein wolfsgroßer schwarzer Hund und knurrte sie an. Es musste Jack sein, nach dem gerufen wurde.
Jeta wagte es nicht, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen, denn der Hund fletschte seine Zähne. Normalerweise fürchtete sie keine Hunde, ganz gleich, wie aggressiv sie sich zeigten, denn sie taten ihr nichts. In ihrem Heimatdorf in den albanischen Alpen lebten zahlreiche Hunde. Sie gehörten niemandem, liefen frei herum und wurden von den Dorfbewohnern gefüttert. Jeta hatte schon früh gelernt, den Tieren zu vertrauen, so wie man Geschwistern oder seinen besten Freunden vertraute. Auch hatte sie mit ihnen kommuniziert, gedanklich und indem sie mit ihnen gesprochen hatte. Auf diese Weise hatte sich immer eine Beziehung zu den Tieren herstellen lassen.
Nachdem sich der erste Schrecken gelegt hatte, hatte sie keine Angst mehr vor Jack, vielmehr erkannte sie, dass er Angst vor ihr hatte. Er duckte sich, wich zurück, dann kam er wieder ein paar Schritte auf sie zu, als sei er noch unschlüssig, ob er sie beschnuppern, angreifen oder vor ihr flüchten sollte. Jeta sah ihm liebevoll in die Augen.
»Ju jeni një qen i bukur«, sagte sie leise. »Pse keni frikë nga unë?«
Sie wollte ihn streicheln, aber er machte einen Satz zurück und fiepte. »Më ndihmo të dal nga këtu. Më sillni zonjën tuaj.«
»Jack! Komm her! Jack!«, schallte es aus dem Nebel, der so dicht geworden war, dass Jeta keine drei Meter weit schauen konnte. Die Stimme war jetzt sehr nah, und auch die Schritte der Hundebesitzerin raschelten im Laub. Inzwischen hatte Jack vollends Vertrauen gefasst. Er wedelte mit dem Schwanz und bellte Jeta freundlich an. Doch als sie ihn erneut streicheln wollte, drehte er sich plötzlich weg und stob davon.
»Da bist du ja«, rief die weibliche Stimme, und Jeta konnte das Klirren von Jacks Geschirr hören. Vermutlich knuddelte ihn seine Besitzerin, während er an ihr hochsprang.
»Hilfe«, sagte Jeta und stand auf. »Bitte helfen Sie mir.«
Doch die Frau reagierte nicht. Ihre Schritte entfernten sich in rasantem Tempo.
Jeta eilte hinterher, so schnell sie konnte. »Bitte kommen Sie zurück!«, rief sie. »Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wie ich aus diesem Wald rauskomme. Bitte, ich brauche Hilfe.«
Doch die Frau antwortete nicht, stattdessen verschwanden ihre Schritte und das Laufen des Hundes im Nebel, bis es irgendwann wieder totenstill wurde.
Die Frau und ihr Hund waren fort.
2
Es war ein grauer und regnerischer Novembernachmittag, als Oguz Demir sein Einfamilienhaus in der Wagnerstraße am Rande von Velten betrat. Seine Stimmung war gedrückt, denn er hatte sich über einen unverschämten Fahrgast geärgert, wie so oft in der letzten Zeit. Verbale Attacken gegen Busfahrer nahmen zu, und ganz besonders bei ihm, da er türkischer Herkunft war. Dennoch war er froh, den Job bei der Oberhavel Verkehrsgesellschaft bekommen zu haben, denn sie brauchten das Geld. Kristin, seine Frau, war mit ihrem Imbiss an der B 96 pleitegegangen, und sie mussten den Kredit für das Haus abzahlen. Ohne seine Schwiegereltern wüsste er ohnehin nicht, wie sie die finanzielle Last stemmen sollten.
Er hängte seine Jacke an die Garderobe und wunderte sich, dass ihm Taner nicht entgegenlief, so wie er es sonst immer tat, wenn Oguz nach Hause kam. In der Küche brannte das Deckenlicht, eine Kinderzeichnung und Filzstifte lagen auf dem Tisch; Taner hatte einen Bauernhof gemalt. Im Wohnzimmer, das sich an die Küche anschloss, lag der Staubsauger mitten im Raum, während die Möbel beiseitegerückt worden waren, als sei seine Frau beim Reinemachen gestört worden. Seltsamerweise war die Terrassentür geöffnet, und ein kalter Luftzug wehte herein. Oguz trat nach draußen und blickte auf einen klitschnassen Rasen, kahle Sträucher und welke Stauden, während es noch immer regnete. Wo war Kristin? Wo war Taner? Und warum stand die Terrassentür so sperrangelweit auf?
Zurück in der Wohnküche holte Oguz sein Handy aus der Hosentasche und wählte Kristins Nummer. Als das Freizeichen erklang, vibrierte es gleichzeitig auf der Küchenzeile. Es war Kristins Telefon, sie musste im Haus sein, vielleicht oben.
Oguz ging zurück in den Flur.
»Taner? Kristin?«
Weil niemand antwortete, eilte er die Treppe hinauf, um im Schlafzimmer nachzusehen. Das Ehebett war ordentlich mit einer Tagesdecke überzogen, und es war kühl im Raum, aber Taner und Kristin waren nicht da. Auch nebenan im Kinderzimmer war niemand.
Oguz wurde unruhig, und er begann, sich Sorgen zu machen. Vielleicht war Kristin zu den Nachbarn gegangen, mit Gregor trank sie oft einen Kaffee. Er wollte gerade noch das Badezimmer überprüfen, da klingelte es an der Tür. Er lief nach unten und öffnete.
»Das ist Gedankenübertragung«, sagte er, als er Gregor erblickte, der einen aufgespannten Schirm in der einen und ein Glas Marmelade in der anderen Hand hielt. Sein Bauch lugte durch den offenen Reißverschluss seines Anoraks.
»Hallo, Oguz«, sagte er fröhlich. »Ich habe Kristin versprochen, was von der Marmelade vorbeizubringen. Brombeeren, selbst gemacht.« Er schüttelte sich. »Bah, was für ein Mistwetter!«
Oguz nahm ihm das Glas ab. »Dank dir, Gregor. Kristin ist nicht da. Ich dachte, dass sie vielleicht bei euch ist …«
»War sie auch, aber am Vormittag. Wir haben ein bisschen gequatscht, und dabei habe ich ihr von der Marmelade erzählt, aber sie hat vergessen, sie mitzunehmen.«
»Willst du nicht reinkommen?«
»Lieb von dir, aber ich muss noch schnell zum Supermarkt. Beate müsste gleich von der Frühschicht zurück sein, und wenn sie nicht sofort was zu essen kriegt, wird sie knurrig. Du kennst sie ja.« Er legte die Stirn in Falten. »Was ist? Du wirkst besorgt. Stimmt was nicht?«
Oguz zögerte. »Ich frage mich, wo Kristin und Taner sind. Die Terrassentür steht auf, und Kristins Handy liegt in der Küche … Es ist so gar nicht ihre Art, ohne ihr Handy aus dem Haus zu gehen.«
»Ach, mach dir keine Gedanken. Taner hatte heute Morgen Halsweh. Wahrscheinlich ist sie mit ihm zum Arzt, und das Handy hat sie vergessen.«
Oguz biss sich auf die Unterlippe. Er war sehr zeitig zur Arbeit gefahren, deshalb hatte er von Taners Halsschmerzen nichts mitbekommen. »Das wird es sein«, sagte er und quälte sich ein Lächeln ab. Gregors Erklärung beruhigte ihn nicht. Wenn Kristin zum Arzt gegangen wäre, hätte sie nicht das Deckenlicht an und die Terrassentür offen gelassen. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihm aus, auch wenn ihm der Verstand sagte, dass er möglicherweise übertrieb. Was sollte schon geschehen sein?
»Also dann … bis demnächst«, sagte er, als Gregor sich verabschiedete, und schloss die Haustür. Auf dem Weg zurück in die Wohnküche stutzte er. In der Gästetoilette wimmerte jemand. Verdutzt blieb er stehen.
»Taner?«
»Papa!«
Oguz war irritiert. Warum hockte sein Sohn auf der Toilette und meldete sich nicht, obwohl Oguz nach ihm gerufen hatte? Als er die Toilettentür öffnen wollte, merkte er, dass sie abgeschlossen war.
»Mach auf!«, sagte er.
Taner weinte.
Oguz rüttelte an der Klinke. »Du sollst die Tür aufmachen!«
»Ich kann nicht. Ich hab keinen Schlüssel.«
»Was heißt das, du hast keinen Schlüssel? Wer hat dich denn da eingeschlossen? Wo ist Mama?«
Taner schluchzte.
»Bitte erzähl mir ganz genau, was passiert ist. Wieso bist du auf dem Klo?« Oguz hatte Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben. Er bekam es mit der Angst zu tun.
»Der Mann hat mich eingeschlossen.«
»Der Mann? Welcher Mann?«
»Er ist reingekommen, als Mama und ich –«
Plötzlich spürte Oguz etwas Kühles an seiner Schläfe. Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff, dass es der Lauf einer Pistole war. Er hob die Hände und ließ das Marmeladenglas los. Es zersplitterte auf dem Steinfußboden. Als er zur Seite schielte, um zu sehen, wer ihn mit der Waffe bedrohte, versetzte ihm der Unbekannte einen Stoß, sodass er in die Wohnküche stolperte. Am Esstisch angekommen wurden ihm die Hände auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Dann spürte er einen Druck auf den Schultern. Er sollte sich hinknien. Oguz gehorchte, was blieb ihm auch anderes übrig?
»Wo ist meine Frau?«, hörte er sich fragen, aber der Unbekannte antwortete nicht.
Oguz geriet in Panik. Sein Herz pochte, und er zitterte am ganzen Körper, denn allmählich dämmerte ihm, was hier geschah. Der Kerl war ein gemeingefährlicher Killer. Oguz kannte ihn nicht persönlich, aber er hatte von ihm gehört. Man sprach über ihn, tuschelte, dass er Verräter hinrichten würde, so wie er es mit den anderen aus der Gruppe auch getan hatte. Hätte er doch geschwiegen! Nun war es zu spät.
Als der Mann die Terrassentür schloss und per Knopfdruck die Jalousien in Küche und Wohnzimmer herunterließ, sah Oguz, dass er einen schwarzen Sweater trug, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Nun wusste er, was ihm bevorstand. Es war so grässlich, dass er es nicht wagte, den Gedanken zu Ende zu führen.
3
Die Stimmung war ausgezeichnet, nur sorgte sich Carla ein wenig um ihren Dezernatsleiter Rolf Hallinger. Er sah schlecht aus, hatte Ringe unter den Augen und geschwollene Tränensäcke. Außerdem hatte er von dem wunderbaren Büfett noch nicht einen einzigen Bissen genommen, stattdessen nippte er die ganze Zeit an einem stillen Wasser. Was war mit ihm los? Nun wollte er auch noch eine Rede halten! Ob das mal gut ging?
Carla beobachtete ihn, wie er aufstand und sich mit einem Blatt Papier an den Kopf der Tafel begab. Dass gerade Hallinger sie ehren wollte, rührte sie, verwunderte sie aber auch ein wenig, denn in all den Jahren, in denen sie sich kannten, hatten sie sich mehr gezankt als vertragen. Dabei fand sie eigentlich, dass er einen hervorragenden Dezernatsleiter abgab. Allerdings stellte sich bei Differenzen meistens heraus, dass sie und nicht er recht hatte. Aus diesem Grund widerstrebte es ihr, sich von ihm etwas vorschreiben zu lassen. In fachlicher Hinsicht nahm sie ihn nicht so ernst, wie es eigentlich sein sollte.
Sie winkte Tino Rosen heran, den hübschen Kellner mit dem aparten Muttermal über der Oberlippe, und trug ihm auf, die Musik auszustellen, während Hallinger noch unschlüssig sein Manuskript überflog. Kurz darauf versiegten die Jazz-Klänge, und es war nur noch das Gemurmel der Gäste zu hören. Dass so viele zu ihrem sechzigsten Geburtstag erschienen waren, freute Carla nicht nur, es ergriff sie regelrecht. Damit sich alle wohlfühlten, hatte sie wie bei einem Staatsbankett auffahren lassen. Es gab Wein, Bier, Sekt, Likör, Schnaps, Kaffee in allen Variationen, für die Kinder Limonade, Saft und Kakao, und im Raum nebenan war ein Büfett aufgebaut, das keine Wünsche offenließ. Obwohl Maria Kaiser und ihr Mann Milan Babic, denen der Gasthof »Seeblick« gehörte, hervorragend gekocht hatten, hatte Carla zu Hause noch kräftig mitgeholfen. Schweine- und Rinderbraten, scharf gewürzter Hackbraten, Linsensuppe mit Bauchspeck, Kartoffelsalat und gebackener Mozzarella in ausgehöhlten Zitronen gingen auf ihr Konto. Ach ja, und der Tomatensalat mit dem frischen Basilikum natürlich auch, und nicht zu vergessen die gefüllten Avocado-Hälften und das in Olivenöl geschwenkte Gemüse, denn es waren auch Veganer zu Gast.
Sie wäre unruhig geworden, hätte sie sich bei der Essenszubereitung allein auf die Wirtsleute verlassen. Schließlich waren Braten aller Art ihre Spezialität. Auch hatte sie das Risiko ausschließen wollen, dass es an irgendetwas mangelte. Stieftochter Leonie hatte das Engagement mit den Worten kommentiert, dass Carlas Massen schließlich auch irgendwoher kommen mussten. Die Bemerkung war gemein gewesen, doch Carla entschuldigte sie damit, dass Pubertierende ihr schlechtes Körpergefühl mit dem Lästern über andere kompensieren mussten.
Während Hallinger in die Runde sah, als würde er jeden Moment mit seiner Rede anfangen, brachten die Wirtsleute und Kellner Tino Getränke zur Tafel. Carla musste verwundert und mit einem Anflug von Eifersucht mit ansehen, dass Bruno die ganze Zeit hinter Maria Kaiser herlief. Schon vor vier Jahren, als Carla den Gasthof entdeckt hatte, hatten sich ihr Hund und die Wirtsfrau auf Anhieb gut verstanden. Brunos Verhalten war merkwürdig, denn Rauhaardackel verhielten sich Fremden gegenüber reserviert. Bruno war in dieser Hinsicht keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Menschen außerhalb der Familie waren es normalerweise nicht wert, auch nur eines Blickes gewürdigt zu werden.
»Liebes Geburtstagskind, liebe Gäste«, sagte Hallinger und rückte seine dicke Brille zurecht, während es im Raum augenblicklich still wurde. Hallinger trug eine edle auberginefarbene Krawatte zu einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd. Seine Hand, in der er das Manuskript hielt, zitterte, auf seiner Stirn perlte Schweiß. Er schien Kreislaufprobleme zu haben, denn Nervosität konnte nicht der Grund sein. Hallinger war ein Alphatier und mit dem Sprechen vor Gruppen vertraut.
»Es ist mir eine Ehre, dass ich heute Abend einer von Ihnen sein darf«, sagte er, »denn ich erachte es nicht als selbstverständlich, dass ich eingeladen wurde. Frau Stach und ich haben ein – gelinde gesagt – spannungsreiches, kontroverses und zuweilen auch zugewandtes und vertrautes berufliches Verhältnis.«
Das trifft es, dachte Carla und trank einen Schluck Bier. Auf den Gesichtern der Gäste zeichnete sich ein Lächeln ab.
»Ich erinnere mich noch gut an Frau Stachs Anfangszeit bei der Neuruppiner Polizeidirektion. Zum Einstieg hatte sie mich und einige Kollegen aus dem Dezernat zu einem Kegelabend eingeladen. Es war schön, wir hatten Spaß, und als ich an der Reihe war und zur Bahn wollte, kam ich nicht durch, weil Frau Stach mitten im Durchgang stand und einen Plausch hielt. Ich bat sie, ein Stück zur Seite zu treten, doch sie reagierte nicht. Ich berührte sie zögerlich an der Schulter, drückte ein wenig, räusperte mich, bat noch einmal, flehte fast, doch es endete damit, dass ich mich an ihr vorbeiquetschen musste.«
Gelächter brandete auf.
»Da könnte ich auch noch ein paar Geschichten erzählen«, brüllte Kathrin über die Tafel hinweg und klatschte laut lachend in die Hände. »Meine Frau zeigt gerne mal, wo der Hammer hängt, hahaha.«
Selbst Leonie, pubertätsbedingt cool, konnte sich ein schiefes Grinsen nicht verkneifen.
Obwohl es viele Jahre zurücklag, erinnerte sich Carla noch gut an die Situation. Sie hatte Hallinger demonstrieren wollen, dass sie sich nicht von ihm einschüchtern ließ. Dass er sich ebenfalls erinnerte, hieß, dass die Botschaft angekommen war.
»Aber es gab eben auch diese anderen Momente«, fuhr Hallinger fort, nachdem es im Raum wieder still geworden war. »Als meine Frau vor einigen Jahren starb … da … da haben sich Frau Stach und ihre Ehefrau Kathrin rührend um mich …« Hallinger presste plötzlich die Hand vors Gesicht und begann zu weinen. Auch Carla schossen Tränen in die Augen. Was er sagte, berührte sie.
»Der macht aber keinen so fitten Eindruck«, flüsterte Kathrin ihr ins Ohr. Sie trug ein zartblaues Kleid, das wunderbar zu ihren dunkelbraunen Locken passte.
»Es scheint ihm aus irgendeinem Grund nicht gut zu gehen«, flüsterte Carla zurück und tupfte sich mit einem Taschentuch die Augen trocken. »Die Blässe und das Zittern sind nicht normal.«
Sie sah besorgt zu Julia rüber, die sich an Ruben gelehnt hatte und Carlas Blick ebenso besorgt erwiderte. Auch ihr schien Hallingers Befinden aufzufallen. Für Carla war sie der Hingucker des Abends. Das eng anliegende knallgelbe Kleid sah auf ihrer dunklen Haut phantastisch aus. Die krausen Haare waren kurz geschoren, zwei riesige goldene Kreolen baumelten an den Ohren. Ruben schien Julias Attraktivität zu genießen, denn er hatte einen Arm um sie gelegt und sah sie verliebt an. Die beiden waren ein schönes Paar, auch wenn Ruben mit Mitte fünfzig ein ganzes Stück älter als Julia war. Vor wenigen Tagen hatte er Carla gestanden, dass er mit noch keiner Frau so glücklich gewesen war wie mit Julia.
»Aber ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden«, sagte Hallinger, nachdem er sich wieder gefangen hatte. »Frau Stach ist eine hervorragende Kommissarin …«
Die Gäste schauten gebannt nach vorne und warteten darauf, dass Hallinger weitersprach, doch er starrte nur auf sein Blatt Papier. Seine Atmung war flach, und er hielt sich eine Hand an den Oberbauch.
»Wir brauchen einen Krankenwagen«, rief Carla und sprang auf, noch ehe die Gäste begriffen, was gerade geschah. Kathrin schnappte sich ihr Smartphone und wählte den Notruf, während Carla an den Kopf der Tafel stürmte. Doch es war zu spät. Noch ehe sie bei ihm war, stürzte Hallinger zu Boden und blieb reglos liegen.
4
Nachdem Hallinger in ein Krankenhaus gebracht worden war, war die Atmosphäre zunächst bedrückt gewesen, doch inzwischen hatten sich alle wieder gefangen. Kurz nach Mitternacht steuerte die Stimmung auf einen Höhepunkt zu. Aus den Boxen dröhnte Rockmusik der siebziger und achtziger Jahre, es wurde wild getanzt. Schweißnass kamen Carla und Julia von der Tanzfläche und setzten sich an einen kleinen Tisch.
»Ich frag mich, wo die Kinder sind«, sagte Carla und meinte damit Julias Sohn Nehemie, Rubens Sohn Joshua und ihre eigenen beiden, die eigentlich Kathrins leibliche waren.
»Alles, was pubertiert, ist vor der Musik geflohen«, sagte Julia und schenkte Mineralwasser in zwei Gläser. »Die hocken nebenan und daddeln auf ihren Handys. Ruben, das älteste Kind von allen, mittendrin.«
Beide lachten.
Da näherte sich die Wirtin Maria Kaiser, zog einen Stuhl heran und setzte sich dazu. Sie war recht schlicht gekleidet mit T-Shirt und Birkenstocksandalen. Carla mochte sie. Sie trug das Herz am rechten Fleck, wie es so schön hieß, hörte sich die Sorgen der Gäste an und war sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe benötigte.
»Störe ich?«, fragte sie fröhlich.
»Ganz und gar nicht«, sagte Carla und rückte ein Stück näher an Julia heran, sodass sie alle drei Platz hatten. »Ich bin Ihnen ja so dankbar, wie liebevoll Sie alles arrangiert haben.«
Bruno trottete herbei und sprang auf Maria Kaisers Schoß. Carla machte Anstalten, ihn wegzuscheuchen, doch Maria winkte beschwichtigend ab. »Lassen Sie ihn nur, er darf das. Wir verstehen uns prima, nicht wahr, Bruno?«
Als hätte der Hund Maria verstanden, leckte er ihre Hand. Carla musste sich sehr zusammenreißen, um den Hauch von Eifersucht, der in ihr aufkeimte, zu unterdrücken. Am liebsten hätte sie den treulosen Kerl sofort ins Auto gebracht.
»Was mit Ihrem Chef, dem Herrn Hallinger, passiert ist, tut mir sehr leid«, sagte Maria Kaiser, wobei sie abwechselnd Carla und Julia anschaute. »Ich hoffe, dass er durchkommt.«
»Im Augenblick sieht es zumindest danach aus«, sagte Carla mit giftigem Blick zu Bruno. Sie hatte vor einigen Stunden im Krankenhaus angerufen und von einem behandelnden Arzt erfahren, dass Hallinger am Morgen wieder nach Hause könne, sofern die Werte über Nacht stabil blieben.
»Es steht nicht gut um ihn«, sagte Maria und kraulte Brunos Kopf. »Sein Magen ist krank. Sorgen Sie dafür, dass er eine gute Behandlung erhält, sonst schafft er es nicht.«
Carla und Julia warfen sich einen verdutzten Blick zu. »Woher wissen Sie das?«, fragte Carla und runzelte die Stirn. »Kennen Sie und Herr Hallinger sich persönlich?«
»Nein, es ist nur so ein Gefühl. Sagen Sie … Kann ich mal im Vertrauen mit Ihnen sprechen?«
»Selbstverständlich«, sagte Julia.
»Es ist mir etwas unangenehm, weil es ja eigentlich Ihr Geburtstag ist«, sagte Maria zu Carla, die grinsend auf ihre Armbanduhr schaute.
»Mein Geburtstag ist Geschichte«, erwiderte sie. »Sie können also ruhig sagen, was Ihnen auf der Seele brennt.«
»Bevor ich anfange, habe ich eine Bitte: Halten Sie mich nicht für verrückt. Natürlich könnte ich auch zu jeder x-beliebigen Polizeidienststelle gehen. Ich fürchte nur, dass man mich da hochkant rauswerfen würde.«
»Sie machen es aber spannend«, sagte Carla und schenkte sich und Julia ein Glas Rotwein ein.
Marias Mann Milan Babic kam hinzu und stellte ein Tablett mit einer Flasche Sliwowitz und randgefüllten Schnapsgläsern auf den Tisch. »Das geht aufs Haus«, sagte er, verteilte die Gläser und setzte sich dazu. Er war ein unscheinbarer Typ mit lichten dunkelblonden Haaren, blasser Gesichtsfarbe und einem fliehenden Kinn. Carla mochte ihn ebenfalls, denn wie seine Frau hatte er ein freundliches, zugewandtes Wesen. Oft spielte er bis spät in die Nacht mit den Gästen Karten, und zweimal jährlich organisierte er ein Skatturnier, das äußerst beliebt war. Dass der Gasthof »Seeblick« so gut lief, lag nicht nur an der phantastischen Lage am Großen Stechlin. Es war vor allem auch der Herzlichkeit der Wirtsleute zu verdanken.
Sie hoben die Schnapsgläser. »Auf Carla!«, erklang es im Chor.
»Auch von mir noch mal aaaaa… alles Gute für Sie«, sagte Milan.
Dass er stotterte, hatte Carla am Anfang als beklemmend empfunden, doch mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, zumal Milan mit seinem Sprachfehler recht souverän umging. Er redete unbeirrt drauflos, statt verschämt zu schweigen.
»Sie wollten uns gerade etwas erzählen«, sagte sie zu Maria Kaiser.
Maria knallte ihr leeres Schnapsglas auf den Tisch. »Wissen Sie, was ein Klartraum ist?«, fragte sie.
»Ein Traum, bei dem Träumende wissen, dass sie träumen«, sagte Julia. »Ich habe so was hin und wieder.«
»Ich habe das auch«, sagte Maria. »Allerdings ist es bei mir so, dass mir ein solcher Traum die Zukunft vorhersagt. Das, was ich in einem Klartraum sehe, geschieht irgendwann in Wirklichkeit. Zumindest ist das meine Erfahrung.«
»Leider, muss man ergänzen«, sagte Milan, »denn für Maria ist es oft eine große Belastung. Sie sieht Dinge voraus, die sie nicht ääää… ändern kann. Und es sind nicht immer schöne Dinge.«
Carla und Julia warfen sich einen skeptischen Blick zu.
»Können Sie hellsehen?«, fragte Julia, und Maria sah verlegen zu Boden.
»Ich bin eine Hellseherin. Schon als Kind hatte ich einen Hang dazu, es hat sich bis heute nicht geändert.«
Carla verdrehte innerlich die Augen. Sie bezweifelte zwar nicht grundsätzlich, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gab, als wissenschaftlich zu erklären waren, doch als Polizistin hatte sie derart schlechte Erfahrungen mit angeblicher Hellseherei gemacht, dass sie dem Phänomen zutiefst misstrauisch gegenüberstand. Manchmal kamen Menschen mit vermeintlich hellseherischen Fähigkeiten ungefragt auf sie zu und boten ihre Hilfe an, bei einer Entführung oder wenn ein Kind vermisst wurde. In einigen ausweglos erscheinenden Situationen hatten Polizeikollegen Hellseher um Hilfe gebeten. Jedoch hatte Carla es nie erlebt, dass es sie weitergebracht, geschweige denn einen Fall gelöst hätte. Die Vorhersagen hatten sich ausnahmslos als falsch und abwegig entpuppt.
»Wie sehen Sie in die Zukunft?«, fragte Julia, die nicht ganz so argwöhnisch zu sein schien wie Carla. »Nur im Traum?«
»Nein«, sagte Maria, und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Ich mache das professionell. Wenn Kunden kommen, lass ich mich in eine Art von Trance fallen. Mir erscheinen dann Bilder über das Leben der Person, die mich um Rat fragt. Anschließend besprechen und interpretieren wir diese Bilder.«
»Ich war mal Marias Kunde, da haben wir uns kennengelernt«, sagte Milan und grinste. »Es war eine pppppp… peinliche Sitzung. Maria hat nichts, aber auch wirklich gar nichts vorhergesehen.«
»Das ist richtig«, sagte Maria lachend und sah Milan liebevoll an. »Im Nachhinein wussten wir, warum. Wir hatten uns ineinander verliebt, bald darauf wurde Milan mein Mann. Dinge, die mich persönlich betreffen, kann ich nicht erkennen.«
Carla sah an den Gesichtern des Paares, wie glücklich sie waren, Milan strahlte wie ein kleiner Junge. Er stand auf und schenkte allen Sliwowitz nach. Der Alkohol stieg ihnen allmählich zu Kopf, vor allem Carla hatte zu viel durcheinandergetrunken. Mit dem Auto konnte vermutlich keiner der Gäste mehr nach Hause fahren.
»Aber warum ich Ihnen das alles erzähle«, sagte Maria, nachdem sie den Schnaps hinuntergekippt hatte. »Ich hatte neulich wieder so einen Klartraum. Jemand verfolgt eine Frau in einem Wald. Er spürt sie auf, zwingt sie in die Knie – und tötet sie mit einem Kopfschuss. Es war furchtbar. Ich habe die Frau so deutlich vor mir gesehen, sie hatte Angst, weinte, schrie um Hilfe. Alles war so real.«
Carla bekam eine Gänsehaut, sie rieb sich die Arme. Die Geschichte machte sie sprachlos. Was Maria Kaiser erzählte, klang so authentisch, und doch war es eben nur ein Traum gewesen. Den anderen schien es ähnlich zu gehen, denn alle schwiegen betreten.
»Würden Sie die Frau oder ihren Verfolger wiedererkennen?«, fragte Julia nach einer Weile und schaute dabei zögerlich zu Carla, als wolle sie sich das Einverständnis für die Befragung holen.
»Den Verfolger habe ich nur schemenhaft gesehen, wie einen Schatten. Ich könnte ihn nicht beschreiben. Aber die Frau … Sie war noch jung, Mitte zwanzig vielleicht, hatte lange, dunkle Haare und stammte aus Südeuropa. Am Oberarm hatte sie ein Jesuskreuz als Tattoo, in einem Ohr steckte ein silbernes Kreuz. Sie muss ein sehr gläubiger Mensch sein.«
Carla war verblüfft, wie detailliert Maria die Frau beschreiben konnte. Die Hellseher, mit denen sie Kontakt gehabt hatte, hatten vagere Aussagen getroffen. Doch manche Träume waren eben realistisch und detailreich. Es hieß noch lange nicht, dass sie ein Ereignis voraussagten.
»Wissen Sie, wo das Ganze geschehen soll?«, fragte Julia.
»Nein, ich weiß nur, dass es sich in einem Wald abspielt. Ich habe Bäume gesehen und viel Laub auf dem Boden.«
»Ich vermute, dass Sie der Frau noch nie in Wirklichkeit begegnet sind«, sagte Carla.
Maria schüttelte den Kopf. »Jedenfalls ist es mir nicht bewusst. Das Gesicht kam mir zwar bekannt vor, aber das kann auch Einbildung sein. Ich fühle mich meinen Traumfiguren innerlich immer sehr verbunden.«
Carla fragte sich, was sie mit der Geschichte anfangen sollten. Sie stellte sich gerade Rolf Hallinger vor, wie sie in sein Büro marschierte und ihn um ein paar Hundertschaften bat, um Brandenburgs Wälder zu durchsuchen. Hallinger würde fragen: »Aber wie kommen Sie darauf, dass ein Mord geschehen ist?«, und Carla würde antworten: »Frau Kaiser, die Wirtin aus dem ›Seeblick‹, hat es geträumt.« Sie musste schmunzeln, als sie Hallingers Gesicht vor sich sah, den entgeisterten Blick unter der dicken Brille und den Mund, der vor Sprachlosigkeit nicht mehr zuging.
»Meine Frau erzählt Ihnen das alles, weil sie ihre Hilfe anbieten will«, sagte Milan zu Carla. »Für den Fall, dass Sie eine Tote finden, auf die die Beschreibung zutrifft. Nicht wwwww… wahr, Liebes?«
Maria nickte. »Vielleicht kann ich Sie bei der Aufklärung unterstützen, so kann ich wenigstens etwas tun. Es ist bedrückend, all diese Dinge zu wissen, ohne sie beeinflussen zu können. Glauben Sie mir, ich hätte diese Gabe lieber nicht.«
Es war Carla ein Bedürfnis, nicht durchscheinen zu lassen, wie abwegig sie Marias Aussage fand. Es wäre respektlos, und sie wollte Maria nicht kränken. »Ich verspreche Ihnen, dass wir uns bei Ihnen melden, wenn wir von einem derartigen Verbrechen erfahren«, sagte sie.
Maria nickte nachdrücklich. »Danke für Ihr Vertrauen«, sagte sie, und Carla hoffte, das Thema nun abschließen zu können. Die Stimmung war gekippt, und so wollte sie ihr Geburtstagsfest eigentlich nicht enden lassen.
5
Es war ein nebliger Morgen, als der Schupo Heinz Böttcher das Auto in der Wagnerstraße in Velten parkte. Carla, die auf dem Beifahrersitz saß, trank noch schnell einen Schluck Kaffee, den sie in einer Thermoskanne mitgebracht hatte. Ihre Laune war an einem Tiefpunkt angelangt, denn den Sonntag nach ihrem Fest hatte sie sich eigentlich anders vorgestellt. Bis zum Mittag hatte sie ausschlafen, dann ausgiebig frühstücken und später mit Kathrin und den Kindern Waffeln backen wollen. Stattdessen würde sie Schlaf nachholen oder arbeiten müssen, je nachdem, was die Ermittlung ergab und wie lang sie dauerte.
Ihr Schädel brummte, trotz der zwei Aspirin, die sie schnell noch eingeworfen hatte. Als sie die Sonnenblende herunterklappte und in den Spiegel blickte, wich auch das letzte bisschen Lebensenergie. Tiefe Furchen an der Nase und um den Mund herum, glasige Augen und eine weiße Kurzhaarfrisur, die am Kopf klatschte, als hätte ihr jemand einen Eimer Wasser drübergeschüttet. Es war kein guter Zeitpunkt, um einen Mordfall aufzuklären.
»Ich bleibe hier, wenn’s genehm ist«, sagte Böttcher und kurbelte den Sitz zurück, um ein Nickerchen zu machen.
Carla kroch aus dem Wagen und schlug die Autotür mit Karacho zu, weil sie Böttcher um seine Möglichkeit zu schlafen beneidete. Die Blende konnte er selbst wieder hochklappen.
Das Einfamilienhaus, ein moderner, weiß gestrichener Fertigbau, war weitläufig mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. Ein Grüppchen schaulustiger Nachbarn stand mitten auf der Straße und spähte zum Grundstück. Zahlreiche Polizeiautos und Zivilfahrzeuge säumten den Straßenrand.
Carla öffnete ein kleines Tor und betrat einen gepflegten Vorgarten. An der Haustür wartete ein weiterer Schupo, er hieß Henri Pöhl. Carla hatte gelegentlich mit ihm zu tun; er war ein noch junger Kollege mit roten Haaren und einem kantigen Kinn.
»Dann können wir ja loslegen«, sagte er durch einen Mundschutz und reichte Carla einen Tyvek-Schutzanzug, den sie sich rasch überstreifte. Er selbst trug auch einen.
»Wir haben zwei Mordopfer«, begann er seine Einweisung, während Carla in die Überziehschuhe schlüpfte und dabei dachte, dass sie beim nächsten Fest ein neues Rezept ausprobieren sollte: glasierter Schweinebraten in einem Salzbett. Sie war mal in einer Zeitungsbeilage darauf gestoßen, es hatte äußerst lecker geklungen. Der Gedanke daran hob ihre Laune ein wenig.
»Oguz Demir und seine Frau Kristin Demir«, fuhr Pöhl in einer Lautstärke fort, als wäre Carla schwerhörig. Sie hatte sein furchtbar lautes Organ vergessen. »Sind vor vier Jahren von Berlin nach Velten gezogen.«
Carla legte sich ebenfalls einen Mundschutz an und betrat hinter Pöhl den Flur. Auf dem Boden lag ein zersplittertes Marmeladenglas, das bereits von der Spurensicherung markiert wurde.
»Vorsicht!«, schrie Pöhl, und Carla hätte fast aufgeschrien vor Schreck. Vielleicht sollte sie ihm erklären, dass sie das erste Mal an einem Tatort war und keinen blassen Schimmer hatte, was hier so ablief. Aber sie unterließ es, weil ihr nicht nach Scherzen zumute war.
»Eine Spaziergängerin hat uns informiert«, sagte Pöhl. »Als sie heute früh mit ihrem Hund hier vorbeiging, hörte sie die Hilferufe eines Kindes. Die Kollegen sind sofort herbeigeeilt und haben die Tür aufgebrochen.«
Carla hielt sich eine Hand ans Ohr. »Bitte, Herr Pöhl, ich bin noch nicht taub. Das könnte sich allerdings ändern, wenn Sie weiterhin so rumbrüllen.«
»Entschuldigung!« Es klang gedämpfter. »Jemand hat den kleinen Sohn auf dem Gästeklo eingeschlossen, Taner, sechs Jahre alt.«
Carla verdrängte den Gedanken, dass der Junge soeben seine Eltern verloren hatte.
»Wo ist er jetzt?«, fragte sie.
»Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht, obwohl er körperlich nichts zu haben scheint. Aber er steht unter Schock.«
»Hat man ihn befragen können?«
»Noch nicht. Eine Psychologin soll ihn sich zuerst ansehen.«
Carla blickte in eine winzige Toilette mit einem Oberlicht in Kippstellung. »Eingeschlossen«, murmelte sie mehr zu sich selbst, ohne ein inneres Bild zu bekommen, was sich hier zugetragen haben könnte. Schweigend folgte sie Pöhl in eine Wohnküche, wo es unangenehm süßlich roch. Die Jalousien waren heruntergelassen, das Licht brannte. Auf dem Boden lag bäuchlings ein Toter, seine Hände waren mit Handschellen gefesselt, der Teppich war voller Blut. Vor seinem Mund war etwas, das Carla nicht identifizieren konnte. Ihr war auch nicht danach, es näher zu untersuchen. Später vielleicht.
Eine Beamtin der Spurensicherung zwängte sich an Carla vorbei aus dem Zimmer. Sie hatte den Tatort fotografiert.
»Die Notärztin ist schon wieder weg«, sagte Pöhl, der wieder in seine gewohnte Lautstärke verfallen war. »Sie schätzt, dass der Tod vor fünfzehn bis zwanzig Stunden eingetreten ist, also irgendwann zwischen gestern Nachmittag und gestern Abend. Er wurde mit einem Kopfschuss getötet. Außerdem hat man ihm die Zunge …«
Carla wandte sich angeekelt ab, ihr wurde übel. Ein Stück Zunge lag vor dem Mund des Toten. Sie hatte es befürchtet. »Das ist ja das gleiche Muster wie bei den anderen Morden. Habt ihr das LKA informiert?«
»Schon geschehen. Die Ermittler müssten gleich eintreffen.«
Carla dachte mit Erleichterung daran, dass ihr Dienst bald beendet sein würde. Die Zungenmorde, wie die Taten unter vorgehaltener Hand genannt wurden, fielen in den Aufgabenbereich des LKA. Genau genommen ermittelte Ruben Weiß, Julias Partner und Carlas langjähriger Freund.
»Die Notärztin vermutet, dass dem Mann die Zunge vor seinem Tod –«
»Es reicht, vielen Dank, Herr Pöhl«, sagte Carla, die nicht an Einzelheiten interessiert war, zumindest nicht in ihrer Verfassung. »Wo ist die Ehefrau?«, hörte sie sich fragen.
»Oben im Bad. Ebenfalls Kopfschuss, aber die Zunge ist noch drin, falls Sie das jetzt wissen wollen. Möchten Sie sie sehen?«
»Nachher. Kennt man schon den Tathergang?« Ihr Blick fiel ins angrenzende Wohnzimmer, wo einige Möbel hochgestellt waren und ein herumliegender Staubsauger den Eindruck erweckte, als sei jemand beim Putzen unterbrochen worden. Auf dem Teppich in der Nähe der Terrassentür prangten dreckige Fußspuren.
»Der Tathergang ist noch unklar«, sagte Pöhl. »Im oberen Stock wurde ein Arbeitszimmer durchwühlt, Computer und Handys wurden entwendet. Als wollte der Täter Spuren verdecken. Das gleiche Vorgehen wie bei den anderen Morden.«
»Wie kriegt man die Dinger da hoch?«, fragte Carla und zeigte auf die Jalousien.
Pöhl drückte einen Knopf an der Wand, und die Jalousien fuhren summend nach oben. Es wurde augenblicklich taghell im Raum.
Carla trat nach draußen, während Pöhl im Haus blieb und durch die geöffnete Tür spähte. Auf der Terrasse, die von einem Glasdach überspannt wurde, haftete ebenfalls Dreck von Schuhen, in einem Beet waren Fußabdrücke zu erkennen. »Der Täter ist von hier gekommen«, rief sie Pöhl zu. »Vielleicht stand die Terrassentür auf, weil die Frau sauber gemacht hat und lüften wollte. Die Spurensicherung soll sich das gleich mal anschauen.«
Zurück in der Wohnküche besah sich Carla die Kinderzeichnung auf dem Esstisch. »Er hat sie beide überrascht«, sagte sie. »Der Junge hat gemalt, die Mutter gesaugt. Vermutlich hat er sie mit einer Pistole bedroht. Die Frage ist: Wo war der Vater des Jungen? Und warum wurde die Frau oben im Bad erschossen und nicht hier unten wie ihr Mann?«
»Vielleicht hat sie zu fliehen versucht«, sagte Pöhl.
»Nein, das tut eine Mutter nicht. Sie überlässt ihr Kind nicht einem Killer. Wahrscheinlich hat sich der Kerl den Jungen von hinten geschnappt und die Mutter mit der Pistole gezwungen, in den Flur zu gehen, wo er den Jungen in die Toilette gesperrt hat. Er hatte von Anfang an nicht vor, ihn zu erschießen. Das heißt, dass wir es wahrscheinlich mit einem Killer zu tun haben, der selbst Kinder hat.«
Carla ging in den Flur, wo die Luft ein wenig besser war, weil die Haustür aufstand.
Pöhl kam hinterher. »Ein Killer mit Herz, meinen Sie.«
»Wenn Sie es so nennen wollen.« Carla schaute erneut in die Toilette und versuchte, den Hergang zu rekonstruieren. Erst nachdem der Junge hier eingeschlossen worden war, war die Mutter nach oben gelaufen. Vielleicht hatte sie aus dem Badfenster um Hilfe rufen wollen. Doch der Täter war schneller und hatte sie erschossen.
»Aber warum die heruntergelassenen Jalousien?«, fragte Pöhl.
Carla stützte sich auf einer Kommode ab. Ihr war schwindelig. »Der Täter wollte verhindern, dass die Schreie des Opfers zu hören waren.«
»Verstehe«, sagte Pöhl betreten. »Bleibt nur noch die Frage, wo der Vater die ganze Zeit war.«
»Vielleicht kam er später. Als die Frau schon tot und der Junge eingeschlossen war.«
»Sie meinen, dass der Täter hier im Haus auf ihn gewartet hat?«
»Möglich wäre es. Was machte Demir beruflich?«, fragte sie.
Pöhl zückte einen kleinen Notizblock und blätterte darin. »Busfahrer. Nachbarn haben ausgesagt, dass er die Linie 816 von Borgsdorf-Schule bis Velten-Süd gefahren ist.«
Carla merkte, dass sie immer wackeliger auf den Beinen wurde.
»Alles in Ordnung?«, fragte Pöhl besorgt.
Carla holte tief Luft. Jetzt bloß nicht ohnmächtig werden, dachte sie und verfluchte zugleich ihr Übergewicht. Ein paar Kilos weniger täten ihrem körperlichen Wohlbefinden sicherlich gut. Kalter Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn, ihr Herz raste. Wo verflucht noch mal blieb Ruben? Warum konnte er nicht ein einziges Mal pünktlich an einem Tatort erscheinen? Diese olle Schlafmütze!
Pöhl holte einen Stuhl heran und half Carla mit einem Griff unter die Achseln, sich zu setzen. Sie kam sich vor, als hätte sie nicht ihren sechzigsten, sondern ihren achtzigsten Geburtstag gefeiert.
Nachdem sie ein Glas Wasser getrunken hatte, das Pöhl ihr gebracht hatte, fühlte sie sich besser. Zugleich war sie beunruhigt, weil ihr Kollege Maik im Fall dieser grausamen Morde verdeckt ermittelte. Er war in ein Sammelbecken aus Verschwörungsanhängern und Rechtsextremen geschleust worden – alles Leute, die im Verdacht standen, für diese brutalen Morde verantwortlich zu sein. Carla fürchtete, dass Maik auffliegen und ein ähnliches Schicksal erleiden könnte wie der Ermordete in der Küche. Sie hatte alles versucht, um ihn von dem Einsatz abzuhalten, leider vergeblich.
Durch die geöffnete Haustür sah sie einen schwarzen BMW mit Ruben auf dem Beifahrersitz vorfahren, am Steuer saß eine Kollegin vom LKA, die Carla nicht kannte. Sie würde beide kurz in den Fall einweisen, dann hatte sie frei.
6
Dichter Nebel hatte sich über die Wälder der Uckermark gelegt. Maik steigerte sein Tempo, obwohl er achtgeben musste, nicht über Wurzeln zu stolpern, die sich unter der dicken Laubschicht verbargen. Es war nicht nur der Marathon, der ihn antrieb, er wollte sich auch das Heimweh von der Seele laufen. Seit drei Wochen lebte er mit einer neuen Identität in einer kleinen Wohnung in Stegelitz, einem Kaff in der Uckermark, getrennt von seinen Kollegen, seinen Freunden – und von Lydia und Anna. Er hieß nun Kevin Hässler, so stand es zumindest in seinem Ausweis, und war vierzig Jahre alt. Das Geburtsjahr stimmte mit seinem wirklichen Alter überein, nur den Tag hatte man geändert.
Kevin Hässler, der Name fühlte sich fremd und unsympathisch an, auch wenn er ihn täglich hörte und sich allmählich daran gewöhnt haben müsste. Doch er passte zu der Umgebung, in der er nun leben musste. Die Menschen um ihn herum waren verbissen, kalt und voller spinnerter Ideen. Am liebsten hätte er seine Koffer gepackt und wäre noch heute zurück nach Neuruppin gefahren, nach Hause, zu seiner Familie. Doch es galt durchzuhalten, denn er hatte Pläne. Er wollte in den Höheren Dienst aufsteigen und eine Leitungsfunktion übernehmen. Man würde sich an ihn erinnern, wenn er die Sache erfolgreich hinter sich gebracht hatte. Wenn er ein Attentat verhindert hatte – oder was auch immer diese Menschen, mit denen er verkehren musste, im Schilde führten. Es herauszufinden, war seine Aufgabe.
Er zuckte zusammen, als ein Knistern im Unterholz die frühe Morgenstille durchbrach, dann verkrampfte sich sein Herz. Ein Wildschwein schreckte hoch und stob polternd davon. Maik bremste ab und blieb einen Augenblick keuchend stehen, um den Schock zu verdauen. Seine Nerven waren angespannt. Die Menschen, bei denen er als verdeckter Ermittler eingeschleust worden war, begegneten ihm mit Misstrauen und Skepsis. Sie gingen mit äußerster Brutalität gegen Verräter vor und solche, die sie dafür hielten. Möglicherweise beobachteten sie ihn, postierten sich vor seiner Haustür, folgten ihm beim Autofahren oder versteckten sich just in diesem Moment hinter einem der zahlreichen vom Nebel verschluckten Bäume. Er durfte nicht allzu intensiv darüber nachdenken, sonst wurde er nervös und machte Fehler.
Er lief erneut los, beschleunigte, hob die Beine an und achtete auf eine aufrechte Körperhaltung. Vielleicht war seine Angst unbegründet, vielleicht entsprang sie lediglich einem schlechten Gewissen, denn was er an diesem Morgen vorhatte, war brandgefährlich. Es konnte ihn das Leben kosten. Aber er musste es tun. Es half ihm, die Menschen und das Milieu um ihn herum besser zu ertragen. Nur noch wenige Meter, und er würde mit Lydia sprechen.
Er wurde langsamer, schlenderte, schaute sich um. Es war totenstill. Dann ging er auf einen Baum zu. Der abgefallene Ast war riesig, er hatte beim Brechen ein Loch im Stamm hinterlassen. Maik spähte noch einmal in alle Richtungen, dann griff er in das Loch und holte sein Handy heraus, ein kleines von Siemens aus den frühen 2000er Jahren, das C25. Es lag regengeschützt in einem Plastikbeutel. Der Akku war nur noch zu einem Viertel voll.
Er war vom Laufen durchgeschwitzt und fror etwas, als er Lydias Handynummer eintippte. Nach dem dritten Freizeichen meldete sie sich mit einem verschlafenen »Maik?«. Es tat so gut, ihre Stimme zu hören. Bis er zurück nach Hause durfte, konnte es noch Monate dauern.
»Hey«, flüsterte er. »Hast du gut geschlafen?« Er sah sie vor sich, ihren wunderschönen Körper in cremeweißer Unterwäsche, wie sie sich im Bett aufsetzte und die langen lockigen Haare hinter das Ohr strich. Im Hintergrund lief leise Popmusik, die vermutlich aus dem Radiowecker kam.
»Hey. Meinst du, dass es gut ist, wenn wir so oft sprechen? Ist das nicht zu gefährlich?«
»Kein Problem, glaub mir. Wie geht es euch?«
Sie seufzte. »Wir vermissen dich. Anna fragt jeden Tag nach dir.«
Es brach ihm das Herz. Seine Tochter war diesen Sommer eingeschult worden, er dachte ständig an sie. Seine Augen wurden feucht. »Ich vermisse euch auch.« Hoffentlich merkte Lydia nicht, dass er weinte. Sie sollte nicht wissen, dass er litt, es würde sie nur unnötig belasten.
»Willst du nicht zurückkommen?«, fragte sie.
»Ich kann das LKA nicht hängen lassen. Aber keine Angst. Wenn alles glattgeht, bin ich in ein paar Wochen wieder da.«
»Wenn alles glattgeht! Maik, ich mache mir so furchtbare Sorgen um dich. Gestern Nachmittag war ich bei Carla. Ich glaube, sie ist auch besorgt.«
»Carla? Wie war das Fest?«
»Wunderschön. Du kannst dir nicht vorstellen, was sie an Essen aufgefahren hat.«
»Doch, das kann ich mir vorstellen.«
Sie kicherten.
»Anna war auch mit, sie hatte einen Riesenspaß. Und dein Chef ist zusammengeklappt. Bei einer Rede.«
»Hallinger? Was Ernstes?«
»Keine Ahnung, aber er ist wohl wieder raus aus dem Krankenhaus. Maik, ich muss dir was sagen. Ich war gestern Nachmittag bei Carla, weil ich mein Handy auf dem Fest vergessen hatte. Carlas Familie und ich haben Kaffee getrunken, es gab frische Waffeln. Dabei hat sich Carla eingehend nach mir und Anna erkundigt. Ich hatte den Eindruck, als suche sie nach einem Weg, um dich wieder nach Hause zu holen.«
»Was? Hat sie das gesagt?«
»Nein, es ist nur so ein Gefühl. Jedenfalls hat sie durchscheinen lassen, dass sie am Morgen bei einem Tatort wegen eines Tötungsdelikts war. Sie steht ja unter Schweigepflicht, deshalb kenne ich die Einzelheiten nicht. Aber weißt du, was sie eben in den Nachrichten gebracht haben?«
»Nein.«
»In Velten wurde ein Ehepaar ermordet, Eltern eines kleinen Jungen.«
»Schrecklich. Aber warum beschäftigt dich das?«
»Sie haben nichts Genaues gesagt, aber ich glaube, dass der Mord ziemlich brutal war. Und dass er was mit diesen Leuten zu tun hat, bei denen du ermittelst. Deshalb war Carla auch so beunruhigt.«
Maik ließ seinen Blick durch den Nebel schweifen. An einem Baumstamm war eine Wölbung zu erkennen. Er war sich nicht sicher, ob er sich täuschte oder ob dort jemand stand.
»Ach, Lydia. Das bildest du dir bestimmt alles nur ein.« Er behielt die Wölbung im Auge. »Ruben wird nicht zulassen, dass ich von dem Fall abgezogen werde. Es wäre fatal, jetzt, da wir schon so weit sind.«
Es entstand eine Redepause, und Maik fragte sich, was in Lydia vorging.
»Ich hab so ein komisches Gefühl bei der Sache«, sagte sie nach einer Weile. »Das geht nicht gut aus, glaube mir. Bitte komm nach Hause.«
Maik wurde es mulmig zumute, denn Lydia fühlte oft das Richtige. Wenn er ein Problem hatte, dann gab es keine bessere Ratgeberin als sie. Doch er konnte aus der Ermittlung, die von langer Hand so gründlich vorbereitet worden war, nicht einfach aussteigen. Es war besser, das Gespräch zu beenden, es verunsicherte ihn nur. »Hör zu, ich muss aufhören«, sagte er. »Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.«
Maik drückte das Gespräch weg. Die Wölbung war verschwunden, sofern es sie jemals gegeben hatte. Der Nebel war so dicht, dass er sich alles Mögliche herbeiphantasieren konnte. Er wickelte das Handy in die Plastiktüte und legte es zurück in den Stamm. Dann stakste er durch Laub und Unterholz zu dem Baum, bei dem er die Wölbung zu sehen geglaubt hatte. Er wollte nachschauen, ob dort jemand stand.
7
Der Verkehr auf der B 167 war ruhig an diesem trüben Montagmorgen. Julia hing ihren Gedanken nach, während herbstbunte Bäume an ihr vorüberzogen. Im Radio lief ein Schlager von Michelle. Julia hatte oft den Schlagersender eingeschaltet, wenn sie zur Arbeit fuhr, weil es die einzige Möglichkeit war, diese Musik zu hören, ohne dass sich Nehemie demonstrativ die Ohren zuhielt oder Ruben genervt fragte: »Könnten wir bitte etwas anderes anmachen?« Auch wenn sie kein Fan war, so liebte sie Schlager beim Autofahren, weil sie die Texte verstand, mitsingen konnte und die Lieder im Großen und Ganzen harmlos waren. Schwerwiegendes erlebte sie bei ihrer Arbeit zur Genüge.
Als sie sich durch einen Baustellenstau in Neuruppin gequält hatte, parkte sie ihr Auto vor einem riesigen Backsteingebäude in der Fehrbelliner Straße 4c, der Polizeidirektion Nord. Sie stieg aus und lief die Treppe hinauf in den zweiten Stock, wo sich die Vermisstenstelle befand.
»Guten Morgen«, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln, als sie den Raum betrat, denn es ging ihr ausgezeichnet. Das Wochenende inklusive Carlas Fest war wunderschön gewesen. Auch mit Ruben lief es wunderbar, sie hatten vor Kurzem ihr Einjähriges gefeiert. Am meisten freute sie sich darüber, dass sie endlich eine Familie für Nehemie gefunden hatte. Ihren vierzehnjährigen Sohn ohne männliche Bezugsperson aufwachsen zu sehen, hatte ihr permanent ein schlechtes Gewissen bereitet.
Ihr Kollege Uli Rösler saß mit einer Frau am Besuchertisch und hob lässig eine Hand zum Gruß, in der anderen hielt er einen Personalausweis. Der ernste Blick hinter seinen Brillengläsern verriet, dass er eine Vermisstenmeldung aufnahm. Er war ein untersetzter Mann, Ende fünfzig und mit lichtem Haar, das sorgfältig zur Seite gekämmt war. »Ihr Name ist Ottilie Wiechert, und Sie sind einundfünfzig Jahre alt«, sagte er.
»Tilly wäre mir lieber«, erwiderte die Frau mit einer tiefen Stimme. »Ottilie klingt so nach Strafe Gottes.«
Uli reichte ihr den Ausweis zurück. »In Ordnung, also Tilly Wiechert. Dann bitte noch mal von vorne. Warum glauben Sie, dass Ihrer Untermieterin etwas zugestoßen ist?«
Tilly Wiechert war recht dick und erinnerte Julia von der Figur her an Carla. Sie trug einen hennaroten Pagenschnitt und goldene Ohrringe, ihre Haut war leicht gebräunt, als besuche sie regelmäßig ein Solarium.
»Sie müssen mir glauben«, sagte Tilly Wiechert mit Nachdruck und schnaufend, als fiele ihr das Atmen aufgrund ihres Gewichtes schwer. »Jeta wäre niemals weggefahren, ohne sich zu verabschieden. Das passt einfach nicht zu ihr, dafür ist sie viel zu gewissenhaft. Warten Sie, ich zeige Ihnen ein Foto.« Sie kramte hektisch ihr Smartphone aus einer Handtasche und reichte es Uli.
Um nicht zu stören, schlich Julia möglichst leise zu ihrem Spind, zog die Jacke aus und hängte sie hinein. Der weite Arbeitsweg strengte sie an. Seit sie und Nehemie zu Ruben gezogen waren, fuhr sie die Strecke zwischen Neuruppin und Eberswalde zwei Mal täglich, eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück. So konnte es nicht ewig weitergehen. Deshalb hatte sie eine kleine Wohnung in Neuruppin gemietet, und zwar in dem Block, in dem sie vorher mit Nehemie gewohnt hatte. Wenn es spät wurde oder sie am Morgen sehr früh zur Arbeit musste, blieb sie dort. Zum Glück hatte sich Nehemie mit Ruben und dessen Sohn Joshua so gut eingelebt, dass sie ihn beruhigt in seinem neuen Heim lassen konnte, ohne ständig das Gefühl zu haben, sich um ihn kümmern zu müssen. Ruben und sie hatten schon laut darüber nachgedacht, ein Haus zu kaufen, das näher an Neuruppin lag, aber auch nicht zu weit weg vom LKA in Eberswalde, wo Ruben arbeitete. Im Löwenberger Land vielleicht, wo sie ursprünglich herkam, oder im berlinnahen Oranienburg, das sich genau in der Mitte befand. Doch bis es so weit war, hatten sie noch einiges zu tun. Heiraten zum Beispiel. Sie musste unwillkürlich lächeln, als sie daran dachte.
»Ich wiederhole«, sagte Uli und las von dem Protokoll ab. »Ihre Untermieterin heißt Jeta Seferi, ist sechsundzwanzig Jahre alt, und Sie haben sie am Freitagvormittag gegen elf Uhr das letzte Mal gesehen. Sie stammt aus Albanien, hat schulterlange, dunkelbraune Haare, eine schlanke Figur, ist etwa einen Meter siebzig groß und trägt ein tätowiertes Jesuskreuz am Oberarm. Korrekt?«
»Das ist richtig«, sagte Tilly Wiechert. »Und silberne Ohrringe in Form eines Kreuzes. Jeta ist sehr gläubig. Ihre Familie gehört einer katholischen Minderheit in Albanien an.«
Julia horchte auf, als sie gerade Wasser in den Kocher füllte, um sich einen Kaffee im Drücker zuzubereiten. Hatte die Frau etwas von silbernen Kreuzohrringen und von einem Kreuz-Tattoo gesagt?
»Aus Südeuropa«, sagte Uli nachdenklich und tippte mit dem Kuli auf den Tisch. »Wie lange lebt sie denn schon in Deutschland?«





























