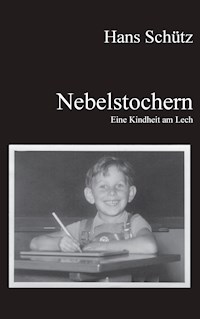
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung "Nebelstochern - Eine Kindheit am Lech" lässt die Welt eines kleinen Dorfes der 50er und 60er Jahre im Allgäu wieder aufleben. Erzählt wird, wie der kleine Hansi mehr und mehr seine Hei-mat entdeckt und in immer größeren Kreisen sich die Welt erschließt. Eine turbulente Familiengeschichte,der harte Alltag einer Arbeiterfamilie, historische Begebenheiten und Allgäuer Originale bilden den Hintergrund der Erzählung, der weit mehr als nur lokale Bedeutung zukommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Frau Marianne Schütz, den Kindern Stephan, Nico und Jonas, sowie meinem Geburtsort Lechbruck gewidmet.
Inhalt
Einleitung
Barfuß
Im Loch
Der Goresse
Im Urwald
Ausflüge
Im Kindergarten
Auf dem Friedhof
Alpträume
Heimwege
Winter
November 1951
Fasching
Weihnachten
Wintersport
Beim Dr. Eger
Die Mädchen
Das Zwergle
Erstkommunion
Nachbarschaft
Beim Fischen
Der Speiseplan
Narret Zenzl
Das Floß
Die Hütte
Die Hexe
Schulzeit
Der Kaugummi
Am Metzgerberg
Soldaten
Schlangen
Erzieherische Maßnahme
Die Beerdigung
Der Bretterdiebstahl
Ärger
Konkurrenz
Klausengehen
Schulwechsel
Der neue Schulweg
Musik
Die Lehrer
Schulferien
Der Freund
Am Schmuttersee
Abendunterhaltung
Der Fernseher
Fußball
Rauch
Wäsenstechen
Die andere Lechseite
Familienstreit
Toto und Lotto
Der Umzug
Nachwort
Einleitung
Aller Anfang ist schwer. In mir ist zwar alles da. Doch wie das Vorhandene fassen, packen, in Sprache, in Sätze formen, damit noch erkennbar wird, was da ist, in mir?
Es ist wie im Nebel zu stochern: Man weiß ganz genau, was der Nebel verbirgt, der sich auf eine vertraute Gegend gelegt hat. Man kennt sich aus. Und doch greift man daneben.
Erinnerung kann täuschen. Wer schon einmal bei Nebel eine ihm bekannte Straße gefahren ist, in Eile vielleicht und daher für die Verhältnisse eigentlich zu schnell, der weiß, wie man sich täuschen kann. Wo bin ich? Es müsste doch längst schon die Biegung, der Baum, die Hecke erreicht sein. Habe ich mich doch verfahren? Eine Abzweigung verpasst?
Das Gebiet, das ich rückblickend fassen will, ist ein schwieriges. Es entzieht sich mir nicht nur nebelartig. Manches ist wirklich weg, nicht mehr da, wo es einmal war. Gesichter tauchen auf, deren Namen mir nicht mehr um alles in der Welt einfallen wollen.
Ich sehe Personen vor mir, ganz genau bis in kleinste Einzelheiten. Ich sehe Augen und Nasen, Ohren und Münder, Falten, Runzeln, Warzen und Hände. Hände habe ich mir wohl schon immer genau angesehen, sie mir eingeprägt, zugeordnet und in Klassen eingeteilt. Aber ich höre die Personen in der Erinnerung auch sprechen. Ich sehe sie mitsamt ihrer für sie typischen Mimik und Gestik. Geschichten fallen mir ein, Ereignisse, die mit den Menschen verbunden sind – nur oftmals deren Namen nicht.
Gedächtnistraining. Der Name liegt mir auf der Zunge. Ich weiß, dass ich den Namen doch gewusst habe, ja ich weißsogar, dass ich den Namen immer noch weiß. Nur er fällt mir nicht ein. Ärger steigt hoch, Alzheimerwitze „trätzen“ mich. Ich stelle vergebliche Versuche an, meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Das Alphabet soll helfen. Von A bis Z buchstabiere ich halblaut vor mich hin, ordne Namen zu, wäge sie ab auf meiner Zunge. Ich prüfe Laute, als wären sie eine Melone auf dem Wochenmarkt. Viele werden gleich wieder aussortiert, zurückgelegt in die Ablage. Andere kommen in eine Art engere Auswahl, werden noch einmal rundum betrachtet, abgeklopft. Die letzten sind schon nahe dran und doch weiß ich jetzt, der gesuchte Name ist nicht dabei. Aber er ist doch da, in meinem Kopf! Nur wo? Also beginnt das ganze Suchspiel von neuem.
Manchmal hilft es. Wie groß ist meine Erleichterung, wenn ich dem Nebel, dem Vergessen, doch noch einen Namen entrissen habe! Sorgsam spreche ich ihn aus und zwar jeden Laut genau so, wie er gerade für die Person ausgesprochen werden muss, die diesen Namen trägt. Es kommt vor, dass bei zwei Personen derselbe Name gleich geschrieben wird, aber völlig unterschiedlich lautet. Wenn die Aussprache passt, klingen sie und meine Vorstellung von der betreffenden Person zusammen wie zwei aufeinander abgestimmte Kirchenglocken.
Manchmal hilft das Alphabet gar nicht. Dann breche ich frustriert die Suche ab. Das Stochern im Nebel war vergebens. Die Gedanken wenden sich anderem zu. Plötzlich aber, oft nach Stunden, erwische ich mich dabei, dass ich noch nicht kapituliert habe. Etwas in mir gibt nicht auf, weiß genau, dass irgendwo da drinnen dieser Name doch noch vorhanden sein muss. Und er ist da, plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne Hilfsgerüst, ohne Mühe. Welch Erlösung!
Wenn nicht, geht die Suche weiter. Sie wird zwar zurückgestellt, aber nicht vergessen. Ich tu zwar so, als hätte ich die ganze Angelegenheit schon abgehakt, doch in Wahrheit suche ich weiter. Es ist jetzt wie ein Spiel mit dem Gedächtnis: Ich gehe nicht mehr direkt auf die Sache los, sondern lenke ab, täusche und tarne. So gelingt es manchmal. Und dann steht der Name da, als wäre er immer schon dort gewesen, genau an der Stelle, wo er hingehört, und ich frage mich, warum ich nicht gleich am richtigen Platz gesucht habe.
Eine Möglichkeit, um vergessene Namen wieder aufzutreiben, ist, andere Menschen zu fragen, so ganz nebenbei, ohne auch nur im Geringsten zuzugeben, wie viel einem dieser Name auf einmal bedeutet, wie wichtig er geworden ist. Es sind nicht viele Verwandte in meiner Nähe, die ich so unbefangen befragen könnte. Die Mutter, aber den Vater leider nicht mehr, den Bruder. Bekannte aus gemeinsamer Kindheit sind so gut wie nicht greifbar. Ein Umzug im Alter von dreizehn Jahren auf die andere Lechseite, aus dem Geburtsort Lechbruck weg nach Steingaden, erweist sich im Nachhinein als beträchtliches Hindernis.
Zwar blieben noch gemeinsame Schulfreunde aus Lechbruck, die dasselbe Gymnasium in Füssen besuchten, doch die Kontakte wurden weniger. Denn der Bus aus Steingaden fuhr eine andere Strecke, nämlich über Trauchgau, Buching, Schwangau, vorbei am Bannwaldsee, der St.-Coloman-Kirche und den Königsschlössern und dann erst über den Lech hinüber ins Städtchen Füssen.
Die Lechbrucker Gymnasiasten aber überquerten auf ihrem Schulweg den Fluss nie. Sie blieben von der Abfahrt beim Postamt oberhalb des Metzgerbergs bis zur Ankunft in Füssen auf der linken, westlichen Lechseite: Sie fuhren über St. Wendelin, Sameister, Roßhaupten-Bahnhof, Roßhaupten und Rieden, dann sanft hinunter und am Forggensee entlang und hinein in die Stadt zum Busbahnhof. Dort trafen sich die Fahrschüler, um gemeinsam die wenigen Meter hinüber zum Gymnasium zu gehen.
Noch eine Möglichkeit, um an einen verloren gegangenen Namen zu kommen: Ich suche alles zusammen, was mit dem Besitzer des Namens verbunden ist, mache mir ein genaues Bild von ihm und das schärft die Erinnerung. Dazu gehören die Kleidung, die Stimme, der Geruch oder eine Geschichte. Zu jedem Namen ist auch eine bestimmte Umgebung in meinem Gedächtnis abgespeichert: Die Schulzimmer, der riesige Sandkasten im Kindergarten, die Kirche und mehr noch der Friedhof, oft auch der Wald und die Wiesen, ein Bach oder der Fluss.
Landschaft geht nicht so leicht verloren wie Namen. Sie ist da wie immer, auch wenn sie heute verbaut ist, ausgeräumt, flurbereinigt, abgeholzt, begradigt, von Straßen und Wegen zerschunden und umgepflügt, von Neubauten und Gewerbegebieten zersiedelt, von Mobilfunksendern verschandelt, von Hochspannungsleitungen zerschnitten und von Stauseen zugedeckt. Aber egal wie sich die Gegend meiner Kindheit durch das vielfältige Eingreifen der Menschen verändert hat, in mir ist sie so geblieben, wie sie damals war.
Hier gibt es kein Suchen und Stochern. Es genügt ein Gedanke und schon bin ich angekommen, wo ich früher einmal war: Am langen südhängigen Falchen, einem an seiner höchsten Stelle etwa achthundert Meter hohen Bergrücken, der sich vom Lech weg westwärts hinzieht mit seinen Wiesen und Gehölzen. Unterhalb davon, zwischen „dem“ Fluss und einer weiteren, deutlich niedrigeren Hügelkette plätschert der Höllbach aus dem Wald heraus, kurvenreich, tief eingeschnitten und immer rechts und links von Bäumen und Sträuchern begleitet, bis er kurz vor seiner Mündung in den Kanal durch klotzige Felsbrocken gebändigt, begradigt und beruhigt wird.
Oberhalb der Kanaleinmündung strömt der wilde Lech, ein echter Gebirgsfluss noch, mit Kiesbänken, Nebenläufen, Altwassern und Auenwäldern, da und dort schon bedroht durch Baggerlöcher vom Kiesabbau.
Auf der anderen Seite des Flusstals, hinter der nächsten Hügelkette oberhalb des Flößerdorfes Prem, bei Föhn wie zum Greifen nahe: die Berge. Die erste Kette der Trauchgauer Berge, noch bis zu den Höhen dunkelbewaldet, dahinter aufragenddieGipfel des Ammergebirges und weiter im Westen, nach dem tiefen Einschnitt des Lechdurchbruchs bei Füssen die felsigen Allgäuer Alpen, bis hin zum spitz aufragenden Grünten, auf dem damals schon ein Fernsehturm auszumachen war.
Von einigen Stellen, vor allem wenn man von den wenigen auf halber Höhe des Falchens gebauten Häusern über trockene Wiesen weiter nach oben stieg zur Falchenstraße, die fast am Kamm des Hügels verlief, konnte man hinter den Ammertaler Bergen die Zugspitze sehen, aber gerade noch die Spitze, mehr nicht.
Der zentrale Blickfang vom Balkon oder Fenster aus ist aber die Hochplatte, ein breiter runder Felsrücken mit Ost- und Westgipfel, den kleinere Berge einrahmen: Der Firstberg und die Klammspitze zur Linken und der Geißelstein, die Gumpenkarspitze und der Gabelschrofen zur Rechten. Weiter nach Westen dem Lechtal zu der Tegelberg mit Branderschrofen und – einem liegenden Löwen gleich – der mächtige Säuling.
Gebirgspanorama als Heimat.
Doch nicht nur die Großlandschaft ist eingemeißelt ins Gedächtnis. Bis ins kleinste Detail stellen sich Bilder ein, von einem Waldrand, von einem Baum, einem Bachufer mit Fischgumpen darunter, einer Flussuferstelle, einem Fuchsbau.
Namen dagegen wehren sich gegen das Erinnern.
Barfuß
Der kleine Hans, viele werden ihn zeitlebens Hansi nennen, eroberte sich seine Heimat zunächst mit einem Beil. Das holte er sich aus der Werkstatt, die in der großen Holzhütte neben dem Wohnhaus untergebracht war. In diesem Schuppen, in dem auch das Brennholz und die Wäsen lagerten und ein Verschlag für die Hasen eingerichtet war, gab es sogar einen Dachboden, der mit Baumaterialien und allerlei Gerümpel voll gestellt war und den man über eine hölzerne Innentreppe erreichte.
In der Werkstatt, einem durch Holzwände abgetrennten Raum, befand sich Werkzeug aller Art, wieman es beim Hausbau, bei der Gartenarbeit, beim Wäsenstechen und bei der Holzbearbeitung gebrauchen konnte. Natürlich war das Werkzeug tabu für die beiden Buben im Haus, den Hansi und den zweieinhalb Jahre älteren Richard. Doch irgendwie schaffte es Hansi, sich den kleinen Beichel zu erobern. Begleitet von Ermahnungen und Befürchtungen der Mutter – „Bis no ebbas bassiert!“ – wurde das Werkzeug zum wertvollsten Besitz.
Die Kinder liefen barfuß, den ganzen Sommer lang. Es galt die Regel: „In Monaten ohne ‚R‘ darf man barfuß gehen.“ Das hieß dann aber auch, dass am Abend vor dem Schlafengehen die Füße wieder gewaschen werden mussten. Dazu gab es eine große Schüssel, die am Außen-Wasserhahn neben der Haustür aufgefüllt wurde. Dazu kam eine Wurzelbürste und, wenn es sein musste, ein Stück Kernseife. Da saßen sie im Sommer fast täglich, die beiden Schütz-Buben, und rubbelten und bürstelten. Der grüne Grassaft ging am schlechtesten weg, aber die Mutter kontrollierte streng. Welches Glück, wenn sie einmal keine Zeit zu Nachforderungen hatte oder das Füßewaschen auf wundersame Weise gar einmal ganz ausfiel!
Einmal saß der Hansi da, auf der Betontreppe, die zwischen Haus und Hütte nach wenigen Stufen zweigeteilt hinunter zum Garten oder in den Keller führte. Er war fertig mit dem Füßewaschen und hätte nun das blau karierte Handtuch zum Trocknen gebraucht. Doch so laut er auch schrie, niemand hörte ihn.
Der Vater war mit Hansis großem Bruder Richard wohl noch im Wald. Gegen Abend ging er oft den zweispurigen Feldweg entlang, der gleich hinter dem Gartenzaun als Fortsetzung der ungeteerten Zufahrtsstraße in den Wald führte. Dort gab es brauchbare Dinge zu holen, die man bei Tageslicht besser nicht nach Hause trug: Brennholz, Stangen für den Zaun oder für Beeteinfassungen im Garten und einmal im Jahr auch einen Christbaum.
Hansi und sein Bruder Richard
Die Mutter hätte doch eigentlich da sein müssen. Aber sie hörte das Rufen nach dem Handtuch nicht. Mit den Füßen im kalten Wasser wurde aus dem Rufen und Schreien immer mehr ein Weinen, unterbrochen von Momenten, da der Bub lauschte in der Hoffnung, die Mutter herbeieilen zu hören. Irgendwann gab der Hansi auf und schluchzte nur noch leise vor sich hin. Angst breitete sich in ihm aus. Er kam sich vor wie in einem der Märchen, die die Mutter immer als Betthupferl vor dem Schlafengehen vorlas. Vielleicht war etwas passiert? Oder sie hatten ihn allein gelassen, waren weggegangen?
Hansi kam in seinen Tagträumen immer wieder auf den Gedanken, er sei gar nicht seiner Eltern Kind. Irgendwie beschlich ihn immer wieder der Verdacht, er sei hier nur aufgenommen worden, vielleicht ein verstoßener Sohn reicher Eltern, ein Königskind gar? Und jetzt hatten sie ihn hier allein gelassen und das Kind wusste nicht mehr ein noch aus.
Da ging die Haustür auf und die Mutter stand da.
„Ja was isch denn mit dir los? Hoscht ja scho Schwimmhait zwischbe de Zecha! Jetztat abr nix wia woadle nei ins Haus!“
Das Haus am Falchen, Hausnummer 175¼
Im Loch
Wenn der Hansi mit seinem Beil unterwegs war – und das war er amliebsten von früh bis spät –, dann konnte er nicht barfuß sein. Da brauchte er seine Gummistiefel.
Haus und Holzhütte standen nebeneinander an der oberen Grundstücksgrenze, am Hang. Unterhalb einer aus Felsbrocken aufgeschichteten, efeuumrankten Steingartenböschung und des darunter verlaufenden Kieswegs fiel der Garten ab bis zu einer ziemlich ebenen Wiesenterrasse. Die diente, da dort eine Wäscheleine zwischen zwei Holzpfosten gespannt war, in späteren Jahren immer häufiger als Fuß- und Federballplatz. Von dort aus ging es noch steiler in Richtung Höllbach hinunter. Ein gekiester Fußweg schlängelte sich vom Haus den Hang hinunter bis zur Grundstücksgrenze, wo hinter Zaun und Tannenhecke die Garage des reichen Nachbarn, des Fabrikanten Kartmann, stand. Eine Garage hatten Mitte der fünfziger Jahre nur wenige.
In dem Gartenteil westlich vom Haus wuchsen am oberen Gartenzaun bei der Straße Birken und Fichten, an die sich ein Sommerhäuschen schmiegte. Ein relativ ebenes Wiesenstück daneben eignete sich ideal zum Spielen, unter anderem auch für das österliche Eierkugeln. Dabei rollten die gefärbten Eier über zwei parallel zur Böschung liegende Holzlatten. Das Ei, das am weitesten in die Wiese kugelte, machte seinen Besitzer zum Sieger.
Weiter unten waren – wiederum terrassenförmig – ein großer Gemüsegarten angelegt und mehrere Reihen Beerensträucher gepflanzt. Überall im Garten standen Obstbäume, aufdenen Äpfel, Pflaumen und Griecherle wuchsen. Letztere sind eine Art kleiner Zwetschgen, die in den meisten Jahren recht sauer blieben, aber zu einer ganz passablen Marmelade verarbeitet werden konnten.
Am südwestlichen Ende des Gartens hörte der Zaun auf. Hier brauchte es keine künstliche Begrenzung mehr, denn es tat sich ein tiefer Graben auf, der sich zu einem kleinen Seitental des Höllbachs weitete und „Loch“ genannt wurde. Die steilen Böschungen waren mit Laubgehölzen dicht bewachsen und nur der oberste Einschnitt, dort wo der Gartenzaun unterhalb der Johannis- und Stachelbeeren endete, konnte noch genutzt werden als eine Art Kompost- und Müllplatz.
„I gang ins Loch!“ Das war die tägliche Abmeldung von der Mutter, solange das Wetter mitspielte. Gummistiefel an, das Beil aus der Hütte geholt und ab ging’s in den „Urwald“. Vom Garten aus hatte sich der Hansi einen Pfad durch das Gehölz im Loch frei geschlagen, zunächst den steilen Hang schräg hinab, bis zum Rinnsal am Grund, dann stets dem Wasser folgend bis zur Mündung ins Höllbächle. Mit der Zeit wurde der Dschungelpfad immer mehr verlängert und verlief bald schon höllbachaufwärts bis dorthin, wo das Audickicht ein gutes Stück vom heimischen Garten entfernt allmählich in den großen Wald überging.
Der freigeholzte Pfad musste immer wieder nachgebessert werden. Da und dort bekam er eine Abzweigung, zum Beispiel um auf der dem Bach gegenüberliegenden Seite ganz nahe, aber ungesehen, an den Fußweg nach Helmenstein heranzukommen oder um an der Falchenseite von einem Feldweg aus die Bauern bei der Feldarbeit beobachten zu können.
Der Goresse
Die meisten Wiesen bewirtschaftete am Falchen der „Goresse“, der seinen Bauernhof schräg gegenüber vom Postamt hatte, genau dort, wo der Falchenweg im Dorf anfing und wo im gegenüberliegenden Lebensmittelgeschäft die Mutter normalerweise ihre Einkäufe erledigte.
Der Laden gehörte Katharina Schütz, einer Schwägerin von Hansis Großvater, und ihr Mann, Josef Schütz, hatte eine Besonderheit zu bieten, die in diesem Ausmaße wohl kaumein zweites Mal vorkommen dürfte. Zwar galt im Allgäu der damaligen Zeit ein Kropf nicht gerade als selten, doch der „Onkel Josef“ gerufene Mann, eigentlich mein Großonkel, hatte einen so großen, in praller Rundung unter dem Kinn vorquellenden Riesenkropf, dass die Kinder immer wieder auf diese seltsame Körperwucherung hinstarren mussten. Beim Onkel Josef waren die obersten Hemdknöpfe funktionslos, da der Kropf einen erheblichen Teil des Oberkörpers bedeckte. Immer wieder suchte der kleine Hansi nach den ersten Anzeichen, die ankündigten, was bei so einem Allgäuer Spezialabzeichen wohl früher oder später unumgänglich sein musste: Irgendwann, da war sich der Bub ganz sicher, würde dieses Ding da am Halse mit einem lauten Knall platzen und der Onkel Josef elend verbluten. Doch nichts dergleichen geschah, sondern der Josef Schütz qualmte seine lange gebogene Pfeife wie eh und je und ging seinem Geschäft nach.
Und das bestand im Schneckensammeln. Dazu hatte er einen Metallring, mit dem er messen konnte, ob die Weinbergschnecken die vorgeschriebene Mindestgröße hatten, und einen braunen Rupfensack, in dem die Tiere landeten, die die Ringprüfung, allerdings zu ihrem Schaden, bestanden hatten. Mit hohen Lederstiefeln konnte man den stets Pfeife rauchenden Onkel Josef oft an den Waldrändern des Falchengebietes auf seinen Beutezügen sehen. Der meist recht gut gefüllte Sack ließ vermuten, dass die Schneckenjagd durchaus erfolgreich verlief. Nur wohin die Schnecken geliefert wurden, wussten die Kinder nicht. Aber die Schütz-Buben verzogen ohnehin das Gesicht und schüttelten sich vor Ekel, wenn sie sich vorstellten, dass diese Schnecken, vor allem in Frankreich, wie der Vater zu berichten wusste, angeblich als Delikatesse verzehrt wurden.
Der Bauer Goresse zog die Falchen-Buben auf eine andere Art in seinen Bann. Zunächst einmal begegneten sie ihm während mehr als einer Hälfte des Jahres recht regelmäßig, wenn er seine Kühe, die auf den Wiesen am Falchen weideten, am Morgen aus- und am Abend wieder eintrieb. Das ging nie ohne lautes Rufen, Schreien und Kommandieren vonstatten. Schon von weitem hörte man immer wieder sein vertrautes „Hoh! Hoh! Hohohoho!“, das an manchen Stellen von einem Echo beantwortet wurde und dadurch fast wie ein Kanon klang.
Sowohl er selber als auch seine Frau und die schon größeren Töchter hatten nichts dagegen, wenn beim Heuen die Kinder zum Helfen kamen. Die standen zwar sicher mehr im Weg herum, als dass sie eine wirkliche Hilfe gewesen wären, aber beim Goresse hatte man Kinder einfach gern und das spürten diese auch.
Besonders gefielen ihnen die damals üblichen Hoanzen und Schwedenreiter, auf denen das frisch gemähte Gras zum Trocknen aufgehängt wurde. „Hoanzen“ hießen Holzpfähle mit zwei bis drei Querverstrebungen, als „Schwedenreiter“ bezeichnete man Pfahlreihen, zwischen denen Drähte gespannt wurden. Hier konnte man dann tagelang wunderbar „Fangerles“ und „Versteckus“ spielen, wozu neben den Kartmann-Kindern auch die Töchter des oberen Nachbarn Beringer hinzukamen. Wenn das Heu trocken war und der Goresse mit dem „Bulldog“ und dem großen Heuwagen hintendran angefahren kam,dann half man nicht nur beim Aufladen, sondern durfte hoch oben auf dem fertigen Fuhrwerk noch bis halb ins Dorf hinunter mitfahren.
Beliebt war auch ein Abstecher in den Kuhstall des Bauern. Wenn die Mutter am späten Nachmittag nach dem Eintreiben bei der Kathi noch etwas einzukaufen hatte, war der Hansi schon deswegen mit dabei, weil er bei der Gelegenheit dem Goresse einen Besuch abstatten konnte. Der saß um diese Tageszeit auf einem Schemel neben einer seiner Kühe und ließ die frische Milch durch geschicktes Ziehen an den Euterzitzen in einen Milchkübel spritzen. Kam aber der Hansi während desMelkens in den Kuhstall, dann konnte der sicher sein, dass der Goresse mit einer der Zitzen nicht in den Kübel, sondern auf den Besucher zielen würde. Mit lautem, dröhnendem Lachen spritzte er dem Buben so die warme Kuhmilch ins Gesicht.
Auch zu anderen Zeiten mussteman beim Goresse immer mit einem Spaß rechnen: Zum Beispiel, wenn Besuch gekommen war und einen der Vater schnell mit dem Rucksack zum Gasthof Drei Rosen geschickt hatte, um ein paar Flaschen Bier und Limo für die Bewirtung der Gäste zu holen. Denn der Gasthof war im Vorderhaus des Goresse’schen Anwesens untergebracht und wurde von ihm selbst und seinen Schwestern bewirtschaftet. Wenn der Goresse den Hansi sah, kam er aus dem Stall, der Tenne oder dem Garten gelaufen, um ihm nachzurufen: „Schütz, Schütz, heb’s Hemad hoach und schbritz!“
Im Urwald
Dort wo höllbachaufwärts der hohe Wald begann, gab es auf der anderen Bachseite einen großen Fuchsbau. Wenn Hansi im Frühjahr ganz leise den Bachhang hinaufschlich, konnte er mit ein bisschen Glück die jungen Füchse vor den Eingangslöchern in den Bau beim Spielen und Herumtoben beobachten.
Auf der anderen Bachseite, am Falchensüdhang fandman im Frühjahr so viele Schusternägele und Enziane, dass einige Wiesen ganz blau leuchteten. Andere Wiesen am Waldrand, mehr dem Steilhang zu, waren rosa und rot von Primeln oder – später im Jahr – gelb vor lauter Trollblumen und dazwischen fanden sich die verschiedensten Arten von heimischen Orchideen.
Die Arbeit an den Schleichpfaden durchs Gehölz ging nicht ohne Schrammen und Risse ab. Denn es gab im Loch und am Bach entlang Brombeerranken und Heckenrosen, Weißdorn, Sanddorn und Berberitzen. Aber das nahm der Hansi klaglos in Kauf.
Hier war er allein in seiner Welt. Keiner konnte ihn sehen in seinem Urwald und er sah doch so viel: Die Fische im Bach, die Vögel in den Bäumen und somanches Frosch- und Schlangengetier. Interessant fand er die Blindschleichen, von denen es im Garten neben den Eidechsen im Steingarten wohl am meisten gab. Im Frühjahr, wenn am Morgen noch Reif auf dem Gras lag, waren sie steif und unbeweglich, mit zunehmender Wärme aber wurden sie agil und schlangenähnlicher.
Vom Großvater hatte der Bub auch gelernt, wie man jenes Tier sichtbar machen konnte, das im Sommer, vor allem ab dem späten Nachmittag bis weit in den Abend hinein überall zu hören, aber nirgends zu sehen war. Das waren die Grillen, die an sonnigen Prallhängen ihre Löcher im Boden hatten, so auch an den kleinen Böschungen des „Fußwegles“, das durch den Garten führte. Wenn man mit einem Grashalm in eines dieser Löcher hineinbohrte, dann kam der Bewohner meist ziemlich schnell rückwärts aus seiner Behausung heraus – ein lustiges Spiel, das man oft wiederholen konnte.
Ein Rest an Unheimlichkeit blieb aber auch im so vertrauten Lochpfad: Geräusche, die nicht zuzuordnen waren, Gedanken an Schlangen oder sonstige gefährliche Tiere. Plötzlich sprang mitunter ein Untier aus einem dichten Busch, sodass der Hansi vor Schreck sein Beil fallen ließ. Doch es war nur Schnurri, die Katze, die sich immer wieder einen Spaß daraus machte, den Hansi auf seinen Urwalderkundungen zu begleiten.
Natürlich gehörte auch ein Taschenmesser zur Urwaldexpeditionsausrüstung. Damit ließen sich die jungen, ganz gerade wachsenden Haselnussstecken abschneiden und mittels einer Spitze an einem Ende in Speere verwandeln. Besonders viel Zeit nahm der Bub sich dann, um durch das geschickte Abschälen der Rinde Muster in die Stecken zu schnitzen. Er gravierte Ringe, Spiralen, Mäander, Längsfelder, Wellenlinien und, als er etwas älter war, auch den eigenen Namen ein. So wurde jeder Speer zu einem besonderen Einzelstück.
Auch Pfeil und Bogen stellte der Hansi schon bald selber her, nachdem er von seinem Vater und dem älteren Bruder Richard abgeschaut hatte, wie man es machte: Er schnitt eine passende Hasel- oder Weidenrute bei einer Astgabelung ab und bog sie so, dass er ein Stück dünne Schnur, in die an beiden Enden Schlingen geknüpft worden waren, als Bogensehne einhängen konnte. Dünnere Ruten wurden vorne zugespitzt und hinten eingekerbt und somit zu Pfeilen verarbeitet. In späteren Jahren lernte der Hansi dann noch, dass die Pfeile viel besser flogen, wenn man vorne, gleich hinter der Spitze ein wenige Zentimeter langes Stück Holunderstengel draufsteckte. Das





























