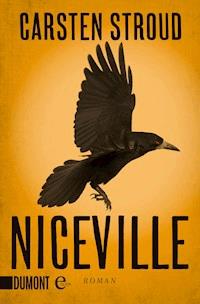
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Niceville-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Band 1 der packenden Niceville-Trilogie, hochgelobt vom großen Stephen King Niceville, eine Kleinstadt im Süden der USA: idyllisch, altmodisch und noch immer fest in den Händen der Gründerfamilien. Aber irgendetwas läuft schief in Niceville. An einem Sommertag verschwindet der kleine Rainey Teague. Zehn Tage später wird er gefunden – in einer alten Gruft. Er liegt im Koma. Nick Kavanaugh, der Ermittler, steht vor einem Rätsel. Merle Zane und Charlie Danziger überfallen eine Bank und machen sich mit 2,5 Millionen Dollar aus dem Staub. Nach einer Meinungsverschiedenheit knallen sie sich gegenseitig ab. Beide überleben schwerverletzt. Niceville findet keine Ruhe mehr und wird zu einem Ort ohne Gnade. Während eines infernalischen Wochenendes überschlagen sich die Ereignisse. Liegt ein Fluch über der Gegend? Geht er von einem mit schwarzem Wasser gefüllten Loch in dem Felsen oberhalb der Stadt aus? Man sagt, etwas lebt darin. Doch was soll das sein? Er ist einer der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit, gilt als Großmeister des Horrorromans und ist ein Riesenfan von Carsten Stroud. Nachdem Stephen King den letzten Band der Niceville-Trilogie gelesen hatte, schrieb er einen begeisterten Brief an Strouds amerikanische Agentur: „Carsten Strouds Niceville-Trilogie ist genial, und das Beste hat er sich bis zum Schluss aufgehoben. DER AUFBRUCH ist brillant geschrieben, eine geradezu hypnotische Lektüre. Das hier liest sich vielleicht wie ein Werbetext, aber das ist es nicht. Es ist ein aufrichtiger Fan-Brief. Ich mochte NICEVILLE. Aber erst bei DER RÜCKKEHR habe ich verstanden, was ich hier vor mit hatte. Die Action-Szenen sind großartig, und der Sound hat ein bisschen was von Chandler, ein bisschen was von Vonnegut und ist doch durch und durch Stroud. Ich hoffe sehr, dass diese drei Bände zusammen veröffentlicht werden, sodass die Leser deren volle Wucht spüren und die Vielfältigkeit des breiten Figurenensembles erleben können. Meiner Meinung nach hat NICEVILLE einen Platz verdient zwischen den großen Orten im Reich der Imagination wie Mittelerde, Narnia und Arkham. Ich bewundere die schiere Energie und die Reichweite des Ganzen. Außerdem gibt es diesen umfassenden, vergnügt-deftigen Humor, der für mich das Tüpfelchen auf dem i ist, und der die dunkle Seite von Abel Teague und Konsorten aufbricht. NICEVILLE überquert mit einer Selbstverständlichkeit Genre-Grenzen, springt über diese Kluft, die unbedeutendere Autoren verschluckt, wie ein fettes Motorrad über umgestürzte Bäume. Es gibt wirklich nichts Vergleichbares, und mir bleibt nichts zu sagen außer Bravo. Also: Bravo! Stephen King PS: Ich mag Rainey Teague immer noch nicht. Und vertraue ihm schon gar nicht.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Niceville-Trilogie
Niceville. Eine Kleinstadt im Süden der USA. Ein nicht enden wollender Fluch. Eine mit pechschwarzem Wasser gefüllte Senke, die über der Stadt thront. Menschen, die verschwinden. Andere, die zu Monstern mutieren. Und mittendrin Nick Kavanaugh, Ex-Militär und Ermittler, dessen Familie und gesamte Existenz bedroht wird, durch das Böse, das in Niceville schlummert. Wird es ihm gelingen, dem Spuk ein Ende zu bereiten? Ein rasanter Mix aus Hardboiled-Thriller, Fantasy und Horror – eine packende, sich über alle Genregrenzen hinwegsetzende Trilogie, hochgelobt vom großen Steven King.
Bereits lieferbar:
Band 1: Niceville
Band 2: Die Rückkehr
Band 3: Der Aufbruch (erscheint Anfang November 2015)
Band 1: Niceville
Niceville. Eine Kleinstadt im Süden der USA, idyllisch, altmodisch und noch immer fest in den Händen der Gründerfamilien. Hier lässt es sich leben. Aber irgendetwas läuft schief in Niceville. An einem Sommertag verschwindet der kleine Rainey Teague. Zehn Tage später wird er gefunden – in einer alten Gruft. Er liegt im Koma. Nick Kavanaugh, der Ermittler, steht vor einem Rätsel. Niceville findet keine Ruhe mehr. Merle Zane und Charlie Danziger überfallen eine Bank und machen sich mit 2,5 Millionen Dollar aus dem Staub. Nach einer Meinungsverschiedenheit knallen sie sich gegenseitig ab. Beide überleben schwerverletzt.
Niceville wird zu einem Ort ohne Gnade. Während eines infernalischen Wochenendes überschlagen sich die Ereignisse. Liegt ein Fluch über Niceville? Geht er aus von einem mit schwarzem Wasser gefüllten Loch indem Felsen oberhalb der Stadt? Man sagt, etwas lebt darin. Doch was?
Carsten Stroud
war Bootsbauer an der Baja California und Berufstaucher in der US Army. Er hielt sich in geheimer Mission in den gefährlichsten Gegenden der Dritten Welt auf. Er ist Journalist und preisgekrönter Sachbuchautor, seine Romane sind Bestseller in den USA.
Carsten Stroud hat drei erwachsene Kinder und lebt heute mit seiner Frau in Toronto. Sein erster ins Deutsche übersetzte Roman ›Niceville‹ erschien 2012 im DuMont Buchverlag, der Nachfolgeband ›Die Rückkehr‹ 2013.
Carsten Stroud
NICEVILLE
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren
Vollständige eBook-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Taschenbuchausgabe 1. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel ›Niceville‹ bei Alfred A. Knopf, New York. © Carsten Stroud 2012 © 2012 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Übersetzung: Dirk van Gunsteren Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Eric Isselé – Fotalia.com Satz: Fagott, Ffm
Ihr vier Winde, herbei, Den Toten haucht Euren Atem ein, Auf dass sie leben.
Denkmal für die Gefallenen der Konföderierten StaatenForsyth Park, Savannah
Rainey Teague kommt nicht nach Hause
Die Polizei von Niceville brauchte nicht einmal eine Stunde, um die Person zu finden, die den Jungen zuletzt gesehen hatte: Alf Pennington. Sein Antiquariat lag an der North Gwinnett, nicht weit von der Kreuzung Kingsbane Walk, auf dem normalen Schulweg des Jungen, der Rainey Teague hieß.
Von der Regiopolis School nach Garrison Hills waren es ungefähr eineinhalb Kilometer, für die der Zehnjährige, der gern ein bisschen trödelte und sich die Zeit nahm, in sämtliche Schaufenster zu sehen, meist etwa fünfunddreißig Minuten brauchte.
Raineys Mutter Sylvia, eine im Grunde vernünftige, wenn auch vom Kampf gegen den Eierstockkrebs zermürbte Frau, hatte in der Küche des Hauses in Garrison Hills einen Snack für den Jungen bereitgestellt: ein Schinken-Käse-Sandwich und Pickles.
Sie saß an ihrem Computer und forschte in den Tiefen von ancestry.com, wobei ein Teil ihrer Aufmerksamkeit der Haustür galt, denn sie wartete wie jeden Tag darauf, dass Rainey hereingepoltert kam. Hin und wieder warf sie einen Blick auf die digitale Uhr in der Taskleiste.
Es war 15 Uhr 24, und sie stellte ihn sich vor, ihren Jungen, ihr spätes Kind, das sie, nach jahrelangen erfolglosen Versuchen mit künstlicher Befruchtung, aus dem Waisenhaus in Sallytown geholt und adoptiert hatte.
Blass und blond, mit großen braunen Augen und schlaksigem Gang – sie sah ihn, als säße sie in einem Hubschrauber, als wäre Niceville unter ihr ausgebreitet, von den dunstverhangenen braunen Belfair-Hügeln im Norden bis zum grünen Band des Tulip, der sich um den Fuß von Tallulah’s Wall wand, breiter wurde, abermals die Richtung änderte und durch das Zentrum der Stadt floss. Weit entfernt im Südosten konnte sie eben noch die flachen Küstenmarschen und dahinter das schimmernde Meer sehen.
Sie sah ihn in seiner Schuluniform, den blauen Blazer über die Schulter geworfen, mit offenem Hemdkragen und gelöster Krawatte, mit tief hängendem Harry-Potter-Rucksack und flatternden Schnürsenkeln: Er kam an den Bahnübergang zwischen Peachtree und Cemetery Hill – selbstverständlich blickte er in beide Richtungen –, und jetzt schlenderte er durch die steile Allee an der Felswand entlang, an deren Fuß der Friedhof für die konföderierten Gefallenen lag.
Rainey.
In ein paar Minuten würde er zu Hause sein.
Ihre langen, zarten Finger huschten über die Tastatur, als spielte sie Klavier. Das lange schwarze Haar hing über ihre Augen, und sie saß aufgerichtet und konzentriert da, die Füße sittsam gekreuzt, und kämpfte mit den Nebenwirkungen des Oxycodon, das sie gegen die Schmerzen eingenommen hatte.
Auf ancestry.com ging es um Ahnenforschung, und Sylvia hatte die Seite angesteuert, um ein Familienrätsel zu lösen, das sie seit geraumer Zeit beschäftigte. Im Zuge ihrer Nachforschungen hatte sie den Eindruck gewonnen, dass die Antwort auf ihre Fragen irgendetwas mit einem Familientreffen zu tun haben musste, das 1910 auf Johnny Mullrynes Plantage bei Savannah stattgefunden hatte. Sylvia war entfernt verwandt mit den Mullrynes, die diese Plantage lange vor dem Bürgerkrieg gegründet hatten.
Später sagte sie zu dem Polizisten, der die Anzeige aufnahm, sie habe sich irgendwie in dieser Ahnenforschung verloren, ihr Zeitgefühl sei ihr abhandengekommen – eine der Nebenwirkungen des Oxycodon.
Als sie abermals auf die Uhr sah, diesmal mit leichter Besorgnis, war es 15 Uhr 55. Rainey hätte vor zehn Minuten zu Hause sein sollen.
Sie dachte ein wenig nach, schob den Stuhl zurück, ging durch den langen Flur zur Haustür mit ihrer Füllung aus Buntglas und dem Rundbogen aus handgeschnitztem Mahagoni und trat hinaus auf die breite, geflieste Terrasse, eine hochgewachsene, schlanke Frau in einem makellosen schwarzen Kleid, mit einer silbernen Halskette und Ballerinas aus rotem Lackleder. Sie verschränkte die Arme und beugte Kopf und Oberkörper nach links, in der Hoffnung, ihren Sohn auf der schattigen Eichenallee zu sehen.
Garrison Hills war eines der schönsten Viertel von Niceville, umspielt vom warmen Licht alten Geldes, einem Licht, das durch die Wipfel der Eichen und die grauen Fetzen von Spanischem Moos fiel, das die Rasenflächen leuchten und die Dächer der alten Villen an dieser Straße schimmern ließ.
Es war kein Junge zu sehen, der auf dem Bürgersteig dahinschlurfte. Es war überhaupt niemand zu sehen. So angestrengt sie auch Ausschau hielt – die Straße blieb leer.
Lange stand sie so da. Ihre leichte Besorgnis verwandelte sich erst in Verärgerung und nach weiteren drei Minuten in ernstere Sorge, aber noch nicht in Panik.
Sie ging wieder ins Haus, griff zu dem Telefon auf der antiken Anrichte neben dem Eingang und drückte die Schnellwahltaste 3. Sie hörte einen Rufton nach dem anderen, und mit jedem nahm ihre Sorge ein wenig zu. Nach dem fünfzehnten legte sie auf.
Sie drückte die »Beenden«-Taste und dann die Schnellwahltaste 4, um das Sekretariat der Regiopolis School anzurufen. Nach dem dritten Läuten meldete sich Father Casey, der ihr bestätigte, Rainey habe die Schule um zwei Minuten nach drei verlassen, zusammen mit dem üblichen Lemmingstrom aus lärmenden Jungen in grauen Hosen, weißen Hemden und blauen Blazern mit dem in Gold gestickten Schulwappen auf der Brusttasche.
Father Casey hörte sogleich die Dringlichkeit in ihrer Stimme und sagte, er werde zu Fuß Raineys Heimweg entlang der North Gwinnett bis zum Long Reach Boulevard gehen.
Sie tauschten die Handynummern aus, und dann nahm Sylvia die Wagenschlüssel, ging die Stufen zur Doppelgarage hinunter – ihr Mann Miles, ein Investmentbanker, war noch in seinem Büro in Cap City – und stieg in ihren roten Porsche Cayenne; Rot war ihre Lieblingsfarbe. Als sie durch die gepflasterte Einfahrt rückwärts auf die Straße setzte, war in ihrem Kopf nur weißes Rauschen, und ihre Brust war wie von Stacheldraht eingeschnürt.
Auf der North Gwinnett entdeckte sie Father Casey inmitten des Gewimmels dahinschlendernder Menschen, eine schwarz gekleidete Gestalt mit einem Priesterkragen, über eins achtzig groß und mit der Statur eines Footballspielers. Sein Gesicht war besorgt gerötet.
Sie hielt an und ließ das Fenster herunter. Sie berieten sich kurz. Wagen fuhren vorbei, Passanten sahen neugierig herüber: ein gutaussehender, etwas erhitzter junger Jesuit, der leise und eindringlich auf eine sehr hübsche Frau mittleren Alters in einem roten Cayenne einredete.
Am Ende dieser Besprechung stieß Father Casey sich vom Wagen ab und machte sich daran, jede Gasse und jeden Park zwischen der Schule und Garrison Hills abzusuchen. Sylvia Teague griff zu ihrem Handy, atmete tief durch, sprach in Gedanken ein Stoßgebet an den heiligen Christophorus und rief die Polizei an. Man sagte ihr, sie solle sich nicht von der Stelle rühren – man werde sofort einen Streifenwagen schicken.
Und so saß sie in dem nach Leder riechenden Cayenne und starrte hinaus auf den Verkehr entlang der North Gwinnett, sie versuchte, an nichts zu denken, während sich rings um sie her der Alltag von Niceville abspielte, einer verschlafenen Stadt in den Südstaaten, wo sie seit ihrer Geburt lebte.
Die Regiopolis School und dieser Teil der North Gwinnett lagen tief im grünen Herzen von Niceville. Es war ein altmodisches Stadtzentrum, fast durchgehend beschattet von großen, alten Eichen, deren dicke Äste durch zahllose Stromkabel miteinander verbunden waren.
Der Tulip floss breit und gewunden durch das Zentrum, seine glatte braune Oberfläche glitzerte im Sonnenlicht. Überall am Ufer blühten Magnolien und Bougainvilleen.
Die meisten Gebäude waren im Stil der Jahrhundertwende gebaut, aus roten Ziegeln und mit Messingverzierungen. Sie standen in breiten, schattigen, gepflasterten Alleen mit gusseisernen Straßenlaternen.
Marineblau und goldfarben lackiert, so schwer wie Panzer, rollten die Straßenbahnen am Cayenne vorbei und ließen das Lenkrad unter Sylvias Hand erbeben. Sie betrachtete das sanfte goldene Licht, den feinen Dunst aus Pollen und Flussnebel, der immer über der Stadt zu liegen schien: Er nahm den Kanten die Schärfe und verlieh Niceville das Aussehen und Lebensgefühl einer früheren, anmutigeren und würdevolleren Zeit. In einer so hübschen Stadt, sagte sie sich, konnte doch gar nichts Schlimmes passieren, oder?
Tatsächlich hatte Sylvia schon immer gefunden, dass Niceville eines der schönsten Städtchen im ganzen tiefen Süden hätte sein können, wenn es nicht aus irgendeinem unerfindlichen Grund im langen Schatten von Tallulah’s Wall erbaut worden wäre, einem riesigen Kalksteinfelsen, der den Nordostteil der Stadt überragte. Sie konnte ihn von dort, wo sie jetzt war, sehen: eine gelbe, mit Ranken und Moos bewachsene Wand, so hoch und breit, dass bestimmte Viertel im Osten der Stadt erst nachmittags von der Sonne beschienen wurden. Oben auf dem Felsen standen uralte Bäume um ein kreisrundes, mit kaltem schwarzem Wasser gefülltes Loch, von dem niemand wusste, wie tief es war.
Dieses Loch hieß Crater Sink.
Sylvia war einmal mit Rainey dort gewesen. Es hatte ein Picknickausflug sein sollen, aber die alten Fichten und Eichen waren voller flüsternder, knarzender Geräusche gewesen und hatten sich, wie es schien, über sie gebeugt, und das Wasser des Crater Sink war schwarz und still gewesen und hatte infolge irgendeiner optischen Täuschung nicht das winzigste Stück des blauen Himmels widergespiegelt.
Sie waren nicht lange geblieben.
Jetzt dachte sie wieder an Rainey, und mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie die ganze Zeit nicht aufgehört hatte, an ihn zu denken.
Vier Minuten später hielt der erste Streifenwagen neben ihrem roten Cayenne. Am Steuer saß Mavis Crossfire, eine hochgewachsene, kräftige, erfahrene Polizistin, die wie alle guten Polizisten Humor und kühle Kompetenz verströmte, unterlegt mit einer latenten Bedrohlichkeit.
Mavis Crossfire kannte und mochte die Familie Teague – Garrison Hills gehörte zu ihrem Revier. Sie beugte sich zum Fahrerfenster des Cayenne und begriff ebenso schnell wie Father Casey, dass die Geschichte, die Sylvia erzählte, alarmierend war. Es war eine Geschichte, die Mavis weit ernster nahm, als irgendein Polizist in irgendeiner mittelgroßen amerikanischen Stadt sie zu diesem frühen Zeitpunkt genommen hätte, was daran lag, dass in Niceville fünfmal mehr Menschen verschwanden als im Landesdurchschnitt.
Darum hörte Sergeant Mavis Crossfire sehr genau zu, als sie von Rainey Teagues Verschwinden erfuhr, und darum ging sie nach etwa vier Minuten an ihr Funkgerät und informierte den diensthabenden Captain, der wiederum die Special Task Force in Belfair und ein Team des CID, der Kriminalpolizei von Cullen County, unter Leitung von Lieutenant Tyree Sutter alarmierte.
Zehn Minuten später hatten jeder Polizist in Niceville, jeder Sheriff in den umliegenden kleineren Orten und sämtliche Staatspolizisten im weiteren Umkreis einen digitalen Download mit Raineys Foto und Beschreibung erhalten – das Sekretariat der Regiopolis School hatte von jedem Schüler ein Digitalfoto –, und alle verfügbaren Leute waren mit dem Fall befasst. Es war eine überaus lobenswerte Leistung, nicht schlechter als die der besten Polizei des Landes und weit besser als die der meisten anderen. Motivation ist alles.
Nicht einmal eine Stunde später trat ein Polizist namens Boots Jackson, der von seiner Streife durch das am Fluss gelegene Viertel Patton’s Hard ins Zentrum beordert worden war, in Alf Penningtons Antiquariat an der North Gwinnett und stellte fest, dass dies der Ort war, wo Rainey Teague zum letzten Mal gesehen worden war. Er tippte diese Meldung sogleich in den mit der Zentrale verbundenen Kleincomputer ein.
Inzwischen war die Suchmeldung an die Polizisten der Countys Cullen und Belfair sowie an die State Patrol bis hinauf nach Gracie und Sallytown und hinunter nach Cap City, der etwa achtzig Kilometer entfernten Hauptstadt des Bundesstaates, weitergegeben worden.
Tyree Sutter, genannt Tig, ein Schwarzer mit groben Gesichtszügen und einer mehrfach gebrochenen Nase, so groß und massig, dass er sein eigenes Schwerefeld erzeugte, saß an seinem Schreibtisch im Gebäude des CID in der Powder Ridge Road und sah Alf Penningtons Aussage auf dem Bildschirm. Er druckte sie aus und übergab sie Detective Nick Kavanaugh, einem zweiunddreißigjährigen ehemaligen Offizier der Special Forces. Nick war ein Weißer, schlank, eins neunzig groß und hart wie Eichenholz. Er hatte blassgraue Augen und schwarz schimmerndes Haar, das sich an den Schläfen weiß färbte, und er stand in der Bürotür und sah Tig an wie ein Wolf, der sich in einer Schlinge gefangen hat.
Eine Minute darauf saß er am Steuer seines marineblauen Crown Vic und fuhr mit eingeschalteten Blinklichtern, aber ohne Sirene, den Long Reach Boulevard an der Biegung des Tulip im Stadtzentrum entlang und hielt knapp zwanzig Minuten später vor Alf Penningtons Geschäft in der North Gwinnett 1148. Es war 18 Uhr 17, und Rainey Teague war seit genau einer Stunde und vierzehn Minuten als vermisst gemeldet.
Alf Pennington war Ende sechzig und zaundürr. Er hatte einen Altmännerbuckel, eine Glatze, scharfe dunkle Augen und heruntergezogene Mundwinkel. Als Nick eintrat und zwischen den Bücherregalen hindurch auf ihn zukam, sah er von seinem großen Schreibtisch auf. Sein säuerlicher Gesichtsausdruck verstärkte sich.
Alf war von Natur aus kein fröhlicher Mensch. Er runzelte missbilligend die Stirn, als er den dunkelblauen, schlank geschnittenen Sommeranzug sah – viel zu teuer für einen Polizisten, wahrscheinlich nimmt er Schmiergeld –, das aufgeknöpfte Jackett – damit er schneller zu seinem Totschläger greifen kann –, das blütenweiße, am Hals offene Hemd, das gebräunte, kantige Gesicht, das im trüben Licht des Ladens voller Schatten war, die wachsamen grauen Augen, das golden schimmernde Abzeichen am Gürtel, die deutliche Ausbuchtung durch den Revolver in seinem Holster auf der rechten Hüfte.
»Hallo. Sie sind bestimmt von der Polizei. Möchten Sie einen Kaffee?«
»Nein, danke«, sagte Nick mit angenehmer Baritonstimme. Er sah sich um, überflog die Titel der Bücher, sog den Geruch von Staub, Holzpolitur und Zigarettenrauch ein und streckte dann die Hand aus. »Ich bin Nick Kavanaugh vom CID.«
»Ja«, sagte Alf, schüttelte ihm kurz die Hand und zog sie gleich wieder zurück, um nachzusehen, ob der Ring am kleinen Finger noch da war. Alf war Marxist aus Vermont und hielt nicht viel von Polizisten. »Officer Jackson hat gesagt, Sie würden kommen.«
»Und da bin ich. Laut Officer Jackson haben Sie Rainey Teague kurz nach drei gesehen. Könnten Sie ihn beschreiben?«
»Hab ich doch schon«, sagte Alf. Er sprach noch immer mit einem harten, nasalen Vermont-Akzent, durchsetzt mit spitzen Frikativen.
»Ich weiß«, sagte Nick mit einem entschuldigenden Lächeln, das die Aufforderung abmildern sollte. »Aber es wäre mir eine große Hilfe.«
Alf verdrehte die Augen und konzentrierte sich.
»Ich seh ihn jeden Werktag. Er ist ein Trödler. Ein mageres Bürschchen. Zu großer Kopf, blonde Haare, die ihm über die Augen hängen, blasse Haut, Stupsnase. Die Augen groß und braun wie bei einem Eichhörnchen in einem Zeichentrickfilm. Weißes Hemd, das ihm aus der Hose hängt, Kragen offen, Krawatte auf Halbmast, ausgebeulte graue Hose, blauer Blazer mit diesem Katholikenwappen, Harry-Potter-Rucksack, der an ihm hängt, als wäre er voller Ziegelsteine. Ist er das?«
»Das ist er. Um wie viel Uhr war das?«
»Hab ich schon gesagt.«
»Noch einmal, bitte.«
Alf seufzte.
»Fünf nach drei, vielleicht zehn nach drei. Um die Zeit seh ich ihn meistens, dann ist die Katholikenschule aus.«
Nick stellte sich hinter Alfs Schreibtisch und sah zur Straße. Von hier hatte man eine ziemlich gute Aussicht auf die North Gwinnett: Menschen gingen vorbei, der Verkehr strömte vorüber, im Nachmittagslicht blitzte Metall auf.
»Und Sie haben hier gesessen?«, fragte Nick und verfiel unwillkürlich in Alfs Neuenglanddialekt.
»Jo.«
»Haben Sie ihn genau gesehen?«
»Jo.«
»War er allein?«
»Jo.«
»Schien er es eilig zu haben? War er aufgeregt?«
Alfs Stirnrunzeln vertiefte sich, während er darüber nachdachte.
»Sie meinen, als würde ihm jemand folgen?«
»Jo«, sagte Nick.
Alf sah ihn strafend an, und so hörte Nick damit auf.
»Nein. Er stand eine Weile da und hat sich die Bücher angesehen.«
»Ist er mal hereingekommen?«
»Nein. Heutzutage interessieren Kinder sich nicht mehr für Bücher. Die fummeln lieber an diesen Apparaten herum. Nein, er hat immer bloß ins Schaufenster gesehen und ist dann weitergegangen zum nächsten Geschäft. Uncle Moochies Laden.«
»Der Pfandleiher.«
»Ja. Jeden Tag dasselbe: Er sieht herein, winkt mir zu und geht dann weiter, um sich den Mist in Uncle Moochies Schaufenster anzusehen.«
»Die Kollegen haben Uncle Moochie befragt. Er sagt, er hat den Jungen gestern und vorgestern und vorvorgestern gesehen, aber heute nicht.«
»Moochie«, sagte Alf, als wäre das Erklärung genug.
»Moochies Schaufenster ist voller Zeug, das ein Junge sich gern ansieht«, sagte Nick. Alf dachte darüber nach, blinzelte und sagte nichts.
»Haben Sie mal jemanden gesehen, der den Eindruck machte, als würde er dem Teague-Jungen folgen? Irgendjemanden auf der Straße, der sich zu viel für ihn interessiert hat?«
»Einen von diesen Perversen?«
»Ja. Einen von denen.«
»Nein. Ich bin zur Tür gegangen und hab dem Jungen eine Weile zugeschaut, wie er da stand und in Moochies Schaufenster starrte. Der hat immer gute fünf Minuten da verbracht und sich das Zeug angesehen. Vielleicht sollten Sie sich auch mal dahin stellen – wer weiß, was es da zu sehen gibt?«
»Meinen Sie?«
»Jo.«
Also stellte Nick sich vor den benachbarten Laden.
Das Geschäft, das Uncle Moochie gern als privates Kreditinstitut bezeichnete, war einst, in den dreißiger Jahren, ein reich verzierter Friseursalon gewesen, und auf dem Glas der Scheibe waren die goldenen Lettern des bogenförmigen Schriftzugs SULLIVAN’S TONSORIAL ACADEMY noch immer schwach zu erkennen, doch das Schaufenster war bis zur Decke vollgestellt mit antiken Standuhren, Spiegeln mit vergoldeten Rahmen, Taschenuhren, Porzellanfiguren von Schoßhündchen, verrosteten Art-déco-Lampen, Medaillons, Broschen und allerlei Talmi-Schmuck, dass es aussah wie eine Schatzkiste in einem Comic. Dass ein Zehnjähriger ein solches Schaufenster faszinierend fand, konnte Nick verstehen.
Laut den von Boots Jackson aufgenommenen Aussagen stand Nick genau an der Stelle, wo man den Jungen zuletzt gesehen hatte.
An den Geschäften weiter unten war Rainey nicht vorbeigekommen, obwohl er sonst regelmäßig bei Scoops in der nächsten Häuserzeile hereingeschaut hatte und in dem kleinen Park an der Kreuzung North Gwinnett und Bluebottle Way oft auf den Sockel der Bronzestatue des konföderierten Soldaten geklettert war.
Heute nicht.
Soweit die uniformierten Kollegen es hatten feststellen können, war diese Stelle vor Uncle Moochies Schaufenster der Punkt, an dem Rainey Teague gestanden hatte, als … als irgendetwas passiert war.
In einer Pfandleihe gibt’s eine Überwachungskamera, dachte er. Und da war sie, links oben, und blinkte mit ihrem roten Auge zu ihm hinunter.
Moochie, ein missmutiger Libanese mit einem schlaffen Gesicht voller Kummer und Tücke, war einst ein Mann von gewaltiger Leibesfülle gewesen, doch nun ließ ein schweres Darmgeschwür ihn schrumpfen wie einen Luftballon. Er war ein polizeibekannter Hehler, aber auch einer von Nicks besten Informanten und sogleich bereit, Nick das Video der Überwachungskamera zu zeigen. Er führte ihn durch ein Chaos aus Pappkartons und Verpackungen in das Hinterzimmer des Ladens, einen Büroraum, in dem es nach Schweiß und Haschisch roch, wo er einen Schrank öffnete, in dem sich ein Monitor verbarg, und ein paar Tasten auf einer Tastatur drückte.
»Ist alles digital und wird nach vierundzwanzig Stunden überschrieben, wenn ich keinen anderen Befehl gebe«, sagte Moochie. Die Bilder bewegten sich rückwärts, und in der unteren rechten Ecke des Bildschirms flackerten die Ziffern der digitalen Zeitanzeige.
Sie standen in Moochies beengtem Büro und sahen, wie sich die Menschen auf dem Bürgersteig vor dem Laden ruckartig bewegten, während die Sekunden zurückschnurrten. Nachdem eine Minute und achtunddreißig Sekunden zurückgespult waren, sah Nick sich selbst auf dem Bürgersteig stehen und zur Kamera hinaufsehen, und dann ging er rückwärts nach links aus dem Bild. Der Zeitmarker bewegte sich und mit ihm die Leute auf dem Bildschirm, steif und eigenartig wie in einem alten Stummfilm, als wären sie Geister aus einer fernen Vergangenheit.
Nick war sehr bewusst, dass Moochie neben ihm stand, und eine Zeitlang fragte er sich, ob nicht vielleicht Moochie selbst das Letzte gewesen war, was Rainey Teague gesehen hatte.
War Rainey in den Laden gegangen?
Und wenn ja, was war dann geschehen?
War er jetzt im ersten Stock oder im Keller?
Das nächste Geschäft war Toonerville, ein Hobbyladen mit einer großen Modelleisenbahn im Schaufenster: Der Zug fuhr durch eine Miniaturversion von Niceville, akkurat nachgebaut bis hin zu der aufragenden Felswand von Tallulah’s Wall. Rainey war sonst immer hineingegangen und hatte sich mit Mrs Lianne Hardesty, der Besitzerin, unterhalten. Rainey war dort stets gern gesehen, doch heute war er nicht gekommen.
Moochie?
Nick war nie irgendetwas Eigenartiges über Moochie zu Ohren gekommen, kein Hinweis auf etwaige Neigungen, Kindern an die Wäsche zu gehen oder dergleichen, und seine Polizeiakte war zwar nicht gerade erbaulich, enthielt aber nichts, was auf irgendwelche wie auch immer gearteten sexuellen Impulse hindeutete.
Aber man konnte nie wissen.
Moochie grunzte, drückte eine Taste, und das Bild fror bei 15:09:22 ein. Da war Rainey Teague. Er trat gerade ins Bild – man sah ihn von rechts oben, so dass er kleiner aussah, als er eigentlich war. Moochie blickte zu Nick, der nickte, und Moochie drückte eine andere Taste. Der Film lief langsam und Bild für Bild weiter. Raineys Gestalt ruckte in den Bildmittelpunkt und sah genau so aus, wie Alf Pennington ihn beschrieben hatte. Der Harry-Potter-Rucksack hing über der einen Schulter und war so schwer, dass er den Oberkörper nach links zog.
Nicks Puls beschleunigte sich, als er den Jungen dort stehen sah. Er spürte einen Schatten dessen, was die Eltern jetzt fühlen mussten, doch selbst der Schatten dieses Entsetzens war kalt und scharf.
Rainey kam kurz vor dem Schaufenster zum Stehen. Er beschattete die Augen und starrte auf den Piratenschatz, und einmal legte er sogar die Stupsnase an das Glas, so dass sie komisch plattgedrückt wurde und sein Atem die Scheibe beschlug. Hinter ihm gingen Passanten durchs Bild, aber keiner beachtete ihn.
»Halt mal an«, sagte Nick.
Er beugte sich vor, um das Gesicht des Jungen zu studieren. Rainey schien vollkommen versunken, er starrte auf etwas in der Auslage, und was immer es war – es faszinierte ihn.
Er war erstarrt, versteinert, als stünde er unter einem Bann.
Wessen Bann?
»Ist er mal in den Laden gekommen?«
Moochie schüttelte den Kopf.
»Ich lass die von der Regiopolis nicht rein. Das sind alles kleine Ali Babas. Wie die Straßenkinder in Beirut.«
»Weißt du, was er sich da angesehen hat? Egal, was es ist – es hat ihn jedenfalls sehr interessiert.«
»Es muss der Spiegel gewesen sein«, sagte Moochie und musterte den Jungen auf dem Bild. »Da, wo er steht, ist er direkt vor dem Spiegel. Er sieht genau hinein. Das ist der mit dem vergoldeten Rahmen. Der ist sehr alt, von vor dem Krieg. Dem Bürgerkrieg, meine ich. Er stammt aus Temple Hill, dem alten Herrenhaus der Cottons, oben in The Chase. Delia Cotton hat ihn ihrer Haushaltshilfe geschenkt, die heißt Alice Bayer und lebt in The Glades, und Alice kam eines Tages damit an und wollte fünfzig Dollar dafür. Ich hab ihr zweihundert gegeben, obwohl das Ding tausend wert ist. Den Pfandbeleg hab ich noch. Ich glaube, der Junge hat sich einfach gern im Spiegel gesehen. Er stand jedenfalls immer da, genau so, direkt davor. Und dann hat er sich ein bisschen geschüttelt und ist weitergegangen. Das Glas ist mit der Zeit wellig geworden, und ich schätze, das fand er irgendwie komisch.«
Nick machte eine Geste, und Moochie ließ die Bilder wieder eins nach dem anderen vorwärtslaufen. Nick starrte darauf und suchte nach irgendetwas, einem Anhaltspunkt. Um 15:13:54 bewegte Rainey den Kopf nach hinten und riss den Mund auf. Um 15:13:55 machte er mit dem linken Bein einen Schritt zurück, und der Mund öffnete sich weiter.
Um 15:13:56 war er nicht mehr da.
Auf dem Bildschirm war nur ein leeres Stück Bürgersteig zu sehen.
Rainey war verschwunden.
»Liegt das an der Kamera?«, fragte Nick.
Moochie starrte auf den Bildschirm.
Nick wiederholte die Frage.
»Nein. Das hat sie noch nie gemacht. Das System ist nagelneu. Hab’s erst letztes Jahr von Securicom installieren lassen. Hat mich dreitausend Dollar gekostet.«
»Noch mal zurück.«
Moochie ließ den Film Bild für Bild zurücklaufen.
Dasselbe.
Das erste Bild: Rainey ist nicht da.
Ein Bild zurück: Da ist er.
Er macht mit dem linken Bein einen Schritt zurück, sein Mund ist weit offen.
Noch ein Bild zurück: Jetzt ist er dicht am Fenster, aber er beginnt bereits …
Was tut er?
Er weicht zurück?
Vor was?
Vor etwas, das er im Spiegel sieht?
Oder vor etwas, das hinter ihm ist und sich spiegelt? Was zum Teufel ist hier passiert?
»Wie wird diese Aufnahme gespeichert?«
»Auf der Festplatte«, sagte Moochie und starrte noch immer auf den Schirm.
»Kann man die ausbauen?«
Moochie sah auf.
»Ja, aber –«
»Ich brauche sie. Nein, Moment – ich brauche das ganze System. Hast du einen Ersatz?«
Moochie war von dieser Entwicklung wenig begeistert.
»Ich hab noch die alte Kamera mit dem Videogerät.«
»Zeig mir die Szene nochmal. Lass sie einfach durchlaufen.«
Moochie drückte die entsprechenden Tasten.
Sie sahen Rainey Teague hakelig ins Bild kommen. Er beugte sich zur Schaufensterscheibe und verharrte, sein Gesicht verriet eine immer größere innere Spannung, er brachte es immer näher an die Scheibe, bis er die Nase daran presste und sie von seinem Atem beschlug.
Dann das Zurückweichen.
Er trat einen Schritt zurück.
Und … war verschwunden.
Die Aufnahme lief weiter. Sie standen da und starrten, wie festgenagelt, und angesichts der absoluten Unbegreiflichkeit des Geschehens lief es ihnen kalt den Rücken hinunter. Sie sahen immer dasselbe Stück Bürgersteig, schlendernde Füße, hin und wieder ein vorbeigewehtes Stück Papier oder den Schatten eines Vogels und im Hintergrund Passanten, die ruhig ihrer Wege gingen.
Sie spulten vor, bis ein Streifenpolizist von links, wo Penningtons Antiquariat war, ins Bild trat und die Hand nach dem Türgriff ausstreckte.
Nick erkannte die große, massige Gestalt und das helle, sommersprossige Gesicht von Boots Jackson, dem Polizisten, dem dieses Viertel zugeteilt worden war. Sie ließen die Aufnahme ein paar Male vor- und zurücklaufen – ohne Ergebnis.
Um 15:13:55 war Rainey Teague da.
Um 15:13:56 war er weg.
Er sprang nicht aus dem Bild, er warf sich nicht zur Seite, er schnellte nicht hoch in die Luft, er verblasste nicht, er löste sich nicht in einer Rauchwolke auf, er wurde nicht von einem Fremden weggerissen.
Er verschwand einfach, als wäre er bloß ein digitales Abbild und als hätte jemand auf die Taste ENTFERNEN gedrückt.
Rainey Teague war einfach weg.
Und er kehrte nicht mehr zurück.
In den strapaziösen Tagen und Nächten, die nun folgten, als das CID und die Streifenpolizisten von Niceville und alle anderen, die abkömmlich waren, den Bundesstaat nach dem Jungen absuchten, glaubte natürlich kein ernstzunehmender Polizist auch nur eine Sekunde lang, dass das, was die Kamera aufgezeichnet hatte, die buchstäbliche Wahrheit war und das Kind einfach nicht mehr existierte.
Es musste irgendein Computerfehler sein.
Oder ein Trick – etwas, das David Copperfield machen würde.
Also nahm man sich das Überwachungssystem vor, das Moochie hatte installieren lassen. Es wurde geprüft und getestet und nochmals getestet, man suchte nach einem Fehler, nach irgendeinem Hinweis darauf, dass Moochie das Ding manipuliert hatte, um eine simple Entführung zu vertuschen. Die ganze Apparatur, ein teures System von Motorola, wurde zu einer gründlichen forensischen Untersuchung an das FBI geschickt, doch man fand keinen Fehler und kein Anzeichen dafür, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte.
Dann kam Moochie selbst an die Reihe. Man unterzog ihn einer Reihe von Verhören, die dem syrischen Geheimdienst alle Ehre gemacht hätten.
Auch hier ergab sich kein Verdacht.
Man nahm seinen Laden auseinander.
Nichts.
Man brachte Delia Cottons antiken Spiegel in ein Labor und untersuchte ihn auf … Nun ja, man hatte keine blasse Ahnung, worauf er untersucht werden sollte, aber ganz gleich, was man sich davon versprochen hatte – man fand nichts. Es war bloß ein mittelgroßer antiker Spiegel mit dunklen Flecken, einem verzierten, vergoldeten Rahmen und einer auf der Rückseite befestigten handschriftlichen Büttenkarte:
In langem Eingedenken – Glynis R.
Man gab Uncle Moochie sein teures Überwachungssystem zurück und entschuldigte sich vielmals. Mit dem Spiegel wollte er allerdings nichts mehr zu tun haben, und so landete dieser in Nick Kavanaughs Wandschrank. Danach nahm man Alf Penningtons Antiquariat auseinander, eine Maßnahme, die er stoisch ertrug und als Beweis für die inhärente Brutalität des Imperiums betrachtete. Man fand nichts.
Man durchsuchte den Toonerville Hobbyshop.
Nichts.
Man sah sich sämtliche verfügbaren Bilder sämtlicher verfügbarer Überwachungskameras entlang der North Gwinnett zwischen Bluebottle Way und Long Reach Boulevard an.
Keine einzige Spur.
Nach neun schlaflosen Nächten war Nick Kavanaugh praktisch nicht mehr Herr seiner Sinne, und so löste seine Frau Kate, eine Familienanwältin, auf Drängen von Tig Sutter schließlich ein paar Valium in seinem Orangensaft auf und packte ihn ins Bett, wo er zwölf Stunden lang schlief wie ein Toter.
Während Nick schlief, rief Kate nach kurzem inneren Kampf ihren Vater an. Dillon Walker war Professor für Militärgeschichte am Virginia Military Institute im Shenandoah-Tal. Es war schon spät, aber Walker, der verwitwet war und allein in einer Institutswohnung am Rand des Exerzierplatzes lebte, meldete sich nach dem zweiten Läuten. Kate hörte seine leise, warme Bassstimme und wünschte wie so oft, ihr Vater würde nicht so weit von Niceville entfernt wohnen und ihre Mutter Lenore, die große Liebe ihres Vaters, wäre nicht vor fünf Jahren bei einem schlimmen Unfall auf der Interstate ums Leben gekommen. Seit damals war ihr Vater nicht mehr derselbe. Er hatte etwas Wichtiges verloren, sein liebenswertes Feuer war erloschen. Doch er war wach und aufmerksam genug, um die Anspannung in ihrer Stimme zu hören.
»Kate … wie geht’s dir? Ist alles in Ordnung?«
»Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe, Dad. Hab ich dich geweckt?«
Walker saß in seinem Ledersessel. Er hatte nicht geschlafen, aber er war tatsächlich über James Morris’ Pax Britannica eingenickt, einem Buch über das britische Weltreich unter Königin Victoria. In Kates Stimme war ein leises Beben, wie immer, wenn sie sich Sorgen machte.
»Nein, mein Schatz. Ich habe noch gelesen. Du klingst besorgt. Ist was mit Beth? Oder Reed?«
Beth war Kates ältere Schwester. Sie steckte in einer katastrophalen Ehe mit einem ehemaligen FBI-Agenten namens Byron Deitz, den alle in der Familie von Herzen verabscheuten. Ihr Bruder Reed war bei der State Police und fuhr einen speziell für Verfolgungsjagden ausgelegten Wagen. Er war ein kantiger junger Mann, der nichts lieber tat, als Raser zu stellen.
»Nein, Dad. Es geht um Nick.«
»Du lieber Himmel, er ist doch nicht etwa verletzt?«
»Nein, nein. Ihm ist nichts passiert. Ich habe ihm ein paar Valium in Orangensaft aufgelöst, damit er mal schlafen kann. Er ist jetzt oben, im Bett. Seit Tagen arbeitet er ununterbrochen an einem Fall. Er ist fix und fertig.«
Sie hielt inne, als wüsste sie nicht, wo sie anfangen sollte. Walker beugte sich vor, stocherte in der Glut des Kaminfeuers, bis ein paar gelbe Flammen aufflackerten, lehnte sich wieder zurück und griff nach seinem Scotch. Er schmeckte ein wenig abgestanden, aber noch immer nach Laphroaig.
Er hörte Kate atmen und stellte sich vor, wie sie in dem alten Haus der Familie Walker auf der Veranda saß: eine schlanke junge Frau mit kastanienbraunem Haar und zarter, heller Haut, einem fein geschnittenen, eleganten Gesicht und saphirblauen Augen – das Ebenbild ihrer Mutter. Er nippte abermals an seinem Glas und stellte es ab.
»Du klingst, als wolltest du mich etwas fragen, Kate. Hat es mit Nicks Fall zu tun?«
Schweigen.
»Ich glaube schon, Dad. Es ist wieder jemand verschwunden.«
Sie hörte, dass der Atem ihres Vaters kurz stockte, und wusste, dass sie ein heikles Thema angeschnitten hatte. Vor einigen Jahren hatte ihr Vater eigene Nachforschungen über die zahlreichen Entführungsfälle in Niceville betrieben, das Projekt nach dem Tod seiner Frau jedoch abrupt eingestellt, es nie wieder aufgenommen und das Thema seither immer geschickt vermieden. Als er jetzt sprach, klang seine Stimme so warm wie immer, wenn auch vielleicht etwas wachsamer.
»Verstehe. Ich nehme an, das ist es, was Nick nicht schlafen lässt. War es wirklich eine Entführung? Wie die anderen?«
»Bisher scheinen sie das zu denken. Ich würde dir gern davon erzählen. Darf ich?«
»Natürlich, Kate. Wenn ich irgendwie helfen kann.«
Kate erzählte ihm, was man bisher wusste: von Rainey Teague, der auf dem Heimweg von der Schule verschwunden war, von Moochies Pfandleihe, der Überwachungskamera und davon, dass der Junge sich einfach in Luft aufgelöst hatte. Walker hörte zu und spürte, dass es ihm die Kehle zuschnürte.
»Der Junge heißt Teague? Doch nicht etwa Sylvias Sohn?«
»Doch, Dad.«
»O Gott. Wie furchtbar. Wie geht es ihr?«
»Sehr schlecht. Sie verliert den Boden unter den Füßen.«
»Und Miles?«
»Du kennst doch Miles. Er ist ein typischer Teague, und die haben alle diesen kalten Kern. Aber auch er wird mit jedem Tag stiller. Die beiden haben die Hoffnung aufgegeben.«
»Und wer ist an dem Fall dran?«
»Praktisch alle. Die Polizei von Belfair und Cullen County, die State Police und die Leute vom FBI in Cap City.«
»Und gibt es irgendwelche Hinweise?«
»Nichts. Absolut nichts.«
Schweigen.
Dann sagte er mit gezwungener Ruhe: »Ist irgendetwas … Anomales passiert?«
»Anomal? Wie meinst du das?«
»Ich weiß es nicht. Du fragst mich, weil ich eine Zeitlang darüber nachgeforscht habe, aber im Grunde weiß ich heute nicht mehr als damals. Darum habe ich ja damit aufgehört. Weil es sinnlos war.«
»Du hast damit aufgehört, als Mom gestorben ist, Dad.«
Wieder schwieg er.
Sie wartete.
Sie war ihm zu nahe getreten, das wusste sie, aber sie wusste auch, dass sie sein Liebling war und immer eine besondere Verbindung zu ihm gehabt hatte.
»Mit anomal meine ich alles, was schwer zu erklären ist.«
»Abgesehen von der Tatsache, dass Rainey sich vor der Linse einer Überwachungskamera in Luft aufgelöst hat?«
»Vor Moochies Pfandleihe, stimmt’s?«
»Ja.«
»Du sagst, er hat vor dem Schaufenster gestanden und hineingesehen?«
»Ja.«
»Was hat er da gesehen?«
»Einen Spiegel.«
Ihr Vater schwieg, doch sie spürte seine Anspannung – es war wie ein Summen in der Leitung. »Was für einen Spiegel?«
»Einen alten. Moochie sagt, er ist von vor dem Bürgerkrieg. Er stammt aus Temple Hill. Delia Cotton hat ihn ihrer Haushaltshilfe geschenkt.«
»Die Teagues und die Cottons«, sagte er mit tonloser Stimme.
»Ja, zwei der Gründerfamilien.«
Wieder schwieg er.
Schließlich sagte er: »Könntest du mir den Spiegel beschreiben?«
»Goldener Barockrahmen, altes Glas, die Silberschicht ist an einigen Stellen abgeblättert. Vielleicht aus dem 17. Jahrhundert. Aus Irland oder Frankreich. Ungefähr siebzig mal siebzig Zentimeter. Schwer. Auf der Rückseite klebt eine alte Visitenkarte.«
»Was steht darauf?«
»In sehr schöner Schrift und mit türkiser Tinte geschrieben: ›In langem Eingedenken – Glynis R.‹«
Abermals angespanntes Schweigen. Kate konnte ihn langsam und beherrscht atmen hören. So, als versuchte er, sich zu beruhigen. Alle freundliche Wärme war aus seiner Stimme verschwunden.
»Wo ist er jetzt? Der Spiegel, meine ich. Noch immer bei Moochie?«
»Nein, er ist hier. Oben, in unserem Schlafzimmer, im Schrank. Warum?«
Walker gab so lange keine Antwort, dass Kate glaubte, er sei vielleicht eingeschlafen.
»Dad? Bist du noch da?«
»Ja. Entschuldige. Ich habe nachgedacht.«
Das klang wie … nein, nicht wie eine Lüge. Er würde sie nie belügen. Es klang wie eine Ausflucht.
»Wirst du aus alldem schlau, Dad? Gab es Verbindungen zwischen den alten Familien? Nick hat versucht rauszukriegen, wer diese Glynis war, aber Delia sagte, sie hätte keine Ahnung. Sagt der Name dir irgendetwas?«
»Nein. Nein, er sagt mir gar nichts.«
Wieder dieses Gefühl, als würde er auf vorsichtige Distanz gehen.
Als würde er Ausflüchte machen.
»Was sollen wir tun, Dad? Ich möchte Nick gern helfen. Und Sylvias Familie auch. Rainey war … ist ein so netter Junge. Ich weiß, dass es schon spät ist, Dad. Ich weiß, dass du eigentlich schlafen willst. Mir geht es nicht anders. Aber hast du irgendeine Idee?«
Sie wartete.
»Benutzt ihr den Spiegel?«
»Nein, natürlich nicht. Er ist ja eine Art Beweisstück.«
»Ihr solltet ihn Delia zurückgeben. Oder ihrer Haushaltshilfe. So bald wie möglich. Er ist bestimmt sehr wertvoll.«
»Im Augenblick ist er, wie gesagt, ein Beweisstück. Das sagt Nick jedenfalls. Hast du sonst noch einen Vorschlag?«
»Ihr dürft ihn auf keinen Fall benutzen.«
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Ich auch nicht.«
Sie versuchte, einen Scherz zu machen.
»Ist er vielleicht verhext?«, sagte sie und lächelte. »Ich meine, wenn wir ihn zerbrechen, haben wir dann sieben Jahre Pech?«
»Vielleicht solltet ihr genau das tun.«
»Was tun?«
»Ihn zerbrechen. In tausend Stücke. Und die Scherben in den Crater Sink werfen.«
»Du machst Witze.«
Kurzes Schweigen.
»Ja. Ich mache Witze. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich muss jetzt ins Bett, und du ebenfalls. Ruf mich doch morgen Vormittag noch mal an, so gegen elf. Dann können wir ausführlich reden.«
»Mache ich, Dad. Ich hab dich lieb.«
»Ich dich auch, Kate. Ich hab dich sehr lieb.«
Kate kam nicht dazu, Dillon Walker am nächsten Vormittag um elf Uhr anzurufen, und zwar hauptsächlich wegen der hektischen Aktivitäten nach einem Anruf am frühen Morgen. Es war Tig Sutter, der Nick mitteilte, Sylvia Teagues roter Porsche Cayenne sei drei Stunden zuvor von einer Streife bei der Routinekontrolle eines Parkplatzes in der Nähe von Crater Sink entdeckt worden. Ihre Ballerinas habe man am Rand des Sink gefunden.
Trotz des von Marty Coors, dem Chef der State Police in Cap City, angeordneten Einsatzes eines Tauchroboters blieb Sylvia Teague spurlos verschwunden.
Der Roboter tauchte tiefer und tiefer hinab, die Scheinwerfer leuchteten nur wenige Meter durch das kalte schwarze Wasser und mussten sich dann der trüben Dunkelheit geschlagen geben. Das Steuerkabel war dreihundertfünfzig Meter lang.
Das Sonarsystem zeigte nichts als Felswände und vielleicht einen Seitenstollen, der in einer Tiefe von dreihundertdreißig Metern abzweigte und wahrscheinlich eine Verbindung zum Tulip herstellte.
Wenn Sylvia Teague tatsächlich im Crater Sink ertrunken war – bislang hatte man keinen Abschiedsbrief gefunden, und Selbstmord war nur eine von mehreren Möglichkeiten –, würde man warten müssen, bis sie aufgrund des natürlichen Laufs der Dinge wieder an die Oberfläche kam.
Vielleicht hatte irgendeine Strömung sie in den Stollen gezogen. In diesem Fall würde eines Tages vielleicht das, was von ihr übrig war, im Fluss auftauchen.
Die Suche im Crater Sink beanspruchte den größten Teil des Tages. Nick war die ganze Zeit dabei, abgezehrt und vollgepumpt mit Amphetaminen. Er blieb bis etwa sechs Uhr abends dort. An diesem Abend, dem Abend des zehnten Tages, bekam er einen Anruf von Mavis Crossfire, die ihm sagte, man habe Rainey Teague gefunden.
Als Nick am Friedhof für die konföderierten Soldaten bei Garrison Hills eintraf, ging gerade die Sonne unter. Polizeiwagen waren an einem kleinen Erdhaufen neben einem der gewundenen Wege geparkt, die sich den Abhang hinaufschlängelten, vorbei an Hunderten weißer Steinkreuze und ein paar Davidsternen, und zum sogenannten New Hill führten, jenem Teil des Bürgerkriegsfriedhofs, der für die prominenteren Zivilisten in der Geschichte Nicevilles reserviert war.
Dort standen etwa fünfzig kleine Tempel im klassizistischen Stil. Die meisten waren Familiengrüfte, und in die Türstürze waren Namen wie HAGGARD und TEAGUE, COTTON und WALKER, GWINNETT und MULLRYNE, MERCER und RUELLE eingemeißelt.
Jede Gruft war aus Marmorblöcken erbaut und mit einer soliden Eichentür verschlossen, die zusätzlich mit einem Eisengitter gesichert war. Der Boden war hier sehr steinig, und so bestanden einige der unauffälligeren Grüfte aus tief in die Erde eingelassenen Kammern, die mit roten Ziegeln ausgekleidet und mit einer Marmor- oder Granitplatte abgedeckt waren. Ringsum hatte man Erde zu einem flachen Hügel aufgeworfen. Eine solche Gruft war nur durch eine niedrige Öffnung am einen Ende zugänglich, durch die man einen Sarg hineinbringen konnte, doch diese war selbstverständlich mit einem Gitter versehen und stets verschlossen.
Die anderen Polizisten standen um einen dieser Hügel herum und sahen zwei Feuerwehrmännern zu, die die Deckplatte der Gruft mit Vorschlaghämmern bearbeiteten. Nick hörte die dumpfen Schläge und sah im Licht der Autoscheinwerfer und Arbeitslampen, die man aufgestellt hatte, Staub aufstieben.
Alle drehten sich um, als Nick seinen Crown Vic am Fuß des Hangs abstellte und langsam hinaufging. Mavis Crossfire löste sich aus der Gruppe. Nick sah auch die hochgewachsene Gestalt und den Marine-Corps-Haarschnitt von Marty Coors, der die anderen überragte und Nick mit finsterem, hartem Gesicht entgegensah.
»Nick«, sagte Mavis, ging ihm entgegen und gab ihm die Hand. »Er ist hier.«
Nick sah an ihr vorbei zu dem flachen Hügel und den Männern, die mit Hämmern auf Ziegel und Marmor einschlugen.
»Er ist da drin? Woher wollt ihr das wissen? Die Gruft da ist seit über hundert Jahren nicht mehr geöffnet worden. Wie alle anderen übrigens. Die Schlösser sind verrostet. Die Gitter stecken halb in der Erde, und alles ist überwuchert.«
»Ja, das stimmt. Das stimmt vollkommen. Nick? Alles in Ordnung?«
Nick sah sie an.
»Nein, verdammt, es ist nicht alles in Ordnung. Bei dir vielleicht?«
Mavis bedachte ihn mit einem Lächeln, das sich in eine Grimasse verwandelte.
»Nein. Bei mir auch nicht. Bei uns allen nicht. Woher wir wissen, dass er da drin ist? Wir können ihn hören.«
Nick sah sie lange an.
Mavis nickte. Ihr Gesicht war ausdruckslos, doch sie war bleich, und in ihren Augen war etwas Gehetztes.
»Ja, du hast richtig gehört. Ich wollte es dir am Telefon nicht sagen, damit du nicht unterwegs hierher einen Unfall baust. Der Friedhofsgärtner hat heute Nachmittag was gehört. Es klang wie ein Vogel, aber dann doch wieder nicht. Er ist dem Geräusch bis zu dieser Gruft hier nachgegangen.«
»Wer liegt da?«
»Ein Typ namens Ethan Ruelle. 1921 gestorben. Bei einem Duell am Weihnachtstag – das ist jedenfalls das, was der Friedhofsgärtner sagt. Einer von der Feuerwehr hat einen Geräuschsensor. Den setzen sie bei eingestürzten Gebäuden ein. Er hat das Ding auf die Deckplatte gelegt, und wir alle konnten es genau hören.«
»Was hören?«
»Ein Kind. Ein weinendes Kind.«
Nick sah sie an, dann an ihr vorbei zu den arbeitenden Männern, den herumstehenden Polizisten, dem Krankenwagen im Hintergrund, dessen Signallichter rot und blau leuchteten und ein hektisches Flackern über den Friedhof warfen.
»Das ist ein Trick«, sagte er schließlich und spürte Wut in sich aufsteigen. »Diese ganze Sache war nichts als ein Scheißtrick. Jemand verarscht uns, Mavis. Das Ganze ist bloß ein verdammter Taschenspielertrick.«
»Wenn es ein Trick ist, dann ist es ein verdammt guter«, sagte Mavis in beruhigendem Ton. »Der Feuerwehrmann hat auf die Deckplatte geklopft, und das Weinen ist schlimmer geworden. Irgendwas ist das drinnen. Und wir glauben – oder vielleicht sollte ich sagen: wir hoffen –, dass es Rainey ist.«
Sie hörten ein gedämpftes Rumpeln, ein dumpfes Poltern, und dann redeten alle gleichzeitig, laut und schnell.
Nick und Mavis eilten hinzu, als Marty Coors vortrat und mit der Taschenlampe in das Loch leuchtete, das die Feuerwehrmänner gemacht hatten. Das verängstigte Gesicht eines Jungen sah zu ihnen auf, große braune Augen, blondes Haar, Tränenspuren auf den schmutzigen Wangen, der Mund groß und weit aufgerissen, als der Junge tief Luft holte für den Schrei, den er im nächsten Augenblick ausstieß. Er gellte über die Gräber, und aus einem Lindenhain stob ein Schwarm Krähen auf.
Es war Rainey Teague, und er lebte.
Als sie ihn herauszogen, trug er noch seine Schuluniform. Sie stellten fest, dass er in einer langen Holzkiste gelegen hatte, in einem Sarg, und dass der Sarg nicht leer war.
Rainey Teague hatte in den dürren, mumifizierten Armen eines Leichnams gelegen, vermutlich dem von Ethan Ruelle. Man hatte keine Ahnung, wie dies vor sich gegangen war. Wie, von wem und warum war die Gruft geöffnet worden, ohne dass irgendwelche Spuren geblieben waren? Aber Rainey Teague lebte. Man brachte ihn auf die Intensivstation des Lady Grace Hospital, wo er im Verlauf der nächsten fünf Stunden in ein Koma fiel.
Auch drei Tage später lag er noch im Koma, als sein Vater Miles ihn zum wiederholten Male besuchte. Er war eingerahmt von den üblichen medizinischen Apparaten, von Tropfinfusionen, Kabeln, Kathetern und piependen Monitoren.
Die Ärzte sagten Miles, einem untersetzten, irischstämmigen Mann Anfang fünfzig, mit dessen gutaussehendem Gesicht es rapide bergab ging, dieser Zustand sei nach einem sehr heftigen seelischen Trauma nichts Ungewöhnliches. Dann zogen sie sich zurück und ließen ihn mit seinem Sohn allein.
Miles Teague blieb zwei Stunden. Er betrachtete seinen Sohn und sah ihn ein- und ausatmen. Schließlich beugte er sich hinunter und küsste ihn auf die Stirn. Dann erhob er sich, ging zum Parkplatz, setzte sich in seinen großen schwarzen Mercedes und fuhr nach Hause, wo man ihn am nächsten Morgen fand. Er lag, in den Kleidern, die er am Tag zuvor getragen hatte, in dem marmornen Pavillon am Ende des Gartens, neben sich seine handgemachte Purdy-Flinte, und hatte sich den Kopf von den Schultern geschossen.
EIN JAHR SPÄTER
FREITAGNACHMITTAG
Cokers Nachmittag erfordert eine gewisse Konzentration
Das Funkgerät in Cokers Tasche summte wie ein Käfer in einer Flasche. Coker war tief in sich selbst versunken und versuchte, vor seinem inneren Auge zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln würden. Früher war ihm dieser alte Zen-Trick leichter gefallen, aber das war lange her. Er spähte durch das hohe gelbe Gras auf die zweispurige Straße, die sich durch das langgestreckte grüne Tal auf ihn zuwand. Das schwere Gewehr in seinen Händen fühlte sich so fest und warm an wie der Hals eines Pferdes.
Das Funkgerät summte abermals.
Coker zog es hervor und drückte die Sprechtaste.
»Ja?«
»Wir sind bei Kilometer 47.«
Danzigers Stimme war flach und ruhig, aber angespannt. Coker hörte die Sirenen im Hintergrund, das Zischen des Fahrtwinds, das Rumpeln der Räder auf dem unebenen Asphalt.
»Wie läuft’s?«
Coker hörte einen kurzen, knappen Wortwechsel zwischen Danziger und Merle Zane, dem Fahrer. Beide klangen ein bisschen aufgeregt, aber das war ja nur natürlich.
»Bis jetzt sind’s nur vier«, sagte Danziger. »Sie sind hinter uns, halten aber Abstand. Außerdem ist ein Hubschrauber vom Fernsehen dabei, aber keiner von den Bullen, soweit wir das erkennen können. Wie sieht’s weiter vorn aus?«
Coker sah auf den kleinen tragbaren Fernseher, der neben ihm auf dem Boden stand. Auf dem winzigen Plasmabildschirm konnte er ein stumpfschwarzes, wie ein Geschoss geformtes Fahrzeug erkennen. Seine Frontpartie ähnelte einer geschlossenen Faust. Das war Merle Zanes Chrysler Magnum, der auf dem schwarzen Band einer Landstraße über einen Flickenteppich aus Wiesen und Feldern dahinjagte, dicht gefolgt von vier Wagen der State Police: zwei anthrazitgrau und schwarz lackierten Crown Vics, einem weiteren schwarz-braunen Crown Vic eines Deputy Sheriffs und einen dunkelblauen Wagen ohne Aufschrift, einem rasenden Ziegelstein mit mächtigen Reifen und einem schwarzen Frontschutzbügel.
Die Bilder kamen aus dem Hubschrauber eines örtlichen Fernsehsenders, der ebenfalls dabei war. Coker sah die Signalleiste auf den Streifenwagen rot und blau blinken.
Er drehte am Lautstärkeregler und hörte den atemlosen Bericht einer jungen Reporterin, die die Verfolgungsjagd beschrieb. Die Wagen wurden kleiner, als der Hubschrauber an Höhe gewann, um eine Hochspannungsleitung zu überfliegen. Für einen Augenblick sah man das bläuliche, wellige Land und die niedrigen braunen Hügel in der Ferne.
In diesen niedrigen braunen Hügeln wartete Coker.
Er hob das Funkgerät auf und drückte die Ruftaste.
»So weit keine Sperren, die Straße ist frei. Bestätige: Ihr habt vier Wagen im Nacken. Zwei von der State, einer ist ein Deputy. Der blaue Dodge Charger ist einer von ihren Straßenfegern. 6,1-Liter-Motor, interner Überrollbügel, Kuhfänger. Im Augenblick hält er sich noch im Hintergrund, aber bei der ersten Gelegenheit habt ihr ihn am Arsch. Er wird versuchen, euch mit diesem Kuhfänger rechts oder links hinten zu erwischen, damit ihr ins Schleudern kommt. Lasst ihn nicht zu nah herankommen.«
»Werden wir nicht«, sagte Danziger. »Vorn also alles frei?«
Danzigers Stimme klang noch immer flach, man spürte die Anspannung darin. Coker hörte den Polizeifunk ab, das Hin und Her zwischen der Zentrale und den Verfolgern.
»Sie haben Verstärkung aus den Sektoren 4 und 9 angefordert, aber bis jetzt sind nur zwei Wagen frei, und die sind dreißig Kilometer entfernt, auf der anderen Seite der Belfair-Hügel. Die Bullen sind über das ganze County verteilt, aber die meisten sind auf der Schnellstraße und regeln den Verkehr an der Unfallstelle. Da ist auch ihr Hubschrauber.«
»Okay«, sagte Danziger. »Gut.«
Coker hörte einen dumpfen Knall, das Klirren von Glas und dann Merle Zane, der leise fluchte.
»Verdammte Scheiße, die schießen auf uns.«
Coker sah auf den Bildschirm und hörte die aufgeregten Worte, die die Reporterin hervorsprudelte. Am unteren Rand des Bildschirms war ein Schriftband: LIVE! VERFOLGUNGSJAGD AUF ROUTE 311 IN RICHTUNG SÜDEN! LIVE! Der Name der Reporterin stand dort nicht. Wer immer sie war – Coker hatte den Eindruck, dass sie mit Begeisterung dabei war.
Gut für dich.
Genieß es, solange du kannst, Kleines.
»Wie gesagt: Ihr lasst sie zu nah rankommen.«
Coker hörte das Knallen einer Pistole, eine Reihe bellender Schüsse, und dann wieder Zanes Stimme.
»Danziger schießt zurück.«
»Sag ihm, er soll das lassen, Merle. Zurückschießen motiviert sie nur noch mehr. Das sollte er eigentlich wissen. Sag ihm, er soll den Kopf einziehen, sonst blasen sie ihm den weg.«
Er hörte, wie Merle Danziger anblaffte und der genervt antwortete, aber das Schießen hörte auf. Dann meldete Merle sich abermals.
»Kilometer 46. Wir sind noch zwei Kilometer entfernt.«
»Ich bin hier«, sagte Coker und ließ die Sprechtaste los.
Er stellte den Fernseher leiser und schaltete den Polizeifunk aus. Was die State-Bullen gerade taten, spielte eigentlich keine Rolle.
Was immer es war – jetzt war es zu spät.
Der Fernseh-Hubschrauber.
Das war ein Problem.
Er sah auf den Bildschirm und versuchte, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie hoch er flog, in welchem Winkel zur Straße er sich bewegte und um welchen Typ es sich handelte. Die meisten Fernseh- und Polizei-Hubschrauber in diesem Bundesstaat waren Eurocopter 350. Nach dem Motor- und Rotorengeräusch zu urteilen war auch dies einer. Ein hübsches, schnelles Ding.
Aber leicht und verletzlich.
Ein fliegendes Ei.
Er lehnte sich im Sitzen an einen Baum, legte das Gewehr auf dem Schoß ab, atmete langsam ein und öffnete sich für das, was rings um ihn her vorging.
In einer Gruppe von Pappeln auf der anderen Straßenseite stritten sich zwei Krähenschwärme. Der Wind aus dem Tal bewegte das Gras und ließ die Ähren nicken und die dürren Halme wispern und rascheln. Die Nachmittagssonne auf seiner linken Wange war warm wie Blut. Er sah auf. Der Himmel war blau und wolkenlos. Weiter unten wühlte ein Opossum in der roten Erde – sein Schwanz überragte wie ein gebogener Stock das blassgelbe Gras. Über ihm kreisten träge drei Bussarde mit weit ausgebreiteten reglosen Flügeln und ließen sich von den Aufwinden tragen, die vom Tiefland aufstiegen. Es roch nach Mariengras, Klee, warmer Erde, heißem Asphalt. Der Geruch erinnerte ihn an Billings und die Senken voller Mariengras im Bighorn Valley. Aus der Ferne hörte er, leise noch, aber sich nähernd, das Jaulen der Sirenen.
Er blickte auf den Bildschirm und sah die Wagen, die Merles schwarzem Magnum folgten. Der dunkelblaue Dodge Charger überholte und schob sich näher an Merle heran, als die Straße bergauf in die Belfair-Hügel führte.
Die Krähen verstummten, wie um besser lauschen zu können, und stoben dann in einer wirbelnden schwarzen Wolke auf. Das bernsteinfarbene Licht der Sonne schimmerte auf ihren Flügeln.
Er hörte das Trommeln des tief fliegenden Hubschraubers, der noch hinter den Baumwipfeln verborgen war, und dann, untermalt vom Sirenengewimmer, das Quietschen der Reifen, als Merle den Magnum durch die fünfhundert Meter entfernte scharfe Kurve jagte.
Die Sirenen klangen jetzt schriller, wilde Echos hallten von den Bergen wider und vermischten sich mit dem Jaulen der Motoren.
Coker setzte die Ohrenschützer auf, hob das Gewehr, atmete langsam aus und kniete sich hin. Er stellte das Zweibein des Gewehrs auf einen Baumstumpf und richtete den Lauf aus, bis die Mündungsbremse auf die Baumwipfel zeigte.
Es war ein halbautomatisches Gewehr. Im Kastenmagazin steckten fünf Patronen, drei weitere volle Magazine waren in dem Segeltuchbeutel, der neben ihm auf dem Boden lag. Sollte er die brauchen, würde er bei Sonnenuntergang tot sein.
Erst als das leuchtend rote Ei des Hubschraubers über den Bäumen auftauchte, beugte er sich vor und brachte das Gewehr in Anschlag. Er spähte durch das Leupold-Zielfernrohr und presste den Schaft fest an die Schulter, um den heftigen Rückstoß aufzufangen.
Er legte den Finger an den geriffelten Abzug und bewegte ihn, bis er einen leichten Widerstand spürte. Dann hielt er inne.
Der Hubschrauber flog niedrig, knapp oberhalb der Wipfel. Er folgte der Krümmung der Hügelflanke, ein eifriger Jäger, der flach dahinglitt, damit die Reporterin schöne, ruckfreie Aufnahmen bekam. Coker konnte in der verglasten Kanzel zwei blasse Gestalten erkennen. Die Reporterin saß vermutlich links, auf dem Platz des Copiloten, hielt die Kamera und sagte ihren Text.
Der Pilot saß rechts und bediente Lenkung und Pedale. Er konzentrierte sich ganz auf die Situation und dachte an Stromleitungen, Baumwipfel, selbstmörderische Gänse und den übrigen Luftverkehr, der in diesem Gebiet unterwegs sein mochte.
Hätte er in Cokers Richtung geblickt, dann hätte er bloß ein Stück khakifarbenen Stoff auf einer verdorrten Wiese gesehen, vielleicht auch noch das lange schwarze Rohr, das unter dem Stoff hervorsah.
Coker nahm ihn ins Visier, atmete ein, atmete halb aus und hielt den Atem an. Er war vollkommen reglos.
Dann drückte er ab.
Die Barrett bockte und schlug gegen seine rechte Schulter, die Verbrennungsgase der Patronenladung schossen rechts und links aus der Mündungsbremse. Das Bild des Hubschraubers im Visier verschwamm für einen Augenblick in einem Hitzeflirren, doch Coker konnte erkennen, dass das .50er-Projektil den Piloten mitten in die Brust getroffen hatte.
Er explodierte förmlich. Die hydrostatische Schockwelle lief mit Schallgeschwindigkeit durch seinen Körper – es war, als wäre ein Asteroid in einen See eingeschlagen.
Coker hatte solche Volltreffer oft gesehen. Wenn man dann vor dem Fahrzeug stand, hing der Kopf des Fahrers nur noch an ein paar Sehnen, die Augäpfel waren herausgesprengt worden, aus Mund und Ohren quoll dunkles Blut, und vom Oberkörper war außer rosaroten Wirbeln und klaffenden Rippen nichts mehr übrig.
Es geht doch nichts über Feuerkraft, dachte er.
Da es jetzt keinen mehr gab, der die Blattstellung und den Heckrotor steuerte, kam der Hubschrauber ins Straucheln, kippte und rollte unter wildem Schütteln seitlich weg.
Auf dem Bildschirm verfolgte Coker, wie Himmel und Erde die Plätze tauschten. Das Bild verschwamm in einem Wirbeln, als die Bäume der Kamera entgegensprangen.
Durch die Ohrenschützer stark gedämpft hörte er den gellenden Schrei blanken Entsetzens, dünn wie Silberdraht, der aus den Fernsehlautsprechern drang. Die Reporterin fasste ihre letzte Superstory zusammen, einen Augenzeugenbericht von einem tödlichen Hubschrauberabsturz.
Live!
Der Gedanke ließ ihn lächeln und brachte ein gelbliches Funkeln in seine hellbraunen Augen. Sein harter Mund wurde noch härter.
Coker spürte den Boden erbeben, als der Hubschrauber jenseits der Bäume aufschlug. Aus dem rechten Augenwinkel sah er orangerote Flammen auflodern, doch da hatte er seine Position bereits verändert und die zweispurige Straße ins Visier genommen. Gerade bog Merles Magnum um die Kurve.
Er hatte eine Stelle gewählt, wo er die gesamte S-Kurve übersehen konnte und die Wagen direkt auf ihn zuhielten. Er hatte ausreichend Zeit zum Zielen und die ganze Kolonne im Schussfeld.
Wenn dies ein Marine-Hinterhalt gewesen wäre, hätte man auf einer Seite der Straße fünf Schützen postiert, davor ein paar Claymoreminen mit Fernzündung: siebenhundert Stahlkugeln mit gewölbter Ladung aus C4-Plastiksprengstoff und den schönen, unbedingt zu beherzigenden Worten STIRNSEITE ZUM FEIND. Ein Druck aufs Knöpfchen, und sie würden mit einem gewaltigen Donnern und einem Hagel aus Metall explodieren und die armen Schweine in der Feuerzone in Stücke reißen. Dann eine Minute Beschuss aus sämtlichen automatischen Waffen und zum Schluss noch ein paar Mörsergranaten, sofern man gerade welche zur Hand hatte.
Aber jetzt waren hier nur Coker und seine Barrett. Er saß am oberen Ende der S-Kurve und sah sie kommen, sah Merles schmales bleiches Gesicht hinter dem Steuer und Danzigers schmutzig blondes Haar.
Alles verlangsamte sich.
Links von Merles schwarzem Wagen war ein Stück des dunkelblauen Charger zu sehen.
Nur ein Stück.
Aber genug.
Den zweiten Schuss aus dem Fünfer-Magazin setzte er in den Kühler des Charger. Der überhitzte Motorblock explodierte, heißer Stahl durchschlug das Blech zwischen Motorraum und Fahrgastzelle und flog in Gesicht, Brust und Bauch des Fahrers. Der Wagen schoss nach rechts.
Er raste in die Bäume, Blut spritzte auf den Airbag und die Innenseite der Windschutzscheibe.
Der Charger stand still und begann zu dampfen.
Coker hatte jetzt freies Schussfeld auf den zweiten Wagen, den braun-schwarzen Wagen des Deputy Sheriffs, in dem nur der Fahrer saß. Coker sah, wie er den Kopf wendete, als er an dem Wrack des Charger vorbeifuhr, wie er entsetzt den Mund öffnete. Er erkannte ihn: Es war ein ernsthafter junger Cullen-County-Bulle namens Billy Goodhew.
In diesem Augenblick rasten Merle Zane und Charlie Danziger an Coker vorbei. Die Hupe jaulte, und Danziger starrte durch das Beifahrerfenster.
Coker wandte nicht den Kopf, er registrierte sie kaum. Man hätte neben ihm eine 9 Millimeter abfeuern können, und er hätte nicht gezuckt.
Sein dritter Schuss zerlegte Billy Goodhews Kopf und Oberkörper und verteilte die Fragmente über das Gitter hinter ihm. Anschließend durchschlug das Projektil die Heckscheibe, so dass in einem jener verrückten Zufälle, wie sie sich in Feuergefechten ereignen, ein im hellen Sonnenlicht leuchtender Regen aus Blut und Gehirnmasse auf der Windschutzscheibe des Wagens hinter ihm niederging.
Beide State-Police-Wagen bremsten abrupt und mit qualmenden Reifen. Die Frontpartien gingen in die Knie, die Wagen zogen nach links und rechts und kamen quer zur Straße und mit einander überlappenden Heckpartien zum Stehen.
Cokers vierter Schuss ging in die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite des linken Wagens. Die Fragmente schlugen von innen Pickel ins Dach, die zersplitterte Windschutzscheibe überzog sich mit dunklem Blut. Da die Beifahrertür geschlossen blieb, nahm Coker an, dass der Fahrer allein gewesen war.
Armes Schwein.
Infolge der Rezession mussten die meisten State- und County-Bullen auch nachts allein auf Streife fahren. Es war eine Schande. Diese verdammten Erbsenzähler in Cap City. Aber die mussten ja nicht um zwei Uhr morgens allein auf einer gottverlassenen Landstraße eine Alkoholkontrolle vornehmen und einen überladenen schwarzen Escalade mit getönten Scheiben anhalten, in dem Gott weiß was sein konnte.
Coker wandte seine Aufmerksamkeit dem anderen Wagen zu, aus dem ein Polizist stürzte, in der Linken eine Schrotflinte, in der Rechten das Funkgerät. Sein Stetson war verrutscht, und auf dem runden weißen Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen war ein Ausdruck blanken Entsetzens.
Er fuhr herum und rannte gebückt zur abgewandten Seite der Wagen, um so viel Metall wie möglich zwischen sich und den zu bringen, der da auf ihn schoss.
Coker wartete, bis er Deckung gefunden hatte, und um zu sehen, wo der Rumpf war, ließ er ihn sogar einen Schuss abfeuern. Das fünfte Projektil ging quer durch den Wagen und riss den Oberkörper des Polizisten in Stücke.
Die Schrotflinte schlug klappernd auf dem Asphalt auf.
Ruhe kehrte ein.
Die Stille verdichtete sich. Coker spürte sein Herz an die Rippen schlagen. Dann stand er auf, schüttelte den Kopf, um das Klingen in den Ohren loszuwerden, und sah sich um, als erblickte er diesen Ort zum ersten Mal.
Die Stille war entnervend, und obwohl er Ohrenschützer getragen hatte, hörte er alles nur undeutlich und gedämpft. Seine rechte Schulter schmerzte vom Rückstoß der Barrett.
Jenseits der Straße war ein kleiner Waldbrand ausgebrochen – eine weiße Rauchsäule stieg in den Himmel.
Der Rauch der brennenden Pappeln roch gut, er war würzig und scharf. Erinnerte ihn an Weihnachten, damals in Billings. Schöne Zeiten. Coker atmete ihn ein paarmal ein und fühlte, wie die Welt langsam wieder in den Normalzustand zurückkehrte.
Er schaltete den Polizeifunk ein und hörte eine Weile zu. Was er hörte, war Panik. Niemand wusste, was zum Teufel passiert war, aber jeder brüllte allen anderen zu, was jetzt zu tun sei.
Er nahm an, dass er genug Zeit hatte, die Spuren zu verwischen.
Er wechselte das Magazin, lud durch, legte den Sicherheitsbügel um und hängte sich das zwölf Kilo schwere Gewehr am Trageriemen so um, dass er es, wenn es sein musste, jederzeit in Anschlag bringen konnte.
Dann zog er einen Colt Python hervor, ging auf der Straße zu den Streifenwagen und feuerte in jeden intakten Schädel, den er fand, eine .357er Weichkernkugel, lud nach und erledigte den Rest von dem, was zu erledigen war.
Unter einigen Schwierigkeiten – wegen der Latexhandschuhe und den Blutspritzern und Gewebestücken, die auf allen Oberflächen der Innenräume klebten – entfernte er die Festplatten der Überwachungskameras. Dann trat er rückwärts von den Wagen zurück, um zu sehen, ob seine Stiefel Blutspuren hinterließen.
Er ging zurück zu seinem ursprünglichen Standort, sammelte die fünf Patronenhülsen auf, verwischte die Fußspuren und sah sich noch einmal prüfend um, bevor er über die Hügelkuppe zu seinem Wagen ging, einem großen, schwarz-braunen Crown Vic mit der Aufschrift des County-Sheriffs.
Er öffnete den Kofferraum, zerlegte die Barrett, zog das heiße Rohr aus dem Verschluss und wischte alles mit einem silikongetränkten Tuch ab. Dann legte er die Teile in die Aussparungen des Koffers.
Er zog den blutverschmierten Overall aus, stopfte ihn in eine braune Papiertüte, schloss den Kofferraum und überprüfte im Außenspiegel die Uniform: Alles in allem sah er ziemlich gut aus. Dann setzte er sich ans Steuer und fuhr langsam davon. Im Rückspiegel erblickte er die dünne Rauchfahne, die sich über den Himmel zog. Jetzt, da die Aufregung vorüber war, kehrten die Krähen zurück – die hungrigeren ließen sich auf den Dächern der Streifenwagen nieder, unwiderstehlich angezogen vom Anblick frischen Blutes.
Die Sonne ging unter und warf lange blaue Schatten über den Asphalt. Als er durch ein Pappelwäldchen fuhr, flackerte honiggelbes Licht stroboskopartig auf der Seite seines Gesichts. Im Polizeifunk ging es noch immer hektisch hin und her, doch er hatte den Eindruck, dass irgendjemand in der Zentrale – wahrscheinlich Mickey Hancock – die Sache endlich in den Griff bekam. Bald würde man ihn rufen, ihn und alle anderen Bullen in der westlichen Hemisphäre.
Coker seufzte und betrachtete zufrieden die Welt, die an ihm vorbeizog. Er lächelte, setzte die Ray-Ban auf, zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Seine Schicht begann gerade erst, und es sah nach einer hektischen Nacht aus, doch die Wärme und der herrliche Sonnenuntergang trösteten ihn. Es versprach ein schöner Abend zu werden.
Tony Bocks Nachmittag ist enttäuschend
»Mögen alle Anwesenden sich erheben!« Und so erhoben sie sich, als Richter Theodore W. Monroe in den Gerichtssaal zurückkehrte. Seine schwarze Robe umwallte ihn wie die Schwingen des Schicksals. Das Gerichtsgebäude war ursprünglich eine katholische Kirche gewesen, und so gab es in diesem Saal noch immer zehn Buntglasfenster auf jeder Seite, weiß gestrichene alte Holzwände und eine Reihe von Ventilatoren unter dem Deckengewölbe aus Zedernholz, die – wenn auch weitgehend erfolglos – die feuchte Luft in Bewegung halten sollten, die nach all den Jahren noch immer leicht nach Weihrauch roch.
Richter Monroe, ein alter Kämpe des Justizwesens mit kleinen schwarzen Augen, einem schmalen Lächeln und einem Profil wie ein Küchenbeil, setzte sich, wo einst der Altar gewesen war und nun eine hohe, mit Schnitzereien verzierte Richterempore stand. Auf ihrer Front war das Ölgemälde eines Kavalleriegefechts im Bürgerkrieg – die Schlacht bei Brandy Station – und dahinter eine große, aber verblasste amerikanische Fahne. Es waren nur achtundvierzig Sterne darauf, aber da weder Alaska noch Hawaii sich schriftlich beschwert hatten, hing sie noch immer über Richter Monroes grauem, borstigem Kopf.





























