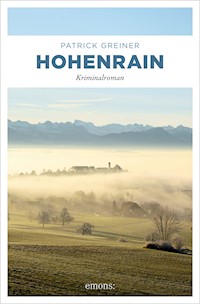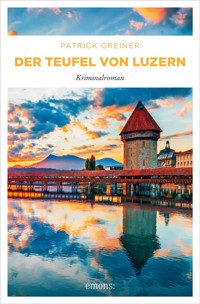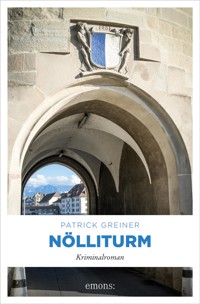
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein gesellschaftskritischer Krimi mit besonderem Thema: Als ein Stadtluzerner Baulöwe bei einem Unfall ums Leben kommt, wird der Fall schnell zu den Akten gelegt. Doch es gibt genug Personen, die eine Rechnung mit dem Opfer offen hatten. Zusammen mit Staatsanwältin Nora Schilling beginnt Polizeiermittler Thomas Kessler zu graben, wo andere die Grube lieber zulassen. Sie folgen einer Spur ins Luzerner Zunftwesen, als es einen weiteren Toten gibt – diesmal ein astreiner Mord. Eine atemlose Jagd beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Greiner, geboren 1979 in Luzern, ist studierter Jurist mit Anwalts- und Notariatspatent. Nach Jahren als Untersuchungsbeamter bei der Staatsanwaltschaft Luzern, in der Beratung sowie der Verwaltung arbeitet er heute als Compliance Officer bei einer Schweizer Bank. Nebenbei war er einige Zeit als Barpianist und Sänger tätig und tritt heute noch privat auf. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Zug.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung wie auch die darin vorkommenden Figuren sind frei erfunden. Gewisse Charaktere mögen da und dort bekannt oder vertraut erscheinen. Der Vergleich mit allfälligen Originalen ist jedoch entweder rein zufällig oder dann höchstens als Inspiration gedacht. Im Anhang befinden sich ein Glossar und ein Rezept.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: stock.adobe.com/tauav
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-162-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Dieses Buch ist all den Menschen gewidmet, deren Stimme in der Gesellschaft nicht so viel Gewicht hat, die aber ein Recht darauf haben, ebenfalls gehört zu werden.
Ebenso ist es meiner Frau Nicole und unserer gemeinsamen Tochter Noëlle gewidmet – danke für eure Engelsgeduld.
Es gibt zwei Sorten Ratten: Die hungrigen und satten.
Prolog
Das Brauchtum hat einen festen Platz in den Luzerner Schulzimmern. Natürlich gehört es sich auch, die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Luzern zu kennen. Dazu zählen die Namen der markanten Türme der Museggmauer, die jede Schülerin und jeder Schüler mindestens einmal im Leben besuchen darf und von denen ein jeder einzigartig ist und seine ganz bestimmte historische Aufgabe hatte. Diese Türme gehören zum Stadtbild wie die Kapellbrücke oder der Wasserturm; letzterer als einer in dieser Reihe, abgetrennt von der ursprünglichen Festungsanlage.
Leider gehen solche typischen Themen aus dem Schulunterricht gerne vergessen, und wenn man Erwachsene nach den Museggtürmen fragt, können sie, wenn es hochkommt, vielleicht noch gut die Hälfte namentlich nennen. Dabei muss man sich nur deren neun merken von ursprünglich dreißig. Und dennoch bereitet es selbst Stadtbewohnern oft Mühe, diese fehlerfrei aufzuzählen, wobei das folgende Sprüchlein manchmal helfen kann:
Nölli, Männli, Lueg is Land,
Be Wach mer Zyt,
Be Schirm mer s’Pulver
Ond em Allewende s’Dächli.
Dieses Sprüchlein steht für die neun Türme, die heißen: Nölliturm zu Beginn neben der Reuss, daneben Männliturm, Luegislandturm, Wachtturm, Zytturm, Schirmerturm, Pulverturm, Allenwindenturm und zum Abschluss der Dächliturm.
1
Turmwart des Nölliturms zu sein war für Paul Stadelmann nicht Beruf, sondern Berufung. Dieses für ihn ehrenvolle Amt übte er seit vielen Jahren mit unerschütterlichem Pflichtgefühl aus wie einst der treue Wächter, der dem Turm offenbar seinen Namen gab.
Stadelmannn verließ, das schüttere gräuliche Haupthaar mit einer Schiebermütze bedeckt, wie gewohnt seine Wohnung im Brambergquartier, nur ein paar Gehminuten vom Nölliturm entfernt.
Stadelmann war nicht einfach nur Turmwart, er war Mitglied der »Zunft der Waldstätter«, die dieser Turm beherbergte. Einmal im Monat hielt die ausschließlich Männern vorbehaltene Vereinigung, die größte und bekannteste Zunft der Stadt, in der sich alles tummelte, was in der Region Rang und Namen hatte, ihren Höck in diesem das Stadtbild prägenden Zeugnis einer Wehranlage ab. Dieser Turm war ihr Zunftlokal, das sie hegten, aber auch pflegten, denn Tradition verpflichtet, und dies seit beinahe hundertfünfzig Jahren, nachdem der Turm während mehreren Jahrhunderten das Schießpulver der Stadt beherbergt hatte und danach während kurzer Zeit als Waffen- und Petroleumslager galt, bis er für heitere Zwecke umgenutzt wurde.
Es war ein wunderbarer Mittwochmorgen im launischen April, acht Uhr dreißig, nachdem ihm seine Frau wie üblich das Frühstück zubereitet hatte, bestehend aus einem starken Kaffee, zwei Scheiben Roggenbrot, etwas Aprikosenkonfitüre, gesalzener Butter und der Tageszeitung, wovon er für gewöhnlich nur den Regionalteil las. Ihn interessierte nicht sonderlich, wie es in der Welt zu- und herging, solange der Himmel über dem Stadtluzerner Gebiet nicht verhangen war.
Der Zunfthöck war bereits zwei Tage her, doch nur das Gröbste gereinigt. Heute würden die Putzfrauen den Rest saubermachen. Maria und Lourdes würden bald eintreffen, weshalb er zeitig vor Ort sein wollte.
Unterwegs begegnete er Herrn Isler, der gerade mit seinem Cockerspaniel Hector Gassi ging.
»Guten Morgen, Herr Stadtrat.«
»Herrgott, Paul, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht so titulieren. Ich bin einfach der Heinz. Außerdem sind wir ja im selben Verein, wobei ich dort nicht immer ein so treuer Gast bin bei den Sitzungen«, sagte Isler und zeigte mit seiner Hand in Richtung Nölliturm, der mit seiner fülligen Größe wie ein Fels in der Brandung erschien.
»Verzeih, Heinz. Ich bin und bleibe der bescheidene Entlebucher Bueb, auch wenn wir in der sechsten Generation hier in der Stadt leben. Ich bin halt kein Studierter. Aber du hast Recht, du bist wirklich einer der am meisten Abwesenden. Ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal gesehen habe. Viel zu tun?«
»Ja, im Moment läuft einiges. Und wie du sicherlich in der Zeitung gelesen hast, nimmt diese Sache, ›Metropolis Lucerne‹, Fahrt auf. Ich kann jetzt noch nicht abschätzen, was dahintersteckt. Etwas stinkt da gewaltig. Mehr kann ich dir nicht sagen.«
»Jaja, Amtsgeheimnis, ich verstehe.« Stadelmann versiegelte symbolisch seine Lippen mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand.
»Und haben sich die Herrschaften wenigstens anständig aufgeführt vorletzte Nacht?«
»Ja, es ging, habe schon Schlimmeres erlebt. Weißt du noch vor zwei Jahren, im Herbst?«
»Du meine Güte, wie hätte ich das vergessen können. Vogel und Galliker, die sich geprügelt haben, nachdem herausgekommen war, dass der Galliker die Alte vom Vogel vögelt.«
Hector begann zu winseln, sah sein Herrchen in dessen brauner Wildlederjacke mit treuherzigem Blick an und wedelte mit dem Schwanz.
Isler schaute auf die Uhr. »Oha, ich sollte wohl weiter. Ich habe um neun Uhr dreißig einen Termin. Mach’s gut, Paul, und halt mir den Laden in Schuss.«
»Danke gleichfalls. Politik und Zunftwesen sind ja nicht immer grundverschieden.«
»Oh nein, au contraire, mon frère.«
Sie verabschiedeten sich und gingen ihres Weges. Ein feiner Kerl, dachte sich Stadelmann. Und dennoch hätten sie nicht aus unterschiedlicheren Schichten kommen können. Bei Isler gehörte es als Vertreter der alteingesessenen Luzerner Oberschicht zum guten Ton, einer Zunft anzugehören. Stadelmann war einfach dabei, vielleicht aus Goodwill, vielleicht weil er ein ehrlicher »Chrampfer« war. Jeder, der dabei sein wollte, brauchte zwei Paten, die ihm den Eintritt in diese selbst ernannte Elite gewährten. Es war eine lange Tradition, und Stadelmann betrachtete es als Pflicht, Traditionen zu wahren.
2
Stadelmann erreichte wenige Minuten später die schwere Eingangstüre des Nölliturms, die von der Brüggligasse zugänglich war, und wollte sie aufschließen. Das Schloss klemmte, was ihn ärgerte. Er hatte aber nicht lange Zeit, sich darüber zu wundern, denn als er die Türe öffnete, erschrak er, das Herz rutschte ihm fast in die Hose. Eine Ratte huschte zwischen seinen Beinen vorbei und suchte sich einen Weg in die Freiheit.
»Verdammtes Mistvieh! Ich muss wohl die Fallen wieder aufstellen«, grummelte er vor sich hin.
Er vergaß, das Licht einzuschalten, machte ein paar Schritte nach vorne und stolperte über einen weichen Gegenstand. Stadelmann fiel zu Boden und war noch benommener als bei der flüchtenden Ratte. Doch er fing sich sogleich, stand auf und machte das Licht an. Er traute seinen Augen nicht. Da lag eine männliche Person bäuchlings vor ihm. Der anscheinend leblose Körper – eine braune Cordhose lugte unter dem langen Kamelhaarmantel hervor – war von kräftiger Statur, circa ein Meter achtzig groß, älteren Jahrgangs.
Nach dem ersten Schock stupste er ihn an.
»Hallo, hallo?«, war das Einzige, was ihm über die Lippen kam.
Dann trat er etwas zur Seite nach rechts. Das Gesicht des Mannes war in diese Richtung gedreht, und jetzt konnte Stadelmann ihn erkennen.
»Maria, Muttergottes, das ist ja der Egli! Jesus, was soll ich tun?«
Er geriet in Panik, rannte zur Türe, aus dem Turm und auf die Brüggligasse hinaus, auf der gerade Stadtrat Isler mit Hector auf dem Rückweg war.
Stadelmann schaute Isler entsetzt an.
»Nanu, Päuli, hast du einen Geist gesehen?«, fragte Isler.
»Er ist tot«, stammelte Stadelmann.
»Was? Wer ist tot?«
»Der Egli, der Egli Theo.«
»Ja, und woher weißt du das?«
»Er liegt hier drin, im Nölliturm, am Fuße der Wendeltreppe. Er liegt einfach so da, macht keinen Wank.«
»Bist du dir sicher, dass er tot ist?«
»Er hat nicht reagiert. Atmung habe ich keine wahrgenommen. Ich habe mit ihm geredet, ihn angestupst.«
»Warte, lass mal sehen. Halt das«, sagte Isler geistesgegenwärtig, drückte Stadelmann die Hundeleine in die Hand und ging hinein.
Wenig später kam Isler wieder heraus und sah zu Stadelmann mit seinem Spaniel an der Leine. Hector hatte sich auf sein Hinterteil gesetzt und schaute sein Herrchen mit schiefem Blick an, was so viel heißen mochte wie: Was soll das Ganze?
»Du hattest recht mit deiner Vermutung. Er ist wirklich tot. Habe seinen Puls an der Halsschlagader fühlen wollen. Nix, nada. Sonst konnte ich nichts Verdächtiges feststellen, also so auf die Schnelle.«
»Das sagst du so einfach?«
»Was soll ich denn sonst sagen? Tot ist tot, oder zumindest vermute ich das. Ich bin ja kein Arzt. Tut mir leid für den alten Knaben, auch wenn wir das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatten. Ich kannte ihn zu wenig, als dass ich jetzt in tiefe Anteilnahme verfallen würde. Es ist eine Leiche, okay, aber ich sehe weder einen Kopfschuss noch ein Messer im Rücken. Einzig ein paar merkwürdige Blutspuren im Gesicht fielen mir auf. Die passen so gar nicht dahin.«
»Und dich nimmt so was nicht mit?«
»Nein, ich bin Politiker, ich bin es gewohnt, bei schlimmen Ereignissen, die Nerven zu wahren. Ich rufe jetzt die Polizei.«
Während das Telefon klingelte, sagte Isler zu Stadelmann: »Ich frage mich, was der da drin wollte. Der Höck war doch vorgestern.«
»Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei, mein Name ist Ronja Suter. Wie kann ich behilflich sein?«
»Ja, guten Tag. Hier ist Stadtrat Isler. Ein Zunftkollege von mir und ich müssen Ihnen den Tod eines anderen Zunftmitgliedes melden. Beim vermutlich Toten handelt es sich um Theo Egli, ehemaliger Zunftmeister der Zunft der Waldstätter. Fundort ist der Innenbereich des Nölliturms, Zugang Brüggligasse, gleich bei der Treppe.«
»Wie können Sie sich da sicher sein? Haben Sie seine Personalien geprüft?«
»Nein, das war nicht nötig. Wir sind persönlich bekannt«, gab Isler selbstsicher und selbstverständlich zur Antwort.
»Aha, ist notiert.«
Nachdem Isler noch ein paar Angaben zu Personalien gemacht hatte, legte er auf und telefonierte sogleich mit seiner Sekretärin, um sie über seine Verhinderung bei der Ratssitzung zu informieren.
Stadelmann brachte nicht viel auf die Reihe. Mit einer guten Begründung konnte er die beiden eingetroffenen Putzfrauen abwimmeln. Das Geld für die nicht beanspruchte Zeit würde er ihnen selbstverständlich zukommen lassen.
Die beiden Männer warteten zusammen mit Hector, bis die Polizei eintraf.
3
Stadelmann drehte vor dem Eingang des Nölliturms, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Ersatz für einen Turm mit mangelhafter Bausubstanz errichtet und um 1900 mit der Durchfahrt für den Verkehr versehen wurde, seine Kreise und kaute auf seinen Fingernägeln.
Isler reagierte sichtlich genervt darauf. »Beruhig dich endlich und führ dich nicht auf wie ein Irrer. Du erinnerst mich an einen der Spinner oder Pseudo-Spinner aus ›Einer flog über das Kuckucksnest‹.«
»Ich kann nicht anders. Ein Toter hier im Nölliturm, unserem heiligen Nölliturm. Das bringt Unglück.«
Isler verwarf die Hände. »Ach, heilig. Scheinheilig manchmal, ja. Aber heilig? Mitnichten und Neffen.«
Ein Todesfall dieser Art war für die Staatsanwaltschaft immer ein außergewöhnlicher Todesfall. Die ganze Kavallerie musste ausrücken.
Hector schien gänzlich unbeeindruckt. Er kratzte sich mit dem Hinterbein das rechte Ohr, womit er seine Gleichgültigkeit mehr als jeder Mensch perfekt zum Ausdruck brachte.
Die Polizei traf in Vertretung einer Wachtmeisterin und eines Wachtmeisters ein. Sekundiert wurden sie von Feldwebel Thomas Kessler, der den gut erhaltenen achtundzwanzig Meter hohen Rundturm von 13,45 Meter äußerem und 8,85 Meter innerem Durchmesser kurz betrachtete und sich dann den Anwesenden widmete.
Es gesellten sich die frischgebackene Staatsanwältin Nora Schilling, Amtsärztin Annette Freitag und der Kriminaltechnische Dienst dazu, dem auch Thomas Kesslers Freundin Eliane Kaufmann angehörte, die jedoch an diesem Tag nicht im Einsatz stand.
Frau Dr. Freitag war Mitte fünfzig, trug ihr Haar schwarz gefärbt, frisiert wie Mireille Mathieu. Sie war von zierlicher Erscheinung und nicht besonders groß. In ihrem hageren Gesicht waren gleichzeitig Ernsthaftigkeit und ein gesunder Schalk zu lesen.
Nachdem sich alle gegenseitig begrüßt hatten und sich Isler als Melder zu erkennen gegeben hatte, nahmen die Profis ihre Arbeit auf, während sich Isler und Stadelmann für etwaige Fragen in gebührendem Abstand zur Verfügung hielten.
Dr. Freitag konnte es nicht unterlassen, noch einen kleinen Kommentar von sich zu geben. »Ich weiß, es ist zynisch. Aber zum Glück haben Sie mich gerufen. Sie haben mich aus den Klauen eines Irren befreit, ein Hypochonder erster Güte. Jede Woche kommt er mit neuen Flausen zu mir, hat immer wieder mal was bei Dr. Google gelesen. Soll er sich doch von dem behandeln lassen. Wenn der alles hätte, was er sich einbildet, wäre er schon fünfmal gestorben. – Also, wen haben wir denn hier?«
Die beiden Polizeibeamten in Uniform halfen der Ärztin, den Leichnam auf den Rücken zu drehen, und entfernten die Kleidung. Dr. Freitag begann mit der Untersuchung.
»So auf den ersten Blick erkenne ich keine Fremdeinwirkung. Aufgrund der Lage und Nähe zur Treppe schließe ich einen Sturz nicht aus. Aber das ist reine Spekulation.«
Sie tastete den Körper ab, die neuralgischen Partien wie etwa den Hals, und arbeitete sich dann vor zum unübersehbaren Bauch.
»Na ja, Sport schien bei ihm auf der Prioritätenliste nicht gerade eine Spitzenposition einzunehmen.«
Dann schaute sie sich das Gesicht an.
»Ah, und hier haben wir vermutungsweise einen typischen Fall von Leichenfraß. Da bedienten sich wohl Ratten am kalten Buffet. Sehen Sie her, die Bissspuren im Gesicht und an der rechten Hand. Das geschah sicher post mortem.«
Die versammelte Schar begutachtete die Spuren der Verwüstung am Körper des Toten.
»Ratten?«, fragte Staatsanwältin Schilling etwas konsterniert.
»Ja, Ratten sind entlang der Reuss nicht ungewöhnlich«, bestätigte Frau Dr. Freitag.
»Aber sicher!«, intervenierte Paul Stadelmann, der sich unbemerkt und unbefugt zur Legalinspektion reingeschlichen hatte. »Als ich die Türe öffnete, rannte eine große fette an mir vorbei. Die hat den armen Theo angeknabbert. Ich glaube, mir wird schlecht«, sagte er, der sich seines Reinplatzens sogleich reuig wurde, und rannte raus. Er erbrach sein Frühstück auf die wenig befahrene Straße. Hector, der es sich auf dem Asphalt gerade gemütlich machen wollte, schaute auf, zog die Ohren hoch und verstand die Welt nicht mehr.
»Was können Sie zum mutmaßlichen Todeszeitpunkt sagen?«, fragte Kessler.
»Hm, anhand der äußeren Umstände, der schon markanten Leichenstarre und der Totenflecken schließe ich auf einen Todeszeitpunkt vor neun bis zwölf Stunden, also noch gestern Abend. Spuren einer Dritteinwirkung kann ich jedenfalls auch jetzt keine erkennen.«
Kessler wandte sich dem KTD zu. »Und, etwas Auffälliges?«
»Nein. Sein Portemonnaie trägt er noch auf sich. Geld scheint keines zu fehlen. Dann hatte er noch einen, vermutlich, Hausschlüssel dabei und sein Handy. Was auffällt, es hat hier neben der Leiche jede Menge Fußspuren. Unübersichtlich viele«, sagte eine Frau im Schutzanzug.
»Was war denn hier los? Touristenführung?«, fragte Kessler in Richtung Isler, der sich beim Eingang zur Verfügung hielt.
»Nein, keinesfalls. Der Turm ist nicht öffentlich zugänglich, nur für private Führungen. Aber wir hatten vorgestern unseren Zunfthöck. Die Putzfrauen wären erst heute damit beauftragt gewesen, gründlich sauber zu machen.«
»Aha«, sagte Kessler. »Schade, weniger Spuren hätten das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen einfacher gestaltet. Wissen Sie, was er hier wollte, also vermutlich noch gestern Abend?«
»Keine Ahnung«, antwortete Isler. »Ich bin auch nicht so ein regelmäßiger Gast dieser Höcks. Vorgestern war ich zum Beispiel nicht hier. Päuli aber, der weiß so ziemlich alles, was da vor sich geht«, sagte Isler und klopfte Stadelmann, der nach seiner Magenentleerung immer noch kreideweiß im Gesicht war, etwas spöttisch-kumpelhaft auf die Schulter. Dieser stand nach wie vor so unter Schock, dass er aufsprang.
»Also, Herr …?«, fragte Kessler.
»Stadelmann, Paul.«
»Was haben Sie in der ganzen … ähm, Gruppe hier für eine Rolle?«
»Ich bin der Turmwart des Nölliturms. Stolzer Turmwart und noch stolzeres Mitglied der ›Zunft der Waldstätter‹.«
»Aha. Dann erzählen Sie mir mal, ob mit oder ohne Stolz, ein wenig vom toten Zunftmitglied, Ihrem ›Zunftbruder‹ oder wie Sie sich bezeichnen.«
»Was soll ich sagen? Er war vor fünf, nein sechs Jahren unser Zunftmeister. Es war ein tolles Jahr. Wir hatten damals auch ein Jubiläum. Da hatten wir ein großartiges Fest auf dem Bramboden –«
»Bitte, Herr Stadelmann, beschränken Sie sich auf das Wesentliche«, unterbrach ihn Kessler barsch, als Stadelmann endlich aus seiner Schockstarre aufzuwachen schien.
»Ja, was wollen Sie denn genau wissen, Herr Kommissar?«
»Ich möchte wissen, was für eine Art Mensch er war. Ist es für Sie ungewöhnlich, dass er nachts oder zumindest nicht im Rahmen eines Zunftanlasses so alleine in diesem Turm umherwandelte?«
»Schon. Aber Theo war eigen. Er hatte einen Schlüssel. Er konnte hier ein und aus gehen, wann es ihm beliebte. Ich habe vernommen, dass er hier Geschäfte abgeschlossen hat, und dabei sollen nicht nur Geschäftsleute anwesend gewesen sein.«
Isler versuchte es mit Ablenkung. Das Thema war ihm offenbar unangenehm. »Egli hatte als hohes Zunftmitglied, quasi als Ehrenpräsident auf Lebenszeit, als einer der wenigen das Privileg, einen Schlüssel auf sich zu tragen.«
»Wer verkehrte hier sonst noch?«
»Na, Sie wissen schon, Damen für gewisse Stunden.«
»Soso. Und seine Frau wusste davon? Also, war er überhaupt verheiratet?«
»Schon, aber er und seine Frau leben … lebten seit über einem Jahr getrennt. Man hörte allerhand Gerüchte über außereheliche Geschichten seinerseits. Doch darüber will ich nicht weiter spekulieren«, sagte Isler zurückhaltend.
»Wird wohl mit der Zeit schwierig. Können Sie mir sagen, wo seine Frau wohnt?«
»Ja, an der früheren Adresse von Theo in St. Niklausen, Luzerns Goldküste. Er selbst hat sich eine Wohnung unterhalb vom Art Deco Hotel Montana genommen. Also genau genommen gehörte sie ihm schon vorher. Hat einfach die Mieter rausgeschmissen. Der kannte gar nichts, der Theo«, sagte Stadelmann.
»Mit Verlaub, das klingt nicht sehr, wie soll ich sagen, sympathisch«, seufzte Kessler und verdrehte die Augen, während er sich die Adresse von Eglis Frau von Stadelmann geben ließ.
Kessler wandte sich um.
»Können Sie uns etwas zur Todesursache sagen, Frau Dr. Freitag?«, fragte Schilling, die nervös wirkte.
Wieder eine, die aufgrund des politischen Kalküls viel zu früh in dieses verantwortungsvolle Amt gewählt worden war, dachte sich Kessler. Dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aufgrund einer politischen Wahl und nicht primär und ausschließlich aufgrund der Fähigkeit sowie der Lebenserfahrung in ihre Position gehievt wurden, erachtete er als großen Fehler des Systems. Aber solange die Parteien durch die Abgabe einer Mandatssteuer profitierten, würde man hier nichts ändern. Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert.
»Todesursachen, ich spreche bewusst im Plural. Sie können es sich aussuchen. Ich stelle jedenfalls ein gebrochenes Genick fest. Dann gehe ich aufgrund der massiven Prellspuren im Abdomen davon aus, dass innere Blutungen ebenfalls kausal zum Tode geführt haben könnten. Den Schädel hatte er sich, vermutlich mehrfach, angeschlagen. Alles wohl verursacht durch einen schweren Sturz von der Wendeltreppe, wie mir seine Lage verrät. Ob es die Endlage ist, kann ich nur spekulieren. Allerdings gehe ich prima vista davon aus. Das können dann Ihre Kollegen von der Spurensicherung bestätigen. Jedenfalls handelt es sich beim Toten um einen, wie mir sein Ausweis verrät, achtundsechzigjährigen Mann, circa ein Meter achtundsiebzig groß, circa hundertzehn bis hundertzwanzig Kilogramm schwer.«
»Ein klarer Hinweis auf Fremdeinwirkung?«, fragte nun Kessler, während sich die Staatsanwältin etwas notierte.
»Augenscheinlich nicht. Aber die Obduktion könnte hier noch etwas zutage fördern. Könnte auch was mit dem Herzen sein. Das ist immer möglich. Er war fast siebzig, übergewichtig und eventuell gewissen Genüssen nicht abgeneigt. Überweisung ans Institut für Rechtsmedizin?«
»Ja, klare Sache«, sagte die Staatsanwältin.
Die Polizistin in Uniform rief beim Bestattungsunternehmen an, das die Überführung nach Zürich gewährleistete.
»Wie steht es mit möglichen Fußspuren?«, wollte Kessler noch wissen.
»Das können Sie vergessen. Da wäre jeder in der Zunft verdächtig. Wir hatten vorgestern Höck, und die große Reinigung steht erst heute an«, wiederholte Stadelmann.
Isler nickte.
»Mit Verlaub, ob das wichtig ist oder nicht, entscheidet Frau Schilling beziehungsweise die Polizei«, belehrte Kessler Stadelmann etwas gereizt. »Sonst noch etwas? Zum Beispiel etwas Auffälliges von vorgestern anlässlich des Treffens?«
Stadelmann überlegte. »Hm, wenn ich mich recht entsinne, der Theo war vorgestern beim Zunfthöck gar nicht dabei. Das ist etwas merkwürdig. Der entschuldigt sich sonst nie.«
»Das ist ein wertvoller Hinweis. Erspart uns einige Befragungen. Hilft uns aber unter Umständen überhaupt nicht weiter. Nun gut, schauen wir uns doch oben mal um. Vielleicht finden wir dort noch Hinweise«, schlug Kessler vor.
»Gute Idee«, sagte Staatsanwältin Schilling.
4
Im dritten Stock in der Zunftstube angekommen, machten sich die zwei von der Spurensicherung gleich an die Arbeit. Kessler schaute sich um und staunte erst mal. Hier befand sich das Herzstück des Turms, die große Zunftstube. Er war als Stadtluzerner noch nie hier gewesen. Den Wasserturm kannte er schon von anderen Festivitäten, aber das hier war noch eine Nummer größer, prächtiger.
Kessler imponierte der Bau, innen wie außen, wie er sich eingestehen musste, da er nun den gesamten Turm inspizieren konnte.
An den Wänden hingen Armbrüste und andere antike Waffen. Die Butzenscheiben und Glasmalereien waren kunstvoll, und man roch förmlich die jahrhundertealte Geschichte. In der Mitte befand sich der Tisch des Zunftrates, quasi die Geschäftsleitung der Zunft. Ihnen gebührte das edelste Gehölz mit massiven Stühlen, die an eine eckige Tafelrunde erinnerten.
Konzentrisch waren die anderen Tische darum herum angeordnet. Man hatte das Gefühl, in einem altehrwürdigen Rittersaal zu stehen, in dem die sprichwörtliche Virilität in der Luft lag. Hier wurden sicher ausgelassene, bisweilen wohl auch etwas dekadent anmutende Feste gefeiert. Männer waren unter sich und konnten die Sau rauslassen, sexistische Witze und Sprüche klopfen, ohne von der Moralpolizei ertappt zu werden, schon gar nicht, wenn sich unter ihnen ranghohe Herren aus der Justiz befanden.
Kesslers Welt war es nicht. Er bekam dies nur am Rande mit, wenn sein designierter Polizeichef Serge Wolf, selbst Mitglied der Zunft, wieder für einen sogenannten wohltätigen Anlass seines Clubs weibelte. Ansonsten, nein danke.
»Das ist nicht gerade die chambre de reflexion, mehr eine chambre des actes«, gab Stadtrat Isler einen Kommentar in Richtung Kesslers ab, der von diesem gebeten worden war, die Mitarbeitenden der Polizei aufgrund seiner Sachkenntnis und seiner auf Kessler sehr besonnen und neutral wirkenden Art zu begleiten. »Wissen Sie, manche sind aus Überzeugung dabei, aus wahrer Hingabe mit Leib und Seele, wie unser guter Paul Stadelmann. Andere sind dabei, weil sie gefragt wurden und es sich für das Beziehungsnetz hin und wieder als von Vorteil erweisen könnte.«
»Solche wie Sie?«, fragte Kessler rhetorisch, wobei er den rechten Mundwinkel lässig hochzog.
»Unter anderem«, sagte Isler mit einem Augenzwinkern.
»Seien Sie bitte vorsichtig mit dem wertvollen Inventar«, mahnte Stadelmann. Er hatte sich auch nachgeschlichen.
»Komm schon, Päuli, wir sind hier nicht in einem Museum. Hier geht es schon ganz doll zu und her.«
Staatsanwältin Schilling stand plötzlich neben Kessler. »Ich denke, das bringt nicht allzu viel. Machen Sie sich lieber an die Arbeit, um herauszufinden, warum Herr Egli zu solch ungewöhnlicher Stunde hier war. Ob jemand etwas über den Beweggrund weiß, ob er alleine hier war, ob jemand etwas gesehen oder gehört hat. Wir müssen alle Eventualitäten einschließen und Vermutungen ausschließen.«
»Ist gut. Ich werde der Witwe mal einen Besuch abstatten.«
5
Kessler fuhr mit seinem geschalteten, mittlerweile sehr klapprigen und rostigen Škoda Octavia nach St. Niklausen am Vierwaldstättersee. Sein treues Gefährt wurde erst vor ein paar Wochen, wohl zum allerletzten Mal, mit viel Goodwill von der Verkehrskontrolle durchgewinkt.
Diese Gegend hinter dem Schönbühl, auf einer Halbinsel mit pittoresker Aussicht auf den Bürgenstock und die Alpen gelegen, war der Inbegriff für Noblesse. Eine Villa war prunkvoller als die andere. Hier machte sich die Luzerner High Society in einer Art Gated Community ein schönes Leben, fernab der Zentrumslasten einer pulsierenden Stadt. Und doch profitierten sie vom nahen Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Vergnügungen.
Schon die Garagenauffahrt der Eglis beeindruckte Kessler. Hier hätten gut und gerne zehn Autos mühelos nebeneinander abgestellt werden können. Sie war von rund einem Dutzend Hängebirken gesäumt, die wie eine kleine Privatarmee Spalier standen.
Kessler betätigte die Klingel neben der massiven Haustüre. Unmittelbar danach vernahm er lautes Bellen und wurde von einem riesigen Hund begrüßt, obschon er dies nicht wirklich als Begrüßung wahrnahm. Er tippte auf einen Neufundländer, die im Allgemeinen zwar als kräftig, doch friedliebend galten. Kessler hatte keine Angst vor Hunden, aber solche in der Größe von Stadtrat Islers Spaniel Hector waren ihm lieber.
»Leopold, mach Sitz«, sagte eine Frau, die gleich darauf aus der Haustüre trat. Sie war einige Jahre jünger als der verstorbene Egli und wirkte auf Kessler wie eine feine Dame. Sie hatte eine schicke Kurzhaarfrisur, die ihr vermutlich getöntes braunes Haar gekonnt akzentuierte. Auf den Lippen hatte sie ein dezentes helles Rot aufgetragen. Am Hals trug sie eine schlichte Perlenkette.
»Guten Tag, Sie wünschen?«
Kessler kramte seinen Ausweis hervor. »Guten Tag. Spreche ich mit Frau Edith Egli?«
»Ja, und Sie sind?«
»Mein Name ist Thomas Kessler, Kriminalpolizei Luzern.«
Nachdem sie seinen Ausweis beäugt hatte, verfinsterte sich ihre bis anhin freundliche Miene. »Um was geht es?«
»Darf ich hereinkommen? Die Sache ist etwas delikat.«
»Pah, sehen Sie hier weit und breit jemanden?« Es war in der Tat das Privileg der Reichen, sich mit genügend Umschwung eine Art Sicherheitszone bis zum nächsten angrenzenden Grundstück zu verschaffen. Man wollte nicht nur als Reiche unter sich sein, man wollte auch als Einheit offenbar gerne in Ruhe gelassen werden. »Kommen Sie bitte herein, aber ziehen Sie die Schuhe aus. Der Marmorboden ist gerade frisch gereinigt worden.«
Hinter ihnen schloss eine Bedienstete in entsprechender Kleidung die Türe.
»Consuela, bringen Sie uns bitte Kaffee und ein paar Plätzchen«, gab Frau Egli in Auftrag, ohne den Gast zu fragen.
Consuela kam wohl aus Südamerika, sprach nicht und hatte eine schwarze Schürze an. Wie viel Klischee musste sich hier gerade noch bestätigen? Fehlte nur noch der Butler mit affektiertem englischen Akzent, der auf den Namen James hörte.
Frau Egli begleitete ihn in den Salon, wo sich Kessler auf das Sofa setzte, in das er fast versank. Er betrachtete die beiden lebensgroßen sitzenden Tiger aus Marmor, die ihn mit ihren furchteinflößenden Augen zu hypnotisieren schienen.
»Ich weiß, es ist ein völlig unpraktisches Ding. Das war ein Spleen von meinem Alten. Das wird sich bald ändern.«
»Wegen Ihrem Gatten bin ich hier. Wenn es recht ist, komme ich gleich auf den Punkt.«
»Bitte, gerne.«
Die Bedienstete servierte den Kaffee und dazu ein paar schottische Butterkekse.
»Frau Egli, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir vor rund eineinhalb Stunden Ihren Gatten Theo Egli tot aufgefunden haben.«
Sie war gerade dabei, die Tasse anzusetzen, schaute Kessler etwas erstaunt an und nahm dann einen Schluck. Er wartete auf ihre Reaktion. Sie zeigte keinerlei Regung.
»Darf man fragen, wo Sie ihn gefunden haben? Bei einer seiner Kurtisanen?«
»Ich erlaube mir zunächst eine Gegenfrage: Wissen Sie, wo er sich gestern aufgehalten hat?«
»Da fragen Sie die ganz falsche Person. Ich habe mit Theo seit einem halben Jahr kein Wort mehr gewechselt. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über unsere Anwälte. In zwei Wochen wäre der Termin für die Scheidungsverhandlung vor Gericht gewesen. Wir waren fast zweiundvierzig Jahre verheiratet, und ich sage Ihnen jetzt nicht, wie viele davon ich bereut habe. Es waren mehr als die Hälfte.«
Welch harmonische Ehe die beiden doch geführt haben mussten! Da waren Kesslers dreizehn Jahre mit Barbara wohl nur halb so schlimm gewesen. »Wir haben ihn im ersten Stock des Nölliturms gefunden.«
»Was? Einfach so? Auf dem Boden?«
»Ja, es kann sein, dass er die Treppe hinuntergestürzt ist. Aber wir wissen noch nicht, ob es ein Unfall war oder jemand, na, sagen wir, den Sturz provoziert hat.«
»Sie drücken sich ja diplomatisch aus. Sie meinen, ob jemand den alten Fettsack runtergestoßen hat?«
»Das ist Spekulation.«
»Würde mich ja nicht wundern.« Jetzt genoss sie Kesslers volle Aufmerksamkeit. »Ach, wissen Sie. Der Theo, der große Theo Egli, der Baulöwe von Luzern, wie ihn die Medien immer hochjubelten. Der hatte auch Feinde. Wenn Sie im Baubusiness sind, dann gehören Feindschaften dazu wie der Zement, mit dem Sie so manchen Traum und einen ebensolchen Alptraum erschaffen.«
»Können Sie Namen nennen?«
»Lesen Sie denn keine Zeitung? Da gibt es viel Konkurrenz. Zugegeben, es gibt viel Neid, aber eben auch Konkurrenz. Und manche in dieser Branche setzen alle Hebel in Bewegung, um an Aufträge zu kommen.«
»Sie sprechen das Großprojekt ›Metropolis Lucerne‹ an.«
Sie lachte spöttisch und sagte: »Das Großprojekt? Sie meinen, das größenwahnsinnige Projekt. Das ist so wie damals das KKL: für diese Stadt eindeutig eine Schuhnummer zu groß, das jetzige Projekt vielleicht sogar zwei Nummern.«
»Kommen wir nochmals auf gestern zu sprechen. Sie haben also keinen Kontakt zu ihm. Wie steht es mit gemeinsamen Kindern? Falls ja, haben die Kontakt zu ihm?«
»Wir haben drei gemeinsame Töchter. Die haben auch nur sporadisch Kontakt mit ihm. Eine lebt in Neuseeland, eine in London, und die dritte führt ein kleines Hotel in Zermatt. Sie sehen, die Familie hat schon vorher nur noch auf dem Papier existiert.«
»Können Sie mir Personen aus dem gemeinsamen Bekanntenkreis nennen, die mir diesbezüglich weiterhelfen könnten?«
»Unsere sogenannten Bekannten wurden nach unserer Trennung in zwei Lager gespalten, das ist quasi wie auf Zypern. Also kann ich Ihnen dazu nicht viel sagen. Zudem haben sich in den letzten drei, vier Jahren ohnehin viele von Theo abgewandt. Er wurde immer cholerischer, unberechenbarer. Er war seit jeher ein herrischer Mensch, ein Polterer, wie es im Baugewerbe nicht unüblich ist. Es ist ein ruppiges Business, nichts für Zartbesaitete.«
»Also keine Namen?«
»Theo hatte nicht viele Freunde. Das meinte man nur. Er verkehrte gesellschaftlich fast nur noch in seiner Zunft.«
»Aber am vorgestrigen Zunfthöck war er nicht mal dabei.«
»Wirklich? Das ist merkwürdig. Er ist dort ja fast schon zu Hause. Aber es ist mir eigentlich egal. Ja, es ist mir gelinde gesagt vollkommen egal. Soll ich ehrlich sein? Sein Tod berührt mich ziemlich wenig. Er war ein mieser Ehemann, hat mich andauernd mit billigen Flittchen betrogen, und er war ein noch schlechterer Vater. Wenn ich es recht bedenke, war er gar kein Vater. Ich habe unsere drei Töchter alleine großgezogen. Er war ja nie da. Hatte immer ›viel Wichtigeres‹ zu tun. Wenigstens hat er die vorläufig vereinbarten Unterhaltszahlungen korrekt überwiesen. Das muss man ihm lassen.«
»Gut, vielen Dank.« Kessler hatte seinen Kaffee nicht einmal angerührt und erhob sich vom unbequemen Sofa.
»War’s das?«
»Vorerst. Sollten sich noch Fragen ergeben, komme ich gerne auf Sie zurück.«
»Na, gerne weiß ich nicht. Ich helfe einfach, wo ich kann, wenn es nicht anders geht.«
Kessler verabschiedete sich und hinterließ Frau Egli seine Visitenkarte. Er trat vor das Haus und genoss einen kurzen Augenblick die wunderschöne Aussicht. Hier lebt es sich bestimmt gut, wenn nur die Wahrheiten hinter den Fassaden dieser protzigen Wände nicht wären und durch die Ritzen drückten, dass einem übel werden konnte.
Dann brauste er mit seinem Škoda in Richtung Polizeikommando.
6
Am Donnerstag wollte Kessler sich des Umfelds von Theo Egli annehmen und ebenso der Umgebung des Nölliturms. Auf die Auswertung von Eglis Handydaten musste er wohl nicht lange warten. Das Handy lag bereits auf dem Tisch der IT-Forensik, und die Verfügung dazu hatte ihm Staatsanwältin Schilling zukommen lassen.
Die Befragung der Anwohnerinnen und Anwohner um den Nölliturm war ernüchternd. Niemand wollte etwas Auffälliges gesehen oder gehört haben. Nur ein Mann äußerte sich zu den gelegentlichen Aktivitäten beziehungsweise den Besuchen von bestimmten Damen für gewisse Stunden und Vergnügungen. Das habe man jeweils sehr gut mitbekommen, dieses Gekreische und Gejohle, wohl unter starkem Alkoholeinfluss. Zum Glück hätten sie jedoch genügend Abstand zum Turm, denn dort gehe es auch sonst mal hoch zu und her. Für Kessler war das alles nicht wirklich hilfreich.
War am Ende wirklich alles nur ein dummer Zufall, ein Unfall? Hatte er sich bei den Stufen vertan, das Gleichgewicht verloren und war dann unglücklich gestürzt? Sofern er die ganze Treppe runtergefallen wäre, wären die diversen Verletzungen an seinem Körper absolut nachvollziehbar.
An Zufälle glauben – schon das Wort Glauben war für Kessler nur schwer in den Mund zu nehmen –, das lag nicht in der Natur eines genuinen Kriminalisten. Er war zwar nicht derjenige, der hinter jedem Baum und jeder Hecke einen Verbrecher vermutete. Aber ein gewisses Grundmisstrauen war sein steter Begleiter, seine feine Spürnase.
Zum Mittagessen traf er sich mit seinem Freund von der Staatsanwaltschaft, Martin Langer, der in Emmenbrücke arbeitete.
Das »Don Quijote« in der Neustadt wurde von einem spanisch-italienischen Doppelbürger geführt und bot Köstlichkeiten von der Iberischen Halbinsel und dem italienischen Stiefel. Was wollte man mehr! Das Mittagsmenü wurde stets mit einem kleinen Dessert, einer kleinen Freude zum Abschluss, abgerundet. Den obligaten Espresso gab es aufs Haus.
»Seltsam ist die Geschichte mit Egli schon«, konstatierte Kessler bewusst, um die Reaktion Langers auf die Probe zu stellen.
»Fürwahr. Unfall? So was Dummes aber auch.«
»Ja, und einige Mächtige sind ob dieses Ablebens gar nicht so unglücklich.«
»Das vermutest du?«
»Ich? Vermuten? Im Moment gar nichts. Ich bin gespannt, ob die Handydaten was aussagen. Hast du sonst noch Ideen, wo man nachhaken könnte? Deine Kollegin in Ehren, aber die ist etwas gar jung für dieses Business.«
Langer verdrehte die Augen. »Hör mir auf damit. Die war vorher gerade mal zwei Jahre Assistentin. Kam frisch von der Presse. Und jetzt, mit gerade mal neunundzwanzig oder dreißig Jahren, schon Staatsanwältin? Da ist was faul im Staate Dänemark.«
»Ja, eher im Kanton Luzern.«
»Leidiges Thema. Ein alter Zopf, den man endlich abschneiden sollte. Egal, völlig egal. Nein, im Moment, denke ich, habt ihr das Nötigste getan. Stimmt das übrigens mit dem Leichenfraß?«
»Ja, echt übel. Ratten haben sein Gesicht und die rechte Hand angeknabbert.«
»Man könnte meinen, wir seien im finstersten Mittelalter.«
»Wenn du in dieser Zunftstube gewesen wärst, dann würdest du dich tatsächlich dahin zurückversetzt fühlen.«
»Obduktion ist am Laufen?«
»Ja, die müssen vorwärtsmachen. Die Beerdigung ist auf den nächsten Mittwoch angesetzt, vorausgesetzt natürlich, die Leiche wird freigegeben. Wird ein Riesending. Die Hofkirche wird aus allen Nähten platzen. Die gesamte lokale Cervelat-Prominenz aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wird erwartet. Alles Heuchler.«
»Warum das denn?«
»Wenn man seiner Noch-Ehefrau glaubt, dann war der gute Theo zwar stadtbekannt und wohl darüber hinaus. Allzu gerne und oft hatte er auf Fotos mit seiner fleischigen Visage in der Zeitung gelächelt. Andererseits hielt sich seine Beliebtheit in Grenzen, zumindest, was wir bis anhin aus seinem näheren Umfeld in Erfahrung bringen konnten.«
»Okay.«
»Und seine Alte und er fochten, wie mir scheint, einen richtigen Rosenkrieg aus, haben nur noch über die Anwälte miteinander verkehrt. Wie viel Wahrheit da wirklich drinsteckt, weiß ich noch nicht. Es könnte aber bei den Ermittlungen, wenn es denn welche gibt, helfen, etwas über seinen Hintergrund zu erfahren. Kannst du mir dann ein bisschen unter die Arme greifen, sollte ich die eine oder andere Verfügung benötigen?«
Langer zog eine Augenbraue hoch und schaute ihn fragend an. »Thommy, du weißt, wie das läuft: Zuständig ist die Schilling, das ist nun mal so, egal ob dir das passt oder nicht. Oberstaatsanwalt Schilter sieht es nicht gerne, wenn es innerhalb unserer Dienststelle Kompetenzkonflikte gibt. Es reicht schon, wenn wir uns mit den anderen Kantonen herumschlagen müssen, nötigenfalls bis zum Gang ans Bundesstrafgericht in Bellinzona.«
»Ja, schon gut. Ich habe es mal wieder versucht. Denk daran, seit dem Fall Hohenrain genießt du innerhalb des Polizeikorps einen exzellenten Ruf«, sagte Kessler bewusst lobhudelnd.
»Das ehrt mich. Also, wenn ich unterhalb des Radars fliegen kann, dann helfe ich gerne. Und sonst, zu Hause? Grüß mir Eliane bitte.«
»Jaja, sonst alles gut.«
»Ah, ich verstehe. Immer noch das gleiche Thema, die sogenannte K-Frage.«
»Jup, und die Kadenz wird höher.« Kessler breitete seine Serviette auf den Beinen aus, da das Essen serviert wurde: Scaloppine al limone mit sämigem Tomatenrisotto.
7
Am Nachmittag lag die Auswertung der Handydaten von Theo Egli vor. Diese ergab keinen Hinweis auf ein Treffen am Tage seines Todes. Auch wurde kein Kontakt mit einer besonderen Auffälligkeit oder Häufigkeit registriert. Das brachte Kessler nicht weiter. Staatsanwältin Schilling war ebenfalls enttäuscht. Hatte sie hier den großen Clou erwartet?
»Vielleicht müssen wir uns wirklich mit der Unfallversion zufriedengeben.«
»Warten Sie es ab«, sagte er ihr am Telefon.
»Übrigens, ich bin Nora. Ich weiß, hätte ich schon früher anbieten können, ist mir nicht in den Sinn gekommen.«
»Ähm, freut mich, Thomas.«
»Schauen wir mal, was die Obduktion zutage fördert, also wortwörtlich.«
Schilling schien ihre anfängliche Nervosität abgelegt zu haben und war schon zu Scherzen aufgelegt.
Kessler beendete das Gespräch. Er schaute sich in seinem Büro um, erblickte seine signierte Schallplatte von Fats Domino, angelehnt an eine Vase mit einer künstlichen Blume drin, und fing an zu grübeln.
»Ich weiß, für einen Unfall ist es einfach zu gediegen, würde zu schnell zu einem Abschluss kommen. Das war genau das Gülleloch, bei dem man möglichst schnell einen Deckel draufnageln möchte, damit der Gestank niemandem mehr unangenehm wäre«, sagte er im Selbstgespräch.
Bei seinen weiteren Gedankengängen beließ er es beim wortlosen Monolog. Stadelmann, so war er sich sicher, hatte kaum etwas damit zu tun. Damit? Ja, womit? Komplott? Intrige? Unbeabsichtigter Unfall? Oder was auch immer. Und Isler? Ja, der wäre sicher nicht vom Schlüsselbund zu entfernen. Ob er der passende Schüssel zur Tür der Lösung wäre, würde sich noch zeigen.
Er rief ihn jedenfalls gleich an, um einen Termin mit ihm zu vereinbaren. Kessler wurde via Sekretariat zu Stadtrat Isler durchgestellt. Er war wenig überrascht, nochmals von der Polizei kontaktiert zu werden. Er zeigte sich bereit für eine offizielle »Stellungnahme«, wies als ausgebildeter Jurist auch darauf hin, sich strikt ans Amtsgeheimnis zu halten.
Dr. Heinz Isler war Vorsteher der Finanzdirektion und gehörte der Partei mit dem nach wie vor stärksten Wähleranteil im Kanton an, auch wenn deren Machtanspruch in den letzten Jahren und Jahrzehnten an der Wahlurne kontinuierlich schrumpfte. Dort saß er seit acht Jahren, seit seiner Kampfwahl gegen einen ehemaligen Kanzleipartner. Der Wahl war eine üble Schlammschlacht in den Medien vorausgegangen. Isler trat an, der Vetternwirtschaft einen Riegel vorzuschieben. Und man musste ehrlicherweise sagen, er hatte aufgeräumt. Isler genoss unter allen Stadträten in der Bevölkerung den besten Ruf. Er galt als integer, loyal und schien eine natürliche Teflonbeschichtung gegen allerlei Günstlingsversuche zu besitzen.
Er wurde sogar als möglicher Stadtpräsident vorgeschlagen. Dies lehnte er dankend ab, da er der Meinung war, wer über die Staatsschatulle wache, besitze wesentlich mehr Macht als derjenige, der zum Schein an der Spitze eines Gremiums hocke, das insgeheim ohnehin dem Prinzip primus inter pares folge.
8
Kessler verließ gegen achtzehn Uhr sein Büro im Kommando an der Kasimir-Pfyffer-Straße und holte sich auf dem Nachhauseweg in Fußnähe ein frisches Brot bei der Bäckerei Wigger. Diese war dafür bekannt, alles selber herzustellen. Das Sortiment war klein und überschaubar, dafür verwendete der Bäcker, der den Betrieb in dritter Generation führte, keine Halbfertigprodukte, wie dies die meisten anderen Betriebe taten.
Kessler kaufte ein Sauerteigbrot, beim Metzger in unmittelbarer Nähe frischen Parmaschinken und Mortadella, im Käseladen einen reifen »Stanser Fladen« – reif war er erst, wenn man ihn vom Löffel zähflüssig auf den Teller tropfen lassen konnte – und bei seinem Hausweinhändler einen geschmeidigen Lagrein vom Kalterer See.
Eliane kochte selten, und heute wollte er nicht den Bocuse geben. Es sollte was Schnelles und doch Leckeres sein.
Noch bevor er die Türe aufschließen konnte, hörte er Eliane üben. Sie vertiefte sich in den dritten Satz von Schumanns Violoncello-Konzert.
Eliane war mehr als nur eine passionierte Hobby-Cellistin. Sie war einst auf gutem Wege, dieses Instrument mit Konzertdiplom am Konservatorium abzuschließen. Doch musste sie sich eingestehen, der Doppelbelastung mit einem parallel laufenden Biologiestudium auf Dauer nicht gewachsen zu sein. Die Leidenschaft für das Instrument blieb, mit gewissen krisenbedingten Unterbrüchen, indes bis heute.
Kessler war immer wieder von Neuem fasziniert, was sie aus diesem anmutigen Instrument herausholen konnte. Auf den Kronen der hohen Töne schwingend und mit den wummernden Bässen die Wände zum Vibrieren bringend. Es war die ganze Palette der menschlichen Dramaturgie, des menschlichen Daseins, in der Essenz vereint in diesem einen Instrument. Wer es beherrschte, der beherrschte die Welt, oder zumindest Kesslers Gefühlswelt.
Diesmal klang es anders. Es hatte nicht die Sanftheit, die Ruhe, die Sicherheit eines starken Schiffes, das einen durch eine stürmische See geleitet. Diesmal war das Cello der Sturm, das Gewitter, und Eliane war diejenige, die dagegen im Wasser ankämpfte.
Er schloss die Türe zur Wohnung auf, und dann passierte es. Eine Saite riss.
»Ach verdammt!«, hörte er sie fluchen und ließ vor Schreck die Einkaufstüte fallen, zum Glück nicht den Wein.
»Eliane, alles in Ordnung?«
»Nichts ist in Ordnung. Ich bin eingerostet wie ein alter Citroën 2CV. Das krieg ich nie hin.«
Kessler wollte zuerst nichts sagen, aber das wäre genauso falsch gewesen wie das, was er dann sagte: »Äh, du hast doch den Dirigenten angefleht, das Stück zu spielen.«
Eliane sah ihn zornig an. »Ist ja klar, dass dies kommen würde.«
»Ehrlich, du musst zugeben, euer ›Orchester Santa Cäcilia‹ spielt auf einem bemerkenswert hohen Niveau für ein Ensemble, in dem, außer den Stimmführern, alles engagierte Laien sind. Du hast es nochmals in eine neue Sphäre gehoben, und euer Dirigent … wie heißt er noch mal?«
»Ivan Creu.«
»Genau. Der hat ebenfalls dazu beigetragen. Aber Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester in a-Moll ist schon hohe Schule, auch wenn er das Werk, wie ich gelesen habe, in gerade einmal zwei Wochen komponiert hat.«
»Willst du damit etwa sagen, ich bin nicht gut genug dafür?«
»Du schon. Aber du bist ja nicht allein. Da ist ein ganzes Orchester. Lassen wir das. Das Konzert ist nicht heute oder morgen. Ich habe lauter leckere Sachen.«
Das Konzert im Saal der Pauluskirche war dennoch in Sichtweite. Er hoffte, Eliane würde das hinkriegen. Wenn sie es schaffte, könnte sie das Orchester mitreißen, davon war er überzeugt. Aber ja, Schumann hatte auch nicht gerade ein heiteres Gemüt. Hätten sie besser das Konzert von Dvořák aufgeführt, nur, das wäre vom Niveau unmöglich gewesen.
9
Polizeichef Wolf stand in Kesslers Büro. Kessler hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt, dass dieser nun den ganzen Laden mit knapp neunhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leitete.
Wolf war nach dem plötzlichen Herztod von Polizeikommandant Urs Willimann Anfang des Jahres in dessen Fußstapfen getreten, hatte somit den Olymp einer kantonalen Polizeikarriere erklommen. Nur der Polizeivorsteher in der Regierung stand über ihm. Kessler dachte, mit dem Posten als Polizeichef sei der Hunger der Bestie gestillt. Doch die Bestie wollte mehr. Er hatte Gefallen gefunden am süßen Nektar der Macht.
Immerhin war Kessler froh, ihn nicht mehr als direkten Vorgesetzten, als Kripochef, zu haben. Allerdings saß er ihm jetzt nicht nur im Nacken, jetzt konnte er ihm von oben genüsslich die Augen aus dem Kopf picken.
»Thomas, na, wie geht es?«, fragte Wolf in schleimiger Manier.
»Guten Morgen, Serge. Alles klar so weit.«
Wolf setzte sich unaufgefordert auf Kesslers Gaststuhl, die Füße mit seinen, immerhin geputzten, Schuhen legte er auf das Pult. Damit wollte er seine unangefochtene Spitzenposition in diesem Betrieb zementieren. Kessler ließ sich derweil nicht von dieser Geste provozieren.
Du kleiner Parvenü, du Papa-Söhnchen, du hast mir schon einmal einen Stein in meinen Karriereweg gelegt. Ich kenne den bitteren Geschmack einer Niederlage. Es ist für mich nichts Neues. Also komm mir nicht mit solch dummen Spielchen.
»Was kann ich Gutes für dich tun, lieber Serge?«, fragte Kessler betont säuselnd.
»Du bist doch am Fall Theo Egli dran.«
»Also Fall, bis jetzt ist es ein außergewöhnlicher Todesfall. Ob es zu einem gewöhnlichen Unfalltod wird, werden wir noch sehen.«
»Du weißt, ich kenne die Familie gut. Meine Familie und seine sind gut befreundet. Es ist für alle sehr schwer, das Ganze.«
Ja, wenn der wüsste. Die Noch-Ehefrau ist vermutlich die letzte Person auf Erden, die diesem Kerl auch nur eine müde Träne nachtrauert, und die Töchter haben sich schon lange von ihrem praktisch inexistenten Vater abgewendet. Was sollte also das ganze Schmierentheater von wegen »gut befreundet«, und es sei »schwer für die Familie«.
»Was willst du mir damit sagen, werter Serge?«
»Nun, ich will damit sagen, dass ich es mir für die Familie wünsche, bald mit dem Fall abschließen zu können. Die Tragik seines Unfalltodes ist schon genug. Die üble Presse in letzter Zeit ist da auch nicht gerade Balsam für die geschundenen Seelen der Hinterbliebenen.«
»Wer sagt denn, es sei mit Bestimmtheit ein Unfall gewesen? Wir gehen aktuell von einem außergewöhnlichen Todesfall aus. Nicht mehr und nicht weniger.« Erst danach fragte er sich: Was soll denn dieses Tempo? Zuerst müssen wir die Resultate der Obduktion abwarten, wie immer. Same procedure as every year, James. »Und was ist mit dem Obduktionsbericht? Der sollte schnellstmöglich vorliegen. Die Staatsanwältin hat einen Eilantrag gestellt.«
Wolf winkte ab. »Was soll der uns schon aussagen? Hast du jemanden gefunden, der dir einen Hinweis auf eine Dritteinwirkung geben konnte? Auch nur den leisesten Verdacht dazu?«
»Nein, das nicht, aber –«
»Nichts aber. Du tust das, was ich dir befehle. So sind nun mal die Regeln.«
»Die Regeln sind es, der Strafjustiz verpflichtet, Fälle sauber abzuklären und Eventualitäten auszuschließen. So haben wir das zumindest mal im Jurastudium gelernt, also woran ich mich erinnern kann.«
Wolf brach in schallendes Gelächter aus. »Du willst mich über Juristerei belehren? Du hast das Studium nach vier Semestern abgebrochen. Ich nicht. Lassen wir diese Abhandlung lieber.«
Tja, ich habe mich bewusst für einen anderen Weg entschieden. Du sitzt hier nur, weil du dreimal durch die Anwaltsprüfungen gerasselt bist und dein Papalein alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit Sohnemann doch noch Karriere machen kann. Kessler wollte sich nicht auf Diskussionen mit seinem Ober-Chef einlassen. Dem war es seit der Wahl zum höchsten Polizisten des Kantons nur noch mehr in die Birne gestiegen, und er befand sich auch in einer Besoldungsklasse ein paar Sphären über ihm.
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte Kessler etwas resigniert.