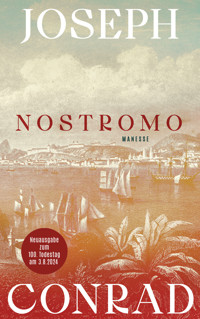
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk der Moderne von frappierender Aktualität, zum 100. Todestag Joseph Conrads neu übersetzt, mustergültig kommentiert und mit einem Nachwort von Robert Menasse
Im späten 19. Jahrhundert ist das südamerikanische Costaguana zerrissen von politischen Konflikten in- und ausländischer Mächte. Zwangsherrschaften, Putsche, Revolutionen wechseln einander ab: Doch egal, welche Clique gerade die Oberhand hat, am grundlegenden System von Unterdrückung und Ausbeutung ändert sich nichts. Der titelgebende Held des Romans, Nostromo, eigentlich Giovanni Battista Fizanda, Exil-Italiener, einer aus dem Volk, Kraftnatur und Tatmensch, «ein Mann von Charakter» (Joseph Conrad über seinen Helden), ist einer jener nützlichen Idioten, der sich von den Herrschenden instrumentalisieren lässt.
In einem seiner politischsten Romane, angesiedelt in einer fiktiven Bananenrepublik, zeigt der Modernist Conrad, wie Profitgier und Machtwille einiger weniger ein Land zugrunde richten. In der Hauptfigur Nostromo wird auf faszinierend exemplarische Weise vorgeführt, dass der Einzelne in einem korrupten, ausbeuterischen System auf verlorenem Posten steht. Faszinierend modern ist an «Nostromo» nicht nur die Thematik von Machtmissbrauch und politischer Willkür, sondern auch die multiperspektivische Erzählweise, die Leserinnen und Leser zwingt, Identifikation und Parteinahme für die handelnden Figuren permanent zu hinterfragen.
«In seiner Mischung von Liebe und Verachtung für das Leben und in der wirren Überzeugung, verraten worden zu sein, verraten zu sterben, ohne zu wissen, von was oder von wem, ist er immer noch einer aus dem Volk, ihr unbestrittener Großer Mann – mit einer eigenen privaten Geschichte», so charakterisiert Joseph Conrad seinen Helden im Vorwort zum Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
«Es gibt keinen Roman, den ich lieber geschrieben hätte als Conrads ‹Nostromo›.»
F. Scott Fitzgerald
Ein Meisterwerk der Moderne zum 100. Todestag des Autors neu übersetzt, mit einem Nachwort von Robert Menasse.
In Costaguana herrschen Korruption, Verrat und Armut – abgesehen von dem unermesslichen Reichtum einiger weniger. Verlass ist nur auf Nostromo, den Capataz de Cargadores, Exil-Italiener, Kraftnatur und Tatmensch, der den Herren des Landes treu dient und unverhofft selbst in den Bann des Silbers gerät.
Im späten 19. Jahrhundert ist das südamerikanische Land zerrissen von politischen Konflikten und Machtkämpfen in- und ausländischer Mächte. Zwangsherrschaften und Revolutionen wechseln einander ab: Doch egal, welche Clique gerade die Oberhand hat, am grundlegenden System von Unterdrückung und Ausbeutung ändert sich nichts.
In einem seiner politischsten Romane, angesiedelt in einer fiktiven Bananenrepublik, zeigt der Modernist Conrad, wie Profitgier und Machtwille einiger weniger ein Land zugrunde richten. In der Hauptfigur Nostromo wird auf faszinierend exemplarische Weise vorgeführt, dass der Einzelne in einem korrupten, ausbeuterischen System auf verlorenem Posten steht. Faszinierend modern ist an «Nostromo» nicht nur die Thematik von Machtmissbrauch und politischer Willkür, sondern auch die multiperspektivische Erzählweise, die Leserinnen und Leser zwingt, Identifikation und Parteinahme für die handelnden Figuren permanent zu hinterfragen.
«Man kann diesen Roman als eine erste Bilanz der Erfahrungen und Einsichten des Abenteurers und Weltenbummlers Conrad lesen, als das große Tableau, in dem seine vorigen Romane und Erzählungen aufgehoben sind, auf eine Weise, die dann zum Standard für seine späteren Romane wurde: im Trivialen das Existenzielle zu sehen, und im Außergewöhnlichen (dem Abenteuerlichen) noch das Gewöhnliche, um nicht zu sagen: die Primitivität der Menschennatur.»
Robert Menasse
Joseph Conrad
NOSTROMO
Roman
Aus dem Englischen übersetzt von Julian Haefs und Gisbert Haefs
Mit einem Nachwort von Robert Menasse
MANESSE VERLAG
«Solch trüben Himmel klärt ein Sturm nur auf.»1
Shakespeare
Für John Galsworthy2
Erster Teil
Das Silber der Mine
Kapitel 1
Zur Zeit der spanischen Herrschaft3 und noch viele Jahre danach war die Stadt Sulaco – deren Orangengärten in ihrer üppigen Schönheit vom Alter des Orts zeugen – aus kommerzieller Sicht nie mehr gewesen als ein Hafen für den Küstenhandel und ein mittelgroßer lokaler Umschlagplatz für Rindsleder und Indigo. Die plumpen Hochsee-Galeonen der Eroberer, die kräftigen Wind brauchten, um sich überhaupt in Bewegung zu setzen, und träge dümpelten, wo moderne Klipper mit einem bloßen Flattern ihrer Segel stramme Fahrt aufnehmen, konnten Sulaco wegen der im großen Golf meist vorherrschenden Flaute kaum erreichen. Mancher Hafen auf der Welt lässt sich wegen tückischer Felsen und stürmischer See nur schwer ansteuern. Sulaco aber hatte in der feierlichen Stille des tiefen Golfo Plácido4 unantastbare Zuflucht vor den Versuchungen des Welthandels gefunden, als läge die Stadt in einem gewaltigen halbrunden Tempel ohne Dach, zum Ozean hin offen und eingerahmt von erhabenen Bergen, in denen die Wolken hingen wie Trauerflor.
Auf der einen Seite dieser ausladenden Einbuchtung im sonst geraden Gestade der Republik Costaguana bildet der letzte Sporn des Küstengebirges ein unbedeutendes Kap namens Punta Mala5. Aus der Mitte des Golfs ist diese Landspitze selbst gar nicht zu sehen; nur die Flanke der steilen Anhöhe im hinteren Teil lässt sich schwach wie ein Schatten am Himmel ausmachen.
Auf der anderen Seite schwebt auf dem gleißenden Horizont leicht etwas, das aussieht wie ein einzelner Fleck aus blauem Nebel. Das ist die Halbinsel Azuera, ein wildes Chaos aus gezackten Felsen und steinernen Terrassen, zerklüftet von senkrechten Schluchten. Sie liegt weit draußen im Meer wie ein grober Steinkopf, der sich auf einem schlanken Hals aus Sand und Dornbüschen aus der grün gewandeten Küste reckt. Sie ist ganz ohne Wasser, denn aller Regen fließt sogleich von den Flanken ins Meer ab, und der Boden reicht – sagt man – nicht aus, um auch nur einen Grashalm zu tragen, als wäre die Gegend durch einen Fluch verdorben. Die Armen, die aus einem dumpfen Trostbedürfnis die Konzepte des Bösen und des Reichtums miteinander verknüpfen, erzählen einem, Azuera sei todbringend wegen der dort versteckten Schätze. Die einfachen Leute aus der Gegend, meist peones6 auf den estancias, vaqueros der Küstenebene oder zahme Indios7, die mit einem Bündel Zuckerrohr oder einem Korb voll Maiskolben im Wert von etwa drei Pennys meilenweit zum Markt kommen, sind sich ganz sicher, dass Berge aus glänzendem Gold in der Düsternis der tiefen Schluchten liegen, die die Steinterrassen von Azuera kerben. Es ist überliefert, dass schon in alten Zeiten viele Abenteurer auf der Suche nach diesen Schätzen untergegangen sind. Auch erzählen einige Alte, dass sich noch zu ihren Lebzeiten zwei fahrende Seeleute – americanos vielleicht, irgendeine Art gringos aber ganz sicher – beim Kartenspiel mit einem nichtsnutzigen mozo unterhielten, und die drei stahlen einen Esel, der ein Bündel Reisig, einen Wasserschlauch und Vorräte für mehrere Tage tragen sollte. Derart ausgerüstet und mit Revolvern am Gürtel hatten sie begonnen, sich mit ihren Macheten einen Weg durch das Dornengestrüpp am Hals der Halbinsel zu schlagen.
Am zweiten Abend war zum ersten Mal seit Menschengedenken schwach eine gerade Rauchfahne (sie konnte nur von ihrem Lagerfeuer aufsteigen) vor dem Himmel über einer messerscharfen Klippe auf dem Steinkopf auszumachen. Die Besatzung eines Schoners, drei Meilen vor der Küste in einer Flaute, starrte dieses Schauspiel verblüfft bis in die Abenddämmerung an. Ein schwarzer Fischer, der unweit davon in einer einsamen Hütte in einer kleinen Bucht lebte, hatte sie aufbrechen sehen und hielt Ausschau nach irgendeinem Lebenszeichen. Als die Sonne gerade unterging, rief er seine Frau, und gemeinsam betrachteten sie voll Neid, Ungläubigkeit und Furcht dieses seltsame Omen.
Die gottlosen Abenteurer gaben kein weiteres Zeichen von sich. Die Seeleute, den Indio und den gestohlenen burro sah man nie wieder. Der mozo – der immerhin aus Sulaco stammte und dessen Frau einige Messen lesen ließ – und das arme vierbeinige Wesen, das ohne Sünde war, hatten vermutlich sterben dürfen, die beiden gringos aber hausen angeblich bis zum heutigen Tag als Geister zwischen den Felsen, unter dem unheilvollen Bann ihres Erfolgs. Ihre Seelen können sich nicht von den Leibern losreißen, die den gefundenen Schatz bewachen. Sie sind nun reich und hungrig und durstig – eine seltsame Vorstellung, diese hartnäckigen gringo-Geister, die als sture Ketzer ausgedörrt in ihren verhungerten Hüllen leiden, wo ein Christenmensch8 entsagt hätte und erlöst worden wäre.
Dies also sind die legendären Bewohner von Azuera, die ihren unrechtmäßigen Reichtum hüten; und der Schatten am Himmel auf der einen und der runde Fleck aus blauem Dunst, der dort den hellen Saum des Horizonts verschwimmen lässt, auf der anderen Seite sind die beiden Endpunkte des Bogens, der den Namen Golfo Plácido trägt, weil noch nie ein Sturm sein Wasser zerfurcht hat.
Sowie sie die imaginäre Linie zwischen Punta Mala und Azuera überqueren, versagt den Schiffen aus Europa mit Kurs auf Sulaco augenblicklich der starke Wind des Ozeans. Sie werden zum Spielball kapriziöser Lüfte, die sich manchmal bis zu dreißig Stunden nacheinander mit ihnen vergnügen. Der Kopf des stillen Golfs vor ihnen ist an den meisten Tagen von einem mächtigen Gebilde aus reglosen, undurchsichtigen Wolken verhangen. In den seltenen klaren Morgenstunden fällt ein anderer Schatten auf den weiten Golf. Die aufgehende Sonne bricht hoch hinter der zerklüftet aufragenden Mauer der Kordilleren hervor, gestochen scharf erheben die dunklen Gipfel ihre steilen Hänge über das erhabene Podest des Waldes, der gleich am Strand beginnt. Inmitten dieser Gipfel hebt sich das weiße Haupt des Higuerota majestätisch in das tiefe Blau. Kahle Haufen gewaltiger Steine sprenkeln die weichen Kuppeln aus Schnee wie winzige schwarze Punkte.
Wenn dann die Mittagssonne die Schatten der Berge aus dem Golf abzieht, beginnen die Wolken aus den tieferen Tälern heranzurollen. Sie hüllen die nackten Felswände über den bewaldeten Hängen in triste Fetzen, verbergen die Gipfel, ziehen als stürmische Rauchpfade über den Schnee des Higuerota. Schon sind die Kordilleren verschwunden, als hätten sie sich in große Haufen aus grauschwarzem Rauch verwandelt, die langsam hinaus aufs Meer wandern und sich entlang der Küste in der blendenden Hitze des Tages auflösen. Immer versucht der schwindsüchtige Rand der Wolkenbank, die Mitte des Golfs zu erreichen, meist jedoch ohne Erfolg. Die Sonne frisst ihn auf, wie die Seeleute sagen. Falls sich nicht durch Zufall ein dunkler Gewitterturm vom Wolkenleib trennt, einmal quer durch den Golf segelt und schließlich aufs offene Meer jenseits von Azuera entkommt, wo er plötzlich in Flammen und Donner aufgeht wie ein unheimliches fliegendes Piratenschiff, das über dem Horizont beidreht und den Ozean mit einer Breitseite bestreicht.
Nachts strebt der Wolkenleib höher hinauf in den Himmel und erstickt den ganzen stillen Golf mit undurchdringlicher Finsternis, in der Regengüsse zu hören sind, die jäh einsetzen und wieder abbrechen – mal hier, mal dort. Tatsächlich sind diese Wolkennächte bei den Seeleuten der gesamten Westküste des ausgedehnten Kontinents längst sprichwörtlich. Himmel, Land und Meer schwinden gemeinsam aus der Welt, wenn sich – wie man sagt – der Plácido unter seinem schwarzen Poncho schlafen legt. Die wenigen unter dem seewärts gerichteten Stirnrunzeln dieses Gewölbes noch verbliebenen Sterne scheinen schwächlich wie in die Öffnung einer dunklen Höhle. In ihrer unermesslichen Weite gleitet das Schiff, auf dem man sich befindet, ungesehen unter den Füßen dahin, seine Segel flattern unsichtbar in der Höhe. Selbst Gottes Augen – so fügen die Seeleute in grimmiger Blasphemie hinzu – könnten nicht erkennen, was die Hand eines Mannes dort tut; man könnte ungestraft den Teufel zu Hilfe rufen, würde nicht sogar seine Bosheit in solch blinder Finsternis zunichte.
Die Ufer des Golfs steigen zu allen Seiten steil an; die unbewohnten Inselchen, die sich knapp außerhalb des Wolkenschleiers direkt gegenüber der Einfahrt zum Hafen von Sulaco sonnen, werden «die Isabellen» genannt.
Da gibt es die Große Isabel; die Kleine Isabel, die ganz rund ist; und Hermosa9, die kleinste. Letztere ist kaum mehr als einen Fuß hoch und etwa sieben Schritt im Durchmesser, die bloße flache Oberseite eines grauen Felsens, der wie Schlacke nach einem Regen in der Sonne dampft, und kein Mensch hätte es je gewagt, vor Sonnenuntergang eine nackte Sohle daraufzusetzen. Auf der Kleinen Isabel steht eine zottige alte Palme mit einem prallen Stamm voller Stacheln, eine wahre Palmenhexe, die über dem groben Sand mit einem trostlosen Bündel toter Blätter raschelt. Auf der Großen Isabel entspringt aus der überwucherten Seite einer Schlucht eine Süßwasserquelle. Die Insel ähnelt einem smaragdfarbenen Keil von etwa einer Meile, liegt flach auf dem Meer und trägt nur zwei große Bäume, die ganz nah beieinanderstehen und zu Füßen ihrer glatten Stämme gemeinsam einen großen Schatten werfen. Eine Schlucht, die sich über die ganze Länge der Insel zieht, ist voller Buschwerk; auf der hohen Seite zeigt sie sich tief zerklüftet, auf der anderen läuft sie als seichte Vertiefung in den schmalen Sandstreifen aus.
Von diesem flachen Ende der Großen Isabel aus fällt der Blick durch eine Öffnung in zwei Meilen Entfernung – ganz abrupt, als hätte man sie mit der Axt aus der ebenmäßigen Küstenlinie gehackt – in den Hafen von Sulaco. Er ist ein längliches Gewässer, wie ein See. Auf der einen Seite reichen die kleinen bewaldeten Hügel und Täler am Fuß der Kordilleren fast rechtwinklig bis an den Strand; auf der anderen erstreckt sich die große Ebene von Sulaco, bis sie sich in weiter Ferne im Opalschimmer trockener Dunstschleier verliert. Ein Stück vom Hafen entfernt und seitlich versetzt, vom Meer aus nicht zu sehen, liegt zwischen den Bergen und der Ebene schließlich Sulaco selbst – hohe Mauern, eine mächtige Kuppel und gleißend weiße Balkone in einem weiten Hain aus Orangenbäumen.
Kapitel 2
Vom Strand der Großen Isabel aus betrachtet, ist das einzige Anzeichen von Handelsaktivität drüben im Hafen das stumpfe, kantige Ende einer hölzernen Mole. Die Oceanic Steam Navigation Company (allgemein OSN genannt) hatte sie über den seichten Teil der Bucht gebaut, nachdem sie beschlossen hatte, Sulaco zu einem ihrer Anlaufhäfen in der Republik Costaguana zu machen. Der Staat hat mehrere Häfen an der lang gestreckten Küste, aber bis auf das wichtige Cayta sind sie alle entweder kleine unvorteilhafte Buchten an dieser felsigen Küste – so zum Beispiel Esmeralda etwa sechzig Meilen weiter südlich – oder bloße offene Reeden, den Winden ausgesetzt und von der Brandung gepeitscht.
Vielleicht waren gerade die atmosphärischen Bedingungen, die die Handelsflotten vergangener Tage ferngehalten hatten, der Grund für die OSN gewesen, den Frieden des Zufluchtsorts zuschanden zu machen, der Sulacos ruhiges Dasein behütet hatte. Die unsteten Luftströmungen, die mit diesem weiten Halbrund aus Wasser hinter der Spitze von Azuera spielten, konnten der Dampfkraft ihrer vorzüglichen Flotte nichts anhaben. Jahr für Jahr waren die schwarzen Rümpfe ihrer Schiffe die Küste auf und ab gefahren, hinein und hinaus, vorbei an Azuera, vorbei an den Isabellen, vorbei an Punta Mala – hatten allem die Stirn geboten, ausgenommen der Tyrannei der Zeit. Ihre Namen, sämtlich der Mythologie entnommen, wurden zu vertrauten Begriffen an einer Küste, die nie von den olympischen Göttern beherrscht worden war. Die Juno war nur für ihre gemütlichen Kabinen mittschiffs bekannt, die Saturn für die Herzlichkeit ihres Kapitäns und den Luxus ihres bemalten und vergoldeten Salons, die Ganymede hingegen war vor allem für den Viehtransport ausgestattet und Passagieren an der Küste nicht zu empfehlen. Noch der einfachste Indio im entlegensten Küstendorf war vertraut mit der Cerberus, einem kleinen schwarzen Dampfer ohne nennenswerten Charme oder Kajüten, dessen Mission darin bestand, immer dicht die bewaldete Küste entlang an großen hässlichen Felsen vorbeizukriechen, pflichtbewusst an jeder Ansammlung von Hütten zu halten und Waren einzusammeln, bis hin zu drei Pfund schweren Paketen aus Kautschuk, eingewickelt in getrocknetes Gras.
Da ihnen selbst das kleinste Päckchen nur selten abhandenkam, sie kaum je einen Ochsen verloren und nie auch nur einen Passagier hatten ertrinken lassen, stand der Name OSN für höchste Vertrauenswürdigkeit. Die Menschen erklärten, ihr Leben und ihre Habe seien in der Obhut der Gesellschaft auf See sicherer als im eigenen Haus an Land. Der Geschäftsführer der OSN in Sulaco, zuständig für den gesamten Betrieb in Costaguana, war sehr stolz auf den Ruf seines Unternehmens und fasste ihn gern in einem Satz zusammen, der ihm oft über die Lippen kam. «Wir machen niemals Fehler.» Für die Offiziere der Gesellschaft wurde dies zu einer strengen Anweisung: «Wir dürfen keine Fehler machen. Ich dulde hier keine Fehler, ganz gleich, was Smith an seinem Ende tut.»
Smith, den er nie im Leben gesehen hatte, war der andere Geschäftsführer und saß gute fünfzehnhundert Meilen von Sulaco entfernt. «Erzählt mir nichts von eurem Smith.»
Dann beruhigte er sich schnell wieder und ließ das Thema mit beflissener Achtlosigkeit fallen. «Smith weiß von diesem Kontinent nicht mehr als ein Wickelkind.»
Kapitän Joseph Mitchell – «unser trefflicher Señor Mitchell» im geschäftlichen und politischen Leben Sulacos, «Pedanten-Joe» unter den Kapitänen der Gesellschaft – war stolz auf sein profundes Wissen über die Menschen und Dinge im Land – cosas de Costaguana. Zu Letzteren zählte er auch die für die ordnungsgemäße Arbeit seiner Gesellschaft besonders hinderlichen häufigen Regierungswechsel durch Militärrevolutionen.
Die politische Atmosphäre in der Republik war in jenen Tagen insgesamt stürmisch. Die flüchtigen Patrioten der jeweils unterlegenen Partei hatten die Angewohnheit, immer wieder mit einer halben Dampferladung Handfeuerwaffen und Munition an der Küste aufzutauchen. Angesichts ihrer völligen Mittellosigkeit zum Zeitpunkt der Flucht hielt Kapitän Mitchell solche Findigkeit für ein wahres Wunder. Er hatte beobachtet, «dass sie anscheinend nie genug Kleingeld bei sich haben, um das Billett für die Passage ins Ausland zu bezahlen». Und er wusste, wovon er sprach; eines denkwürdigen Tages war er nämlich dazu angehalten worden, das Leben des Diktators einer gestürzten Regierung sowie einiger seiner Funktionäre aus Sulaco zu retten – den Parteivorsitzenden, den Direktor des Zollamts und den Polizeichef. Der arme Señor Ribiera (so hatte der Diktator geheißen) war nach der verlorenen Schlacht von Socorro achtzig Meilen über Gebirgspfade gehetzt, in der Hoffnung, die fatalen Nachrichten zu überholen – was ihm auf dem Rücken eines lahmen Maultiers natürlich nicht gelang. Außerdem hauchte das arme Tier dann auch noch das Leben unter ihm aus, und zwar am Ende der Alameda, wo zwischen den Revolutionen manchmal abends die Militärkapelle aufspielt. «Sir», ergänzte Kapitän Mitchell oft mit düsterem Ernst, «das unzeitige Ableben des Maultiers hat die Aufmerksamkeit auf den unglücklichen Reiter gelenkt. Seine Gesichtszüge sind wiedererkannt worden, und zwar von mehreren Deserteuren aus der Armee des Diktators bei der schurkischen Meute, die schon dabei war, die Fenster der Intendencia einzuschlagen.»
Früh am Morgen desselben Tages hatte sich die Obrigkeit von Sulaco in die Zentrale der OSN geflüchtet, ein solides Gebäude am ufernahen Ende der Mole, und die Stadt so der Gnade des revolutionären Pöbels überlassen. Und da der Diktator aufgrund der strikten Rekrutierungsgesetze, die er im Laufe der Auseinandersetzungen hatte erlassen müssen, bei der Bevölkerung verhasst war, hatte er nun gute Aussichten, von der Menge in Stücke gerissen zu werden. Glücklicherweise war Nostromo – «unersetzlicher Bursche» – mit einigen italienischen Arbeitern, die man ins Land geholt hatte, um beim Bau der Nationalen Eisenbahn zu helfen, gerade in der Nähe und brachte es fertig, ihn zumindest vorläufig herauszuholen. Kapitän Mitchell gelang es schließlich, alle in seiner Gig zu einem der OSN-Dampfer zu schaffen – es war die Minerva, die dank eines glücklichen Zufalls just in dem Moment in den Hafen einlief.
Er musste die Herren an einem Tau aus einem Loch in der Rückwand des Gebäudes abseilen, während die Meute, die aus der Stadt herbeigeströmt war und sich über den ganzen Strand verteilt hatte, brüllend und schäumend vor dem Gebäude tobte. Er musste sie schnell die ganze Mole entlangscheuchen; es war eine verzweifelte Jagd gewesen, die sie beinahe alle den Kopf gekostet hätte, und wieder war es Nostromo – «ein Kerl, wie es ihn nur einmal unter tausend gibt» –, der diesmal an der Spitze der OSN-Leichterschiffer die Mole gegen den Ansturm des Pöbels verteidigte und so den Flüchtenden die nötige Frist verschaffte, um die Gig zu erreichen, die mit der Flagge der Gesellschaft im Heck am anderen Ende der Mole bereitlag. Stöcke, Steine, Schrotkugeln flogen; es wurden auch Messer geworfen. Kapitän Mitchell zeigte bereitwillig die lange Narbe eines Schnitts über linkem Ohr und Schläfe, der ihm mit einem an einem Stock befestigten Rasiermesser beigebracht worden war – eine Waffe, erläuterte er, «die bei den schlimmsten Niggern da draußen besonders beliebt ist».
Kapitän Mitchell war ein untersetzter älterer Mann mit hohem spitzem Kragen und gestutztem Backenbart, der gern eine weiße Weste trug und trotz seiner Aura pompöser Reserviertheit in Wahrheit sehr gesprächig war. «Diese Gentlemen», erzählte er oft mit überaus feierlicher Miene, «mussten rennen wie die Hasen, Sir. Ich selbst bin gerannt wie ein Hase. Bestimmte Todesarten sind – ähem – überaus geschmacklos für einen … einen … eh … angesehenen Mann. Sie hätten wohl auch mich totgeschlagen. Sir, ein blindwütiger Pöbel unterscheidet nicht mehr. Die glückliche Fügung unserer Rettung haben wir meinem Capataz de Cargadores zu verdanken, wie sie ihn hier in der Stadt getauft haben. Ein Mann, der damals, als ich seinen wahren Wert erkannt habe, Sir, einfacher Bootsmann auf einem italienischen Schiff war – ein großer genuesischer Frachter, eins der wenigen europäischen Schiffe, die je mit Stückgut nach Sulaco gekommen sind, bevor man mit dem Bau der Eisenbahn begann. Er hat sein Schiff wegen einiger angesehener Freunde verlassen, die er hier kennenlernte, alles Landsleute von ihm, aber auch, wie ich glaube, um etwas aus sich zu machen. Sir, ich kann Menschen recht gut beurteilen. Ich habe ihn als Vorarbeiter unserer Leichterschiffer und Verwalter unserer Mole angeheuert. Das war das Ausmaß seiner Tätigkeit. Aber ohne ihn wäre Señor Ribiera ein toter Mann gewesen. Dieser Nostromo, Sir, ein Mann ohne Fehl und Tadel, ist zum Schrecken aller Diebe dieser Stadt geworden. Wir waren damals verseucht, befallen, überrannt von ladrones und matreros, von Dieben und Mördern aus der gesamten Provinz. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits seit einer Woche in die Stadt geströmt. Sie haben das Ende gerochen, Sir. Fünfzig Prozent dieses mörderischen Pöbels waren professionelle Banditen vom Campo, aber keiner unter ihnen, der nicht schon von Nostromo gehört hätte. Und was die léperos der Stadt angeht, denen hat schon der Anblick seines schwarzen Schnurrbarts und seiner weißen Zähne gereicht. Sie haben vor ihm gezittert, Sir. So viel kann wahre Charakterstärke bewirken.»
Man konnte durchaus sagen, es sei Nostromo allein gewesen, der diesen Gentlemen das Leben gerettet hatte. Und Kapitän Mitchell seinerseits war nicht von ihrer Seite gewichen, bevor er sie keuchend, entsetzt und völlig außer sich, aber in Sicherheit auf den luxuriösen Samtsofas im Erste-Klasse-Salon der Minerva zusammenbrechen sah. Bis zum letzten Augenblick war er sorgsam darauf bedacht gewesen, den Ex-Diktator als «Eure Exzellenz» anzusprechen.
«Etwas anderes hätte ich gar nicht tun können, Sir. Der Mann war erledigt – totenblass und übersät mit Schrammen.»
Bei diesem Besuch der Bucht hatte die Minerva gar nicht erst geankert. Der Geschäftsführer wies sie an, den Hafen sofort wieder zu verlassen. Natürlich konnte die Ladung nicht gelöscht werden, und die nach Sulaco reisenden Passagiere weigerten sich, an Land zu gehen. Sie konnten die Schüsse hören und die Kämpfe am Kopf der Mole deutlich sehen. Der zurückgeschlagene Pöbel steckte seine Energie nun in einen Angriff auf das Zollhaus, ein trostloses Gebäude mit vielen Fenstern, das unfertig wirkte und etwa zweihundert Schritte von der OSN-Zentrale entfernt stand. Es war das einzige weitere Gebäude in Hafennähe. Nachdem Kapitän Mitchell den Kommandanten der Minerva angewiesen hatte, «diese Gentlemen» im ersten Hafen außerhalb Costaguanas an Land zu setzen, fuhr er in seiner Gig zurück, um herauszufinden, was er unternehmen konnte, um den Besitz der Gesellschaft zu schützen. Dieser und der Besitz der Eisenbahn wurden von den europäischen Anwohnern gesichert, das heißt von Kapitän Mitchell selbst und dem Stab der Ingenieure, die für den Bau der Trasse zuständig waren. Unterstützt wurden sie von den italienischen und baskischen Arbeitern, die sich treu hinter ihren englischen Chefs versammelten. Auch die Leichterschiffer der Gesellschaft, Einwohner der Republik, verhielten sich unter der Leitung ihres Capataz sehr gut. Sie waren ein Haufen Ausgestoßener wild gemischten Bluts, vor allem Neger, ewig im Streit mit den anderen Gästen der schäbigen Tavernen im Ort, und sie ergriffen mit Begeisterung diese Gelegenheit, unter solch günstigen Vorzeichen ihre persönlichen Fehden auszutragen. Keiner unter ihnen hatte nicht schon einmal mit Schrecken auf Nostromos Revolver nah vor dem Gesicht geschielt oder sich auf andere Art von Nostromos Entschlossenheit beeindrucken lassen. Er war, wie sie sagten, «ein ganzer Mann», ihr Capataz – zu hochmütig, um sie je zu beschimpfen, ein nimmermüder Zuchtmeister, der in seiner Unnahbarkeit umso furchterregender wirkte. Aber siehe da! Hier stand er nun an jenem Tag in vorderster Reihe, führte sie an und ließ sich gar dazu herab, scherzhafte Bemerkungen an diesen oder jenen unter ihnen zu richten.
Solche Führungskraft beseelte sie alle, und tatsächlich war dem Pöbel nicht mehr vergönnt, als einen – nur einen einzigen – Stapel Eisenbahnschwellen anzuzünden, die mit Teeröl bestrichen waren und daher sehr gut brannten. Ihr Hauptangriff aber – auf die Eisenbahnschuppen, auf die Zentrale der OSN und vor allem auf das Zollhaus, dessen Tresorraum bekanntlich einen großen Schatz in Silberbarren barg – schlug völlig fehl. Selbst das kleine Hotel des alten Giorgio, ganz allein auf halber Strecke zwischen der Stadt und dem Hafen, entging Plünderung und Zerstörung, allerdings nicht durch ein Wunder, sondern weil sie es mit dem Tresorraum vor Augen zuerst außer Acht gelassen und hinterher nicht die Zeit gefunden hatten, noch einmal anzuhalten. Nostromo mit seinen Cargadores war ihnen zu dicht auf den Fersen.
Kapitel 3
Man hätte sagen können, Nostromo habe dabei nur die Seinen beschützt. Von Anfang an hatte er in enger Vertrautheit bei der Familie des Hotelbesitzers wohnen dürfen, der ein Landsmann war. Der alte Giorgio Viola, ein Genueser mit struppiger weißer Löwenmähne – oft einfach «der Garibaldino»10 gerufen (wie Mohammedaner nach ihrem Propheten benannt sind) – war, um Kapitän Mitchells Worte zu benutzen, der «geachtete verheiratete Freund», auf dessen Ratschlag hin Nostromo das Schiff verlassen hatte, um in Costaguana sein Glück an Land zu versuchen.
Wie viele strenge Republikaner empfand der alte Mann nichts als Geringschätzung für den Pöbel und hatte die Vorboten des Aufruhrs ignoriert. Wie üblich schlenderte er an diesem Tag in Pantoffeln durch die Casa, murmelte erbost vor sich hin, um seiner Verachtung für die unpolitische Natur der Revolte Luft zu machen, und zuckte immer wieder mit den Schultern. Am Ende wurde er vom Ansturm der Menge unvorbereitet erwischt. Da war es zu spät, um seine Familie in Sicherheit zu bringen, aber wohin hätte er in der weiten Ebene auch flüchten sollen, mit der beleibten Signora Teresa und den zwei kleinen Mädchen? Also verbarrikadierte der alte Mann alle Öffnungen und setzte sich mit einer alten Flinte auf den Knien trotzig mitten in sein verdunkeltes Café. Seine Frau saß auf einem Stuhl neben ihm und murmelte fromme Fürbitten, an sämtliche Heiligen des Kalenders gerichtet.
Der alte Republikaner glaubte weder an Heilige noch an Gebete noch an das, was er die «Religion der Priester» nannte. Seine Gottheiten hießen Freiheit und Garibaldi; bei Frauen tolerierte er jedoch derlei «Aberglauben», wenngleich er diesem Thema generell mit hochmütigem Schweigen begegnete.
Seine beiden Mädchen – die älteste vierzehn, die andere zwei Jahre jünger – kauerten zu beiden Seiten von Signora Teresa auf dem mit Sand bestreuten Boden, die Köpfe in den mütterlichen Schoß gelegt; beide hatten Angst, wenn auch jede auf ihre Art, die dunkelhaarige Linda entrüstet und zornig, die blonde Giselle, die jüngere, verwirrt und in ihr Schicksal ergeben. Kurz hob die padrona ihre Arme, die sie um die Töchter gelegt hatte, bekreuzigte sich und rang hastig die Hände. Sie stöhnte ein wenig lauter. «Oh! Gian’ Battista, warum bist du nicht hier? Oh! Warum bist du nicht hier?»
Damit rief sie weniger den Heiligen11 selbst an als vielmehr Nostromo, dessen Namenspatron jener war. Und Giorgio, reglos auf dem Stuhl an ihrer Seite, sah sich durch diese vorwurfsvollen und verstörten Rufe gereizt. «Genug, Weib! Was soll das denn? Er hat seine Pflichten zu erfüllen», murmelte er im Dunkeln, und sie gab ächzend zurück: «Ach was! Dafür fehlt mir die Geduld. Pflichten! Was ist mit der Frau, die ihm wie eine Mutter war? Heute Morgen noch habe ich ihn bekniet; geh nicht raus, Gian’ Battista – bleib doch im Haus, Battistino – schau dir die beiden unschuldigen Kindlein an!»
Mrs. Viola war ebenfalls Italienerin, gebürtig aus La Spezia, und bereits mittleren Alters, wenn auch deutlich jünger als ihr Gemahl. Sie hatte ein schönes Gesicht, dessen Teint gelblich geworden war, da ihr das Klima von Sulaco gar nicht bekam. Ihre Stimme war ein voller Contralto. Wenn sie hinter dem Haus stand, die Arme fest unter dem ausladenden Busen verschränkt, und die plumpen chinesischen Mädchen mit den dicken Beinen schalt, die Wäsche aufhängten, Geflügel rupften oder Getreide in den hölzernen Mörsern zwischen den aus Lehm errichteten Wirtschaftsgebäuden hinter dem Haus zerstampften, konnte sie derart erregte, vibrierende, finstere Töne hervorbringen, dass der angekettete Wachhund mit mächtigem Gerassel in seine Hütte rannte. Luis, ein zimtfarbener Mulatte mit sprießendem Schnurrbart und üppigen dunklen Lippen, der das Café mit einem Bündel Palmblätter fegte, hielt kurz inne, während ihm ein sanfter Schauer den Rücken hinabrieselte. Seine schmachtenden Mandelaugen blieben dann eine ganze Weile geschlossen.
Dies waren die Angestellten der Casa Viola, aber sie alle waren früh an diesem Morgen bei den ersten Anzeichen des Aufruhrs geflohen, wollten sich lieber in der Ebene verstecken, als ihr Leben dem Haus anzuvertrauen; eine Vorliebe, die man ihnen keineswegs zum Vorwurf machen konnte, da man in der Stadt glaubte – ob es nun zutraf oder nicht –, der alte Garibaldino habe Geld unter dem Lehmboden der Küche vergraben. Der Hund, ein reizbares struppiges Vieh, bellte abwechselnd wild und jaulte dann kläglich, rannte in seine Hütte und kam wieder heraus, wie Wut oder Angst ihn eben trieben.
Gleich heftigen Windstößen in der Ebene schwoll lautes Geschrei rings um das verbarrikadierte Haus an und wieder ab; nach und nach wurden die Schreie von vereinzelten Schüssen übertönt. Zuweilen herrschte draußen wieder eine Zeit lang unerklärliche Stille, und nichts hätte fröhlicher und friedfertiger wirken können als die hellen schmalen Balken aus Sonnenlicht, die zwischen den geschlossenen Fensterläden hindurch quer durch das Café auf die unordentlich zusammengeschobenen Stühle und Tische an der Wand gegenüber fielen. Der alte Giorgio hatte diesen kargen Raum mit den weiß getünchten Wänden aus gutem Grund als Zuflucht gewählt. Es gab nur ein Fenster, und die einzige Tür schwang nach außen auf den staubigen Pfad zwischen Hafen und Stadt, wo schwerfällige Karren zwischen Aloehecken hinter langsamen Ochsen herrumpelten, gelenkt von Knaben zu Pferd.
In einer dieser Pausen der Stille spannte Giorgio seine Flinte. Das ominöse Geräusch entrang der reglosen Frau an seiner Seite ein leises Stöhnen. Ein plötzlicher Ausbruch aufrührerischen Gejohles ganz in der Nähe ebbte sofort wieder zu wirrem grollendem Gemurmel ab. Jemand rannte am Haus vorbei; als er die Tür passierte, hörte man einen Moment sein lautes Atmen; heiseres Murmeln und Schritte dicht an der Mauer; eine Schulter rieb sich am Fensterladen und brachte kurz die hellen Balken aus Sonnenlicht zum Verschwinden, die durch den ganzen Raum liefen. Signora Teresa umarmte die knienden Gestalten der Töchter noch inniger, mit krampfhaftem Druck.
Die vom Zollhaus vertriebene Meute teilte sich in mehrere Banden auf und zog sich über die Ebene in Richtung Stadt zurück. Das gedämpfte Knattern gelegentlicher Salven in der Ferne wurde noch weiter weg mit kaum vernehmbaren Schreien beantwortet. Dazwischen hörte man schwach vereinzelte Schüsse, und das niedrige, lange, weiße Gebäude, dessen Fenster allesamt mit Läden versperrt waren, schien sich im Zentrum des Tumults zu befinden, der sich in immer weiteren Kreisen um dies abgeschlossene Schweigen zog. Aber die verhaltenen Bewegungen und das Geflüster der Besiegten, die für einen Moment Schutz hinter der Mauer suchten, erfüllten den dunklen Raum, durchzogen von Streifen stummen Sonnenlichts, mit bösen, verstohlenen Geräuschen. Wie unsichtbare Geister, die um ihre Stühle schwebten, drangen sie den Violas ins Ohr und schienen sich murmelnd darüber auszutauschen, ob es ratsam wäre, die Casa dieses Ausländers in Brand zu stecken.
Es zehrte arg an ihren Nerven. Der alte Viola hatte sich langsam erhoben, die Flinte in der Hand, verharrte dann aber unschlüssig, da er keine Möglichkeit sah, sie aufzuhalten. Schon waren hinter dem Haus Stimmen zu hören. Signora Teresa war außer sich vor Angst. «Ach je, der Verräter. Der Verräter», murmelte sie fast unhörbar. «Jetzt werden sie uns verbrennen; und ich habe mich vor ihm auf die Knie geworfen. Aber nein! Er muss ja seinem Engländer auf dem Fuß folgen.»
Sie schien zu glauben, Nostromos bloße Anwesenheit hätte das Haus vollkommen sicher gemacht. Auch sie stand noch immer unter dem Zauber des Rufs, den sich der Capataz de Cargadores an der Küste und der Eisenbahnlinie erarbeitet hatte, bei den Engländern und bei der Bevölkerung von Sulaco. Ihm selbst und sogar ihrem Ehemann gegenüber gab sie immer vor, darüber zu lachen, manchmal gutmütig, öfter jedoch mit seltsamer Bitterkeit. Aber Frauen sind schließlich unbedacht in ihren Meinungen, wie Giorgio bei passender Gelegenheit ruhig anmerkte. In dieser Situation, die Flinte schussbereit in der Hand, beugte er sich zum Kopf seiner Frau herab, die Augen fest auf die verbarrikadierte Tür gerichtet, und flüsterte ihr zu, dass selbst Nostromo nicht hätte helfen können. Was sollten denn zwei Männer, eingeschlossen in diesem Haus, gegen zwanzig oder dreißig ausrichten, die entschlossen waren, das Dach in Brand zu stecken? Gian’ Battista dachte sicher unentwegt an die Casa, davon war er überzeugt.
«Er und an die Casa denken? Er?», keuchte Signora Teresa wie im Wahn. Sie schlug sich die flachen Hände gegen die Brust. «Ich kenne ihn. Er denkt an keinen außer an sich selbst.»
Eine Gewehrsalve ganz in der Nähe ließ sie den Kopf in den Nacken werfen und die Augen schließen. Der alte Giorgio biss die Zähne unter dem weißen Schnurrbart zusammen und verdrehte wild die Augen. Mehrere Kugeln schlugen gleichzeitig in die Hauswand ein; draußen hörte man Putz bröckeln; eine Stimme rief: «Da kommen sie!», und nach einem Moment unerträglicher Stille hörte man eine ganze Horde vor dem Haus vorbeirennen.
Da löste sich die verhärtete Miene des alten Giorgio, und ein Lächeln voll höhnischer Erleichterung legte sich auf die Lippen dieses alten Kämpen mit dem Löwengesicht. Das waren keine Streiter für Gerechtigkeit, sondern Halunken. Selbst sein Leben gegen sie verteidigen zu müssen, war eine Art Herabwürdigung für einen Mann, der als einer der Unsterblichen Tausend an Garibaldis Eroberung Siziliens12 teilgenommen hatte. Er empfand abgrundtiefe Verachtung für diesen Aufruhr von Schuften und léperos, die nicht wussten, was das Wort «Freiheit» wirklich bedeutete.
Er stellte sein altes Gewehr auf dem Boden ab, wandte den Kopf und betrachtete die kolorierte Lithografie Garibaldis in schwarzem Rahmen an der weißen Wand; ein Balken des kräftigen Sonnenlichts teilte sie senkrecht. Seine Augen, an das leuchtende Zwielicht gewöhnt, sahen die lebhafte Färbung des Gesichts, das rote Hemd, den Umriss der breiten Schultern, den schwarzen Tupfer des Bersaglieri-Huts13 mit den Hahnenfedern über der Krone. Ein unsterblicher Held! Das war die Freiheit; sie gab einem nicht nur Leben, sondern auch Unsterblichkeit!
Seine Schwärmerei für diesen einzigartigen Mann hatte sich nicht vermindert. Im Moment der Erleichterung nach der größten Gefahr, die seiner Familie auf all ihren Reisen gedroht haben mochte, hatte er sich erst nach dem Bild seines alten Kommandanten umgedreht, ehe er seiner Frau eine Hand auf die Schulter legte.
Die Kinder knieten noch immer reglos auf dem Boden. Signora Teresa öffnete die Augen ein wenig, als hätte er sie aus tiefem traumlosem Schlummer geweckt. Ehe er Zeit fand, ihr auf seine bedächtige Art ein paar beruhigende Worte zu sagen, sprang sie auf, während sich die Kinder noch eins an jeder Seite an sie klammerten, rang nach Atem und stieß ein heiseres Kreischen aus.
Es ertönte zugleich mit einem heftigen Schlag gegen die Außenseite des Fensterladens. Da hörten sie auch das Schnauben eines Pferds und das rastlose Trappeln von Hufen auf dem schmalen harten Pfad vor dem Haus; wieder krachte eine Stiefelspitze gegen den Fensterladen; bei jedem Knall klirrte ein Sporn, und eine aufgeregte Stimme rief: «¡Hola! ¡Hola da drinnen!»
Kapitel 4
Den ganzen Morgen über hatte Nostromo die Casa Viola aus der Ferne im Blick behalten, selbst mitten im wildesten Getümmel vor dem Zollhaus. «Falls ich da drüben Rauch aufsteigen sehe, sind sie verloren», dachte er bei sich. Sowie die Meute sich zu teilen begann, eilte er mit einer kleinen Gruppe italienischer Arbeiter in diese Richtung, ohnehin der direkteste Weg zur Stadt. Der Teil des Pöbels, den er verfolgte, schien sich beim Haus neu sammeln zu wollen; eine Salve seiner Gefolgsleute, abgefeuert hinter einer Aloehecke, schlug das Pack in die Flucht. In einer Lücke, die man für die Gleise der Hafenabzweigung gehauen hatte, erschien Nostromo auf seiner silbergrauen Stute. Er schrie, gab einen Schuss aus seinem Revolver ab und galoppierte zum Fenster des Cafés. Er vermutete, der alte Giorgio habe diesen Teil des Hauses als Rückzugsort genutzt.
Seine Stimme, die nach atemloser Hast klang, drang ins Innere: «¡Hola, Vecchio!Oh, Vecchio!14 Alles gut bei euch da drinnen?»
«Siehst du …», murmelte der alte Viola in Richtung seiner Frau. Signora Teresa schwieg jetzt. Nostromo draußen lachte. «Ich kann hören, dass die padrona noch lebt.»
«Du hast dir alle Mühe gegeben, mich vor Angst sterben zu lassen», rief Signora Teresa. Sie wollte noch etwas hinzusetzen, aber ihr versagte die Stimme.
Linda hob für einen Moment den Kopf und sah ihre Mutter an, aber der alte Giorgio rief bereits zur Entschuldigung. «Sie ist ein wenig aufgeregt.»
Nostromo draußen rief mit erneutem Gelächter zurück: «Mich kann sie nicht aufregen.»
Signora Teresa fand ihre Stimme wieder. «Ich bleibe dabei. Du hast kein Herz – und kein Gewissen, Gian’ Battista …»
Sie hörten ihn das Pferd von den Fensterläden abwenden. Die Truppe, die er anführte, plapperte angeregt auf Italienisch und Spanisch durcheinander, man stachelte einander zur Verfolgungsjagd auf. Nostromo setzte sich abermals an ihre Spitze und schrie: «Avanti!»15
«Er ist nicht lange bei uns geblieben. Lob von Fremden ist hier nicht zu bekommen», sagte Signora Teresa pathetisch. «Avanti! Ja, das ist alles, woran ihm liegt. Irgendwo und irgendwie immer Erster zu sein bei diesen Engländern. Die zeigen ihn bestimmt überall herum. ‹Das ist unser Nostromo!›» Sie lachte hämisch. «Was für ein Name! Was soll das überhaupt heißen, Nostromo? Der nimmt von denen sogar einen Namen an, der gar kein richtiges Wort ist.»
Währenddessen hatte Giorgio mit ruhigen Bewegungen die Tür entriegelt; eine Flut aus Licht fiel auf Signora Teresa und die beiden Mädchen zu ihren Seiten, eine malerische Dame in einer Pose mütterlicher Erregung. Die Wand hinter ihr war blendend weiß, die groben Farben der Garibaldi-Lithografie glommen im Sonnenschein.
Der alte Viola stand neben der Tür und reckte die Arme in die Höhe, als wollte er all seine flüchtig dahineilenden Gedanken auf dieses Bildnis seines alten Anführers übertragen. Selbst wenn er für die «signori inglesi»16 – die Ingenieure – kochte (und er war ein gerühmter Koch, obgleich seine Küche verrußt war), tat er dies gewissermaßen unter dem wachsamen Blick des großen Mannes, der ihn in einen glorreichen Kampf geführt hatte, bei dem man vor den Mauern Gaetas17 die Tyrannei für immer hätte ausmerzen können, wäre da nicht das verfluchte Pack der Piemontesen samt der Könige und Minister gewesen. Wenn hin und wieder eine Pfanne während einer delikaten Operation mit gehackten Zwiebeln Feuer fing und man den alten Mann fluchend und hustend rückwärts in einer beißenden Rauchwolke aus der Tür treten sah, konnte man den Namen Cavour18 – dieser Erzintrigant, der sich an Könige und Tyrannen verkauft hatte – in allerlei Verwünschungen hören, gerichtet an die chinesischen Mädchen, an das Kochen im Allgemeinen, an dieses rohe Land, in dem er nur noch von der Liebe zur Freiheit zehrte, die dieser Verräter erdrosselt hatte.
Dann kam Signora Teresa oft ganz in Schwarz aus einer anderen Tür, trat in würdevoller Sorge vor, neigte den feinen Kopf mit den dunklen Brauen, breitete die Arme aus und rief mit Inbrunst: «Giorgio, du Mann voller Leidenschaft! Misericordia divina!19 Einfach so in der prallen Sonne! Er wird sich noch eine Krankheit holen.»
Zu ihren Füßen stoben die Hennen mit großen Sätzen in alle Richtungen davon; falls gerade Ingenieure der Bahnstrecke weiter landeinwärts in Sulaco Station machten, schaute das eine oder andere junge englische Gesicht aus dem Billardzimmer hervor, das eine Seite des Hauses einnahm; während Luis der Mulatte im Café am anderen Ende des Hauses darauf achtete, nicht aufzufallen. Die Indio-Mädchen mit ihren Haaren wie wehende schwarze Mähnen, bekleidet nur mit Unterhemd und kurzem Rock, starrten trüb unter den stufig geschnittenen Stirnfransen hervor. Das Fett brutzelte nicht mehr laut, die Rauchschwaden schwebten im Sonnenschein himmelwärts, der strenge Geruch verbrannter Zwiebeln hing in der schläfrigen Hitze und hüllte das ganze Haus ein. Im Westen verlor sich der Blick im weiten flachen Grasland, als reichte diese Ebene zwischen der Sierra hinter Sulaco und dem Küstenstreifen in Richtung Esmeralda um die halbe Welt.
Nach einer beeindruckenden Pause fuhr Signora Teresa mit ihren Vorhaltungen fort: «Ach, Giorgio! Lass Cavour in Frieden und kümmere dich lieber um dich selbst, jetzt, wo wir, allein mit zwei Kindern, in diesem Land verloren sind, nur weil du nicht unter einem König leben kannst.»
Und während sie ihn ansah, führte sie zuweilen hastig eine Hand an ihre Seite, begleitet von einem knappen Zucken ihrer schönen Lippen und einem Kräuseln der geraden schwarzen Brauen, wie ein Aufflackern zornigen Schmerzes oder eines zornigen Gedankens in ihren hübschen ebenmäßigen Zügen.
Und Schmerz war es; sie ignorierte das Stechen. Ein paar Jahre nachdem sie Italien verlassen hatten und nach Amerika ausgewandert waren, hatte es sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht – damals hatten sie sich schließlich in Sulaco niedergelassen, nachdem sie von Ort zu Ort gezogen waren und sich auf verschiedene Weise ihren Lebensunterhalt verdient hatten; meist als Krämer, einmal aber auch als Fischhändler in Maldonado20 – denn wie der große Garibaldi war auch Giorgio einmal Seefahrer gewesen.
Manchmal verlor sie die Geduld ob der Schmerzen. Seit Jahren gehörte dieses nagende Gefühl für sie zur Landschaft zwischen dem glitzernden Hafen und dem bewaldeten Vorgebirge. Selbst der Sonnenschein war schwer und dumpf – schwer vor Schmerz –, nicht wie der Sonnenschein ihrer Jugend, als Giorgio in seinen mittleren Jahren am Ufer des Golfs von La Spezia ernst und leidenschaftlich um sie geworben hatte.
«Geh sofort zurück ins Haus, Giorgio», wies sie ihn an. «Man könnte meinen, du hättest überhaupt kein Mitleid mit mir – und das mit vier signori inglesi unter unserem Dach.»
«Va bene, va bene»,21 murmelte Giorgio. Und gehorchte, denn die signori inglesi würden bald nach ihrem Mittagsmahl verlangen. Er hatte zu diesem unsterblichen und unbesiegbaren Truppe von Freiheitskämpfern gehört, die die Söldner der Tyrannei wie Spreu im Orkan zerstreut hatte, «un uragano terribile»22. Aber das war, bevor er geheiratet und Kinder gezeugt hatte. Und bevor die Tyrannei in Gestalt der Verräter, die Garibaldi, seinen Helden, gefangen setzten, abermals ihr hässliches Haupt erhob.
Drei Türen gab es in der Vorderseite des Hauses, und jeden Nachmittag konnte man den Garibaldino mit seinem großen Busch weißer Haare in der einen oder anderen stehen sehen, die Arme vor der Brust verschränkt und die Beine über Kreuz, wie er seinen Löwenkopf an den Türrahmen lehnte und in die bewaldeten Hänge unter der schneebedeckten Kuppe des Higuerota hinaufschaute. Die Vorderseite des Hauses warf einen langen rechteckigen Schatten, der sich allmählich über die weichen Spurrillen der Ochsenkarren legte. Durch die in die Oleanderhecken gehackten Lücken erstreckte sich die provisorische Hafenabzweigung der Schienen wie ein leuchtendes paralleles Band in einer weiten Biegung aus versengtem dürrem Gras über die Ebene, keine sechzig Schritte von der Rückseite des Hauses entfernt. Abends passierten die Züge mit den leeren flachen Waggons in einem Bogen den dunkelgrünen Hain von Sulaco und kamen auf ihrem Weg zu den Bahnschuppen am Hafen unter wellenförmigen weißen Dampfwolken an der Casa Viola vorbei. Die italienischen Lokführer begrüßten ihn vom Führerstand aus mit erhobener Hand, während die schwarzen Bremser, deren breitkrempige Hüte im Wind flatterten, sorglos auf ihren Bremssitzen saßen und geradeaus blickten. Als Antwort gönnte Giorgio ihnen ein knappes Seitwärtszucken des Kopfs, ohne die Arme von der Brust zu nehmen.
An diesem denkwürdigen Tag des Aufruhrs waren seine Arme nicht vor der Brust verschränkt. Seine Hände umfassten den Lauf der Flinte, die er auf der Türschwelle abgestellt hatte; nicht ein einziges Mal schaute er zur weißen Kuppe des Higuerota hinauf, dessen kühle Reinheit sich hochmütig von der heißen Erde abzuheben schien. Neugierig schweifte sein Blick über die Ebene. Hier und da fielen hohe Staubfahnen in sich zusammen. Die Sonne hing klar und blendend am fleckenlosen Himmel. Mehrere Gruppen von Männern rannten wie kopflos umher; andere formierten sich zum Kampf; das gelegentliche Knattern von Feuerwaffen drang in der flirrend reglosen Luft wie Kräuselwellen an sein Ohr. Einzelne Gestalten hasteten zu Fuß verzweifelt davon. Reiter galoppierten aufeinander zu, wandten sich gemeinsam um, entfernten sich schnell voneinander. Giorgio sah einen zu Boden gehen, Reiter und Pferd verschwanden so plötzlich, als wären sie in einen Abgrund galoppiert. Die Bewegungen dieser lebhaften Szenerie wirkten wie Ausschnitte eines gewalttätigen Spiels, das dort draußen in der Ebene von Zwergen zu Pferd und zu Fuß ausgetragen wurde, die im Schatten des Berges, der wie die kolossale Verkörperung der Stille wirkte, aus winzigen Kehlen brüllten. Nie zuvor hatte Giorgio diesen Teil der Ebene so voller Leben gesehen; sein Blick konnte nicht alle Details auf einmal erfassen; mit der Hand beschirmte er die Augen, bis ihn das plötzliche Donnern vieler Hufe ganz in der Nähe zusammenfahren ließ.
Eine Schar Pferde war aus der umzäunten Koppel der Eisenbahngesellschaft ausgebrochen. Sie kamen wie ein Wirbelwind heran und fegten schnaubend, auskeilend, wiehernd über die Gleise hinweg, mit wild vor- und zurückgeworfenen Köpfen in einem dichten scheckigen Haufen aus rotbraunen, dunkelbraunen und grauen Rücken, mit starren Blicken, gereckten Hälsen, geröteten Nüstern und wehenden langen Schweifen. Sobald sie die Straße erreichten, wirbelten ihre Hufe eine dicke Staubwolke auf, sodass keine sechs Meter von Giorgio entfernt nur noch ein braunes Wallen aus schemenhaften Hälsen und Kruppen vorbeirollte. Die Erde bebte.
Viola hustete, wandte das Gesicht von der Wolke ab und schüttelte sachte den Kopf. «Die wird wohl jemand noch vor dem Abend alle wieder einfangen müssen», murmelte er.
In dem Viereck aus Sonnenlicht, das durch die geöffnete Tür in den Raum fiel, kniete Signora Teresa vor dem Stuhl und hatte ihren Kopf mit der schweren wirren Masse aus ebenholzfarbenem, von Silber durchzogenem Haar über die Handflächen gebeugt. Der schwarze Spitzenschal, den sie um ihr Gesicht zu schlingen pflegte, war neben ihr auf den Boden geglitten. Die beiden Mädchen standen Hand in Hand in ihren kurzen Röckchen da; die offenen Haare fielen unordentlich herab. Die Jüngere hatte einen Arm vor die Augen gehoben, als fürchte sie das helle Licht. Linda hatte ihr die andere Hand auf die Schulter gelegt und starrte furchtlos nach draußen. Viola betrachtete seine Töchter.
Die Sonne brachte die tiefen Furchen seines Gesichts zum Vorschein, und so energisch er auch dreinblickte, hatte seine Miene doch etwas von der Reglosigkeit einer Schnitzerei. Man konnte unmöglich ergründen, was er dachte. Die buschigen grauen Brauen beschirmten seinen finsteren Blick.
«Na? Willst du nicht beten, wie deine Mutter?»
Linda schmollte, wölbte ihre roten Lippen vor, die fast schon zu rot waren; aber sie hatte wunderbare Augen, braun, mit goldenen Einsprengseln in der Iris, intelligent und ausdrucksstark und so hell, dass sie ein Leuchten auf ihr schmales, blasses Gesicht zu werfen schienen. In ihren dunklen Locken schimmerten ein paar Stellen wie Bronze, und ihre Wimpern – lang und rabenschwarz – ließen ihren Teint sogar noch blasser erscheinen. «Mutter wird in der Kirche eine Menge Kerzen opfern. Das tut sie immer, wenn Nostromo weg war und gekämpft hat. Ich werde ein paar zur Kapelle der Madonna in der Kathedrale tragen müssen.»
Dies sagte sie schnell, mit großer Selbstgewissheit und lebhafter, durchdringender Stimme. Dann rüttelte sie ihre Schwester sanft an der Schulter und fügte hinzu: «Und sie hier wird auch eine tragen müssen.»
«Aber wieso müssen?», fragte Giorgio ernst. «Möchte sie das denn nicht?»
«Sie ist schüchtern», sagte Linda und lachte kurz auf. «Die Leute sehen ihr blondes Haar, wenn sie mit uns unterwegs ist. Sie rufen ihr hinterher ‹Guckt euch die rubia an! Schaut euch diese rubita an!› So was rufen sie auf offener Straße. Sie ist schüchtern.»
«Und du? Du bist nicht schüchtern, wie?», sagte der Vater langsam.
Sie warf all ihr schwarzes Haar zurück. «Mir ruft niemand hinterher.»
Nachdenklich betrachtete der alte Giorgio seine Kinder. Zwei Jahre lagen zwischen ihnen. Sie waren ihm spät geschenkt worden, viele Jahre nachdem der Junge gestorben war. Hätte er überlebt, wäre er nun fast so alt wie Gian’ Battista – den die Engländer «Nostromo» nannten; was aber seine Töchter anging, so hatte Giorgio aufgrund seines strengen Naturells, des fortschreitenden Alters und seiner Versunkenheit in Erinnerungen nie allzu große Notiz von ihnen genommen. Er liebte seine Kinder, aber Mädchen gehören eher der Mutter, und ein Großteil seiner Zuneigung war in die Verehrung und in den Dienst an der Freiheit geflossen.
Als sehr junger Mann war er von einem Handelsschiff im Río de la Plata desertiert, um in die Marine von Montevideo einzutreten, damals unter dem Befehl von Garibaldi23. Später hatte er in der Italienischen Legion24 der Republik Uruguay, die gegen die anmaßende Tyrannei von Rosas25 kämpfte, auf weiten Ebenen und an den Ufern riesiger Flüsse an den vielleicht heftigsten Kämpfen teilgenommen, die die Welt je sah. Er hatte unter Männern gelebt, die über die Freiheit deklamierten, für die Freiheit litten, für die Freiheit starben, und all das mit verzweifelter Inbrunst, die Blicke auf das geknechtete Italien gerichtet. Seine Begeisterung war vom Anblick grausamer Blutbäder genährt worden, von Beispielen erhabener Hingabe, vom Lärm des bewaffneten Kampfs, von der flammenden Sprache der Proklamationen. Nie war er dem Anführer, den er selbst gewählt hatte, diesem feurigen Apostel der Unabhängigkeit, von der Seite gewichen, in Amerika und später in Italien bis zum verhängnisvollen Tag von Aspromonte26, als sich durch die Verwundung und Gefangennahme seines Helden der Welt die ganze Niedertracht von Königen, Kaisern und Ministern offenbarte – eine Katastrophe, die ihn mit düsteren Zweifeln daran erfüllt hatte, jemals die Wege der göttlichen Gerechtigkeit ergründen zu können.
Was nicht hieß, dass er Seine Existenz leugnete. Es verlangte Geduld, sagte er oft. Obwohl er Priester nicht mochte und um keinen Preis bereit war, seinen Fuß in eine Kirche zu setzen, glaubte er an Gott. Erfolgten denn nicht alle Proklamationen an die Völker gegen Tyrannen im Namen von Gott und Freiheit? «Gott den Männern – Religionen den Frauen», murmelte er manchmal. Auf Sizilien hatte ihm ein Engländer, in Palermo aufgetaucht, nachdem die Armee des Königs aus der Stadt abgezogen war, eine Bibel auf Italienisch geschenkt – eine Publikation der British and Foreign Bible Society27 mit einem dunklen Ledereinband. In Zeiten politischer Widrigkeiten, in den Phasen der Stille, wenn die Revolutionäre keine Proklamationen herausgaben, verdingte Giorgio sich mit der erstbesten Arbeit, die sich ihm bot – als Seemann, als Hafenarbeiter auf den Kais von Genua, einmal sogar als Landarbeiter auf einem Bauernhof in den Hügeln oberhalb von La Spezia –, und studierte in seiner Freizeit dieses dicke Buch. Er trug es mit sich in die Schlacht. Nun war es seine einzige Lektüre, und um nicht darauf verzichten zu müssen (die Lettern waren sehr klein), hatte er sich bereitgefunden, eine in Silber gefasste Brille als Geschenk von Señora Emilia Gould anzunehmen, der Frau des Engländers, der die Silbermine leitete, neun Meilen von der Stadt entfernt in den Bergen. Sie war die einzige Engländerin in Sulaco.
Giorgio Viola hegte große Achtung für die Engländer. Diese Empfindung, geboren auf den Schlachtfeldern von Uruguay, war mindestens vierzig Jahre alt. Etliche Engländer hatten ihr Blut für die Sache der Freiheit Amerikas gegeben. Der erste, den er je gekannt hatte, war ein Mann namens Samuel gewesen; er hatte bei der berühmten Belagerung von Montevideo28 eine Negerkompanie unter Garibaldi kommandiert und war zusammen mit seinen Negern heldenhaft bei der Durchquerung der Boyarda29 gestorben. Giorgio selbst hatte damals den Rang eines Fähnrichs – alférez – erreicht und für den General gekocht. Später in Italien war er im Rang eines Leutnants mit dem Stab geritten und hatte noch immer für den General gekocht. Während des gesamten Feldzugs in der Lombardei hatte er für ihn gekocht; beim Marsch auf Rom hatte er sich in der Campagna30 sein Rindfleisch auf amerikanische Art mit dem Lasso besorgt; bei der Verteidigung der Römischen Republik war er verwundet worden; er war einer der vier Flüchtigen gewesen, die zusammen mit dem General den reglosen Leib von dessen Frau31 aus dem Wald in das kleine Bauernhaus getragen hatten, wo sie, erschöpft von den Entbehrungen des schrecklichen Rückzugs, schließlich starb. Diese entsetzliche Zeit hatte er überstanden, um seinem General in Palermo zu dienen, als die neapolitanischen Geschosse von der Festung in der Stadt einschlugen. Nach einem ganzen Tag von Gefechten hatte er für ihn auf dem Schlachtfeld am Volturno32 gekocht. Und überall hatte er Engländer an vorderster Front in der Armee der Freiheit gesehen. Er respektierte ihre Nation, weil sie Garibaldi liebten. Sogar ihre Gräfinnen und Prinzessinnen hätten dem General in London die Hände geküsst, erzählte man sich. Das glaubte er ohne Weiteres – ihre Nation war edelmütig, und der Mann war ein Heiliger. Man brauchte ihm nur ein Mal ins Gesicht zu schauen, um die göttliche Kraft des Glaubens zu sehen, die ihn durchströmte, und sein großes Mitgefühl für alle, die in dieser Welt Armut, Leid oder Unterdrückung ertragen mussten.
Der Geist der Selbstvergessenheit, der schlichten Hingabe an ein gewaltiges humanitäres Ideal, welches das Denken und die Rhetorik jener revolutionären Zeiten beseelte, hatte Giorgio gewissermaßen durch strenge Verachtung jedes persönlichen Vorteils gezeichnet. Dieser Mann, den selbst die unterste Klasse in Sulaco verdächtigte, einen Schatz in seiner Küche vergraben zu haben, hatte Geld sein Leben lang verschmäht. Die Anführer seiner Jugend hatten arm gelebt und waren arm gestorben. Es war ihm zu einer Geisteshaltung geworden, nicht an morgen zu denken. Dies war teils einem Leben voller Überschwang, Abenteuer und wilder Kämpfe geschuldet. Vor allem aber war es eine Sache des Prinzips. Es hatte nichts mit dem Leichtsinn eines condottiere33 zu tun, sondern war eine Art Puritanismus der Haltung, aus ebenso strikten Eifer geboren wie religiöser Puritanismus.
Diese strenge Hingabe an eine Sache hatte im Alter eine gewisse Düsternis über Giorgio gebracht. Düsternis, weil seine Sache verloren schien. Es gab noch immer zu viele Könige und Kaiser auf dieser Welt, die Gott für das Volk vorgesehen hatte. Auch ob seiner Naivität war Giorgio bekümmert. Wiewohl er immer bereit war, seinen Landsleuten zu helfen, und bei italienischen Auswanderern hohes Ansehen genoss, wo immer er lebte (in seinem Exil, wie er sagte), konnte er doch die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass sich diese Leute überhaupt nicht für das Schicksal geknechteter Völker interessierten. Seinen Geschichten über den Krieg lauschten sie bereitwillig, schienen sich aber immer zu fragen, was ihm das Ganze wohl eingebracht habe. Nichts, soweit sie das sehen konnten. «Wir wollten nichts haben, wir haben der ganzen Menschheit zuliebe gelitten!», schrie er manchmal wutentbrannt, und die dröhnende Stimme, die lodernden Augen, die wogende weiße Mähne, die braune sehnige Hand, die nach oben wies, wie um den Himmel selbst zum Zeugen anzurufen, beeindruckten seine Zuhörer. Nachdem der alte Mann plötzlich verstummte, mit einer ruckartigen Bewegung von Kopf und Arm, die eindeutig «aber was nützt es schon, mit euch darüber zu reden?» bedeutete, stupsten sie einander an. Da war eine Intensität des Gefühls, ein Grad an persönlicher Überzeugung, etwas, das sie «terribilità»34 nannten. «Ein alter Löwe», so sprachen sie von ihm. Ein kleiner Zwischenfall, ein zufällig geäußertes Wort reichte aus, schon brauste er auf und redete am Strand von Maldonado auf die italienischen Fischer ein, oder später in dem kleinen Laden, den er in Valparaíso35 betrieb, auf seine Landsleute unter den Kunden, oder abends unverhofft im Café auf der einen Seite der Casa Viola (die andere war für die englischen Ingenieure reserviert) auf die ausgesuchte Kundschaft der Maschinisten und Vorarbeiter aus den Bahnschuppen.
Mit schönen, gebräunten, schmalen Gesichtern, glänzend schwarzen Locken, funkelnden Augen, mit breiter Brust und prächtigem Bart und manchmal einem kleinen Goldring im Ohrläppchen hörte ihm die Aristokratie der Eisenbahner zu und wandte sich von ihren Spielkarten oder Dominosteinen ab. Hier und da saß ein blonder Baske und musterte so lange geduldig sein Blatt, ohne zu protestieren. In diesen Raum drang kein Einheimischer aus Costaguana ein. Dies war die Hochburg der Italiener. Selbst die Polizisten aus Sulaco lenkten auf nächtlicher Patrouille ihre Pferde leise am Haus vorbei, beugten sich nur im Sattel hinab, um durch das Fenster einen Blick auf die Köpfe zwischen den Rauchschwaden zu erhaschen; und das eintönige deklamierende Dröhnen der Erzählung des alten Giorgio schien hinter ihnen in die Ebene zu sinken. Nur dann und wann tauchte der Stellvertreter des Polizeichefs, ein brauner kleiner Herr mit breitem Gesicht und einer Menge Indioblut, persönlich auf. Er ließ seinen Burschen draußen bei den Pferden und kam wortlos mit einem selbstsicheren, listigen Lächeln zum langen Tisch. Er deutete auf eine der Flaschen oben auf dem Regalbrett; Giorgio steckte sich die Pfeife in den Mund und bediente ihn persönlich. Es herrschte vollkommene Stille, bis auf das leise Klirren der Sporen. Sobald er das Glas geleert hatte, ließ er lässig seinen prüfenden Blick durch den Raum schweifen, trat hinaus und ritt langsam in einem Bogen zurück zur Stadt.
Kapitel 5
Nur in dieser Form wurde die Macht der örtlichen Behörden in Bezug auf die große Menge kräftiger Fremdlinge eingesetzt, die für das «fortschrittliche und patriotische Unterfangen» in der Erde gruben, Felsen sprengten und Maschinen bedienten. Mit diesen Worten hatte der Excelentísimo Señor Don Vincente Ribiera, Diktator von Costaguana, die Nationale Zentrale Eisenbahn achtzehn Monate zuvor in seiner großen Rede anlässlich des ersten Spatenstichs beschrieben.
Er war zu diesem Zweck nach Sulaco gekommen und hatte danach gegen ein Uhr an einem festlichen Mittagessen teilgenommen, einem convite der OSN an Bord der Juno nach der Zeremonie an Land. Kapitän Mitchell persönlich hatte den über und über mit Flaggen behangenen Leichter gesteuert, der den Excelentísimo im Schlepptau des motorisierten Beiboots der Juno von der Mole zum Schiff brachte. Alle wichtigen Personen Sulacos waren eingeladen worden – die wenigen ausländischen Händler, alle damals in der Stadt befindlichen Vertreter der alten spanischen Familien, die Besitzer der großen Landgüter in der Ebene – ernste, höfliche, einfache Männer, reinblütige Caballeros mit kleinen Händen und Füßen, konservativ, gastlich und zuvorkommend. Die Westprovinz war ihre Hochburg; ihre Blanco-Partei hatte triumphiert; es war ihr Präsidialdiktator, ein Blanco aller Blancos, der nun mit weltmännischem Lächeln zwischen den Vertretern zweier freundlich gesonnener fremder Mächte saß. Sie waren mit ihm aus Santa Marta angereist, um durch ihre Anwesenheit dies Unterfangen zu fördern, an dem Kapital aus ihren beiden Ländern beteiligt war.
Die einzige Dame in dieser Gesellschaft war Mrs. Gould, die Frau von Don Carlos, dem Verwalter der Silbermine von San Tomé. Sulacos Damen waren nicht aufgeschlossen genug, um in diesem Ausmaß am öffentlichen Leben teilzunehmen. Beim großen Ball in der Intendencia am Vorabend waren sie zahlreich erschienen, auf der mit rotem Stoff ausgekleideten Bühne aber, errichtet im Schatten eines Baums am Hafen, wo der feierliche erste Spatenstichs stattgefunden hatte, war allein Mrs. Gould zugegen – ein leuchtender Farbtupfer zwischen den schwarzen Gehröcken hinter dem Präsidenten und Diktator. Auch sie war mit all den anderen Würdenträgern im Leichter gekommen und hatte unter den fröhlich flatternden Flaggen auf dem Ehrenplatz gesessen, neben Kapitän Mitchell, der das Boot steuerte, und später war ihr helles Kleid der einzige wahrlich festliche Anblick bei der ernsten Zusammenkunft im langen, prächtigen Salon der Juno.
Der Kopf des Vorsitzenden der Eisenbahngesellschaft (aus London), stattlich und blass in einer silbrigen Wolke weißer Haare und mit sorgsam gestutztem Bart, schwebte dicht neben ihrer Schulter, aufmerksam, lächelnd und erschöpft. Die Reise von London nach Santa Marta mit Postdampfern und dem Sonderzug der Santa-Marta-Küstenstrecke (bislang einzige Eisenbahn des Landes) war erträglich gewesen – sogar angenehm –, durchaus erträglich. Der Weg über die Berge nach Sulaco hingegen war eine ganz andere Erfahrung, in einer altersschwachen diligencia über unpassierbare Straßen, die sich an grässlichen Abhängen entlangwanden.
«Wir sind zweimal an einem Tag umgestürzt, am Rand sehr tiefer Schluchten», erzählte er Mrs. Gould halblaut. «Ich weiß wirklich nicht, was wir ohne Ihre Gastfreundschaft getan hätten, als wir endlich hier angekommen sind. Was für ein entlegener Flecken Erde Sulaco doch ist! Und das auch noch als Hafenstadt! … Ganz erstaunlich!»
«Wir sind aber sehr stolz darauf. Der Ort hat eine bedeutende Geschichte. Hier saß in den alten Tagen das höchste Kirchengericht zweier Vizekönigreiche», klärte sie ihn lebhaft auf.
«Ich bin beeindruckt. Ich wollte nicht geringschätzig klingen. Sie scheinen tiefe patriotische Gefühle zu hegen.»
«Dieser Ort ist reizend, allein schon seiner Lage wegen. Vielleicht ist Ihnen nicht klar, was für eine alteingesessene Person ich hier bin.»
«Wie alt, ja, das frage ich mich auch», murmelte er und betrachtete sie mit einem feinen Lächeln. Mrs. Gould wirkte dank der lebhaften Intelligenz ihres Gesichts jugendlich. «Die Kirchengerichte können wir Ihnen leider nicht zurückgeben; dafür sollen Sie mehr Dampfschiffe bekommen, eine Eisenbahn, ein Telegrafennetz – eine Zukunft als Teil der großen weiten Welt, die unendlich viel mehr wert ist als jede Kirchengeschichte. Sie werden mit etwas in Berührung kommen, das größer ist als zwei Vizekönigreiche. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Ort an der Küste derart weltabgewandt bleiben könnte. Läge er tausend Meilen im Landesinneren, geschenkt, aber so – überaus bemerkenswert! Hat sich hier vor dem heutigen Tag im Lauf der letzten hundert Jahre jemals irgendetwas ereignet?»
Während er so bedächtig und humorvoll redete, wahrte Mrs. Gould ihr leichtes Lächeln. Voll Ironie versicherte sie ihm, dass sich in Sulaco ganz bestimmt nie etwas zutrug. Selbst die Revolutionen, deren es während ihrer Zeit hier bereits zwei gegeben habe, hätten die Ruhe dieses Orts respektiert. Sie hätten sich in erster Linie in den dichter besiedelten südlichen Landesteilen der Republik zugetragen und im weiten Tal von Santa Marta, das für die Parteien ein einziges großes Schlachtfeld darstellte, mit der Hauptstadt als Preis und dem Zugang zu einem weiteren Ozean. Dort sei man fortschrittlicher. Hier in Sulaco vernehme man nur die Echos der großen Fragen, und natürlich ändere sich deren amtliche Fassung jedes Mal, wenn sie das Bollwerk der Berge überwinde, das er persönlich mit so großer Gefahr für Leib und Leben in einer alten diligencia überquert habe.
Der Vorsitzende der Eisenbahngesellschaft erfreute sich bereits seit einigen Tagen ihrer Gastfreundschaft und war ihr wirklich sehr dankbar. Erst seit seinem Aufbruch aus Santa Marta hatte er angesichts der exotischen Umgebung vollends den Bezug zu einem europäischen Lebensgefühl verloren. In der Hauptstadt war er Gast der Gesandtschaft gewesen und hatte von früh bis spät mit den Mitgliedern der Regierung Don Vincentes verhandelt – kultivierte Männer, denen zivilisierte Geschäftspraktiken nicht unbekannt waren.





























