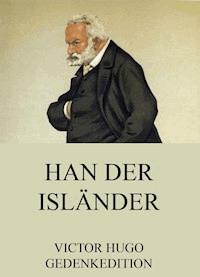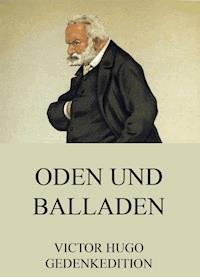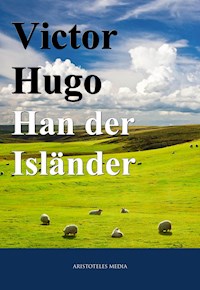Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Glöckner von Notre-Dame ist ein historischer Roman vom missgestalteten Glöckner Quasimodo, der sich in die schöne Zigeunerin Esmeralda verliebt. Weltliteratur eines Ausnahmekünstlers erleben! Zum unbestrittenen Kanon der Weltliteratur gehören dieses Werk mit anhaltendem und vielfältigem Einfluss auf die Literaturgeschichte – bis heute. Spannend und vielschichtig, tiefgründig und unterhaltend, informativ und faszinierend ist dieses Machwerk dieses Ausnahme-Schriftstellers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
Notre – Dame
oder die Liebfrauenkirche zu Paris
Ein historischer Romanund die gesammelten Werke
Einleitung
Victor Hugo ist in der ganzen Welt, von Freund und Feind, als einer der ausgezeichnetsten Dichter anerkannt, die je auf Erden gewandelt. Er wurde 1802 in Besançon geboren und gehört einer alten, schon vor Jahrhunderten auf den Schlachtfeldern geadelten Grafenfamilie an. Sein Vater, der als General in den Diensten des Königs Joseph Bonaparte zuerst in Neapel focht, wo er dem gefährlichen Räuber oder vielmehr Parteigänger Fra Diavolo das Handwerk legte, und dann den spanischen Krieg mitmachte, nahm, wie andere Napoleon'sche Feldherren, seine Familie mit, und so kam es, daß Victor Hugo schon in seiner zartesten Kindheit in Italien und Spanien reiste. Die Sonne des Südens wärmte mit ihren glühendsten Strahlen dieses enthusiastische junge Haupt; aber die ersten Eindrücke, welche der Dichterknabe in dem Farbenglanze einer herrlichen großen Natur empfing, trugen das Gepräge des Abenteuerlichen, Romantischen, Wilden.
War der Vater, ein tapferer Krieger, der unter dem Cäsar der neuen Welt Europa durchzog und in allen Ländern Lorbeeren erntete, gleichsam das Prinzip der Bewegung und Ruhmbegierde für den Sohn: – so knüpften ihn dagegen die Mutter, eine Vendéerin, und seine Lehrer ein Royalist und Geistlicher, Anhänger des alten Regimes, noch stärker an das Poetische und Gefühlige der Mittelalterlichkeit. Der Zauber keuscher Minne, die Innigkeit der Religiosität, mit all' den wundervollen und phantastischen Erscheinungen, die sie erzeugen, drückten sich tief in das Gemüth des jungen Hugo; dabei nahm derselbe den tragischen Ernst, man möchte sagen, die Melancholie des untergehenden Griechen- und Römerthums aus den klassischen Schriften des Polybius und Tacitus in sich auf. Allerdings wird ein Dichter geboren: aber wer wird läugnen, daß solche Anschauungen, eine solche Zeit, solche gleichsam schon in die Wiege gelegten Elemente die Produktivität schnell befruchten, zeitigen und stärken, wenn man in Goethe's »Dichtung und Wahrheit« liest, wie mächtig auf ihn die vergleichungsweise ärmlichen Umgebungen und Verhältnisse seiner Jugendjahre wirkten?
Es darf daher nicht verwundern, daß er schon in seinem dreizehnten Jahre seine Begeisterung für das Ritterthum in Versen zur Ehre Roland's auszudrücken versuchte.
Hugo's Bildungsgang erlitt eine Veränderung, als sich sein Vater von seiner Mutter, wegen ihrer geheimen Verbindungen mit der Emigration, trennte. Er wurde in eine zum Gymnasium Ludwigs des Großen gehörige Anstalt versetzt, und schrieb hier, den Grundsätzen seiner Mutter getreu, eine legitimistische Tragödie, Irtamène. Schon beginnt seine schriftstellerische Laufbahn. Als Concurrent um den von der Académie française ausgesetzten Preis für das beste Gedicht »über die Vorzüge des Studiums,« um welchen sich Männer wie Lebrun, Delavigne u. A. bewarben, wurde er zwar nicht gekrönt, aber belobt. Der Dichter war damals erst fünfzehn Jahre alt, und schloß daher sein Preisgedicht mit den Versen:
»Ich, der ich stets gefloh'n von Hof und Städten bin, Sah kaum drei Lustra zieh'n ob meinem Haupte hin.«
Die erstaunten Akademiker hätten, als sie sich von dieser kaum glaublichen Thatsache überzeugten, dem jungen Talente gern den Preis verliehen, aber er war schon vergeben. Ein Preis, den sein Bruder von der Toulouser Akademie erhielt, feuerte ihn noch mehr an, und er gewann auch bei derselben Akademie im Jahre 1819 deren zwei durch Oden: über die Statue Heinrichs IV. und die Jungfrauen von Verdun (welche im Jahre 1792 das Opfer ihrer Anhänglichkeit an die Emigranten geworden waren). Hier ist die Gelegenheit, auf die ausnehmende Schnelligkeit aufmerksam zu machen, womit Hugo producirt. Seinen ersten Roman »Bug Jargal« schrieb er, 16 Jahre alt, aus Veranlassung einer Wette, in vierzehn Tagen. Die Ode über die Statue Heinrichs IV. verfaßte er in Einer am Krankenbette seiner Mutter durchwachten Nacht. Auch diesmal wollte die Akademie nicht glauben, daß er erst siebzehn Jahre zähle. Im folgenden Jahre erhielt er nochmals den Preis für das Gedicht: »Moses am Nil.«
Von nun an betritt er seine eigentliche Laufbahn als Schriftsteller. Er hatte das Rechtsstudium, dem er sich widmen sollte, vernachlässigt; mit seinem Vater war er, als politischer Meinungsgenosse der Mutter, zerfallen; dadurch gerieth er in Sorgen für sein Auskommen. Aber ein noch weit mächtigerer Sporn war die Liebe. Hugo ist der Sänger der reinsten, tiefsten, innigsten, hingebendsten, ihren Gegenstand vergötternden Liebe. Er konnte dies nur durch Erfahrungen in seinem eigenen Herzen werden. Er hatte eine Jugendgeliebte, der er mit schwärmerischer Neigung zugethan war; man verbot ihm, sie zu besuchen. Dies war, sagt man, die Veranlassung zu seinem schauerlichen Roman »Han d'Islande,« worin er, neben einem das Böse an sich liebenden Ungeheuer (welches jedoch die Grenzen menschlicher Bosheit überschreitet), die Treue und Aufopferung der allen Gefahren und Verhältnissen trotzenden Liebe schildert. Grund und Boden dieses Romans ist zum Theil historisch.
Die Vielseitigkeit von V. Hugo's Talent, woraus wir durch diese neue Dichtgattung, in der er sich auszeichnete, geführt werden, ist nicht minder bewunderungswerth, als seine Fruchtbarkeit und Leichtigkeit. Als Lyriker, als Romantiker, als Dramatiker, als Uebersetzer, als Kritiker und Polemiker hat er fast gleiches Aufsehen gemacht. Seine Oden, Balladen, Hymnen gelten in Frankreich als das Vorzüglichste. Als Kritiker hat er in der Zeitschrift »Conservateur litéraire« vortreffliche Artikel über Walter Scott, Byron, Moore geliefert, auch politische und kritische Ansichten ausgesprochen, welche unter den Rubriken: Literatur und Philosophie in unserer Sammlung ihren Platz finden. Er war es auch, der das poetische Genie Lamartine's, mit welchem er hernach ein freundschaftliches Verhältniß anknüpfte, zuerst in einer begeisterten, den Zustand der damaligen französischen Lyrik satyrisirenden Kritik begrüßt hat.
Der berühmte Chateaubriand nannte ihn ein »erhabenes Kind« (enfant sublime), und auch dieser große Schriftsteller würdigte ihn eines näheren Umganges.
Victor Hugo, einmal ganz in die schriftstellerische Carrière eingetreten, zu Paris in sparsamer Zurückgezogenheit von dem Lohne seines Fleißes lebend, arbeitete angestrengtest, um bald seiner Geliebten eine sorgenfreie Existenz an seiner Hand anbieten zu können. Sein Stolz verhinderte ihn, die Unterstützung seines Vaters anzunehmen. Dagegen wollte sein gutes Glück, daß Ludwig XVIII. einen schönen Charakterzug des Dichters großmüthig belohnte, statt die Ungesetzlichkeit desselben zu bestrafen. Einer seiner Jugendfreunde war in die Militär-Conspiration von Saumur verwickelt. Delon, so hieß er, wurde gerichtlich verfolgt, und Hugo bot dem Flüchtigen, in einem Briefe an dessen Mutter, sein Zimmer an. Der König bekam durch die Polizei diesen Brief in die Hände, und ertheilte ihm die erste aufgehende Pension. Nun stand dem Glücke des Liebenden nichts mehr im Wege; er vermählte sich im Jahre 1822.
Aus allem bisher Gesagten ergibt sich, daß Hugo aus poetischem Interesse den Ideen der Restauration angehörte, weßhalb seine Muse mit dem oppositionellen Streben der öffentlichen Meinung in direktem Widerspruch stand. Auch das Genie zieht im Kampfe mit dem Zeitgeist, sobald dieser eine gesunde Richtung verfolgt, den Kürzern. Deshalb hatte Hugo bisher zwar mit seinen Produktionen Aufsehen gemacht, aber es zu keinem entschiedenen Beifall bringen können, da er sich zwei mächtige Gegner zumal zuzog: die politische Meinung der großen Mehrzahl in Frankreich, und die Verfechter der alten sogenannten klassischen Schule in der schönen Literatur. Sei es nun, daß Hugo einsah, er müsse, um den Schutz des Publikums gegen seine belletristischen Gegner zu gewinnen, in der Politik sich einigermaßen mit demselben conformiren, oder daß er, wie auch sein Freund Chateaubriand, den großen Unfug der veralteten Aristokratie und des verderbten Pfaffenthums, die dem Absolutismus zustrebten, mit richtigem Urtheil erkannte: – genug, er ließ die politische Fehde ruhen, veröffentlichte ein Gedicht auf Napoleon und eine Ode: »à la Colonne« (auf die Vendôme-Säule), welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde. So gerüstet trat er auch als Dramatiker in die Schranken mit dem größtentheils verfehlten und veralteten Klassicismus, – ein Wettstreit, der großes Aussehen erregte und lange die Aufmerksamkeit des Publikums zwischen sich und der Politik getheilt hielt. Sein Drama: Cromwell, obwohl es an ergreifenden Situationen, originellen Charakteren und vortrefflichen Stellen keineswegs Mangel leidet, ist schon wegen seiner Ausdehnung und Ueberfüllung mit Personen für die Bühne nicht geeignet: dagegen ist Marion Delorme, deren Aufführung die ministerielle Theater-Censur von 1829 untersagte, von so hochtragischer Erfindung, und, bei der Gewagtheit des Sujets, so geistreich durchgeführt, daß wir ihr den Preis unter den Tragödien des Dichters zuerkennen möchten.
Die Aufführung des Hernani veranlaßte einen wahren Parteienkampf im Théatre français (1830); und doch ist Hernani mit der hervorstechenden Person Kaiser Carls V., trotz der sinnreichen Aufführung des psychologischen Streits zwischen Ehre, Haß, Liebe und Rache kühler, als die meisten andern Dramen Hugo's.
Die Erhebung der französischen Nation in den Julitagen begeisterte auch unsern Dichter; er sang eine Ode zur Verherrlichung derselben. Aber auch ihn degoutirte das daraus hervorgehende juste-milieu, besonders als man wegen angeblich anstößiger Stellen gegen den König Louis Philipp die Aufführung seines neuen Drama's: Le roi s'amuse verbot. In dem Prozeß darüber sprach er sich drohend gegen das Ministerium aus. Dessen ungeachtet gestalteten sich die Verhältnisse des Dichters, dessen Ruhm und Popularität mit jedem neuen Band Gedichte, mit jedem neuen Schauspiel (Marie Tudor, Marion Delorme, die Burggrafen, Hernani u.s.w.), mit jedem neuen Band Prosa stiegen und durch den Roman Notre-Dame ihren Gipfelpunkt erreichten, zur Julimonarchie auf's Freundlichste, und als Frucht dieses guten Einvernehmens verdient folgendes, in's Jahr 1839 fallende Factum besonders hervorgehoben zu werden, das dem Dichter und dem Könige gleich sehr zur Ehre gereicht.
Als der trotzige Rebell Barbès zum Schaffot verurtheilt war, kam seine Schwester zu dem Dichter und flehte, er möchte den König zur Begnadigung ihres Bruders veranlassen. Ein erster Schritt war ohne Erfolg geblieben. Der Hof trauerte damals um die sanftherzige Marie von Württemberg, und der Graf von Paris war kaum erst auf die Welt gekommen. V. Hugo ging am 12. Juli um Mitternacht noch einmal zum Könige. Se. Majestät war nicht mehr sichtbar. Da schrieb er folgende Strophe, die er auf einem Tische liegen ließ:
Bei jenem taubengleich von Dir entflog'nen Engel, Bei diesem Königskind, dem zarten Blumenstengel, Beim Grab und bei der Wieg' steh ich noch einmal heut: Gib Gnade, Herr, und üb', Gott gleich, Barmherzigkeit.
Bei seinem Erwachen las Ludwig Philipp die vier Zeilen, und Barbès war gerettet.
Im Juni 1841 kam V. Hugo in die Akademie, und zwei Jahre später wurde er zur Pairswürde erhoben.
Als L. Philipp im Februar 1848 relicta non bene parmula davonlief, schloß V. Hugo sich der Republik an und vertheidigte sie als Abgeordneter mit großer Entschiedenheit in Reden, welche die glänzendste oratorische Befähigung beurkundeten. Gegen den Staatsstreich focht er sogar nebst seinen Söhnen auf den Barrikaden und schrieb hernach das von der maßlosesten Parteileidenschaft eingegebene Pamphlet: Napoléon le petit. Seitdem lebte er als Flüchtling theils in Belgien, theils in London, und bewohnt nun schon mehrere Jahre die Insel Jersey, von wo er 1856 einen neuen Band Gedichte herausgab, der in Frankreich verschlungen wurde. Gegenwärtig soll er mit Vollendung eines sechsbändigen Romans beschäftigt sein, welcher den Titel führt: Das Elend. Wir werden nicht ermangeln, ihn gleich nach seinem Erscheinen unserer neuen Sammlung einzuverleiben.
Was die äußeren Verhältnisse des Dichters betrifft, so ist er, abgesehen von dem untröstlichen Schmerz um das verlorene Vaterland, keineswegs zu beklagen. Er erfreut sich des angenehmsten Familienlebens und dabei eines ansehnlichen Wohlstandes, wie ihn Frankreich seinen ausgezeichneten Schriftststellern selten vorenthält.
Stuttgart, im August 1858.
I. Der große Saal
Heute vor dreihundert acht und vierzig Jahren, sechs Monaten und neunzehn Tagen wurden die Pariser durch das Läuten aller Glocken geweckt, die in dem dreifachen Umkreise der alten Lutetia, der Universität und der neuen Stadt einen gewaltigen Bimbam machten.
Dieser sechste Januar des Jahres vierzehnhundert zwei und achtzig war gleichwohl kein Tag, der in der Geschichte roth angezeichnet ist. Es war nichts Besonderes in dem Ereigniß, das auf solche Weise die Glocken und die Spießbürger von Paris vom frühen Morgen an in Bewegung setzte. Kein Fechtspiel zwischen Burgundern und Picarden, keine Prozession des Allerheiligsten, keine Studentenrevolte im Weingarten von Laas, kein feierlicher Einzug unseres gnädigsten Herrn, des Königs, ja nicht einmal eine schöne Hängerei von Räubern und Räuberinnen, zur Befriedigung des Rechts und der Gerechtigkeit und zum abscheulichen Exempel für die gaffende Menge. Es hatte auch nicht, wie sonst im fünfzehnten Jahrhundert häufig geschah, eine glänzende Gesandtschaft mit wehenden Helmfedern und flatternden Fähnlein ihren Einzug gehalten, denn erst vor zwei Tagen hatte die letzte Cavalcade dieser Art, die flämischen Botschafter, welche die Heirath zwischen dem Dauphin und Margarethen von Flandern abschließen sollten, ihren Einzug in die Hauptstadt gehalten, zum großen Verdruß des Kardinals von Bourbon, der, dem Könige zu gefallen, diesen ganzen Troß bäuerischer Bürgermeister aus Flandern in seinem prächtigen Palaste bewirthen mußte.
An diesem sechsten Januar, der, wie Jehan von Troyes sagt, Alles was Leben hatte auf die Beine brachte, war die doppelte Feierlichkeit, die seit unfürdenklichen Zeiten auf einen Tag fällt: das Fest der Könige und der Narren. Da war jedesmal Freudenfeuer auf dem Grèveplatz, Maienfest in der Kapelle von Braque und Mysterium im Justizpalast. Am Abend zuvor schon war das Fest auf Straßen und Plätzen durch die Leute des Herrn Prevot, die in veilchenblauen Sammtkleidern stolzirten und große weiße Kreuze auf der Brust trugen, austrompetet worden.
Die ganze Stadt, Männer und Weiber, lief demnach vom frühen Morgen an einem der obenbezeichneten drei Plätze zu: Der dem Feuerwerk, Dieser dem Maienfest und Jener dem Mysterium; man muß es dem alten gesunden Verstand der Pariser Spießbürger zum Ruhme nachsagen, daß der bei weitem größte Theil dem Feuerwerk oder dem Mysterium im großen Saale des Justizpalastes zuströmte, während die Bänder an dem armen Maienbaum auf dem Kirchhofe der Kapelle von Braque fast einsam und verlassen flatterten. Hauptsächlich fluthete die Menge dem Justizpalaste zu, weil man wußte, daß die flämischen Gesandten der Darstellung des heiligen Mysteriums und der Erwählung des Narrenpabstes, die im gleichen Saale stattfand, anwohnen wollten.
Es war aber nicht so leicht, an jenem Tage in diesen großen Saal zu gelangen, den man damals für den größten hielt, der auf dem ganzen Erdball unter Dach und Fach stand. Der von Menschen wimmelnde Platz vor dem Justizpalast bot den Zuschauern aus den Fenstern den Anblick eines Meeres dar, in
welches fünf bis sechs Straßen, gleich Flußmündungen, jeden Augenblick ihre lebendigen Wellen ergossen. Das Geschrei, das Lachen, und das Stampfen dieser tausend Füße machten ein großes Geräusch und Gelärm. Von Zeit zu Zeit verdoppelte sich dieses Rauschen und Lärmen, und der Strom, der die ganze Masse gegen den großen Thorweg des Palastes fortriß dämmte sich und gerieth in Wirbel. Es bedurfte dabei bloß des Kolbenstoßes eines Bogenschützen von der Leibwache, oder eines Stadtsergenten, der sein Pferd tummelte, um die Ordnung herzustellen.
Unter den Thüren, an den Fenstern, an den Dachladen, auf den Dächern selbst wimmelten Tausende jener ehrbaren, so gutmüthigen und so ruhigen Bürgergesichter; sie blickten auf den Palast, sie blickten auf die strömende Menge und waren zufrieden, denn solche Leute sind schon zufrieden, wenn sie nur viele andere Leute sehen, und ihre Neugierde ist gereizt, wenn sie nur wissen, daß hinter irgend einer Mauer irgend etwas vorgeht, was sie weder sehen noch hören.
Wenn wir, wie wir jetzt im Jahre 1830 sind, uns in Gedanken unter jene Pariser des fünfzehnten Jahrhunderts mischen und mit ihnen, gedrückt und gestoßen, in jenen unermeßlichen Saal, der am sechsten Januar vierzehnhundertzweiundachtzig dennoch zu klein war, einziehen könnten, so würden wir ein Schauspiel genießen, das uns gewiß Freude machte, und lauter so alte Dinge sehen, daß sie uns nagelneu erschienen. Wenn der geneigte Leser nichts dagegen hat, wollen wir versuchen, ihm den Eindruck darzustellen, den er empfunden haben würde, wenn er mit uns über die Schwelle jenes großen Saales geschritten wäre, in dem Gedränge der Spießbürger und der Polizeischergen jener Zeit. Man tritt ein, die Ohren gellen und die Augen werden geblendet. Ueber unsern Häuptern ein doppeltes Bogengewölbe, mit hölzerner Bildnerei eingefaßt, himmelblau gemalt mit gold'nen Lilien: unter unsern Füßen abwechselnde Platten von weißem und schwarzem Marmor; einige Schritte von uns ein ungeheurer Pfeiler, dann wieder einer, dann noch einer, im Ganzen sieben Pfeiler in der Länge des Saals, die in der Mitte seiner Breite das doppelte Gewölbe halten. Rund um die vier ersten Pfeiler Krämerbuden voll glänzenden Geschirrs, um die drei letzten Bänke von Eichenholz, abgenützt und abgeglättet durch die ledernen Hosen der Klagenden und die Mäntel der Richter. Rings um den Saal, an der hohen Mauer hin, zwischen den Thüren, zwischen den Fenstern, zwischen den Pfeilern, die unübersehliche Reihe der Bildsäulen aller Könige von Frankreich seit Pharamund; die schläfrigen Könige mit herabhängenden Armen und stieren Augen, die tapfern und kriegslustigen Herren mit trotzigem Haupt und hoch erhobener Hand. Hierauf unter den langen Fensterbogen tausendfarbige Gläser, an den weiten Ausgängen des Saals reiche Thüren mit feiner Bildnerarbeit, und Alles, Bogen, Pfeiler, Mauern, Thüren, Bildsäulen, von oben bis unten in Himmelblau und Gold glänzend. Hiezu denke man sich den unermeßlichen oblongen Saal, von dem bleichen Lichte eines Wintertages erhellt, angefüllt von der rauschenden Menge, die sich an den Mauern entlang und rund um die sieben Pfeiler drängt, und man wird sich eine, wenn auch nicht klare Idee von dem ganzen Gemälde machen können, dessen seltsame Einzelnheiten wir jetzt vor unsern Lesern aufzurollen gedenken.
An den beiden Enden dieses gigantischen Vierecks sah man an dem einen die berühmte Marmortafel aus einem Stück, das so lang, breit und dick war, daß man, wie alte Schriften berichten, noch kein ähnliches auf der ganzen weiten Welt gesehen hatte; an dem andern die Kapelle, in welcher Ludwig XI., vor der heiligen Jungfrau auf den Knieen liegend, in Stein gehauen war. Diese Kapelle, damals noch neu und kaum seit sechs Jahren erbaut, war ganz im Geschmacke jener seinen Baukunst, jener wunderbaren Bildnerei, jener feinen und profunden Meißelarbeit errichtet, welche das Ende der gothischen Aera bezeichnet und in märchenhaften Phantasien bis gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts fortgelebt hat.
Mitten im Saale, der großen Eingangsthüre gegenüber, war eine mit Goldstoff bekleidete Estrade für die flandrischen Gesandten und die andern vornehmen Personen errichtet, die man zur Darstellung des Mysteriums eingeladen hatte. Nach altem Brauche sollte das Mysterium auf der großen Marmorplatte aufgeführt werden. Man hatte zu diesem Ende ein leichtes hölzernes Gerüste auf derselben aufgeschlagen, das zum Theater dienen sollte, und dessen Inneres, mit Tapeten behängt, den handelnden Personen des Stücks zum Ankleidezimmer diente. Eine von Außen angelegte Leiter wurde als Verbindungsmittel zwischen der Bühne und dem Ankleidezimmer gebraucht, und auf ihr stiegen die Schauspieler, die auftraten oder abgingen, auf und ab. So war es in der Kindheit der Schauspielkunst und der Maschinerie beschaffen.
An den vier Ecken der Marmorplatte standen, aufrecht und steif, vier Trabanten des Hausmeisters des Justizpalastes, bei Festen wie bei Hinrichtungen verpflichtete Hüter des Volks.
So bald der zwölfte Schlag der großen Palastuhr Mittag anzeigte, sollte das Stück beginnen; das war allerdings für eine theatralische Darstellung sehr spät, aber man mußte sich nach der Bequemlichkeit der flandrischen Gesandten schicken. Die schaulustige Menge wartete bereits seit dem frühesten Morgen. Tausende standen schon mit Tagesanbruch vor der großen Treppe des Justizpalastes; Einige hatten sogar die Nacht unter dem großen Thore zugebracht, um sich des Eintritts zu versichern, sobald es geöffnet würde. Mit jeder Minute wuchs der Haufen an und ergoß sich gleich einem Strome, der über sein Ufer tritt, an Mauern, Pfeiler, Fenstergesimse, und wo irgend ein leerer Fleck war, der einen Menschen fassen konnte. Unbehaglichkeit, Ungeduld, Langeweile, die Freiheit eines Tages cynischer Ungebundenheit, die Händel, die sich in Folge des Stoßens und Tretens erhoben, die Abspannung des langen Wartens, gaben schon lange vor der Ankunft der Gesandten dem Treiben dieses eingeschlossenen, gepreßten, halb erstickten Volkes einen Ausdruck bittern Verdrusses. Man hörte nichts als Klagen und Verwünschungen gegen die Flamänder, den Handlungsvorsteher, den Kardinal Bourbon, den Hausmeister des Palastes, Margarethe von Oesterreich, die Stadtsergenten, die Kälte, die Hitze, das schlechte Wetter, den Bischof von Paris, den Narrenpabst, die Pfeiler, die Bildsäulen, diese geschlossene Thüre und jenes offene Fenster: Alles zum großen Ergötzen der zahlreichen Studenten und Lakaien, die unter der Masse zerstreut waren und zu ihrer Belustigung überall das Feuer der üblen Laune schürten.
Eine Bande dieser muntern Gesellen hatte die Scheiben eines Fensterflügels eingeschlagen, und war auf das Gesimse gestiegen, von wo sie abwechselnd nach innen und außen, mit dem Volkshaufen im Saal und dem auf der Straße, schäkerte und Possen trieb. Aus den Fratzengesichtern, welche sie gegen Diesen und Jenen schnitten, aus ihrem schallenden Gelächter, aus den scherzhaften Zurufen, welche sie von einem Ende des Saales zum andern an ihre Spießgesellen ergehen ließen, war leicht abzunehmen, daß sie die allgemeine Abspannung und Langeweile nicht theilten, und einstweilen, bis das Schauspiel anfing, ein Stück auf eigene Faust zu spielen wußten.
»Bei meiner armen Seele, Du bist's, Johannes Frollo de Molendino!« rief einer derselben einem dieser kleinen Teufelsjungen, blondhaarig und mit einem hübschen Spitzbubengesichte, zu, der sich in das Schnitzwerk einer Säule eingenistet hatte, »und man nennt Dich wohl mit Recht Mühlenhans, denn so wie Du dahängst, sehen Deine Arme und Füße wie Windmühlenflügel aus. Seit wann hängst Du denn so in der Luft zwischen Himmel und Erde?«
»Bei der ewigen Barmherzigkeit des Teufels,« erwiderte Johannes Frollo, »es sind schon mehr als vier lange Stunden, und wenn mir die nicht für die Zeit meines Fegfeuers angerechnet werden, so ist kein Gott mehr im Himmel. Schon diesen Morgen um die siebente Stunde hörte ich die acht Chorsänger des Königs beider Sicilien den ersten Vers des Hochamtes in der heiligen Kapelle anstimmen.«
»Saubere Sänger, die!« versetzte der Andere, »ihre Stimme ist noch spitziger, als ihre Kappen. Ehe der König eine Messe für den heiligen Johann stiftete, hätte er sich zuvor erkundigen sollen, ob der heilige Johann lateinische Psalmen im Dialekt der Provence liebt.«
»Das hat er bloß gethan, um diese vermaledeiten Chorsänger des Königs von Sicilien anzustellen!« rief ein altes Weib, das mitten unter der Menge unten am Fenster stand, geifernd aus. »Seht doch, tausend gute Pariser Livres für eine Messe! und dazu noch auf den Pacht des Pariser Fischmarkts angewiesen!«
»Ruhig, alte Vettel!« fuhr sie ein dicker und ansehnlicher Mann an, während er sich die Nase zuhielt, um anzudeuten, daß es in der Nähe eines Fischweibes übel rieche. »Mußte man nicht eine heilige Messe stiften, oder willst Du, daß der König auf's Neue krank werde?«
»Wohl gesprochen, Meister Gilles Lecornu, königlicher Hofkürschner!« rief ihm der kleine Student zu, der am Pfeiler hing.
Der übelklingende Name des armen königlichen Hofkürschners wurde mit schallendem Gelächter aus dem Munde sämmtlicher Studenten begrüßt.
»Lecornu! Gilles Lecornu!« schrieen die Einen.
»Cornutus et hirsutus,« fiel ein Anderer ein.
»Freilich, er ist es in eigener Person!« fuhr der Teufelsjunge von seinem Pfeiler herab fort, »Und was habt Ihr denn zu lachen? Es ist der sehr ehrenwerthe Meister Gilles Lecornu, Bruder des Meisters Johann Lecornu, Haushofmeisters des Königs, Sohn des Meisters Mahiet Lecornu, ersten Thürstehers im Park von Vincennes, lauter ehrbare Spießbürger von Paris, sämmtlich geheirathet von Vater auf Sohn!«
Diese Apostrophe steigerte die allgemeine lustige Laune auf den höchsten Grad. Der arme Hofkürschner wagte den Mund nicht aufzuthun, sondern suchte sich den von allen Seiten auf ihn gerichteten Blicken zu entziehen; er schnaubte wie ein harpunierter Wallfisch, und schwitzte wie ein gehetzter Hase. Vergebens, je mehr er sich Mühe gab, sich durchzudrängen, um so fester speitelte sich seine breite Figur zwischen den Schultern seiner Nachbarn ein. Sein Gesicht war dunkelroth vor Zorn und Verdruß.
Endlich kam ihm einer seiner Nachbarn, dick, stämmig und ehrenfest, wie er selbst, mit christlichem Beistand zu Hülfe.
»Gräulich und abscheulich!« rief er aus, »Studenten, Schulbuben führen eine solche Sprache gegen einen Pariser Bürger! Zu meiner Zeit hätte man sie dafür mit Ruthen gestrichen und auf einem Holzstoß verbrannt.«
Diese Worte brachten die ganze Studentenbande in Aufruhr.
»Holla! Heda! Wer ist's, der dieses Lied singt? Wer ist die unglückverkündende Nachteule?«
»Es ist der Meister Andry Musnier, ich kenne ihn wohl,« rief einer der Studenten.
»Richtig, einer der vier geschwornen Buchhändler der Universität!« fiel ein Anderer ein.
»Alles ist vierfach in diesem Kram,« fügte ein Dritter hinzu: »Die vier Nationen, die vier Fakultäten, die vier Feste, die vier Prokuratoren, die vier Wähler, die vier Buchhändler!«
»Nun wohl denn,« schrie Johannes Frollo, »so muß man ihm auch den Teufel vierfach im Glase zeigen!«
»Musnier, wir verbrennen Deine Bücher!«
»Musnier, wir schlagen Deinem Ladenburschen den Buckel voll!«
»Musnier, wir zerren Dein Schätzchen herum!«
»Die gute dicke Jungfer Oudarde, die so frisch und munter ist, wie wenn sie Wittwe wäre!«
»Hol' euch Alle der Teufel!« brummte Meister Andry Musnier in den Bart.
»Meister Andry,« rief ihm der Teufelsjunge vom Pfeiler herab warnend zu, »wenn Du nicht schweigst, so lasse ich mich auf Deinen Strohkopf herabfallen!«
Bei diesen Worten erhob Meister Andry die Augen zum Pfeiler, schien einen Augenblick dessen Höhe und das Gewicht des kleinen Spitzbuben zu messen, multiplicirte in Gedanken dieses Gewicht durch die Geschwindigkeit des Falles vermehrt, und schwieg weislich.
Johannes Frollo, auf solche Weise Meister des Feldes, fuhr triumphirend fort: »Das thue ich Dir, so wahr ich der Bruder eines Archidiakonus bin! Das sind saubere Leute, unsere Herren von der Universität, daß sie nicht einmal an einem Tage, wie der heutige ist, unseren Privilegien den nöthigen Respekt verschaffen! Sind nicht Maienfest und Feuerwerk in der Neustadt? heiliges Mysterium, Narrenpabst und flämische Gesandte in der Altstadt? Und in der Universität nichts!«
»Und doch wäre der Platz Maubert groß genug dazu!« fiel einer der Studenten ein, der auf dem Fenstergesimse saß.
»Fort mit dem Rektor, den Wählern und den Prokuratoren!« schrie Johannes Frollo.
»Man muß diesen Abend auf dem Champ-Gaillard mit den Büchern des Meisters Andry ein Freudenfeuer machen!«
»Da kann man gleich die Pulte der Schreiber mit verbrennen!« sagte sein Nachbar.
»Und die Stöcke der Pedellen!«
»Und die Spucknäpfe der Professoren!«
»Und die Schenktische der Prokuratoren!«
»Und die Mehlkästen der Wähler!«
»Und den Fußschemel des Rektors!«
»Fort,« rief auf's Neue Johannes Frollo, »fort mit dem Meister Andry, fort mit den Pedellen und Schreibern, fort mit den Theologen, den Medicinern und Juristen, fort mit den Prokuratoren, den Wählern und dem Rektor!«
»Gott stehe uns bei, der jüngste Tag bricht an!« murmelte Meister Andry für sich, und bedeckte mit beiden Händen die Ohren.
»Vom Rektor redet Ihr, da geht er eben über den Platz!« rief einer der Studenten.
Alle Blicke wendeten sich nach dieser Gegend.
»Richtig kurirt, das ist unser in Gott ehrwürdiger Rektor, Meister Thibaut,« sagte Johannes Frollo, der Mühlenhans, »ich kann ihn zwar nicht sehen, aber ich rieche ihn schon von Weitem.«
»Ja, ja,« antworteten mit einer Stimme die Anderen, »er ist es selbst, unser sehr ehrwürdiger Rektor, Meister Thibaut.«
Es waren wirklich der Rektor und sämmtliche Lehrer und Diener der Universität, welche in diesem Augenblicke in Prozession über den Platz des Justizpalastes zogen, um die flämische Gesandtschaft feierlich zu empfangen. Die Studenten, die sich am Fenster drängten, empfingen sie beim Vorüberziehen mit Spottreden und ironischen Beifallsbezeugungen. Der Rektor, der an der Spitze des Zuges einherkam, empfing die erste, sehr gewichtige Ladung derselben.
»Guten Morgen, Herr Rektor! Holla! Heda! Guten Morgen, Herr Rektor!«
»Ist er auch schon da, der alte Spieler? Wo hat er denn seine Würfel gelassen!«
»Wie er auf seinem Maulthier einhertrampelt! Seine Ohren sind länger, als die seines Maulesels!«
»Holla! Heda! Guten Morgen, Herr Rektor Thibaut! Tybalde Aleator! Alter Strohkopf! Alter Spieler!«
»Gott erhalte Dich gesund! Hast Du in dieser Nacht schon oft zweimal sechs geworfen?«
»Oh! welche schlotternde Gestalt, wie die Spielwuth seine Züge verzerrt hat!«
»Wohin denn, alter Thibaut, Tybalde ad Dados, kehrst Du der Universität den Rücken und zottelst der Stadt zu?«
»Ohne Zweifel,« rief der Mühlenhans dazwischen, »sucht er eine Wohnung in der Straße Thibautodé, (Thibaut aux dés).«
Diese Anspielung auf die Spielwuth des Rektors wurde mit donnerndem Beifall und schallendem Händeklatschen aufgenommen und von der ganzen lustigen Bande wiederholt:
»Er sucht eine Wohuung in der Straße Thibautodé, der alte Meister Thibaut, der dem Teufel die Karten mischt!«
Hierauf kam die Reihe an die übrigen Lehrer und Diener der Universität.
»Fort mit den Pedellen! Fort mit den Stabträgern!«
»Sage mir doch, Robin Poussepain, wer ist denn dieser da?«
»Das ist Gilbert de Suilly, Gilbertus de Soliaco, der Kanzler des Collegiums von Autun.«
»Hier hast Du meinen Schuh, wirf ihm denselben in sein Fratzengesicht; Du kannst besser beikommen als ich.«
» Saturnalitias mittimus ecce nuces.«
»Fort mit den sechs Theologen in ihren weißen Chorhemden!«
»Sind das Theologen! Ich hielt sie für sechs weiße Gänse, die das Kloster der heiligen Genovefa der Stadt Paris für das Lehen von Rogny spendet,«
»Fort mit den Medicinern!«
»Fort mit den Hauptdisputationen und allen Schulfuchsereien!«
»Gib mir meine Mütze, Kanzler von St. Genovefa, Du hast eine Ungerechtigkeit gegen mich begangen! Ihr möget es glauben oder nicht, er hat meine Stelle in der Nation der Normandie dem kleinen Ascanio Falzaspada aus Bourges verliehen, weil er ein Italiener ist.«
»Das ist eine Ungerechtigkeit,« schrieen alle Studenten mit einer Stimme. »Fort mit dem Kanzler von St. Genovefa!«
»Heda! Meister Joachim de Ladehors! Heda! Louis Dahuille! Heda! Lambert Hoctement!«
»Hole der Teufel den Prokurator der deutschen Nation!«
»Und die Kaplane der heiligen Kapelle, mit ihren grauen Pelzmänteln dazu! cum tunicis grisis!«
»Seu de pellibus grisis furratis!«
»Holla! Heda! Die Meister der freien Künste! Alle schwarzen und rothen Mützen!«
»Er führt einen schönen Schweif hinter sich, Meister Thibautodé, der Rektor!«
»Man sollte ihn für den Dogen von Venedig halten, der auszieht, sich mit dem Meer zu vermählen.«
»Da kommen die Pfaffen der heiligen Genovefa! Zum Teufel mit ihnen und dem ganzen Pfaffenthum!«
»Abbé Claude Choart! Doktor Claude Choart! Suchst Du Deine Marie Giffarde?«
»Suche sie in der Straße Glatigny.«
»Sie macht eben das Bett des Königs der Hurenjäger.«
»Sie bezahlt eben ihre vier Pfennige, quatuor denarios.«
»Aut unum bombum."
»Seht da«, ihr lieben Leute, den Meister Simon Sanguin, Wähler der Picardie, der seine Frau hinter sich auf dem Maulesel sitzen hat!«
»Post equitem sedet atra cura.«
»Frisch auf, Meister Simon!«
»Guten Morgen, Herr Wähler!«
»Gute Nacht, Frau Wählerin!«
Inzwischen hatte der geschworene Buchhändler der Universität, Meister Andry Musnier, sich zum Ohre des Hofkürschners, Meisters Gilles Lecornu, geneigt: »Ich sage Euch, lieber Herr, der jüngste Tag ist nahe. Wann hat man je solchen Uebermuth von Studenten gesehen? Das Alles dankt man diesen verfluchten Erfindungen des Jahrhunderts: dem Pulver, dem Blei, den Kanonen, den Feldschlangen, den Mörsern, vor Allem aber der Buchdruckerkunst, dieser weiteren Pest aus Deutschland. Es fliegt mit Manuskripten und Büchern, der Buchhandel geht durch die Buchdruckerkunst zu Grunde, ich sage Euch, das Ende der Welt ist nahe.«
»Freilich, freilich« versetzte der Hofkürschner, »ich merke es wohl, denn Sammt und Seide sind jetzt weit mehr gesucht, als die Pelzwaaren,«
In diesem Augenblicke schlug es zwölf Uhr.
»Ah, ah, ah!« rief die ganze Menge aus einem Munde.
Jetzt schwiegen die Studenten. Hierauf großes Geräusch mit den Füßen, Bewegung der Hände und Häupter, Husten und Wehen mit den Sacktüchern; alle machten sich fertig, die Dinge zu schauen, die da kommen sollten. Tiefe Stille, alle Anwesenden starren mit offenem Munde auf die Marmorplatte, auf der die Bühne aufgeschlagen ist. Nichts läßt sich blicken, als die vier Trabanten des Hausmeisters, die noch immer stets und unbeweglich dastehen wie Bildsäulen. Jetzt wenden sich die Blicke dem erhöhten Sitze zu, der für die flämischen Gesandten errichtet ist; aber die Thüre bleibt geschlossen und die Estrade leer. Seit frühem Morgen hatte diese ungeduldige Menge auf dreierlei gewartet: auf die Mittagsstunde, die flandrische Gesandtschaft und das heilige Mysterium. Jetzt, zu dieser Frist, war bloß die Mittagsstunde da.
Das war allzuviel für ein schaulustiges Publikum. Man wartet eine, zwei, drei, fünf Minuten, eine Viertelstunde, nichts zeigt sich. Die Estrade steht verlassen, das Theater bleibt stumm. Auf Ungeduld folgt jetzt Zorn. Erst leise, dann lauter, laufen trotzige Reden von Mund zu Mund. »Das Mysterium! das Mysterium!« murmelt man halblaut. Die Köpfe erhitzen sich, der Sturm ist dem Ausbruche nahe. Jetzt wirft der Mühlenhans den ersten Funken in den Zündstoff.
»Das Mysterium, und zum Teufel mit den Flamändern!« ruft er aus voller Brust über den Haufen hin.
Tausend Hände klatschen ihm Beifall, und tausend Zungen wiederholen donnernd: »das Mysterium und zu allen Teufeln mit den Flamändern!«
»Das Mysterium, und zwar auf der Stelle,« wiederholte der Student, »oder wir führen selbst ein christliches Schauspiel auf, und hängen den Hausmeister des Palastes an seine eigenen Pfosten.
»Wohl gesprochen,« schrie die Menge tobend, »und laßt uns gleich das Geschäft mit seinen Trabanten beginnen!«
Dieser Vorschlag wurde mit Beifall aufgenommen.
Die vier armen Teufel, auf solche Weise bedroht, wurden todesblaß und warfen sich ängstliche Blicke zu. Bereits drängte sich die Menge dem aufgeschlagenen Gerüste zu, das unter dem allgemeinen Andrang krachte und zu brechen drohte.
Der Augenblick war kritisch. »An den Strick! An den Strick!« rief man von allen Seiten.
In diesem Augenblicke hoben sich die Tapeten, die das Ankleidezimmer der Schauspieler bedeckten, und eine Person trat heraus, deren bloßer Anblick dem Andrang der Menge Einhalt that und, wie mit einem Zauberschlag, ihren Zorn in Neugierde verwandelte.
»Stille! Stille!«
Jene Person trat nicht sehr gefaßt und an allen Gliedern zitternd bis an den Rand der Marmorplatte vor, unter hundert Verbeugungen, die sich, nach Maßgabe ihres Vorschreitens, mehr und mehr in förmliche Kniebeugungen verwandelten.
Inzwischen hatte sich die Ruhe so ziemlich wieder hergestellt, und man vernahm nur noch jenes leichte Murmeln, das selbst bei dem Stillschweigen einer großen Menschenmasse immer hörbar ist.
»Meine Herren Bürger und meine Damen Bürgerinnen,« sprach das Individuum, »wir werden die Ehre haben, vor Sr. Eminenz, dem Herrn Kardinal, aufzuführen und darzustellen ein sehr schönes moralisches Schauspiel, das den Namen führt: Das gute Urtheil der heiligen Jungfrau Maria. Ich spiele den Jupiter. Se. Eminenz befindet sich in diesem Augenblicke bei der Gesandtschaft des verehrtesten Herrn Herzogs von Oesterreich, welche eben jetzt an dem Thore Baudets von dem Herrn Rektor der Universität mit einer Anrede empfangen wird. Sobald Se. Eminenz der Herr Kardinal anlangt, werden wir das Stück beginnen.«
Es war allerdings nichts Geringeres als die Vermittlung des Donnergottes in eigener Person erforderlich, um die vier armen Trabanten des Hausmeisters zu retten. Wenn wir so glücklich gewesen wären, diese wahrhaftige Geschichte selbst zu erfinden, und mithin vor unserer Dame Kritik dafür verantwortlich zu sein, so könnte man in diesem Augenblicke gegen uns die klassische Vorschrift anwenden: Nec Deus intersit. Im Uebrigen war das Kostüm unseres Herrn Jupiters sehr schön und hatte nicht wenig dazu beigetragen, die Menge zu beruhigen, indem es ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Donnergott trug ein mit goldenen Nägeln beschlagenes Panzerhemd, auf dem Haupte einen Helm mit silbernen und vergoldeten Knöpfen, und hätte er nicht einen ungeheuern Bart gehabt und etwas in seiner Hand getragen, das den Blitz vorstellen sollte, den er zu schleudern pflegt, so hätte man ihn für einen Bogenschützen der königlichen Leibwache halten können.
II. Peter Gringoire
Was des Donnergottes glänzender Anzug bei der ungeduldigen Menge gut gemacht hatte, das verdarb seine ungeschickte Anrede wieder, und als er zu der unglücklichen Stelle kam: »Sobald Se. Eminenz der Herr Kardinal anlangt, werden wir das Stück beginnen,« verlor sich seine Stimme unter tausendfältigem Geschrei und Zischen,
»Gleich angefangen! Auf der Stelle! Das Mysterium! Sogleich das Mysterium!« schrie man von allen Seiten. Mitten unter dem allgemeinen Getöse vernahm man deutlich die helle, gellende Stimme des Mühlenhans: »Fort mit Jupiter und dem Kardinal Bourbon!«
»Sogleich das moralische Stück! Auf der Stelle! Den Strick für die Komödianten und den Kardinal!« schrie die Menge ungeduldig.
Der arme Donnergott, vor Entsetzen bleich, ließ den Blitz fallen, nahm demüthig seinen Helm ab, grüßte zitternd mit hundert Verbeugungen das Volk und stotterte: »Se. Eminenz ... die Gesandten ... Frau Margareth von Oesterreich ...« hier blieb er stecken, denn die Angst vor dem Strick schnürte ihm die Kehle zu. Fing er das Stück nicht an, so hängte ihn das Volk; fing er es an, so ließ ihn der Kardinal hängen: von beiden Seiten drohte ihm der Strick.
In diesem kritischen Moment trat ein langer hagerer Mann, in einem abgetragenen schwarzen Rock, auf die Bühne zu und sprach: »Jupiter, mein lieber Jupiter!«
Dem Donnergott war vor Angst Hören und Sehen vergangen. Da schrie ihm der Andere unter die Nase: »Michel Giborne!«
»Wer ruft mich?« antwortete Jupiter wie aus einem Traume erwachend.
»Ich bin's,« erwiederte der Schwarzrock.
»Ah, ah, ah!« sagte Jupiter tief ausathmend.
»Fange sogleich an,« sprach der Schwarze weiter. »Thue den Willen des Volles, ich will den Hausmeister besänftigen, und dieser wird den Kardinal beschwichtigen,«
Diese Worte hauchten dem Vater der Götter und Menschen neues Leben ein, und er schrie mit einer jupiterähnlichen Donnerstimme: »Meine Herrn Bürger, das Stück wird sogleich beginnen.«
»Evoe, Jupiter! Plaudite, cives!« riefen die Studenten.
»Hurrah! Hurrah!« schrie das Volk.
Ein betäubendes Händeklatschen folgte, und der Saal ertönte noch von rauschendem Beifall, als Jupiter längst hinter der Tapete verschwunden war.
Inzwischen hatte sich die Person, die, gleich einem Zauderer, den Sturm so plötzlich in Sonnenschein verwandelt, bescheiden in den Schatten eines Pfeilers zurückgezogen und wäre vielleicht dort unbemerkt geblieben, wenn nicht zwei junge Damen das Zwiegespräch zwischen ihm und Jupiter mit angehört hätten.
»Meister,« rief eine derselben dem Manne zu, und gab ihm ein Zeichen, sich zu nähern.
»Was machst Du denn da, liebe Lienarde?« sagte ihre junge reizende Nachbarin zu ihr, »das ist kein Geistlicher, sondern ein Laie, und man sagt zu ihm nicht »Meister,« sondern »Herr.«
In Folge dessen rief ihm Lienarde zu: »Herr.«
Auf diesen Ruf näherte sich der Unbekannte der Balustrade mit den Worten: »Was steht Euch zu Dienst, meine Damen?«
»Oh!« erwiederte Lienarde verwirrt, »nichts, meine Nachbarin Gisquette wünscht Euch zu sprechen.«
»Nein,« unterbrach sie Gisquette erröthend, »Lienarde hat Euch zugerufen: Meister! und ich sagte ihr bloß, du mußt »›Herr‹« sagen.«
Die beiden jungen Mädchen schlugen die Augen nieder. Der Unbekannte betrachtete sie lächelnd und sagte: »Ihr habt mir also nichts zu sagen, meine Damen?«
»Ganz und gar nichts,« antwortete Gisquette.
»Im geringsten nichts,« sprach Lienarde.
Als hierauf der Unbekannte sich entfernen wollte, siegte die weibliche Neugierde und Gisquette rief ihm lebhaft nach: »Herr, Ihr kennt also den Soldaten, der in dem Mysterium die Rolle der heiligen Jungfrau spielen wird?«
»Ihr wollt sagen: die Rolle Jupiters?« versetzte der Anonymus.
»Freilich, freilich, wie einfältig! Ihr kennt also den Jupiter?« fiel Lienarde ein.
»Michel Giborne?« antwortete der Unbekannte, »ja, den kenne ich.«
»Er hat einen gewaltigen Bart!« sprach Lienarde.
»Ist es schön, was sie da sagen werden?« fragte schüchtern Gisquette.
»Sehr schön,« antwortete der Anonymus.
»Was ist es denn eigentlich?« fragte Lienarde.
»Das gute Urtheil der heiligen Jungfrau, ein moralisches Stück, mit Euerm Wohlnehmen,«
»Ah, so!« sagte Lienarde. Hieraus folgte eine kurze Pause, welche der Unbekannte mit den Worten unterbrach: »Es ist ein ganz neues moralisches Stück, das noch nie aufgeführt wurde.«
»Es ist also nicht das nämliche, das man vor zwei Jahren bei dem Einzug des Legaten gab, und worin drei schöne Mädchen auftraten, welche die Rolle...«
»Der Sirenen spielten,« ergänzte Lienarde.
»Und zwar splitternackt,« fügte der Unbekannte hinzu.
Lienarde schlug schamhaft die Augen nieder. Gisquette sah sie an und machte es ebenso.
Der Unbekannte fuhr lächelnd fort: »Das war lustig anzuschauen. Das heutige Schauspiel ist aber ein moralisches Stück, das man ausdrücklich für die Dame von Flandern gemacht hat.«
»Wird man auch Schäferliedchen singen?« fragte Gisquette.
»Nicht doch,« antwortete der Unbekannte, »das kommt in einem moralischen Stücke nicht vor. Man muß die Gattungen nicht verwechseln. Ja, wenn es eine Posse wäre, dann allerdings.«
»Das ist Schade,« versetzte Gisquette. »Damals kamen Wilde, Männer und Weiber vor, die lustige Stückchen sangen.«
»Das ist schön genug für einen Legaten,« sagte trocken der Unbekannte, »aber einer Prinzessin gehört etwas Anderes.«
»Und wie die Musik,« sagte Lienarde, »so schöne Melodien spielte!«
»Und der Brunnen, aus dem Wein, Milch und süßer Wein floß, wo Jedermann so viel trinken konnte, als ihm beliebte.«
»Und die stumme Passion auf dem Dreifaltigkeitsplatze,« fuhr Lienarde redselig fort.
»Der Heiland am Kreuz und die zwei Schächer daneben,« rief Gisquette aus.
Jetzt, nachdem die beiden Plaudertaschen einmal in Gang gekommen waren, floß der Strom ihrer Rede zumal und unaufhaltsam.
»Und am Malerthor andere Personen, sehr reich gekleidet.«
»Und am Brunnen der unschuldigen Kindlein der Jäger, der unter großem Gebell der Hunde und unter dem Schalle der Jagdhörner ein Reh verfolgte!«
»Und als der Legat vorüberzog, lief man Sturm und hieb allen Engländern die Köpfe ab.«
»Und ließ mehr als zweihundert Dutzend Vögel aller Art fliegen, das war sehr schön!«
»Heute wird es noch schöner!« fiel ihnen der Anonymus ungeduldig in die Rede.
»Noch schöner!« rief Gisquette verwundert aus!
»Allerdings,« antwortete der Unbekannte mit Selbstgefühl, »Ihr erblickt in mir, meine Damen, den Verfasser des Stücks.«
»Den Verfasser!« riefen die beiden jungen Mädchen.
»Ihn selbst!« antwortete mit wichtiger Miene der Dichter; »d. h. wir sind unser zwei: Jean Marchand, der das Theater aufgeschlagen, und ich, der das Schauspiel verfertigt hat. Ich heiße: Peter Gringoire.«
Inzwischen hatte die zuvor so tobende Menge geduldig die Eröffnung des Schauspiels erwartet, aber noch immer blieb das Theater leer. Da rief Johannes Frollo mit lauter Stimme: »Holla! Heda! Jupiter, heilige Jungfrau, Gaukler der Hölle! Wo bleibt ihr denn! Das Stück! das Stück! Fangt an, ins Teufels Namen!«
Augenblicklich ließ sich im Innern des Gerüstes Musik hören, der Vorhang hob sich; vier Personen stiegen die Leiter heran und stellten sich, nachdem sie mühsam auf die Bühne gelangt waren, in einer Reihe auf. Sie begrüßten mit demüthiger Verbeugung das gestrenge Publikum, die Symphonie schwieg, und nun nahm das heilige Mysterium seinen Anfang.
Hierauf wurde der Prolog gesprochen, den wir dem geneigten Leser schenken. Die Wahrheit zu sagen, wurde das damalige Publikum, wie das heutige noch, mehr von dem Costüm der Schauspieler, als von dem Text des Stückes angezogen. Unsere vier Personen trugen gleiche Röcke, halb gelb und halb weiß, und untereinander bloß durch die Gattung des Stoffs verschieden. Das erste Kleid war von Gold- und Silberstoff, das zweite von Seide, das dritte von Wolle, das vierte von Leinwand. Die erste der handelnden Personen trug in der rechten Hand ein Schwert, die zweite zwei goldene Schlüssel, die dritte eine Wage, die vierte einen Spaten; um dem Verständnis der Zuschauer, wenn sie sich die Bedeutung dieser Attribute nicht erklären konnten, zu Hülfe zu kommen, las man mit großen schwarzen Buchstaben unten an dem goldenen Kleide: »ich nenne mich Adel;« unten an dem seidenen: »ich nenne mich Geistlichkeit;« unten an dem wollenen: »ich nenne mich Kaufmannschaft;« unten an dem leinenen: »ich nenne mich Landmann.« Das Geschlecht der beiden männlichen und der beiden weiblichen Allegorien war durch die mehr oder minder lange Kleidung und den Kopfputz angedeutet.
Durch den Prolog erfuhr man übrigens, daß Landmann mit der Kaufmannschaft, und Adel mit der Geistlichkeit vermählt sei, und daß beide glücklichen Paare gemeinschaftlich einen prächtigen goldenen Delphin (Dauphin) besaßen, den nur die Schönste der Schönen bekommen sollte. Zu diesem Ende waren sie durch die Welt aus- und eingezogen, die Schönste der Schönen zu suchen. Sie hatten aber dieselbe weder im Königreich Golkonda, noch im Kaiserthum Trapezunt, noch sonst irgendwo in der Welt gefunden, waren so eben höchst ermüdet zu Paris angekommen, und ruhten auf der Marmorplatte im großen Saale des Justizpalastes aus, von wo herab sie einen Schwall von Sentenzen und heilsamen Lehren unter das lauschende Publikum warfen. Das Alles war schön anzuschauen und fein anzuhören.
Niemand lieh den Schauspielern und ihren Worten ein aufmerksameres Ohr, als der Verfasser des Stücks, der Dichter, Peter Gringoire, der Poet. Da stand er hinter einem Pfeiler, reckte seinen langen Hals aus, schaute mit trunkenen Blicken auf die Bühne, und lauschte mit offenem Ohr den Worten der handelnden Personen. Der Beifall, der bei Eröffnung des Prologs von dem Publikum gezollt worden, hatte ihn bereits berauscht. Würdiger Peter Gringoire!
Bald jedoch, so wollte es das grausame Schicksal, sollte ein bitterer Tropfen in den Kelch seiner Freude fließen. Ein zerlumpter Bettler, der, eingekeilt in die Menschenmenge, kein Almosen fordern konnte, suchte irgend einen erhöhten Platz einzunehmen, wo er die Blicke auf sich ziehen und milde Gaben sammeln konnte. Zu diesem Ende stieg er auf einen Pfosten der Estrade, welche für die flämischen Gesandten errichtet war. Hier suchte er durch seinen zerlumpten Anzug und eine häßliche offene Wunde, die fast den ganzen rechten Arm bedeckte, die Blicke und das Mitleid der Menge auf sich zu ziehen. Im Uebrigen jedoch saß er schweigend da und hätte den Fortgang des Stücks nicht gestört, wenn er nicht zum Unglück dem muthwilligen Johannes Frollo, der von seinem Pfeiler umberschaute, in die Augen gefallen wäre. Dieser kümmerte sich wenig um die Unterbrechung des Schauspiels und rief mit tollem Gelächter: »Seht dort den armen Lazarus und werft ihm auch einen Brocken von dem Ueberflusse Eures Tisches zu!«
Wer jemals einen Stein in einen Froschteich geworfen, oder unter einen Flug Tauben geschossen hat, kann sich einen Begriff davon machen, welche Wirkung diese während der allgemeinen Aufmerksamkeit hingeworfenen Worte unter der Menge hervorbrachten. Der arme Peter Gringoire war wie vom Blitze getroffen, denn der Prolog stockte plötzlich und alle Köpfe drehten sich stürmisch dem Bettler zu, der sich dadurch im geringsten nicht aus der Fassung bringen ließ, sondern vielmehr in diesem Zufall eine günstige Gelegenheit zu reichlicher Ernte erblickte; er schloß demnach die Augen zur Hälfte, machte ein Jammergesicht und sagte in kläglichem Tone: »ein Almosen, um Gotteswillen! kranker Mann! armer Mann!«
»Beim Teufel und meiner armen Seele,« rief ihm Johannes Frollo zu, »das ist ja Clopin Trouillefou! Holla! guter Freund, hat Dich denn Deine Wunde am Schenkel gehindert, daß Du sie jetzt auf den Arm gemacht hast?«
So sprechend warf er ihm, mit der Geschicklichkeit eines Affen, eine Silbermünze in den schmutzigen Filz, den der Bettler mit seinem kranken Arm ausstreckte. Clopin Trouillefou nahm Almosen und Spott gleichmüthig hin und fuhr im nämlichen lamentablen Tone fort: »Kranker Mann, armer Mann! Ein Almosen, um Gotteswillen!«
Diese Episode hatte die Aufmerksamkeit der Zuhörer bedeutend gestört; viele von ihnen, Robin Poussepain und sämmtliche Studenten an der Spitze, klatschten diesem seltsamen Duett, das der Mühlenhans mit seiner kreischenden Stimme und der Bettler mit seiner ewigen Litanei, als Schauspiel im Schauspiel, aufführten, stürmischen Beifall.
Der arme Verfasser des Stücks war sehr mißvergnügt. Nachdem er sich von seiner ersten Bestürzung erholt hatte, rief er den Schauspielern mit lauter Stimme zu: »Fortgefahren! In's Teufels Namen! Fortgemacht!«
In diesem Augenblicke zupfte ihn Jemand am Rock; er drehte sich um, es war der runde Arm der schönen Gisquette, die auf solche Art seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.
»Herr,« fragte das Mädchen, »werden sie wohl fortfahren?«
»Allerdings,« antwortete der Dichter.
»In diesem Falle, mein Herr, werdet Ihr wohl die Güte haben, mir zu erklären...«
»Was sie weiter sagen werden?« unterbrach sie der Dichter schnell. »Mit größtem Vergnügen werde ich...«
»Verzeiht, ich meine, was sie bis jetzt gesagt haben,« erwiederte Gisquette.
Der verblüffte Dichter verzuckte das Gesicht wie ein Mensch, dessen wundesten Fleck man berührt. »Dummes, einfältiges Gänschen!« murmelte er zwischen den Zähnen. Von dieser Minute an hatte es die schöne Gisquette, so reizend sie war, für immer mit ihm verdorben.
Inzwischen hatten die Schauspieler seinem Befehle Folge geleistet, und das Publikum hörte ziemlich aufmerksam zu. Der Störenfried, Johannes Frollo, verhielt sich ruhig, der Bettler zählte die gesammelten Pfennige in seinen alten Hut, und das Stück hatte seinen ungestörten Fortgang.
Es war aber auch ein sehr schönes Stück, und man könnte vielleicht heute noch Gebrauch davon machen, wenn man dort Etwas wegschnitte und hier Etwas zusetzte. Die Einleitung, zwar etwas lang und etwas langweilig, war einfach, und Peter Gringoire, in der Aufrichtigkeit seines Herzens, bewunderte ihre Klarheit. Man kann sich denken, daß die vier allegorischen Reisenden, nachdem sie drei Welttheile durchwandert hatten, ohne auf eine angemessene Weise sich ihres goldenen Delphins entledigen zu können, etwas ermüdet waren. Sie hatten demnach, während sie ausruhten, volle Muße, das Lob dieses wunderbaren Fisches zu singen und dabei tausend feine Anspielungen auf den jungen Bräutigam Margarethens von Flandern anzubringen, der damals in seinem traurigen Neste Amboise gewiß nicht daran dachte, daß Landmann und Geistlichkeit, Adel und Kaufmannschaft so eben von einer Reise um die Welt zurückgekommen waren, welche sie in seinen Geschäften gemacht hatten. Besagter Delphin war, wie man aus dem Munde des allegorischen Frankreichs, das sich auf dem Theater bewegte, vernahm, jung, schön, tapfer, und vor Allem (glorreicher Ursprung aller königlichen Tugenden!), war er der Sohn des Löwen von Frankreich. Diese Metapher war kühn und einzig in ihrer Art; auf der Bühne, besonders an einem allegorischen Tage, wo von Hochzeiten, Geburtsfesten etc. großer Herren die Rede ist, nimmt man es mit der Naturgeschichte nicht so genau und stoßt sich nicht an einem Fisch, welcher der Sohn eines Löwen ist; gerade diese seltsamen pindarischen Mischungen deuten auf wahren Enthusiasmus. Allerdings hätte der Dichter diesen schönen Gedanken in etwas weniger als zweihundert Versen entwickeln können, aber man muß bedenken, daß, laut Verordnung des Herrn Prévot, das Stück von der Mittagsstunde bis vier Uhr Abends dauern sollte, und in vier Stunden läßt sich Vieles sagen.
Das Stück war, zur Freude des Dichters, in vollem Gange, als es zu seinem Verdrusse auf's Neue gestört wurde. Als eben die Kaufmannschaft und der Adel in einem Streite begriffen waren, und der gute Bauersmann, von dem Löwen von Frankreich sprechend, mit Entzücken ausrief:
Dort brüllt er durch den Wald, und schüttelt seine Mähnen!
öffnete sich die Thüre der bisher verschlossenen Estrade, und der Thürsteher verkündete mit tönender Stimme: »Se. Eminenz, unser gnädigster Herr Kardinal von Bourbon!«
III. Der Kardinal
Armer Peter Gringoire! Der Donner von zwanzig Kanonen und hundert Büchsen hätte deinen Ohren nicht so wehe gethan, als die in diesem feierlichen dramatischen Augenblicke vom Munde eines Thürstehers ausgegangenen Worte: Se. Eminenz, der gnädigste Herr Kardinal von Bourbon!
Nicht als ob Peter Gringoire den Kardinal gefürchtet oder mißachtet hätte: er hatte weder jene Schwäche, noch diese Vermessenheit. Ein wahrhafter Eklektiker, gehörte Peter Gringoire zu jenen erhabenen und festen, gemäßigten und ruhigen Geistern, welche sich stets in der Mitte aller Dinge zu halten wissen (stare in dimidio rerum), und die der reinen Vernunft, der liberalen Philosophie, der theoretischen Freiheit und Allem, was groß und edel ist, huldigen, bei dem Allem aber Minister, Kardinäle, Bischöfe und Staatsräthe sind und bleiben. Ein kostbares Geschlecht praktischer Philosophen, das sich ununterbrochen fortgepflanzt hat vom Anfang der Dinge, und dem der Himmel den Knäuel der Klugheit verliehen hat, durch den es im Labyrinth aller Zeiten und Ereignisse stets einen erwünschten Ausgang findet! Zu allen Epochen ist und war dieses Geschlecht sich selbst gleich; es weiß sich in alle Zeiten zu schicken.
Nicht also aus Haß gegen den Kardinal oder aus Mißachtung war ihm dessen Eintritt unangenehm, sondern weil er eine neue Störung des Stücks fürchtete. Die Besorgnis des Dichters verwirklichte sich nur allzusehr. Der Eintritt Sr. Eminenz zog die ganze Schaulust des Publikums auf sich. Alle Köpfe drehten sich der Estrade zu. »Der Kardinal! Der Kardinal!« wiederholten tausend Stimmen. Der unselige Prolog gerieth abermals in Stocken. Der Kardinal blieb einen Augenblick auf der Schwelle der Estrade stehen und warf einen ziemlich gleichgültigen Blick auf die Zuschauer im Saale. Die Gährung stieg, jeder wollte die Eminenz sehen.
In der That war auch diese Eminenz ein Herr von großer Gestalt und ebenso sehenswerth, als manches andere Schaustück. Karl, Kardinal von Bourbon, Erzbischof und Graf von Lyon, Primas der Gallier, war mit Ludwig XI. und Karl dem Kühnen verwandt, mit Jenem durch seinen Bruder Peter von Beaujeu, der die älteste Tochter des Königs geheirathet hatte, mit Diesem durch seine Mutter, Agnes von Burgund. Der Hauptzug im Charakter des Primas der Gallier war jener Höflingsgeist, jene Ergebenheit gegen die herrschende Macht, wie wir sie heute noch, so sehr wir uns auch der Fortschritte unserer Civilisation rühmen, tausend-und hunderttausendfältig sehen. Man kann sich denken, in welche zahllose Verlegenheiten ihn diese doppelte Verwandtschaft brachte, und welche weltliche Klippen sein geistliches Schifflein zu umsegeln hatte, um weder an Ludwig noch an Karl zu scheitern, dieser Scylla und Charybdis, die den Herzog von Remours und den Connetable Saint-Pol verschlungen hatten. Unter dem Beistand des Himmels hatte er die Durchfahrt glücklich vollendet und war in dem Hafen zu Rom angelangt, um den rothen Hut, als Preis seiner Bemühungen, in Empfang zu nehmen. Aber obgleich er jetzt im sichern Hafen war, und gerade eben deßhalb, dachte er niemals ohne Unruhe an die vermiedenen Wechselfälle seines politischen Lebens, das so lange Zeit stürmisch und thatenreich war.
Im Übrigen war der Kardinal, was man einen guten Mann heißt; er führte ein lustiges Leben, wie die hohe Geistlichkeit pflegte, trank seinen schäumenden Champagner, war einem feinen Nönnchen nicht abgeneigt, gab lieber hübschen Mädchen als alten Weibern Almosen, und war deßhalb, als ein munterer, leutseliger Herr, wohl gelitten beim Volke von Paris. So oft er öffentlich erschien, umgab ihn ein Schwarm junger Geistlicher, die so galant waren, als heutige Stutzer, und so liederlich, als man nur immer wünschen mochte. Mehr als einmal, wenn alte Betschwestern Abends am erleuchteten Palast des Kardinals vorübergingen, hörten sie zu ihrem Entsetzen die nämlichen Stimmen, die ihnen erst noch in der Kirche zur Vesper gesungen, das bacchische Lied Benedikts XII. anstimmen: Bibamus papaliter.
Ohne Zweifel war es diese so wohl erworbene Popularität, die dem Kardinal bei seinem Eintritt einen schlimmen Empfang von Seiten der Menge ersparte, welche eben noch so unzufrieden gewesen war, und wenig geneigt schien, an dem Tage, wo sie einen Pabst wählte, mit einem Kardinal viele Umstände zu machen. Es ist ein guter Schlag Leute um diese Pariser, sie vergessen und vergeben gerne, und zudem hatten sie ja, da sie das Stück aus eigener Machtvollkommenheit beginnen ließen, einen Sieg über den Kardinal davon getragen, und dieser Triumph genügte ihnen. Ueberdies war der Herr Kardinal von Bourbon ein großer, stattlicher Herr, trug einen sehr schönen Scharlachmantel, wußte sich eine vornehme Haltung zu geben, und hatte mithin den einflußreichsten Theil des Publikums, die Weiber, für sich. Es wäre aber auch die höchste Ungerechtigkeit und Gemeinheit, einen Kardinal auszuzischen, weil er im Schauspiel auf sich warten ließ, wenn dieser Kardinal ein stattlicher Herr ist, einen Scharlachmantel trägt und eine vornehme Haltung hat.
Der Kardinal trat demnach ein und grüßte die Versammlung mit jenem fürstlichen Lächeln, das den Großen gegen das Volk immer zu Gebote steht, und das sich, gleich Krone und Scepter, von Vater auf Sohn vererbt. Hierauf setzte er sich mit abgemessenen Schritten gegen den rothsammt'nen Lehnsessel in Bewegung, der für ihn bereit gestellt war. Ihm auf dem Fuße folgte sein geistlicher Generalstab, dessen Erscheinen den Lärm und die Neugierde im Parterre verdoppelte. Man deutete mit Fingern auf jeden Einzelnen und nannte seinen Namen.
Das Volk, und besonders die Studenten, machten vollen und ungemessenen Gebrauch von den Privilegien, die ihnen das heutige Narrenfest verlieh. Nichts war zu gemein und frech, daß es nicht an diesem Tage gestattet und fast geheiligt gewesen wäre. Jeder wählte sich unter dem geistlichen Generalstab des Kardinals eine schwarze, graue, weiße oder violette Mütze zur Zielscheibe seines Witzes aus. Damit war aber Johannes Frollo de Molendino, als Bruder eines Archidiakonus, noch nicht zufrieden, sondern griff kühnlich den rothen Hut selbst an, indem er freche Blicke auf den Kardinal warf und aus vollem Halse sang: Cappa repleta mero!
Alle diese Einzelnheiten, welche wir hier zur Erbauung des Lesers mittheilen, verloren sich so sehr unter dem allgemeinen Geräusch, daß fast keine Spur von ihnen bis zur Estrade gelangte. Im Uebrigen würde sie der Kardinal geduldig hingenommen haben, weil die Freiheiten dieses Tages ganz in den Sitten jener Zeit lagen. Zudem lag ihm noch etwas ganz Anderes auf dem Herzen, nämlich die Gesandtschaft von Flandern. Nicht als ob er ein großer Politiker gewesen wäre, den die möglichen Folgen einer Verbindung Margarethens von Burgund mit dem Erben von Frankreich schreckten, sondern bloß weil er den flämischen Gesandten Feste geben und Höflichkeiten erweisen mußte, er, Karl von Bourbon, gemeinen Bürgern, er, der Kardinal, ungehobelten flämischen Schöppen, er, ein artiger und lustiger Franzose, niederländischen Bierlümmeln! Mit solchen Leuten öffentlich zu erscheinen, war eine harte Probe, welche nur die geprüfte Königsliebe eines geprüften Höflings zu bestehen vermochte.
Als nun die Thüre sich mit Geräusch öffnete und der Thürsteher mit lauter Stimme ausrief: »Die Herren Gesandten des Herrn Herzogs von Oesterreich!« wendete der Kardinal mit der zärtlichsten Miene von der Welt (so sehr hat ein Höfling sich in der Gewalt) sein Gesicht der Eingangspforte zu.
Jetzt erschienen paarweise mit ernstem Wesen, das in auffallendem Gegensatz zu dem muthwilligen geistlichen Generalstab Karls von Bourbon stand, die achtundvierzig Gesandten Maximilians von Oesterreich, an ihrer Spitze der sehr ehrwürdige Vater in Gott, Jehan, Abt von Saint-Bertin, Kanzler des Ordens vom goldenen Vließ, und Jakob Van Goy, Herr zu Dauby, Bürgermeister von Gent. Die Versammlung im Saale hörte mit halb ersticktem Lachen die fremdartigen Namen und die bürgerlichen Qualifikationen der flandrischen Gesandten an, die der Thürsteher, wie Kraut und Rüben, entstellt und verstümmelt von der Estrade unter das Publikum warf. Da hörte man die für ein französisches Ohr barbarisch klingenden Namen: Loys Roelof, Schöppe der Stadt Löwen: Paul Baeust, Präsident der Provinz Flandern; Jehan Coleghens, Bürgermeister der Stadt Antwerpen; Meister Georg van Moeren, erster Schöppe der Stadt Gent; Meister Geldolf van der Haagen, Schöppe gedachter Stadt; Jehan Pinnok u. s. w., lauter gute, dicke, wohlgenährte flämische Figuren.
Ein einziger derselben machte eine Ausnahme von der Regel. Das war ein feines, verständiges, verschmitztes Gesicht, gegen welches der Kardinal drei Schritte vorwärts und eine tiefe Verbeugung machte, obgleich dasselbe bloß einem gewissen Wilhelm Rym, Rathsherrn der Stadt Gent, angehörte. Wenigen war es damals bekannt, welche Bedeutung dieser Wilhelm Rym hatte; ein seltener Geist, der in stürmischen Zeiten, wie wir sie erlebt haben, an der Spitze einer Revolution erschienen wäre, im fünfzehnten Jahrhundert aber zum Handlanger der lichtscheuen Ränke jener Zeit verdammt war. Ludwig XI., der erste Maulwurf des damaligen Europa's, wußte ihn in seinen geheimen Aufträgen gar wohl zu gebrauchen. Das war aber dem großen Haufen im Saale gänzlich unbekannt, und er ergötzte sich daher nicht wenig an den Höflichkeitsbezeugungen, die, seiner Meinung nach, der Kardinal an die unscheinbare Figur eines flandrischen Stadtraths verschwendete.
IV. Meister Jakob Coppenole
Während der Rathsherr von Gent und die Eminenz tiefe Verbeugungen wechselten und einige leise Worte mit einander flüsterten, trat ein Mann von hoher Gestalt, breiten Schultern und kräftigem, fast plumpem Gesichte, zu gleicher Zeit unter die Thüre. Man konnte einen Bullenbeißer neben einem Fuchs zu sehen glauben. Seine einfache Filzkappe und sein ledernes Koller nahmen sich schlecht aus in der Mitte seiner Umgebungen, die von Gold, Sammt und Seide starrten. Der Thürsteher, der ihn für irgend einen Troßknecht hielt, der sich eindringen wolle, verwehrte ihm den Eintritt.
»Heda, guter Freund! Hier wird nicht passirt.«
Der Mann im ledernen Koller faßte den Thürsteher mit kräftiger Faust an der Schulter und rief mit einer Donnerstimme, die den ganzen weiten Saal erfüllte: »Was willst Du, Bengel? Siehst Du nicht, daß ich auch dazu gehöre?«
»Euer Name?« fragte der Thürsteher.
»Jakob Coppenole.«
»Eure Qualitäten?«
»Strumpfweber zu den drei Ketten in Gent.«
Der Thürsteher prallte vor Schrecken drei Schritte zurück. Bürgermeister und Schöppen anzukündigen, das ging noch an, aber einen Strumpfweber, das war allzu hart. Der Kardinal saß auf Nadeln. Alles Volk horchte und schaute. Seit zwei Tagen bereits hatte sich die Eminenz alle Mühe gegeben, diese flämischen Bären etwas glatt zu lecken, um sie für das Publikum möglichst präsentabel zu machen, und nun kam dieser Akt dazwischen! Wilhelm Rym näherte sich, um den Kardinal aus der Verlegenheit zu ziehen, dem Thürsteher mit seinem feinen Lächeln und flüsterte ihm in die Ohren: »Verkündiget Meister Jakob Coppenole, Schreiber des Schöppenstuhls der Stadt Gent.«
»Thürsteher,« wiederholte der Kardinal mit lauter Stimme, »verkündiget Meister Jakob Coppenole, Schreiber des Schöppenstuhls der erlauchten Stadt Gent.«
Das war ein Fehler; Wilhelm Rym, für sich allein, hätte die Schwierigkeit beseitigt, jetzt aber hatte Jakob Coppenole die Worte des Kardinals vernommen.