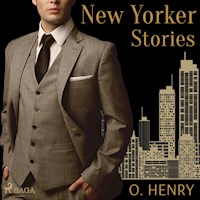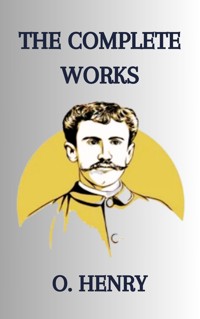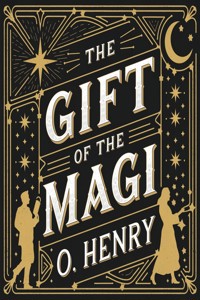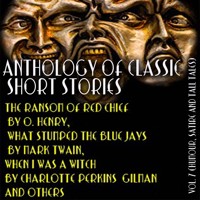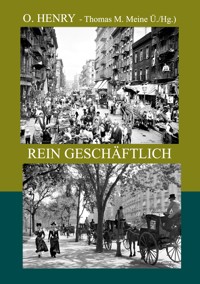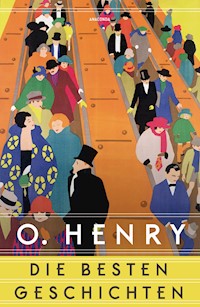
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten von O. Henry (1862–1910) kommen immer rasch auf den Punkt: eine clever entwickelte Szene aus dem Alltagsleben mit verblüffender Pointe. Zehn Minuten Lesezeit, lang nachhallende Wirkung. Der Meister der Short Story beobachtete die ganz normalen Menschen in ihrem meist großstädtischen Umfeld und brachte eine kleine Begebenheit unversehens zum Funkeln. Diese Auswahl seiner besten Erzählungen in der neuen Übersetzung von Alexandra Berlina, die unter anderem die berühmte Weihnachtsgeschichte »Das Geschenk der Weisen« enthält, bietet Leserinnen und Lesern hierzulande endlich wieder einen Zugang zum Werk des amerikanischen Erfolgsautors. Eine echte Entdeckung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
O. Henry
Die besten Geschichten
Neu übersetzt von Alexandra Berlina
Anaconda
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Horace Taylor (1881–1934), Brightest London is Best Reached by Underground, Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Achim Münster, Overath
ISBN978-3-641-29162-4V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Die Gaben der Weisen7
Kleider, Sachen, Leute17
Das möblierte Zimmer28
Der Cop und der Choral40
Per Kurier52
Nach zwanzig Jahren59
Die grüne Tür65
Weihnachten in Yellowhammer78
Schweineethik99
Das missglückte Monopol115
Die dritte Zutat127
Das Mädchen149
Ein Weihnachtsgeschenk von Frio Kid159
Hexenbrot168
Das letzte Blatt175
Editorische Notiz189
Die Gaben der Weisen
Ein Dollar siebenundachtzig. Das war’s. Davon sechzig einzelne Cents – erspart und errettet durch unnachgiebiges Feilschen mit dem Metzger, dem Gemüsehändler und dem Krämer, bis Della vor jedermanns stillen, doch spürbaren Missbilligung solcher Knauserei die Wangen brannten. Dreimal zählte sie nach. Ein Dollar siebenundachtzig. Und morgen war Weihnachten.
Was konnte man da schon anfangen, als sich auf das abgewetzte kleine Sofa zu werfen und loszuheulen? Also tat Della genau das. Woraus wir übrigens auch den philosophischen Schluss ziehen können, dass das Leben aus Schluchzen, Schniefen und Schmunzeln besteht, wobei Schniefen dominiert.
Während die Dame des Hauses nun also vom Ersten zum Zweiten übergeht, können wir uns umschauen. Eine möblierte Wohnung, für 8 Dollar pro Woche, die zwar nicht jeder Beschreibung spottete, sich aber zumindest ins Fäustchen lachte bei jedem Versuch, ihr erzählerisch gerecht zu werden.
In der Eingangshalle unten fand sich ein Briefkasten, in den kein Brief passen wollte, und ein elektrischer Klingelknopf, dem kein sterblicher Finger jemals einen Ton entlocken konnte. Zu diesem Knopf gehörte auch ein Schild, und auf dem Schild prangte der Name »Mr James Dillingham Young«.
»Dillingham« hatte sich in früheren, gedeihlicheren Zeiten übermütig dazugesellt, als Mr Young noch 30 Dollar pro Woche verdiente. Nun war das Einkommen auf 20 Dollar geschrumpft, und der zweite Vorname wirkte verschämt und verschwommen, als ob er ernstlich erwöge, sich zu einem bescheidenen »D.« zusammenzuziehen. Zu Hause wurde Mr James Dillingham Young ohnehin einfach nur Jim genannt, und zwar von Mrs James Dillingham Young, die Sie bereits als Della kennen, und die ihrem Mann jeden Tag freudig um den Hals fiel, wenn er in die Wohnung kam. Und das ist auch alles gut so.
Della hatte inzwischen zu Ende geweint und frischte sich mit der Puderquaste die Wangen auf. Dann ging sie zum Fenster und blickte trübe auf eine graue Katze, die in dem grauen Hof über einen grauen Zaun spazierte. Morgen war Weihnachten, und sie hatte nur 1,87 $, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Monat für Monat hatte sie jeden Cent gespart, und dies war das Ergebnis. Mit zwanzig Dollar die Woche ist eben nicht viel zu machen. Die Ausgaben waren größer als gedacht. Das sind sie ja immer. Nur 1,87 $, um Jim etwas zu schenken. Ihrem Jim. So viele glückliche Stunden hatte sie damit zugebracht, etwas besonders Schönes für ihn zu erträumen! Etwas Feines und Rares und Edles – etwas, was seiner zumindest beinahe würdig wäre.
Zwischen den Fenstern hing ein Pfeilerspiegel. Vielleicht haben Sie mal einen Pfeilerspiegel in einer 8-Dollar-Wohnung gesehen. Eine sehr schmale und sehr wendige Person kann darin ein relativ stimmiges Bild ihres Äußeren erhaschen, wenn sie die aufeinanderfolgenden vertikalen Ausschnitte rasch genug betrachtet. Die schlanke Della hatte diese Kunst gemeistert.
Auf einmal wirbelte sie vom Fenster weg und stellte sich vor den Spiegel. Ihre Augen leuchteten, aus ihrem Gesicht aber war alle Farbe gewichen. Rasch löste sie ihr Haar und ließ es zu seiner vollen Länge herabwallen.
Nun hatten die James Dillingham Youngs zwei Besitztümer, auf die sie mächtig stolz waren. Das eine war Jims goldene Taschenuhr, die seinem Vater und davor seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar. Lebte die Königin von Saba im Haus gegenüber, müsste Della nur einmal ihr frischgewaschenes Haar am Fenster trocknen lassen, um alle Juwelen und Kostbarkeiten Ihrer Majestät in den Schatten zu stellen. Wäre König Salomo der Hausmeister und der Keller voll seiner Schätze, würde er sich jedes Mal vor Neid den Bart raufen, wenn Jim im Vorbeigehen wie zufällig seine Uhr aus der Westentasche zog.
Nun öffnete Della also ihr schönes Haar, und es fiel in glänzenden Kaskaden flüssiger Bronze. Fast wie ein Gewand umhüllte es sie bis zu den Kniekehlen. Nach einem Blick in den Spiegel steckte sie es nervös und hastig wieder hoch. Kurz zauderte sie; eine Minute lang stand sie da, und auf den fadenscheinigen roten Teppich fiel die eine oder andere Träne.
Dann aber an mit dem alten braunen Mantel, auf mit dem alten braunen Hut. Dellas Rock wirbelte hoch, als sie aus der Wohnung und die Treppe hinunter eilte, die Augen immer noch feucht.
Ihr Ziel war ein Haus mit dem Aushang »Madame Sofronie. Haarwaren aller Art«. Della flog in den ersten Stock und blieb keuchend vor der Tür stehen. Madame, wuchtig, bleich und kühl, sah kaum nach einer Sofronie aus.
»Würden Sie mein Haar kaufen?«, fragte Della.
»Kann schon sein«, sagte Madame. »Ziehn Sie mal Ihren Hut aus, und dann schaun wir.«
Wieder fiel die bronzene Kaskade.
Madame wog die Haarpracht mit geübter Hand und verkündete: »Zwanzig Dollar.«
»Her damit!«, sagte Della.
Die nächsten zwei Stunden vergingen wie im Flug. Nein, streichen Sie die abgedroschene Metapher. Della durchwühlte die Läden nach einem Geschenk für Jim.
Und schließlich fand sie es. Es war ganz offensichtlich für Jim gemacht und für niemanden sonst. In keinem der anderen Läden gab es so etwas, und sie hatte sie allesamt auf den Kopf gestellt. Es war eine Uhrkette aus Platin. Einfach gestaltet, konzentriere sie ihren Wert im Wesentlichen; wie alle wirklich guten Dinge kam sie ganz ohne grelles Schmuckwerk aus. Ja, sie war tatsächlich der Uhr würdig. Sobald Della sie erblickte, wusste sie: Die Kette musste Jim gehören. Schlicht aber edel – so waren sie beide. Einundzwanzig Dollar kostete die Kette, und Della eilte mit den 78 Cents nach Hause. Nun würde Jim in jeder Gesellschaft in aller Ruhe die Uhrzeit studieren können. Bis jetzt stand es nämlich so, dass er manchmal heimlich auf seine prächtige Uhr schaute, denn statt an einer Kette hing sie an einem alten Lederband.
Zu Hause wich Dellas trunkene Freude der Umsicht und Vernunft. Sie nahm die Brennzange, zündete das Gas an und machte sich daran, die Verwüstung zu kaschieren, die Großmut und Liebe angerichtet hatten. Und das ist immer eine enorme Aufgabe, meine lieben Leserinnen und Leser. Eine Mammutaufgabe.
Vierzig Minuten später kräuselten sich um Dellas Kopf dichte Löckchen, sodass sie ganz bezaubernd nach einem Buben aussah, der gerade die Schule schwänzt. Sie blickte in den Spiegel – lange, aufmerksam und kritisch.
»Wenn Jim mich nicht gleich nach dem ersten Blick umbringt«, sprach sie zu sich, »sagt er bestimmt, ich sehe aus wie ein Coney-Island-Showgirl. Aber was hätte ich denn tun sollen? Was hätte ich mit einem Dollar siebenundachtzig tun sollen?«
Um sieben Uhr abends war der Kaffee fertig, und die Pfanne wärmte sich auf dem Herd, bereit, die Koteletts zu empfangen.
Jim kam nie zu spät nach Hause. Della legte die Uhrkette in der Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante nahe der Tür. Dann hörte sie seine Schritte unten auf der Treppe, und das Blut wich ihr für einen Augenblick aus dem Gesicht. Sie hatte die Gewohnheit, kleine Gebete über die alltäglichsten Dinge aufzusagen, und nun flüsterte sie: »Lieber Gott, mach bitte, dass er mich immer noch hübsch findet.«
Die Tür ging auf; Jim trat herein und schloss hinter sich ab. Er sah sehr dünn aus, und sehr ernst. Der Arme war erst zweiundzwanzig – und trug schon die Bürde des verheirateten Mannes! Er könnte einen neuen Mantel gebrauchen, und Handschuhe hatte er gar keine.
Jim machte einen Schritt ins Zimmer und erstarrte wie ein Jagdhund, der eine Wachtel gerochen hat. Sein Blick war auf Della geheftet – und es erschreckte sie, dass sie seinen Ausdruck nicht lesen konnte. Es war nicht Ärger, nicht Überraschung, nicht Missfallen, nicht Schrecken, nicht irgendeins der Gefühle, auf die sie gefasst war. Er starrte sie einfach an, mit diesem seltsamen Ausdruck im Gesicht.
Della rutschte vom Tisch und stürzte zu ihm.
»Jim, Liebster«, rief sie, »jetzt schau mich doch nicht so an! Ich hab mein Haar eben abgeschnitten und verkauft; ich konnte dich ja Weihnachten nicht leer ausgehen lassen. Es wächst schon noch nach – du bist mir doch nicht böse, oder? Das musste einfach sein. Mein Haar wächst auch ganz furchtbar schnell! Jetzt sag doch mal ›frohe Weihnachten!‹, Jim, und lass uns glücklich sein. Du weißt ja noch gar nicht, was ich für ein schönes – ein richtig schönes Geschenk für dich habe!«
»Du hast dein Haar abgeschnitten?«, fragte Jim mit sichtlicher Anstrengung, als wäre diese sonnenklare Tatsache bei ihm trotz aller geistiger Bemühung noch nicht ganz angekommen.
»Abgeschnitten und verkauft«, sagte Della. »Aber du magst mich doch trotzdem, nicht wahr? Ich bin ja ich, auch ohne mein Haar, oder?«
Jim schaute sich um, als sähe er die Wohnung zum ersten Mal.
»Dein Haar ist also weg?«, wiederholte er nahezu idiotisch.
»Weg, fort, verschwunden, nicht mehr da. Ich sage doch: Ich hab’s verkauft. Jetzt aber komm, es ist Weihnachten, Junge! Sei bitte lieb zu mir, ich hab’s ja für dich getan.« Dann fuhr Della fort, auf einmal ernst und zärtlich: »Vielleicht könnte man die Haare auf meinem Kopf abzählen, aber meine Liebe zu dir kann niemand berechnen. Soll ich jetzt die Koteletts braten, Jim?«
Da erwachte Jim schließlich aus seiner Trance. Er schloss seine Della in die Arme. Schauen wir für ein paar Sekunden weg, betrachten wir irgendeinen belanglosen Gegenstand am anderen Ende des Zimmers. Acht Dollar pro Woche oder eine Million pro Jahr – was macht das schon für einen Unterschied? Ein Mathematiker hätte etwas dazu zu sagen, oder auch ein Aphoristiker; doch beide würden sich irren. Die drei Weisen hatten ihrerzeit wertvolle Gaben gebracht, doch eine brachten sie nicht. Diese dunkle Behauptung wird später noch erhellt.
Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und ließ es auf den Tisch fallen.
»So meine ich das nicht, Dell!«, sagte er. »Es wurde noch kein Shampoo und kein Schnitt erfunden, die zwischen mich und mein Mädchen kommen könnten. Aber mach mal das Päckchen hier auf, dann siehst du schon, warum ich erst so benommen war.«
Finger zart und flink rissen an der Schnur und am Papier. Dann ein ekstatischer Freudenschrei und dann – ah, dann kamen schon die ewig weiblichen Tränen und Klagen, die den Einsatz aller Trosttalente des Hausherrn erforderten.
Denn da lagen die Kämme: Die Garnitur von Schmuckkämmen – zwei für die Seiten, einer für den Hinterkopf –, die Della schon lange in einem Schaufenster auf dem Broadway bewundert hatte. Wunderschöne Kämme waren das, reines Schildpatt, mit Edelsteinen besetzt, und genau die richtige Farbe für das ebenso wunderschöne und nun verlorene Haar. Die Kämme waren teuer, das wusste Della, und ihr Herz hatte sich ohne jede Hoffnung danach verzehrt. Jetzt gehörten sie ihr. Die langen Locken und der ersehnte Schmuck hätten sich gegenseitig zieren sollen – nun waren die ersten nicht mehr da.
Doch schließlich presste sich Della die Kämme an die Brust, hob den Blick und lächelte durch die Tränen: »Mein Haar wächst so schnell nach, Jim!«
Und dann sprang sie auf wie ein erschrecktes Kätzchen und rief: »Oh, oh!«
Jim hatte ihr wunderbares Geschenk ja noch gar nicht gesehen! Voller Vorfreude streckte sie ihm die offene Hand mit der Kette entgegen. Das edle matte Metall schimmerte auf, als spiegelte es ihr leuchtendes, stürmisches Wesen.
»Ist sie nicht ein Gedicht, Jim? Ich habe die ganze Stadt abgesucht, bevor ich sie entdeckte. Jetzt musst du jeden Tag hundertmal nach der Zeit schauen! Komm, gib mir deine Uhr, ich will sehen, wie sie sich an der Kette macht.«
Doch statt zu gehorchen, ließ sich Jim aufs Sofa fallen, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und lächelte.
»Dell«, sagte er, »lass uns unsere Weihnachtsgeschenke mal für eine Weile beiseitelegen. Sie sind für den Moment zu schön. Die Uhr habe ich verkauft, um dir die Kämme schenken zu können. Und jetzt – hast du nicht etwas von Koteletts gesagt?«
Die Heiligen Drei Könige, das ist weithin bekannt, waren weise Menschen, sehr weise sogar. Sie brachten dem Kinde in der Krippe ihre Gaben und erfanden damit das Weihnachtsgeschenk. In ihrer Weisheit schenkten sie sicherlich auch weise, wahrscheinlich mit Umtauschrecht, für den Fall, dass man schon Weihrauch und Myrrhe im Haus hatte. Und da erzähle ich ohne jede Kunst diese simple Geschichte von zwei närrischen Kindern in einer winzigen Wohnung, die füreinander äußerst unweise die größten Schätze opferten, die sie besaßen. Doch eines will ich den heutigen Weisen sagen: Unter allen Schenkenden waren diese zwei die Weisesten. Unter allen, die schenken und beschenkt werden, sind Menschen wie sie die weisesten. Sie sind die Weisen.
Kleider, Sachen, Leute
Mr Towers Chandler bügelte in seinem Mietzimmer den Abendanzug. Das eine Bügeleisen wurde auf dem kleinen Gasherd vorgeheizt, das zweite kräftig hin und her geschoben, um die perfekte Falte zu erzeugen, die sich schnurgerade von Mr Chandlers tief ausgeschnittener Weste bis zu seinen Lackschuhen erstrecken sollte. So viel und nicht mehr wollen wir hier von der Toilette des Helden verraten. Den Rest mit all seinen erniedrigenden Kniffen kann erahnen, wer selbst die vornehme Armut kennt. Wir aber schauen den jungen Mann erst wieder an, wenn er die Stufen seiner Herberge hinabsteigt: makellos gekleidet, ruhig, sicher, gutaussehend – offensichtlich ein Stammgast der edlen New Yorker Clubs, der sich leicht gelangweilt auf den Weg zu den üblichen Abendvergnügungen macht.
Nun verdiente Chandler aber 18 Dollar die Woche, und zwar in einem Architekturbüro. Er war zweiundzwanzig; er hielt Architektur für eine wahre Kunst; und, auch wenn er es in New York nicht laut zugegeben hätte, fand er den Mailänder Dom doch tatsächlich baukünstlerisch dem Flatiron Building überlegen.
Von jedem Wochenverdienst legte Chandler einen Dollar beiseite. Nach jeweils zehn Wochen trat er mit dem so angesammelten Kapital an die Schnäppchentheke des geizigen alten Gevatters Zeit und erwarb sich einen Abend als Gentleman. Er trug die Insignien der Millionäre und Präsidenten; er begab sich in das Viertel, wo das Leben am prächtigsten leuchtet, und speiste dort mit Luxus und Geschmack. Mit zehn Dollar in der Tasche kann man für ein paar Stunden sehr überzeugend den wohlhabenden Müßiggänger spielen. Die Summe ist mehr als ausreichend für ein elegantes Essen, dazu eine Flasche mit respektablem Etikett, ein angemessenes Trinkgeld, eine Zigarre, ein Cab und die üblichen Etceteras.
Dieser eine köstliche unter siebzig öden Abenden war für Chandler stets ein frischer Quell der Glückseligkeit. Eine höhere Tochter erlebt nur einen ersten Ball, und dieser allein tröstet sie mit süßer Erinnerung, wenn ihr Haar weiß wird – Chandler aber empfand alle zehn Wochen eine Freude so durchdringend, so aufregend, so neu wie die allererste. Zwischen Bonvivants im Wirbel des unsichtbaren Orchesters unter Palmen zu sitzen, die Habitués dieses Paradieses zu betrachten und von ihnen betrachtet zu werden – was ist im Vergleich dazu schon der erste Tanz eines Mädchens im Tüllkleid mit kurzen Ärmeln?
Von der allabendlichen Kleiderparade umgeben, schritt Chandler den Broadway hinauf, Betrachter und gleichsam Exponat. An den nächsten neunundsechzig Abenden würde er Kammgarn tragen; statt eines Restaurants erwarteten ihn dubiose Mittagsmenüs, schnell hinuntergeschlungene Mahlzeiten in einem Diner und mit Bier hinuntergespülte Sandwiches auf seinem Mietzimmer. Dazu war er bereit, denn er war ein echter Sohn der Hauptstadt des großen Tamtams, und ein paar Stunden im Rampenlicht waren ihm viele dunkle Abende wert.
Chandler schlenderte langsam an den Vierziger-Straßen entlang, wo der Broadway zur Straße des Müßiggangs wurde: Der Abend war noch jung, und wenn man nur alle siebzig Tage einmal zur Crème de la Crème gehört, will man den Genuss doch in die Länge ziehen. Unterwegs erhaschte er strahlende, finstere, neugierige, bewundernde, aufreizende, verlockende Blicke, denn seine Kleidung und sein Auftreten offenbarten in ihm einen wahren Bonvivant.
Einmal blieb er stehen und überlegte sich, ob er zurück zu dem mondänen Restaurant spazieren sollte, in dem er meist an seinen Luxusabenden zu speisen pflegte. In diesem Augenblick trippelte ein Mädchen leichtfüßig um die Ecke, rutschte auf dem vereisten Schnee aus und plumpste zu Boden.
Chandler eilte zu ihr und half ihr mit aller Höflichkeit auf die Beine. Das Mädchen humpelte zur Hauswand, lehnte sich dagegen und bedankte sich sittsam.
»Ich glaube, mein Knöchel ist verstaucht«, sagte sie dann. »Der Fuß hat sich beim Fallen verdreht.«
»Tut es sehr weh?«, fragte Chandler besorgt.
»Nur wenn ich darauf auftrete. Ich denke, in ein paar Minuten kann ich wieder laufen.«
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, erkundigte sich der junge Mann. »Ein Cab rufen vielleicht?«
»Danke«, antwortete sie leise, aber herzlich. »Machen Sie sich bitte keine Umstände. Es war so ungeschickt von mir! Dabei trage ich furchtbar vernünftige Schuhe – den Absätzen kann ich die Schuld wahrlich nicht zuschieben.«
Chandler betrachtete das Mädchen mit wachsender Bewunderung. Sie war hübsch, auf eine feine, grazile Art; ihr Blick war fröhlich und freundlich. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid, eine Shopgirl-Uniform vielleicht. Ihre glänzenden dunkelbraunen Locken schauten unter einem billigen schwarzen Strohhut hervor, den lediglich ein dezentes Samtband mit Schleife schmückte. Kurz: Sie war das Idealbild eines anständigen arbeitenden Mädchens.
Plötzlich kam der junge Architekt auf eine Idee. Er würde sie zum Essen einladen! Genau das hatte seinen prächtigen Festmahlen gefehlt. Die kurzen Stunden des eleganten Luxus würden ihm das doppelte Vergnügen bereiten, wenn er sie mit einer Dame teilte. Und sie war eine Dame, das machten ihr Benehmen und ihre Sprache ganz deutlich. Trotz ihrer äußerst schlichten Kleidung war er sicher: Es würde ein Vergnügen sein, mit ihr an einem Tisch zu sitzen.
Rasch schwirrten ihm diese Gedanken durch den Kopf, und schon wusste er: Gleich würde er sie tatsächlich fragen. Es verstieß natürlich gegen die Etikette, aber Frauen, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienten, waren ja oft weniger formell gesinnt. Sie besaßen Menschenkenntnis und hielten mehr auf ihr eigenes Urteil als auf leere Gepflogenheiten. Wenn er seine zehn Dollar mit Bedacht ausgab, war eine feine Mahlzeit für zwei durchaus drin. Und was für eine wunderbare Erfahrung so ein Abendessen für sie sein würde, was für ein Kontrast zu der grauen Routine ihres Lebens! Sicherlich würde ihre aufrichtige Freude an dem Dinner zu seiner eigenen beitragen.
»Ich glaube«, sagte er offen und ernst, »Ihr Fuß braucht eine längere Pause, als Sie vermuten. Es gäbe da eine Möglichkeit, ihm etwas Ruhe zu gönnen – und mir gleichzeitig einen Gefallen zu tun. Ich wollte gerade essen gehen, mutterseelenallein, als Sie um die Ecke stolperten. Kommen Sie mit: Wir dinieren gemütlich, plaudern ein bisschen; in der Zwischenzeit erholt sich Ihr Knöchel und trägt Sie dann bestimmt tapfer nach Hause.«
Das Mädchen blickte schnell in Chandlers ehrliches, freundliches Gesicht. Ein Funkeln blitzte kurz in ihren Augen, und dann lächelte sie offen.
»Wir kennen uns doch gar nicht – wäre das nicht falsch?«
»Überhaupt nicht«, antwortete der junge Mann mit aller Aufrichtigkeit. »Ich stelle mich sogleich vor – erlauben Sie, Mr Towers Chandler. Ich hoffe, Ihnen das Dinner so angenehm wie möglich zu machen, und danach will ich mich von Ihnen verabschieden oder Sie bis zur Tür begleiten, ganz wie Sie möchten.«
»Aber meine Güte!«, rief das Mädchen mit einem Blick auf Chandlers makellosen Anzug. »Ich mit meinem alten Kleid und Hut!«
»Das macht nichts«, sagte Chandler fröhlich. »Keine Dame in Abendgarderobe könnte bezaubernder aussehen als Sie, da bin ich mir ganz sicher.«
»Mein Knöchel tut tatsächlich noch weh«, gab das Mädchen nach einem versuchten Schritt zu. »Ich nehme Ihre Einladung an, Mr Chandler. Nennen Sie mich bitte – nennen Sie mich Miss Marian.«
»Dann wollen wir los, Miss Marian«, sagte der junge Architekt beschwingt, aber galant, »keine Sorge, es ist nicht weit. Gleich im nächsten Block kenne ich ein sehr respektables, gutes Restaurant. Stützen Sie sich bitte auf meinen Arm – ja, so –, und dann wollen wir ganz langsam laufen. Ein einsames Abendessen ist schon etwas trist. Ich muss zugeben, ein bisschen freue ich mich, dass Sie auf dem Eis ausgerutscht sind.«
Als die beiden an einem wohlgedeckten Tisch Platz genommen hatten und ein beflissener Kellner vor ihnen stand, empfand Chandler wieder die sprudelnde Freude, die ihm jeder seiner Luxusabende brachte.