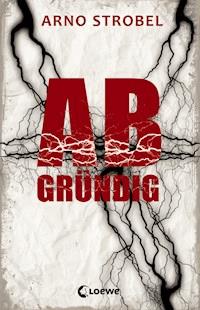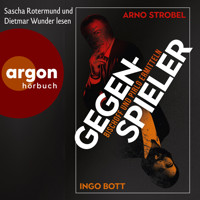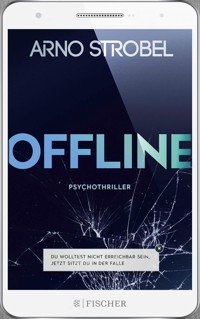
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fünf Tage ohne Handy. Ohne Internet. Offline. Der neue Psycho-Thriller von Bestseller-Autor Arno Strobel Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. Digital Detox. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. Aber am zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg. Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Arno Strobel
OFFLINE
Du wolltest nicht erreichbar sein. Jetzt sitzt du in der Falle.
Psychothriller
Über dieses Buch
Fünf Tage ohne Handy. Ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf 2000 Metern Höhe reist.
Aber am zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg. Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb sind seine Thriller wie spannende Entdeckungsreisen zu den dunklen Winkeln der menschlichen Seele und machen auch vor den größten Urängsten nicht Halt.
Alle seine bisherigen Thriller waren Bestseller, standen wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Arno Strobel lebt als freier Autor in der Nähe von Trier.
www. arno-strobel.de
www.facebook.com/arnostrobel.de
@arno.strobel
Außerdem bei FISCHER Taschenbuch erschienen:
»Der Trakt«, »Das Wesen«, »Das Skript«, »Der Sarg«, »Das Rachespiel«,» Das Dorf«, »Die Flut«, »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe«, »Im Kopf des Mörders – Kalte Angst«, »Im Kopf des Mörders – Toter Schrei«, »Die App«, »Sharing«, »Fake«, »Der Trip«, »Stalker«, »Mörderfinder – Die Spur der Mädchen«, »Mörderfinder – Die Macht des Täters«, »Mörderfinder – Mit den Augen des Opfers«, »Mörderfinder – Stimme der Angst«
Inhalt
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Epilog
[Leseprobe zu »Stalker«]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Der Tod macht stille Leute
Deutsches Sprichwort
Prolog
Sie dreht das heiße Wasser ab und bleibt noch einen Moment mit geschlossenen Augen stehen, spürt, wie die Nässe über ihre Haut läuft, bis nur noch eine schnell kalt werdende, dünne Schicht übrig ist.
Das Badetuch hängt sauber gefaltet über einer Stange am Eingang der durch eine Glaswand abgetrennten Regendusche. Nachdem sie den Frotteestoff um ihren Körper geschlungen und festgesteckt hat, verlässt sie den Nassbereich.
Der breite Spiegel über dem Waschbecken ist beschlagen, er lässt ihr Gesicht nur als konturlose, dunkle Fläche erahnen. Sie hebt die Hand und malt mit dem Zeigefinger die ungefähren Umrisse ihres Kopfes in den matten Dunst, fügt Punktaugen und einen lachenden Strichmund hinzu und verziert das Gemälde am unteren Rand mit zwei ineinander verschlungenen Herzen. Sie grinst, als ihr bewusst wird, dass sie sich gerade benimmt wie ein verliebter Teenager.
»Du Kindskopf«, sagt sie zu dem Dunstgesicht, doch ein angenehm wohliges Gefühl erfüllt sie, als ihr Blick wieder auf die langsam verblassenden Herzchen fällt.
Florian. Sie kennt ihn erst seit wenigen Wochen, und doch ist es, als habe er ihr bisher in eher ruhigen Bahnen verlaufendes Leben von einem Tag auf den anderen in eine quirlig-bunte Parade verwandelt.
Noch immer lächelnd, nimmt sie eines der Handtücher aus dem Regal neben dem Waschbecken, beugt sich vornüber, wickelt die langen blonden Haare darin ein und dreht es dann auf dem Kopf zu einem Turban.
Ein Blick auf ihre Armbanduhr auf der Ablage zeigt ihr, dass es schon kurz nach einundzwanzig Uhr ist.
Das Ende eines anstrengenden Tages.
Fotoshooting. Firmenpräsentation eines Juwelierladens, ein Routinejob. Dachte sie zumindest, als sie am späten Vormittag aufgebrochen war. Wie hätte sie auch ahnen können, dass der Kunde sich als eine schwer zu ertragende Mischung aus Pedant und Choleriker herausstellen würde.
Bis nach neunzehn Uhr musste sie die immer gleichen Schmuckstücke wieder und wieder fotografieren, während der Inhaber, Werner Diedler – oder heißt er Wolfgang? –, an jeder Kamera- und Beleuchtungseinstellung etwas zu meckern gehabt hatte. Dabei hat sie sich wie schon öfter die Frage gestellt, warum sie sich das antut, statt sich zurückzulehnen und von dem beträchtlichen Vermögen zu leben, das ihr Vater ihr hinterlassen hat. Und wie jedes Mal hat sie sich diese Frage selbst beantwortet. Weil es das Gefühl ist, etwas Sinnvolles zu tun, das sie immer wieder antreibt.
Sie wendet sich ab und verlässt das Badezimmer. Zeit für ein Glas Rotwein. »Ella, spiel die Playlist Chillen«, sagt sie, als sie an der Kommode im Wohnzimmer vorbeikommt, auf der ihr Smart Speaker steht.
In der Küche nimmt sie den Korkenzieher aus der Schublade und öffnet die Flasche, die sie beim Nachhausekommen auf dem kleinen Tisch bereitgestellt hat. Dabei denkt sie darüber nach, ob sie Florian anrufen soll. Er ist für ein paar Tage beruflich in Rom und sitzt um diese Zeit wahrscheinlich mit Geschäftspartnern in einem schicken Restaurant beim Abendessen. Dass das ausgerechnet an ihrem Geburtstag sein muss, ist sehr schade. Mit niemandem auf der Welt würde sie diesen Abend lieber verbringen als mit ihm.
Sie betrachtet das Telefon, das neben ihr auf der Arbeitsplatte in der Ladestation steht, zögert aber. Wird er sich nicht bedrängt oder gar belästigt fühlen, wenn sie ihn anruft? Andererseits … ist es nicht ein romantischer Liebesbeweis, dass sie es nicht erwarten kann, seine Stimme zu hören?
Sie greift nach dem Weinglas, hält es gegen das Licht der Stehlampe und erfreut sich am herrlichen Purpur des Inhalts. Mit geschlossenen Augen und geblähten Nasenflügeln genießt sie das wundervolle Bouquet, eine Komposition aus Kirschen, Brombeeren und Tabakblättern, bevor sie sich einen ersten Schluck gönnt und das Glas wieder abstellt. »Herzlichen Glückwunsch, Katrin.«
Ihr Blick fällt erneut auf das Telefon. Sie hat so gehofft, dass Florian sich im Laufe des Tages melden und ihr gratulieren würde. Andererseits kann sie sich gut vorstellen, dass sein Tag sehr stressig war und er den Kopf nicht frei hatte.
»Ach, was soll’s«, ermuntert sie sich selbst und nimmt den Hörer von der Ladestation. Während ihre Finger über das Zahlenfeld huschen, fragt sie sich, warum sie Florians Nummer noch immer nicht im Adressbuch abgespeichert hat, und hält sich dann in gespannter Erwartung das Telefon ans Ohr.
Statt des erwarteten Klingeltons hört sie jedoch eine weibliche Stimme, die ihr erst auf Deutsch und dann auf Englisch erklärt, dass die Nummer, die sie gewählt hat, nicht vergeben ist. Verblüfft lässt sie den Hörer sinken und starrt auf das kleine Farbdisplay, auf dem die Telefonnummer zu sehen ist. Nein, sie hat sich nicht vertan.
»Seltsam«, murmelt sie und versucht es erneut, um kurz darauf wieder den gleichen Hinweis zu hören. Sie legt das Telefon auf die Ablage, geht ins Schlafzimmer und zieht ihr Smartphone vom Ladekabel ab. Noch auf dem Weg zur Küche versucht sie es mit diesem Gerät. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die Nummer existiert nicht.
»Verdammt«, stößt sie aus und wirft das Handy unsanft neben das Telefon auf die Arbeitsplatte. Ein wirklich toller Geburtstag.
Sie greift nach ihrem Glas und lehnt sich gegen den Kühlschrank. Wie kann es sein, dass Florians Anschluss, den sie in den letzten Wochen zigmal angerufen hat, plötzlich nicht mehr existiert? Wenn er eine neue Nummer hätte, wüsste sie doch wohl davon. Oder?
Er ist Programmierer bei einem Telekommunikationsunternehmen. Was genau er dort macht, weiß sie nicht, aber es wäre sicher ein Leichtes für ihn, jederzeit eine neue Nummer zu bekommen.
Sie nimmt einen großen Schluck und stößt sich von der Kühlschranktür ab.
»Quatsch!«, sagt sie laut und geht ins Wohnzimmer. Das wird sich alles aufklären. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Florian in Rom ist und die Verbindung aus irgendwelchen Gründen nicht hergestellt werden kann. Oder er hat sein Handy verloren und die Karte sperren lassen. Vielleicht ist es auch gestohlen worden. Man hört doch immer wieder davon, dass es in Rom von Taschendieben nur so wimmelt.
Als sie es sich auf der Couch bequem gemacht hat, fällt ihr auf, dass keine Musik läuft. Funktioniert an diesem Tag denn gar nichts?
»Ella?« Gespannt wartet sie auf die weibliche Stimme des Smart Speakers, die sie nach ihren Wünschen fragt, doch das Gerät bleibt stumm.
»Ella!«, wiederholt sie energischer, wartet aber erneut vergeblich auf eine Reaktion.
»Ella, wie spät ist es?« Nachdem auch diese Standardfrage das Gerät nicht zum Antworten bewegen kann, stellt sie das Glas auf dem niedrigen Couchtisch ab, steht auf und geht zu der Kommode.
Der Lautsprecher ist eingeschaltet, wie der streichholzkopfgroße, blau leuchtende LED-Punkt an der rechten Seite beweist. Also gut, einen letzten Versuch noch.
»Ella! Wie spät ist es?«
Erneut bleibt das Gerät ihr eine Antwort schuldig. Sie zuckt mit den Schultern und geht zur Couch zurück. Schöne neue Technikwelt. Wenn der Lautsprecher morgen noch immer nicht funktioniert, wird sie ihn zurückbringen. Schließlich hat sie ihn erst vor ein paar Wochen gekauft.
Sie schaltet den Fernseher ein, zappt durch die Programme und findet schließlich einen romantischen Film, der zwar schon eine Weile läuft, ihr aber trotzdem geeignet scheint, sich davon noch ein bisschen ablenken zu lassen, bevor sie sich schlafen legt.
Um kurz nach zweiundzwanzig Uhr dreißig schaltet sie den Fernseher aus und geht ins Bad, zehn Minuten später legt sie ihr Smartphone auf dem Nachttisch ab, kuschelt sich in die Bettdecke und löscht das Licht. Mit den Gedanken bei Florian schläft sie kurz danach ein.
Sie weiß nicht, wovon sie aufgewacht ist, registriert aber, dass es noch mitten in der Nacht sein muss. Im Zimmer ist es beinahe vollkommen dunkel. Lediglich im oberen Bereich des Fensters gegenüber drückt sich ein Hauch von Mondlicht durch die beiden letzten Reihen des nicht ganz geschlossenen Rollladens, ein Punkt, an dem sich ihr Blick orientieren kann.
Sie will sich gerade umdrehen, um weiterzuschlafen, als sie den Atem anhält. Ihr Name … Hat da jemand ihren Namen gesagt? Nein, nicht gesagt. Geflüstert. Irgendwo außerhalb des Schlafzimmers.
Sie richtet sich ein wenig im Bett auf und lauscht angestrengt in die Dunkelheit, während ihr Herz schneller schlägt.
»Katrin …« Da ist es wieder. Es klingt fremd, lockend. »Kaaaatrin …«
Ein eiskalter Schauer kriecht ihr über den Rücken, auf ihrer Stirn bilden sich winzige Schweißperlen.
Nein, das ist kein Traum. Jemand ist in ihrer Wohnung, und diese Gewissheit jagt ihr mehr Angst ein, als sie je zuvor gehabt hat.
Dann plötzlich taucht dieser Gedanke auf, der die einzig logische Erklärung liefert und sie gleichzeitig beruhigt.
Florian. Er weiß, wo der Ersatzschlüssel versteckt ist. Sie hat es ihm gesagt, falls er mal unangemeldet vorbeikommen möchte. Und genau das ist jetzt der Fall. Er ist gar nicht in Rom, das war nur ein Vorwand, um sie auf diese außergewöhnliche Art zum Geburtstag zu überraschen. Das passt zu ihm. Und das ist das einzig Wahrscheinliche.
Anders als der Gedanke, jemand würde nachts lautlos in ihre Wohnung einbrechen, um dann im Wohnzimmer zu stehen und leise ihren Namen zu rufen. Das ist eher ein Setting für einen billigen Horrorfilm als die Realität, hier in ihrer Wohnung.
Deshalb hat Florian sich also nicht gemeldet und war auch nicht zu erreichen. Wahrscheinlich steht er – mit einem riesigen Blumenstrauß in den Händen – feixend im Wohnzimmer.
»Florian?« Sie bemerkt, dass sie nur geflüstert hat, und wiederholt seinen Namen lauter. Lauscht wieder angestrengt. Nichts. Sicher hat er große Mühe, sein Lachen zu unterdrücken, während er nebenan auf sie wartet.
Sie schlägt die Bettdecke zurück und schwingt die Beine aus dem Bett. Trotz der plausiblen Erklärung erschauert sie, als hätte ein kalter Windhauch sie gestreift, als sie ihr Schlafzimmer verlässt.
Im Wohnzimmer knipst sie die Stehlampe neben der Tür an und sieht sich erwartungsvoll um, doch … da ist niemand. »Florian?«, fragt sie abermals, nun wieder unsicher. »Ich weiß doch, dass du da bist. Nun komm schon, zeig dich. Mach mir keine Angst.«
Die Stille im Raum erscheint ihr mit einem Mal unnatürlich. Körperlich. So, als presse jemand Watte gegen ihre Ohren. Erneut beschleunigt sich ihr Herzschlag, steigert sich zu einem Wummern, das die bedrückende Stille zwar unterbricht, die Situation allerdings nicht besser macht.
War da ein Knacken? Hatte sich neben ihr etwas bewegt? Nein. Oder?
»Katrin!«
Sie stößt einen spitzen Schrei aus und weicht unwillkürlich einen Schritt zurück. Die Stimme ist weiblich, und die Art, wie sie ihren Namen flüstert, klingt … irre.
»Du wolltest wissen, wie spät es ist.« Die Haare auf Katrins Armen richten sich auf. Ella! Ihr Blick fällt auf den Smart Speaker. Das ist ja vollkommen verrückt …
»Ja«, antwortet sie leise und wundert sich, wie dünn ihre Stimme klingt.
»Es ist Zeit für dich zu sterben, Katrin.«
Ihr stockt der Atem, der Raum beginnt sich zu drehen, ihre Hand tastet nach dem Türrahmen, stützt sich daran ab.
»Was?«, flüstert sie kaum hörbar.
»Du wirst ster-ben«, flüstert die Ella-Stimme in einem absurden Singsang. »Er kommt dich ho-len.«
Katrins Herz hämmert gegen ihre Rippen, das Atmen fällt ihr schwer. Eine Schlinge legt sich unnachgiebig um ihre Brust und zieht sich zu, enger und enger.
»Wer … sind Sie?«
»Du kennst mich, Katrin …« Aus dem Flüstern ist ein säuselndes Wispern geworden. Schlimmer noch – es ist nicht mehr Ellas Stimme, die da zu ihr spricht. Sie ist nun männlich, und Katrin kennt sie wirklich. Aber …
»Du wirst sterben. Bald … bald komme ich dich holen.«
Sie spürt, wie etwas in ihr geschieht. Es ist wie ein Schalter, der sich ohne ihr Zutun umlegt. Sie stößt sich vom Türrahmen ab, ist mit wenigen schnellen Schritten an der Kommode, greift mit zitternden Händen nach dem Kabel, mit dem Ella am Netz hängt, und reißt mit einem wilden Ruck den Stecker aus der Dose. Dann hebt sie den Lautsprecher hoch und wirft ihn mit aller Kraft auf den Boden, wo er regelrecht explodiert, als wäre ein kleiner Sprengkörper in ihm gezündet worden.
Sie steht da und starrt das aufgeplatzte Gerät an, aus dem kleine Bauteile an Drähten heraushängen. Wie Gedärm aus einem aufgeschlitzten Bauch, denkt sie.
»Ella?« Sie wartet, fünf Sekunden … zehn. Nichts.
Den Blick noch immer auf das zerstörte Gerät gerichtet, das plötzlich von einer feindlichen Aura umgeben zu sein scheint, macht sie einen Schritt zurück, noch einen und einen weiteren. Schließlich wirft sie sich herum und läuft auf unsicheren Beinen ins Schlafzimmer, wo sie ihr Mobiltelefon abgelegt hat.
Sie muss die Polizei rufen.
Das Gerät liegt neben der Lampe auf dem Nachtschränkchen. Der Anblick des schwarzglänzenden Displays wirkt beruhigend. Ihr Rettungsring in diesem Horrorszenario. Als sie gerade mit zitternden Händen danach greifen möchte, leuchtet der Bildschirm plötzlich auf, und eine männliche Stimme aus dem winzigen Lautsprecher an der Unterseite flüstert: »Das nützt dir nichts. Du wirst sterben. Ich komme dich holen. Bald.«
1
»Ach du meine Güte.« Thomas deutete mit einem Kopfnicken auf den jungen Mann, der über den freien Platz vor den Schiffsanlegern zielstrebig auf sie zukam. »Mister Cool himself. Wetten, dass das dieser Typ ist, der noch fehlt? Ich hab immer so ein Glück.«
Thomas Strasser tendierte dazu, vorschnell über jeden zu lästern, der auch nur ansatzweise Wert auf sein Äußeres legte und gutgekleidet war. Ganz besonders dann, wenn es sich um einen Geschlechtsgenossen handelte.
Das mochte daran liegen, dass er selbst mit seinem struppigen Bart, der Nickelbrille und den beachtlich schlecht sitzenden Klamotten wie das aussah, was er auch tatsächlich war: ein Computer-Nerd. Seine Leibesfülle, mit der er seine Unsportlichkeit wie ein Fanal vor sich hertrug, setzte diesem Bild das berühmte I-Tüpfelchen auf.
In diesem Fall konnte Jennifer die Bemerkungen ihres Mitarbeiters jedoch verstehen, denn der Mann, der sie nun fast erreicht hatte, erfüllte das gegenteilige Klischee nahezu perfekt.
Er mochte Anfang dreißig, also in Jennifers Alter sein, womit zumindest die offensichtlichen Gemeinsamkeiten auch schon erschöpft waren. Zu einer auffälligen knallroten Daunenjacke mit diagonalen weißen Streifen, auf denen in ebenso auffälliger Schrift der Name Bogner prangte, trug er eine Skihose in Husky-Grau. Seine Haare waren so akkurat nach hinten gegelt, dass sie wie ein dunkelbrauner Helm um seinen Kopf lagen, das Gesicht war von der Sonne oder in einem Studio gebräunt.
Mit verzückter Miene hielt er sein Smartphone vor sich und machte ein Selfie. Wahrscheinlich dokumentierte er sein Eintreffen, für wen auch immer. Trotz des trüben Wetters trug er eine Sonnenbrille, die mit ihren verspiegelten Gläsern und der geschwungenen Form ebenso gut als Skibrille für Yuppies durchgehen würde. Und genau das war auch der Begriff, der Jennifer einfiel, als er vor ihnen stehen blieb und ihnen das strahlende Weiß seiner zweifellos gebleachten Zähne zeigte, indem er einfach die Lippen zurückzog, ohne dass sich der Rest seines Gesichts auch nur bewegte. Der Arm mit dem Smartphone senkte sich.
»Hi, ich bin David.« Er sah sich um und betrachtete die anderen Mitglieder der Gruppe. »Ihr seid die Digital-Detox-Fraktion, richtig?«
»Ja«, antwortete der Teamleiter des Reiseveranstalters, der neben Jennifer und Thomas stand und sich ihnen kurz zuvor als Johannes Petermann vorgestellt hatte. Er war Anfang fünfzig, die grauen Haare reichten in einer unmodernen Frisur halb über die Ohren. »Das sind wir. Und Sie müssen David Weiss sein, auf den wir schon seit zwanzig Minuten warten.«
»Das tut mir leid«, erwiderte Weiss auf eine Art, die bedeutete: Das tut es nicht. »Also, nicht, dass ich David Weiss bin, das tut mir weiß Gott nicht leid, haha, aber dass ihr auf mich warten musstet. Kommt nicht wieder vor.« Erneut bleckte er die Zähne.
»Okay.« Petermann machte ein paar Schritte und wandte sich der Gruppe zu, die nun vollständig war und mit ihm selbst aus elf Mitgliedern bestand. Nachdem er sich mehrfach die Hände gerieben hatte, was den herrschenden Temperaturen um die minus fünf Grad ohne Handschuhe geschuldet sein musste, zog er ein Blatt Papier aus der Jackentasche.
»So, nachdem wir jetzt also vollzählig sind, heiße ich Sie herzlich am Startpunkt unseres Trips hier in Schönau am Ufer des herrlichen Königssees willkommen. Zuerst stelle ich Ihnen kurz unser kleines Team von Triple-O-Journey vor. Falls Sie es noch nicht in Ihren Unterlagen gelesen haben, die drei O stehen für Out Of Ordinary, also ungewöhnlich. Bei uns können Sie keinen Pauschalurlaub buchen, sondern nur individuell konzipierte Reisen, weswegen Sie ja auch hier sind. Später dazu dann mehr. Anschließend checken wir noch kurz, dass wir auch die richtigen Teilnehmer dabeihaben, und dann kommt der Moment der Wahrheit. In dieser Kiste« – er deutete hinter sich auf eine grüne Kunststoffbox von der Größe eines Reisekoffers – »bewahren wir alle elektronischen Geräte bis zu unserer Rückkehr auf. Keine Angst, die Teile werden entsprechend gekennzeichnet, so dass Sie Ihr Smartphone oder Tablet problemlos wiederfinden.«
Er lächelte verschwörerisch. »Für mich ist es auch das erste Mal. Ich finde das sehr spannend.« Nach einem erneuten Blick in die Runde klatschte er in die Hände. »Sobald wir das erledigt haben, kann es auch schon losgehen. Noch etwas: Wenn es für alle okay ist, benutzen wir ab jetzt die Vornamen, das schafft gleich ein bisschen mehr Gruppenfeeling und ist nicht so steif. Okay? Gut.«
Damit nickte er der jungen Frau zu, die neben ihm stand und in die Runde strahlte. »Beginnen wir mit Ellen Weitner, also einfach Ellen. Sie hat nach dem Bachelor in Tourismuswirtschaft ihren Master in Internationalem Tourismus- und Eventmanagement gemacht und bei uns ihre erste Stelle angetreten.«
Die Mittzwanzigerin lächelte etwas gequält in die Runde, was daran liegen konnte, dass es ihr erster richtiger Job war und sie alles besonders gut machen wollte.
»Der blendend aussehende junge Mann hinter ihr ist Nico. Nico Schwerte.« Er deutete auf den sportlich wirkenden, schwarzhaarigen Enddreißiger, der lächelnd nickte.
»Er ist neu in unserem Team und kommt aus Österreich, genauer gesagt aus Damüls im Vorarlberg. Nico ist nicht nur ein ganz hervorragender Skiläufer, sondern auch ein sehr erfahrener Bergführer. Er wird uns von St. Bartholomä aus den Weg zeigen und darauf achten, dass wir alle gesund hin- und auch wieder zurückkommen.«
Jennifer betrachtete den Österreicher und stellte fest, dass sie ihn auf Anhieb sympathisch fand. Er war kein Beau, strahlte aber den jungenhaften Flegelcharme eines ewig Pubertierenden aus, der nie erwachsen werden will.
»Und zuletzt gibt es noch mich, Johannes. Ich bin der verantwortliche Teamleiter von Triple-O-Journey und zuständig für alles, was mit dieser Tour zusammenhängt. Das ist dann auch schon das gesamte Team. Wie Sie alle wissen, werden wir nach einem etwa fünfstündigen, leichten Fußmarsch unser Ziel, ein ehemaliges Bergsteigerhotel, erreichen. Alles Weitere dann vor Ort.«
Er hob wieder das Blatt an. »Kommen wir nun zu Ihnen. Da haben wir als Erstes das Team von … Moment …« Sein ausgestreckter Zeigefinger fuhr über das Papier. »Ah, hier. Das Team von Fuchs Telecom, eines Dienstleisters der Telekommunikationsbranche, der sich dazu entschlossen hat, vier seiner Mitarbeiter, die normalerweise von morgens bis abends mit Smartphones und Internet zu tun haben, eine fünftägige Digital-Detox-Auszeit zu gönnen. Wer weiß, vielleicht kann das Unternehmen ja anschließend von den Erfahrungen profitieren, die die vier in diesen Tagen machen.«
Mit einem Lächeln blickte er zu Jennifer und Thomas, neben denen auch Anna und Florian sich intensiv unterhalten hatten und nun verlegen lächelten.
»Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn Jennifer König ihre Mitarbeiter selbst vorstellt.« Er deutete mit der ausgestreckten Hand zu ihr hinüber. »Bitte, Jenny.«
Von einer völlig Unbekannten über den Vornamen zur Namensabkürzung innerhalb von zwei Minuten. Das war rekordverdächtig. Sie nickte lächelnd. »Gerne. Dieser bärtige Gemütsmensch gleich neben mir ist Thomas Strasser. Er ist mit Ende zwanzig einer unserer jüngsten Systemprogrammierer. Daneben haben wir Anna Simonis, Informations- und Kommunikationstechnikerin, und Florian Trappen, wie Thomas ebenfalls Systemprogrammierer und für die Entwicklung von Apps zuständig.«
Jenny bemerkte, dass David Weiss kurz zusammengezuckt war, als er Florians Namen hörte. Nun starrte er ihn an, als denke er darüber nach, woher er ihn kannte. Sie riss sich von der Szene los und lächelte in die Runde.
»Was das alles im Einzelnen bedeutet, können die drei euch in den nächsten Tagen selbst erzählen. Zeit genug werden wir ja haben, so ganz ohne Smartphones und Internet.«
»Vielen Dank, Jenny«, übernahm Petermann wieder und klatschte in die Hände. »Dann haben wir noch vier Mitstreiter, die diese fünf Tage unabhängig von ihren Arbeitgebern gebucht haben, weil sie wohl zu Recht der Meinung sind, die handyfreie Zeit werde ihnen guttun. Als da wären: Annika und Matthias Baustert, sie sind verheiratet und haben ein kleines Unternehmen. Dann Sandra Weber, sie ist bei einer Versicherung angestellt, und schließlich David Weiss, der bei einem Vermögensdienstleister in Luxemburg beschäftigt ist.«
»Partner!«, rief Weiss und wandte dabei seinen Blick von Florian ab. »So viel Zeit muss sein. Ich bin Partner einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.«
»Ähm, ja, oder so.« Petermann faltete seinen Zettel zusammen und ließ ihn in der Jackentasche verschwinden.
»Alles andere werdet ihr sicher in den nächsten Tagen von jedem selbst erfahren.« Erneut klatschte er in die Hände.
»Also dann … her mit euren Handys. Und falls ihr Tablets, Notebooks oder sonstigen elektronischen Schnickschnack mit euch herumschleppt, obwohl ihr fünf restlos digitalbefreite Tage gebucht habt – alles zu mir, bitte. Ich verlasse mich auf eure Ehrlichkeit.«
Ellen wartete schon mit einer kleinen Tüte in der Hand an der grünen Box und lächelte Jenny entgegen, als die ihr als Erste ihr ausgeschaltetes Smartphone reichte.
»Nein, steck es selbst hier rein, beschrifte die Tüte mit deinem Namen und verschließe sie. Dann kannst du sie in die Box legen.«
Sie reichte Jenny einen Stift und die Tüte, die aus festem weißem Papier bestand und etwa die Größe eines DIN-A5-Blattes hatte. In schwarzer Schrift war OFFLINE darauf gedruckt, darunter gab es ein umrandetes Kästchen mit Platz für den Namen. Am unteren Rand war das Logo von Triple-O-Journey angebracht, drei ineinander verschlungene, grüne O, in denen in winzigen Buchstaben die Worte Out, Of und Ordinary standen, mit dem Schriftzug JOURNEY darunter.
Jenny tütete ihr Smartphone ein, beschriftete das vorgesehene Feld mit ihrem Namen und klappte die selbstklebende Lasche der Tüte um. Nachdem sie das so verpackte Gerät in der Box abgelegt hatte, nickte Petermann ihr zufrieden zu und deutete zum Anleger. »Wunderbar. Bitte.«
Während sie sich abwandte, fiel ihr auf, dass sie den Reiseleiter als Einzigen noch gedanklich beim Nachnamen nannte. Das lag wahrscheinlich am Altersunterschied. Sie nahm sich vor, darauf zu achten, wenn sie ihn ansprach.
Das weiße Schiff mit dem Holzaufbau, das an der Anlegestelle zwei auf sie wartete, trug am Bug den Namen Marktschellenberg. Die gepolsterten Bänke im Inneren boten Platz für vielleicht siebzig oder achtzig Fahrgäste, waren für diese Fahrt aber ihrer Gruppe mit ihrem Gepäck vorbehalten, was einigen Männern und Frauen, die in Outdoorkleidung vor dem Anleger standen und ebenfalls die etwa vierzigminütige Tour über den Königssee nach St. Bartholomä machen wollten, gar nicht gefiel.
Es war angenehm warm im Inneren der Marktschellenberg, sobald Jenny die unmittelbare Nähe des Eingangs mit der geöffneten Türluke verlassen hatte.
Sie suchte sich einen Platz am Fenster im hinteren Bereich, stellte ihren Rucksack neben sich ab und drückte ihre Stirn gegen die kalte Scheibe. Das Wasser des Sees war so glasklar, dass sie problemlos bis auf den Grund schauen konnte, was unter anderem darin begründet war, dass keinerlei Abwässer in den Königssee geleitet wurden. Das hatte sie wenige Tage zuvor noch in einem Bericht gelesen. Und dass an der tiefsten Stelle des Sees hundertneunzig Meter zwischen der Wasseroberfläche und dem Grund lagen.
»Hast du deinen Rucksack da abgestellt, damit keiner auf die Idee kommt, sich neben dich zu setzen?«
Jenny sah erschrocken auf. Sie hatte nicht bemerkt, dass Florian neben ihr stand. »Ach, Blödsinn. Das kann auch nur dir einfallen.« Sie zeigte lachend auf den Platz neben sich. »Also was ist, möchtest du dich zu mir setzen?«
Florian hob beide Hände. »Könnte ja sein, dass du lieber deine Ruhe haben willst auf den letzten Metern in der Zivilisation. Chefmeditation oder so was.«
»Quatsch. Nun komm, setz dich schon.« Sie nahm den Rucksack und stellte ihn auf der Bank hinter sich ab.
Florian war ein lieber Kerl, der auch gute Arbeit leistete, aber manchmal beschlich sie das Gefühl, dass es ihm schwerfiel, eine Frau als Chefin zu akzeptieren, die zudem noch rund fünf Jahre jünger war als er selbst. Und das, obwohl sie mit allen Mitarbeitern ihres kleinen Teams ein sehr kumpelhaftes Verhältnis hatte. Auch mit Florian, mit dem es anfangs etwas schwierig gewesen war. Seinen Job hatte er vom ersten Tag an sehr gut gemacht, daran hatte es nicht gelegen. Er hatte auf sie allerdings einen recht verschlossenen Eindruck gemacht, gerade so, als trage er etwas mit sich herum. Mit der Zeit war er dann aber zugänglicher und zu einem wichtigen Mitarbeiter geworden, den sie in vielerlei Hinsicht schätzte.
»Dieser David hat draußen mit Ellen und Johannes darüber diskutiert, warum er nicht noch ein paar dringende Telefonate führen kann, bevor er sein Handy abgibt«, erzählte Florian, während er sich neben Jenny auf die Bank setzte. »Erst als Johannes drohte, ohne ihn abzufahren, wenn er es nicht in die verdammte Tüte steckt, hat er aufgegeben. Um sich gleich darauf darüber zu beschweren, dass die Tüte für sein heiliges Handy nicht ausgepolstert ist.«
Jenny musste lachen. »Ja, das passt. Scheint ein nicht ganz einfacher Mensch zu sein.«
Florian blickte an ihr vorbei aus dem Fenster. »Ich bin schon sehr gespannt, wie er ohne das Ding klarkommt.«
»Was das angeht, bin ich auch gespannt, wie ich ohne zurechtkomme. Unglaublich, aber das Teil fehlt mir jetzt schon.«
Eine Weile sahen sie schweigend aus dem Fenster und beobachteten zwei Enten, die gemächlich am Schiff vorbeischwammen.
»Dass denen nicht kalt ist.« Jenny lief allein beim Gedanken an die Wassertemperatur, die zumindest an der Oberfläche kurz vor dem Gefrierpunkt liegen musste, ein Schauer über den Rücken.
»Die haben eine dicke …«, setzte Florian an, wurde aber von David unterbrochen, der seinen Rucksack geräuschvoll auf der Bank ihnen gegenüber ablegte, Jenny zuzwinkerte und Florian einen seltsamen Blick zuwarf, bevor er sich auf die Sitzfläche fallen ließ und ebenfalls nach draußen sah.
So hingen sie eine Weile ihren Gedanken nach, während einer nach dem anderen der restlichen Reisegruppe die Marktschellenberg betrat und sich einen Platz suchte.
Jenny beobachtete Matthias, der im vorderen Teil des Schiffs den Rucksack seiner Frau vor ihr auf dem Boden abstellte. Gerade überlegte sie, dass er wohl im gleichen Alter wie seine Frau, vielleicht sogar zwei, drei Jahre jünger war, als David sagte: »Florian Trappen …«
Jenny und Florian sahen ihn an. »Ich überlege die ganze Zeit, woher ich deinen Namen kenne. Es fällt mir einfach nicht ein. Zumindest im Moment nicht. Aber ich komme noch darauf, da bin ich sicher. Ich kenne dich von irgendwoher …«
2
Jenny sah fragend zu Florian hinüber, der mit den Schultern zuckte. »Keine Ahnung, was du meinst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns noch nie begegnet sind. An dich würde ich mich bestimmt erinnern. Allerdings kann das auch damit zusammenhängen, dass ich bisher dein Gesicht noch nicht vollständig gesehen habe. Es ist schwierig, jemanden zu erkennen, wenn er sogar bei trübem Wetter und im Inneren eines Schiffs seine Augen hinter einer verspiegelten Sonnenbrille versteckt.«
»Hm … nein, keine Begegnung«, antwortete David, ohne auf Florians Anspielung einzugehen oder die Brille abzusetzen. »Ich denke eher, es ist dein Name, den ich schon mal gehört oder gelesen habe. Aber wie gesagt, es fällt mir bestimmt wieder ein. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant.« Damit wandte er den Kopf wieder ab. Das Thema schien – zumindest für den Moment – für ihn erledigt zu sein.
Nachdem sie einen kurzen, vielsagenden Blick mit Florian gewechselt hatte, widmete auch Jenny sich erneut dem herrlichen Anblick auf der anderen Seite der Glasscheibe und bemerkte erst in diesem Moment, dass das Schiff mittlerweile abgelegt hatte und sich langsam vom Anleger entfernte.
Nicht nur die Berge im Hintergrund waren schneebedeckt, auch das Ufer des Sees und die Landschaft rundherum waren fast nahtlos weiß. Die Dächer der wenigen Hütten und Häuser, die noch nicht vom Schnee befreit worden waren, ächzten unter der Last von fast einem halben Meter Dicke. Das war für Ende Februar nichts Außergewöhnliches für die Menschen hier, wie sie von einem Ortskundigen erfahren hatte.
Für sie als Norddeutsche hingegen war dieser Anblick eine Seltenheit, so dass sie weniger an die Gefahren dachte, sondern die schönen Aspekte der Schneemassen genoss.
Ihre Gedanken kehrten zu David zurück. Er gehörte zu diesen Menschen, die ihr wohl auf ewig ein Rätsel bleiben würden. Es musste ihm doch klar sein, dass er mit seiner großkotzigen Art bei fast allen aneckte und sich keine Freunde machte. Vielleicht war ihm das aber auch schlicht egal. Als sie kurz zu ihm hinüberblickte und seinen selbstzufriedenen Gesichtsausdruck sah, hielt sie diese Vermutung für recht wahrscheinlich.
Die Fahrt dauerte wie angekündigt rund vierzig Minuten inklusive eines fünfminütigen Stopps vor der Echowand etwa auf der Hälfte der Strecke, bei dem der Bootsführer aus der geöffneten Tür mit seiner Trompete das berühmte Echo vom Königssee demonstrierte.
Kurz bevor sie dann langsam auf den Anleger von St. Bartholomä zuglitten, das aus nicht mehr als einigen wenigen Gebäuden und einer kleinen Kirche besteht, hatten sie zum ersten Mal einen freien Blick auf die Ostwand des Watzmann, dessen Gipfel in einer dichten Wolke verschwand. Rund zweitausend Meter ging es dort steil nach oben, was immer wieder Bergsteiger aus der ganzen Welt magisch anzog.
»So, bitte alle mal herhören.« Nicos Stimme, die aus einem Lautsprecher in der Decke direkt über ihnen drang, riss sie aus ihren Gedanken.
»Wir verlassen jetzt das Schiff und versammeln uns direkt vor dem Anleger. Bitte lauft nicht herum, unser Zeitplan ist recht eng. Wenn wir bei Tageslicht an unserem Ziel ankommen möchten, müssen wir bald los. So, wie es aussieht, wird der Aufstieg nicht ganz einfach, und wir werden wohl mindestens fünf Stunden brauchen, vielleicht sogar sechs, je nachdem, wie mühsam der Weg über die Serpentinen der Saugasse sich gestaltet. Zudem ist für heute Abend wieder Schneefall gemeldet.«
»Mühsam?«, rief Thomas von der Mitte des Schiffs, und die Sorge in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Es hieß doch, es sei ein leichter Fußmarsch bis zu dem Hotel.«
Nico zeigte sein jungenhaftes Lächeln. »Keine Angst, wir werden nicht klettern müssen, aber es sind halt Serpentinen, die durch die Saugasse führen, und die gehen nun mal leider bergauf. Da der letzte Schneefall schon ein paar Tage her ist, wird dort zwar mittlerweile ein Pfad getreten sein, aber ein Spaziergang wird es nicht ganz.«
»Na super. Und was genau heißt bergauf?«
»Das bedeutet, wir werden über eine Distanz von etwa sechshundert Metern gut dreihundert Höhenmeter überwinden. Das Ganze in zweiunddreißig Serpentinen und mit einer maximalen Steigung von vierzig Grad.«
»Hey, junger Mann«, rief Annika Baustert Thomas zu. »Schau mich mal an. Ich bin Mitte vierzig und werde da raufmarschieren wie nichts. Wenn du unterwegs müde wirst, sag einfach Bescheid, dann trage ich dich.«
Dafür erntete sie allgemeines Gelächter, in das nur Thomas und Jenny nicht einstimmten. Sie mochte es nicht, wenn jemand aufgrund seines Äußeren verspottet wurde, schon gar nicht, wenn es sich um einen ihrer Mitarbeiter handelte.
»Ich bezweifle, dass ihm das jetzt wirklich geholfen hat«, bemerkte Anna, die neben Thomas saß, laut in Richtung Annika, woraufhin die beide Hände hob. »Entschuldigung, ich wollte ihn nur ein bisschen aufmuntern, war nicht böse gemeint.«
»Also«, ergriff Nico wieder das Wort, »du brauchst keine Befürchtungen zu haben, Thomas. Ich werde jetzt draußen die Schneeschuhe verteilen, damit kommt man auch in tiefem Schnee ganz super voran. Mit ein wenig Grundsportlichkeit kann man den Weg problemlos schaffen.«
Genau das ist ja sein Problem, dachte Jenny und erhob sich von der Bank. Dass Thomas keine Sportskanone war, lag auf der Hand. Was die meisten der Gruppe aber nicht wussten, war, dass er neben seinem Hang zu Fastfood und Süßigkeiten auch noch starker Raucher war und schon auf einer kurzen Treppe außer Atem kam. Dass er ausgerechnet diese Tour zum Anlass nehmen wollte, von den Glimmstängeln wegzukommen, oder besser gesagt einen weiteren Versuch dazu zu starten, war zwar löblich, würde aber so schnell sicher nichts an seiner Kurzatmigkeit ändern.
Sie verließen das Schiff und sammelten sich am Ende des Stegs, wie Nico es ihnen gesagt hatte.
Jenny zog den Reißverschluss ihrer Outdoorjacke ganz zu und wickelte den Schal enger um den Hals. Der kalte Wind drang auch noch durch den kleinsten Spalt und ließ die Temperatur um einiges eisiger erscheinen.
Verrückterweise verspürte sie mit einem Mal das dringende Bedürfnis, ihr Smartphone zur Hand zu nehmen und ihre Mails und die Anrufliste zu checken. Sie hoffte, dass zu Hause alles in Ordnung war und es Hannes gutging, und dachte daran, dass sie in vier Monaten vor den Traualtar treten würde. Und zum wiederholten Mal horchte sie in sich hinein, was sie bei dem Gedanken daran empfand.
»Hey, mach dir mal keinen Kopf.« Florian legte Thomas die Hand auf die Schulter. »Wir sind ja auch noch da. Wenn es wirklich zu anstrengend wird, helfen wir uns gegenseitig.«
»Ja, schau’n wir mal«, entgegnete Thomas wenig begeistert. Jenny sah ihm an, dass er sich in diesem Moment wohl kaum etwas sehnlicher wünschte als eine Zigarette.
»So.« Petermann … Johannes postierte sich vor der Gruppe und klatschte gleich mehrmals in die Hände. »Willkommen in St. Bartholomä. Während Nico und Ellen die Schneeschuhe an alle verteilen, die ihr bitte an eurem Gepäck befestigt, bis wir sie brauchen, noch ein paar Worte von mir. Ich übergebe jetzt das Ruder demütig an unseren Bergführer, und darüber solltet ihr alle froh sein, denn wenn ich mit meinen ausgeprägten Nicht-Kenntnissen der Berchtesgadener Bergwelt unsere Gruppe anführen würde, dann würden wir wahrscheinlich zwei Stunden lang im Kreis laufen und wieder hier ankommen.« Alle lachten.
»Das sind ja optimale Voraussetzungen für einen Reiseleiter«, rief Annikas Mann Matthias, womit er die Lacher auf seiner Seite hatte. Dabei bemerkte Jenny, dass er eine ganz ähnliche Figur hatte wie Thomas, was ihr bisher gar nicht aufgefallen war, den vorherigen Einwurf seiner Frau für sie aber noch unverständlicher machte.
Sie verbrachten etwa fünfzehn Minuten damit, sich fertig anzukleiden, hier und da Getränkeflaschen aus den Rucksäcken zu ziehen und nach dem Trinken wieder zu verstauen, und die Schneeschuhe in Empfang zu nehmen, die vollkommen anders aussahen, als Jenny sich das vorgestellt hatte.
Aus irgendwelchen alten Filmen hatte sie eine Erinnerung an riesige, flache, aus Korbgeflecht hergestellte Teile, die das Gehen zu einer entenähnlichen Fortbewegungsart machten. Das, was Ellen ihr reichte, hatte damit recht wenig zu tun. Die Schneeschuhe waren etwa fünfzig Zentimeter lang, bestanden aus Carbon und sahen aus wie das Skelett von riesigen Badelatschen mit einer komplizierten Bindung darauf. Laut Ellen hatten diese Dinger eine Steighilfe, die die Füße sogar bei einer Steigung von dreißig Grad noch in der Waagerechten hielt.
Nachdem Nico und Ellen allen geholfen hatten, die High-End-Teile an ihren Rucksäcken zu befestigen, ging es los.
In der ersten halben Stunde liefen sie in lockerer Formation auf einem von anderen Wanderern in den Schnee getretenen Pfad am flachen Ufer des Sees entlang, bevor Nico sie nach rechts führte, wo das Gelände leicht anstieg.
Jenny hielt sich gemeinsam mit Florian am Ende der Gruppe an Thomas’ Seite, während Anna einige Meter vor ihnen damit beschäftigt war, David zuzuhören, der unaufhörlich auf sie einredete.
Nico erwies sich als guter und umsichtiger Führer. Immer wieder ließ er sich zurückfallen und erkundigte sich, ob das Tempo okay war, bevor er wieder an allen vorbei nach vorn spurtete. Wenn er bis zu ihrem Ziel so weitermachen würde, hätte er eine doppelt so lange Strecke zurückgelegt wie alle anderen.
In halbstündigem Rhythmus ließ er sie anhalten und gönnte ihnen ein paar Minuten Pause, bevor sie sich wieder auf den Weg machten durch bizarre Felslandschaften und an Steilwänden vorbei, bei deren Anblick Jenny ein Gefühl von tiefer Demut empfand.
Hier und da mussten sie sich zwischen umgestürzten Bäumen oder Baumstümpfen hindurchzwängen oder über alte, teils morsche Stämme klettern, die aus dem Schnee ragten.
Nach knapp zwei Stunden war für Jenny der Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr sicher war, wieder zurückzufinden, wenn sie auf sich allein gestellt wäre.
Thomas hielt verhältnismäßig gut mit, obwohl er sofort schweißüberströmt war und nach Luft japste, sobald sie ein steileres Stück bewältigen mussten.
Als sie an den Serpentinen der Saugasse ankamen, waren sie seit knapp drei Stunden unterwegs.
Nico hielt an und wartete, bis alle ihn erreicht hatten, dann deutete er auf das hinter ihm steil ansteigende Gelände. »Wir sind jetzt an der Saugasse angekommen, und wie ihr seht, geht es schon zackig bergauf, aber wir werden das schaffen. Offenbar sind wir die Ersten, die nach den letzten Schneefällen hier hinaufgehen. Das bedeutet, dass wir noch keinen Pfad im Schnee haben, dem wir folgen können. Aus diesem Grund werden Ellen und ich euch jetzt dabei helfen, eure Schneeschuhe anzulegen. Ihr werdet sehen, die Steighilfe in den Bindungen erleichtert das Gehen bergauf ganz enorm. Ab hier haltet ihr euch bitte hintereinander und achtet genau darauf, wohin ihr eure Füße setzt. Alles klar? Dann los, Schneeschuhe an.«
»Und?«, wandte Jenny sich an Thomas. »Was denkst du?«
Er nickte, mit Blick auf die Steigung. »Ich schaffe das schon.« Dann verzog er das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. »Ich bin ja jetzt Nichtraucher.«
»Das ist die richtige Einstellung«, sagte eine Frau hinter Jenny. Es war Sandra, die Versicherungsangestellte, mit der Jenny bisher noch kein Wort gewechselt hatte. Während der Wanderung hatte sie sie hier und da neben Johannes oder Annika und Matthias gehen sehen. Sie durfte etwas älter sein als Jenny, vielleicht sieben- oder achtunddreißig. Die gewellten, pechschwarzen Haare, die unter ihrer hellen Wollmütze hervorquollen, ließen ihr schmales Gesicht noch blasser erscheinen, als es sowieso schon war.
»Genau«, stimmte Jenny ihr zu. »Du möchtest doch sicher nicht von Annika getragen werden.«
»Ich weiß, wie man sich in der Situation fühlt.« Sandra sah Thomas ernst an. »Und du hast tatsächlich recht, man merkt sofort, dass man besser durchatmen kann, wenn man diese elenden Dinger weglässt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch aufgehört. Es ist zwar alles andere als einfach, aber wenn du nachher da oben angekommen bist, wirst du stolz auf dich sein und wissen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast.«
»Das hoffe ich«, entgegnete Thomas und schenkte ihr ein dankbares Lächeln, dann bückte er sich, um die Schneeschuhe anzulegen.
Viermal hielten sie an und machten eine Pause. Zu Jennys Freude war es nur ein Mal wegen Thomas, der verkündete, nicht mehr zu können.
Nach einer Stunde und zwanzig Minuten hatten sie es geschafft und wurden mit einem beeindruckenden Ausblick belohnt.
Während sie alle noch keuchend und stöhnend nach Luft japsten, baute Nico sich vor ihnen auf und wirkte dabei so frisch, als sei er noch keinen Meter gegangen.
»Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es gepackt. Bevor wir weitergehen, ruht euch einen Moment aus und genießt den Blick auf die Hachelköpfe und den leider gerade in den Wolken steckenden Watzmann. Ab hier geht es zwar stetig ansteigend weiter durch das Ofenloch und die kleine Saugasse, aber so steil wie das Stück, das wir gerade hinter uns haben, wird es nicht mehr werden. Nachdem ihr das bis hierher geschafft habt, wird euch der Rest wirklich wie ein Spaziergang vorkommen.« Er zwinkerte Thomas aufmunternd zu, bevor er fortfuhr: »Der höchste Punkt unserer Wanderung liegt auf tausendsechshundertsiebzig Meter, bevor wir dann das Kärlingerhaus am Funtensee erreichen. Von dort ist es noch eine gute Stunde bis zu unserem Hotel. Noch Fragen?«
»Ja, ich«, rief Matthias, woraufhin alle ihn ansahen. »Ich habe heute Morgen im Radio den Wetterbericht gehört, in dem von zum Teil heftigen Schneefällen die Rede war. Ich kenne mich in den Bergen nicht aus, aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen, in der Bergwanderer von einem Schneesturm überrascht worden sind. Das sah nicht lustig aus. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir ja um einiges später dran als geplant. Wir brauchen länger als vorgesehen« – er bedachte Thomas mit einem Seitenblick – »und sind zudem auch erst mit einiger Verzögerung in Schönau losgekommen.« Nun galt sein Blick David.
»Was, wenn es anfängt zu schneien, während wir noch unterwegs sind?«
David hatte die Anspielung auf seine Verspätung verstanden und hob grinsend eine Braue. »Echt jetzt? Und wegen diesen zehn Minuten machst du ein Gesicht, als hätte dir gestern jemand eine Prise Plutonium in den Bohneneintopf gemischt?«
Noch bevor Matthias darauf reagieren konnte, schüttelte Nico den Kopf. »Der Wetterumschwung ist erst für den Abend vorhergesagt, aber selbst wenn es unterwegs zu schneien beginnt, wird es nicht so schnell so heftig, dass wir in Schwierigkeiten kommen könnten. Wenn ich das auch nur ansatzweise befürchtet hätte, wären wir nicht losgegangen. Okay?«
»Okay, dein Wort in Gottes Ohr.«
»Gut, dann gehen wir es an.«
Es dauerte drei weitere Stunden, bis sie dort angekommen waren, wo sie die nächsten fünf Tage ohne Smartphone und Internet verbringen würden, und es schneite in der Zeit nicht.
Als Jenny gemeinsam mit Thomas und Anna die letzte Steigung überwunden hatte, setzte die Dämmerung gerade ein.
Das Hotel lag in einer kleinen Senke vor ihnen, die inmitten der Felsen wie eine Lichtung anmutete, die im schwindenden Tageslicht auch allein schon unheimlich gewirkt hätte. Der Anblick des Gebäudes allerdings ließ Jenny erschauern. Thomas neben ihr schien es ganz ähnlich zu gehen, denn er murmelte: »Fuck! Ein gottverdammtes Horrorhaus.«
3
Jenny ließ das Gebäude an Shining von Stephen King denken. Nicht, weil es ähnlich ausgesehen hätte wie das Overlook Hotel aus dem Film, sondern weil der in der Dämmerung liegende verwinkelte Bau abweisend und wenig einladend wirkte, was in ihr das Bedürfnis weckte, augenblicklich auf dem Schneeschuh kehrtzumachen und möglichst schnell einen großen Abstand zwischen sich und dieses Hotel zu bringen.
Der mit dunklem, fast schwarzem Holz verkleidete Komplex sah aus, als hätte man mehrere kleine Gebäude ohne Rücksicht auf jegliche Symmetrie einfach ineinandergeschoben. Umgeben war das Hotel von mehreren Baumgruppen, die zu gleichmäßig angeordnet waren, als dass sie zufällig dort gewachsen sein konnten.
Jenny konnte schlecht einschätzen, wie viele Zimmer es in diesem Gebäudekonglomerat wohl gab, es waren aber auf jeden Fall bedeutend mehr, als sie es sich nach der Beschreibung vorgestellt hatte. Jetzt verstand sie auch, warum es in dem Onlineprospekt nur Fotos vom Innenbereich gegeben hatte.
»Das ist unser Hotel«, erklärte Nico überflüssigerweise mit lauter Stimme gegen das entsetzte Gemurmel an, das um ihn herum aufbrandete. »Das zukünftige Mountain Paradise. Fragt mich bitte nicht, warum man einem Hotel in den Berchtesgadener Alpen einen englischen Namen gibt.
Wenn es euch so geht wie mir, als ich bei unserer Probetour vor zwei Wochen hier angekommen bin, dann wollt ihr jetzt wahrscheinlich weglaufen.«
»Quatsch, ist doch abgedreht«, rief David dazwischen. »So ein Schuppen, und dann Mountain Paradise … genau mein Humor. Wer wohnt hier? Der Yeti?«
Nico sparte sich einen Kommentar dazu und fuhr fort: »Ich kann euch aber versichern, ihr werdet sehr angenehm überrascht sein, wenn ihr das Innere seht, oder zumindest den renovierten Teil, in dem wir uns aufhalten werden. Das Hotel wurde Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut und ist mit den Jahren immer wieder erweitert worden, wie man deutlich sieht. Es hat früher als Basis für Bergsteiger und Kletterer gedient, die von hier aus zu Touren aufgebrochen sind. Vor etwa zwei Jahren wurde es dann vom ehemaligen Besitzer geschlossen und stand eine Weile leer, bis ein Investor es vor kurzem gekauft und damit begonnen hat, es aufwendig zu renovieren.
Wenn ich recht informiert bin, soll daraus ein Luxusresort abseits von Stress und Trubel werden. Die Leitung von Triple-O-Journey ist durch Zufall darauf aufmerksam geworden und hat gleich erkannt, dass sich dieser Platz gerade jetzt optimal dazu eignet, unser neues Digital-Detox-Konzept zu testen. Wenn unser Trip so erfolgreich wird, wie wir alle denken, wird es wohl auf eine dauerhafte Kooperation zwischen den Besitzern und Triple-O-Journey hinauslaufen.« Mit einer weit ausholenden Geste deutete er auf die Berge um sie herum. »Hier gibt es definitiv nichts. Kein Internet, keinen Handyempfang. Nur absolute Ruhe.«
»Und wenn wir einen Notfall haben?«, erkundigte sich Matthias. »Ja«, schloss seine Frau sich an. »Was ist, wenn wir einen Arzt brauchen?«
Nico nickte. »Für diesen Fall gibt es ein Funkgerät, mit dem man die Bergrettung verständigen kann. Bei aller Abgeschiedenheit sind wir also nicht vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Aber jetzt habe ich euch genug erzählt. Lasst uns da runtergehen, damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt, dass der erste Eindruck täuscht und wir die kommenden Tage in einem wahren Juwel verbringen werden.«
Sofort setzte das Gemurmel wieder ein, während sie mit gemischten Gefühlen, die sich deutlich auf einigen Gesichtern abzeichneten, auf das Hotel zugingen.
Der Eingang lag hinter einer der Baumgruppen und war von ihrem erhöhten Standpunkt aus bedauerlicherweise nicht zu sehen gewesen, denn allein dieser Bereich revidierte bereits den ersten Eindruck.
Wie unschwer zu erkennen war, gehörte dieser Komplex zu dem renovierten Teil. Großzügige Glaselemente schoben sich mit leisem Summen auseinander, als Johannes sich als Erster etwa zwei Meter vor den Türen befand, und gaben den Weg in einen großen, mit hellem Carraramarmor ausgekleideten Lobbybereich frei. Die zukünftige Rezeption bestand aus einer etwa zehn Meter langen, ebenfalls mit Marmor verkleideten Theke. Eine unter der Arbeitsplatte versteckte Lichtquelle zauberte einen blauen Schein auf die helle Oberfläche. Bei der Renovierung wurde offensichtlich nicht gespart. Wer immer der Investor war, er hatte wohl keine Geldsorgen.
»Wow!«, stieß Anna so laut aus, dass es von den noch kahlen Wänden widerhallte. »Nico hatte recht. Das hätte ich definitiv nicht erwartet. Das ist ja … wundervoll.«
»Genau mein Stil«, erklärte David. »Hier komme ich wieder her, wenn es fertig ist.« Er nahm zum ersten Mal die Sonnenbrille ab und drehte sich um die eigene Achse. Dabei fiel Jenny auf, dass seine Augen dunkelblau waren.
Auch die anderen Mitglieder der Gruppe zeigten sich begeistert.
»Meine Lieben«, begann Johannes – natürlich mit einem Händeklatschen, das wie ein Peitschenknall von dem Marmor zurückgeworfen wurde. »Wie ihr sehen könnt, entsteht hier ein wundervolles Resort, und wir haben das große Glück, es quasi im Rohzustand testen zu dürfen. Zurzeit ruhen die Renovierungsarbeiten allerdings, weil die Firma, die mit dem Auftrag betraut war, Konkurs angemeldet hat und die neue Ausschreibung noch läuft. Weshalb der ganze Komplex uns allein zur Verfügung steht.«
Ein Raunen lenkte Jennys Aufmerksamkeit von Johannes weg und zu den beiden Männern hin, die von der Seite die Lobby betreten hatten. Einige Meter vor der Gruppe blieben sie stehen und blickten wortlos zu Johannes hinüber.
Der Ältere von ihnen musste mindestens sechzig Jahre alt sein. Das noch volle braune Haar, in dem sich verblüffend wenig Grau zeigte, stand in Kontrast zu den tiefen Furchen, die Gesicht und Stirn durchzogen. Ein kugelförmiger Bauch drückte gegen die blaue Latzhose, als wolle er sie sprengen.
Sein Kollege, ebenfalls in einen Blaumann gekleidet, der allerdings so schlabberig an ihm hing wie auf einem Drahtkleiderständer, war deutlich jünger, vielleicht Anfang vierzig. Beim Anblick seines hageren, spitzen Gesichts musste Jenny zwangsläufig an ein Frettchen denken. Etwas Verschlagenes lag in seinem Blick, als er einen nach dem anderen musterte.
»Ah«, machte Johannes, wobei Jenny unsinnigerweise auffiel, dass er vergessen hatte, in die Hände zu klatschen. »Wie aufs Stichwort. Wenn ich eben sagte, wir haben das ganze Hotel für uns, dann stimmt das nicht ganz, denn es gibt noch diese beiden Herren. Das sind die Hausmeister des Hotels. Oder, um es zu präzisieren, die Hausmeister des ehemaligen Hotels. Horst wird bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen, so dass nur Timo auch für das zukünftige Mountain Paradise zuständig sein wird.«
Timo, das Frettchen, schoss es Jenny durch den Kopf, und sie schämte sich im nächsten Moment für diesen Gedanken.
Während Horst mit unbewegter Miene kurz nickte, verzog Timo den Mund zu einem Grinsen, in dem für Jennys Empfinden eine gehörige Portion Hinterlist versteckt war, und rang sich ein knappes »Hallo« ab.
»Wenn ihr also irgendwelche Probleme haben solltet, wendet euch vertrauensvoll an die beiden. Sie kennen das Haus wie ihre Westentasche.«
Vertrauensvoll war nicht unbedingt ein Wort, das Jenny mit den beiden, insbesondere mit Timo, assoziiert hätte.
»Ich hätte da was.« David. Natürlich. »Mein Handy funktioniert nicht.«
Offenbar teilten einige Leute seinen Sinn für Humor, denn hier und da war unterdrücktes Lachen zu hören.
Die beiden Hausmeister fanden das augenscheinlich nicht witzig, denn sie wandten sich ab und verließen die Lobby, wobei Horst mehrmals den Kopf schüttelte.
»Ellen wird euch gleich eure Zimmer zeigen.« Johannes zog die Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Sie sind ausnahmslos renoviert, und ihr seid die ersten Gäste, die in ihnen untergebracht sind.«
»Wie steht es mit Essen?«, wollte Florian wissen. »Gibt es hier auch Köche? Ich muss gestehen, dass sich in mir ein Hungergefühl breitmacht.«