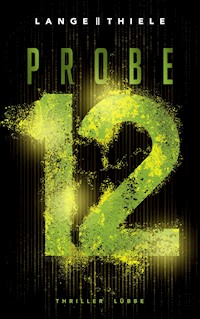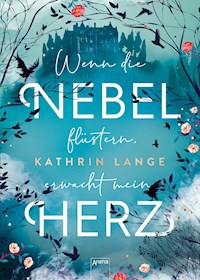8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Faris-Reihe
- Sprache: Deutsch
Um die Terroristen zu stoppen, muss er einer von ihnen werden
Nach einem Bombenattentat am Brandenburger Tor ist der Berliner Sonderermittler Faris Iskander zu einer Art Undercover-Joker geworden. Man setzt ihn auf den mutmaßlichen Terroristen Muhammad al-Sadiq an, der aus dem Gefängnis heraus einen Terroranschlag in Berlin plant. Um an Sadiq heranzukommen, muss sich Faris als Islamist ausgeben und seine terroristischen Absichten glaubhaft unter Beweis stellen. Doch das ist nicht sein einziges Problem: Im Laufe der Ermittlungen stellen er und sein Team fest, dass außerdem ein rechtsradikaler Anschlag vorbereitet wird. Das Unterfangen wird immer gefährlicher, zumal in seiner Einheit nicht alle mit offenen Karten spielen …
Eine Stadt in Angst und ein skrupelloser Gegner - Faris Iskanders härtester Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Nach einem Bombenattentat am Brandenburger Tor ist der Berliner Sonderermittler Faris Iskander zu einer Art Undercover-Joker geworden. Man setzt ihn auf den mutmaßlichen Terroristen Muhammad al-Sadiq an, der aus dem Gefängnis heraus einen Terroranschlag in Berlin plant. Um an al-Sadiq heranzukommen, muss sich Faris als Islamist ausgeben und seine terroristischen Absichten glaubhaft unter Beweis stellen. Doch das ist nicht sein einziges Problem: Im Laufe der Ermittlungen stellen er und sein Team fest, dass außerdem ein rechtsradikaler Anschlag vorbereitet wird. Das Unterfangen wird immer gefährlicher, zumal in seiner Einheit nicht alle mit offenen Karten spielen … Eine Stadt in Angst und gleich zwei skrupellose Gegner – Faris Iskanders härtester Fall.
Autorin
Kathrin Lange wurde 1969 in Goslar am Harz geboren. Obwohl sie sich beruflich der Hundestaffel der Polizei anschließen wollte, siegte am Ende ihre Liebe zu Büchern, und sie wurde zuerst Buchhändlerin und dann Schriftstellerin. Heute ist sie Mitglied bei den International Thriller Writers und schreibt sehr erfolgreich Romane für Erwachsene und Jugendliche. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem kleinen Dorf bei Hildesheim in Niedersachsen.
Bei Blanvalet von Kathrin Lange bereits erschienen:
40 Stunden
Gotteslüge
Kathrin Lange
OhneAusweg
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Blanvalet Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Hannah Jarosch
BL . Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17583-2V001
www.blanvalet.de
FürAli, Ayman,Mohammed, Muhammad, Muhyadinund Mustafe.
Willkommen in meinem Leben.
Und für all die anderen,
die ihre Kinder in Boote setzen,
weil ihr Land gefährlicher geworden ist
als das weite, offene Meer.
Der Tod ist eine unveränderliche Größe,
allein der Schmerz ist eine veränderliche,
die unendlich wachsen kann.
(Georg Christopher Lichtenberg)
So Allah es wollte, wahrlich, er hätte
euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht.
Doch will er euch prüfen, in dem, was er euch gegeben. Wetteifert darum im Guten.
(Der Koran, Sure 5, Vers 53)
Teil 1
Man kann das Böse leugnen,aber nicht den Schmerz.
1. Kapitel
Noch zwei. Minuten. Zu leben.
Seine Gedanken kamen abgehackt, genau wie sein Atem, aber er zwang sich, ruhig zu bleiben. Sein Blick hastete über den Fetzen Papier, den er auf seinem Oberschenkel abgelegt hatte. Ein Stück von einem DIN-A4-Blatt mit brisantem Inhalt. In der Dunkelheit waren die Buchstaben kaum zu erkennen.
»Er muss hier irgendwo sein!« Die Stimme der Frau, die Jagd auf ihn machte, ließ ihn den Kopf heben.
Kaum noch Zeit.
Er zerknüllte das Blatt, steckte es in den Mund. Schluckte angestrengt. Das Papier rutschte ihm scharfkantig und unangenehm die Kehle hinunter.
Mühsam rappelte er sich auf. Flüchtete weiter.
Im Laufen zog er ein Wegwerf-Handy aus der Tasche, verlor es fast, weil seine Hände glitschig waren von Schweiß.
Von kaltem Schweiß.
Gar nicht gut.
Er krallte die Finger fester um das billige Telefon. Hoffte, dass das verdammte Mistding noch funktionierte. Der Akku war vorhin schon ziemlich am Ende gewesen.
Noch anderthalb. Minuten.
Diese Phase seines Sterbens würde die hässlichste werden, das wusste er.
In dem Rohbau gab es noch keine Türen zwischen Parkdecks und Treppenhaus. Die Fahrstuhlschächte waren klaffende Öffnungen, notdürftig gesichert durch Holzplanken, die jemand mit gelbem Absperrband umwickelt hatte. Er sprintete um eine Ecke und durch eine der klaffenden Lücken in der Wand. Im nächsten Moment stand er vor der rohen Betontreppe, die auf die nächste Parkebene hinaufführte. Oben nichts als Dunkelheit. Gut. Das war genau das, was er brauchte.
Sein Herz begann zu rasen, als er sich an den Aufstieg machte. Er biss die Zähne zusammen.
Noch eine Minute.
Die Zeit wurde knapp.
Er erreichte den oberen Treppenabsatz, stolperte, weil die letzte Stufe ein bisschen höher war als die anderen. Mit einem gepressten Aufschrei fiel er auf die Knie. Seine Stimme hallte zwischen den Betonsäulen des Parkdecks wider, und er konnte seine Verfolger näher kommen hören.
Das Licht der Straßenlaternen zeichnete die Konturen des rohen Betons seltsam weich. Er blinzelte, als ihm bewusst wurde, dass es nicht das Licht war, das alles in einen flirrenden Nebel tauchte. Es war das Gift in seinem Körper.
Seine Zeit war fast um.
Er kam schwerfällig auf die Füße und hastete weiter, taumelnd jetzt.
»Er muss hier irgendwo sein!« Wieder die Frauenstimme.
Während im Treppenhaus Schritte ertönten, flogen seine Finger über die Tastatur des Handys. Aus Sicherheitsgründen hatte er die Nummer nicht eingespeichert, aber er kannte sie auswendig. Doch er vertippte sich.
»Verfickte Scheiße!«, zischte er. Sein Atem jagte, und trotzdem bekam er kaum noch Luft. In fliegender Hast wählte er neu.
Seine Verfolger hatten jetzt den oberen Treppenabsatz erreicht. Er duckte sich hinter eine Betonbrüstung. Das Handy gab ein leises Piepsen von sich, als es die Verbindung herstellte. Der Lichtkegel einer Taschenlampe flammte auf, huschte umher auf der Suche nach ihm.
»Da hinten ist er!«, rief die Frau. Und dann: »Geben Sie auf, Herr Akay! Sie können vielleicht uns entkommen, aber dem Gift auf keinen Fall!«
Er warf sich mit dem Rücken gegen die Brüstung, die ihn noch vor den Blicken seiner Häscher schützte. Seine Hände zitterten jetzt, ihm war schwindelig. Sein Brustkorb hob und senkte sich bei jedem qualvollen Atemzug. Verzweifelt presste er das Telefon ans Ohr. Geh ran!
Hinter ihm näherten sich Schritte.
Die Welt verschwamm vor seinen Augen.
»Tromsdorff!« Die Stimme an seinem Ohr ertönte unvermittelt, und Akay brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass am Ende doch noch abgehoben worden war.
»Es ist alles ganz … anders«, stieß er hervor. »Al-Sadiq hat …« Falsch. Ganz falsch! Noch mal: »Der Anschl…« Die Worte verebbten, als ihm die Luft wegblieb. Sein Herz begann zu stolpern. Reiß dich zusammen! »Nicht …« Verzweifelt versuchte er, Luft in seine Lunge zu bekommen, denn er wusste, wenn es ihm nicht gelang, sein Wissen weiterzugeben, würden Hunderte von Menschen sterben. In seinen Ohren kreischte es jetzt, sein Herz hörte auf zu stolpern und fing an zu flattern. Schwarze Schatten näherten sich am Rand seines Gesichtsfeldes. Das Licht der Taschenlampe blendete ihn. »Hi …«
Vergeblich. Er bekam kein einziges Wort mehr heraus.
O Gott, Berlin!
Zwei Gestalten tauchten dicht vor ihm auf. Er wusste, dass es ein Mann und eine Frau waren.
»Lassen Sie das Telefon fallen!«, befahl der Mann.
Verzweifelte Hoffnung zuckte durch Akays schwindenden Geist. Tromsdorff hörte zu. Er würde die Stimme erkennen! Die Jungs von der SERV waren gut. Sie würden ihre Schlüsse ziehen. Akay hob das Kinn, blinzelte, um den Mann vor sich zu fokussieren. War das eine Pistolenmündung, in die er schaute? Egal! Er wollte dem Befehl dieses Mistkerls nicht gehorchen, wollte einen allerletzten Akt des Widerstands leisten, aber sein Körper stellte sich nun vollends gegen ihn. Das Handy entglitt seinen Fingern und landete mit einem Klappern auf dem Betonboden.
Der Mann hob es auf, unterbrach die Verbindung.
»Durchsuch ihn!«, befahl die Frau. »Wir müssen sichergehen, dass er keine verwertbaren Informationen bei sich trägt.«
Beinahe hätte Akay gegrinst. Gut, dass er den Zettel verschluckt hatte. Das Pamphlet auf der Vorderseite würde der SERV helfen, die drohende Katastrophe zu verhindern. Seine Augen versagten ihm nun vollständig den Dienst, aber er spürte, wie er von Kopf bis Fuß abgetastet wurde. Sein Gehirn kreischte nach Sauerstoff.
»Nichts«, sagte der Mann. Er klang erleichtert.
Akays Brustkorb zog sich schmerzhaft zusammen.
Ihm war kalt. So kalt.
Etwas wurde ihm gegen die Stirn gepresst, und er wusste, dass es die Mündung der Waffe war.
»Nicht!«, zischte die Frau. »Das hört man!«
»Scheißegal!«, sagte der Mann.
Mach schon!, dachte Akay grimmig. Und dann: Hoffentlich werden sie den Zettel lesen können.
Gleich darauf drückte der Mann ab.
Der Schuss hallte ohrenbetäubend laut durch das halb fertige Parkhaus und weithin hörbar durch die Nacht. Andrea Roth verfluchte im Stillen diesen Idioten, mit dem sie hier zusammenarbeiten musste.
»Das hat halb Berlin gehört!«, fauchte sie.
Ihr Begleiter, sein Name war Timo Herdmann, zuckte nur gleichgültig die Achseln.
»Du hättest einfach warten können, bis er von allein krepiert.«
Herdmann sah sie an, und sie glaubte, Ekel in seinem Blick zu erkennen. »Du bist eiskalt, weißt du das?«
Diesmal war sie es, die mit den Schultern zuckte. »Einer muss ja glattbügeln, was du verbockst!«
Abwehrend hob Herdmann die Hände. »Woher sollte ich ahnen, dass dieser Blödmann bei mir auftaucht?«
Weil du Idiot eine Spur gelegt hast, dachte Andrea. Eine Spur so breit wie der Amazonas.
»Herrgott noch mal!«
Es nützte nichts. Das Kind war in den Brunnen gefallen, und nun mussten sie Schadensbegrenzung betreiben. Sie beschloss, auf Nummer sicher zu gehen, und kontrollierte selbst noch einmal sämtliche Taschen des Toten. Auch sie fand den Zettel nicht, den Akay aus Herdmanns Wohnung hatte mitgehen lassen. War das gut oder schlecht?
Mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger rieb sie sich die Stirn, während Herdmann die Anrufliste von Akays Handy aufrief und kontrollierte, wem dessen letztes Telefonat gegolten hatte.
Als die Nummer auf dem Display erschien, fluchte er, dann drehte er es so, dass sie daraufsehen konnte.
Akay hatte die SERV angerufen.
Auch das noch!
Herdmann scrollte durch die Anrufliste und hielt das Handy dabei so, dass sie ihm zusehen konnte. »Er hat nur dieses einzige Mal telefoniert, seit … eben.«
Seit eben.
Natürlich wagte es dieser Volltrottel nicht, es auszusprechen: Seit Akay ihnen durch Herdmanns Dämlichkeit auf die Schliche gekommen war.
So nah war Hiob noch nie vor der Enttarnung gewesen.
Andrea spürte noch immer die Symptome einer Art Schock, der sie ergriffen hatte. »Du verdammtes Arschloch!«, fuhr sie Herdmann an. »Wir hatten nicht ohne Grund den Befehl gegeben, keine Aufzeichnungen …« Sie warf die Hände in die Höhe. »Und dann lässt du den Mann auch noch entkommen, statt ihm sofort eine Kugel in den Kopf zu jagen.«
»Einen Schuss hätte man gehört!«
Ach, dachte sie grimmig. Auf einmal?
»Und immerhin habe ich ihm das Gas ins Gesicht gesprüht«, verteidigte sich Herdmann weiter.
Das Gift.
Das seine Zeit brauchte, um zu wirken. Das es Akay ermöglicht hatte zu fliehen – und sie dazu gezwungen, ihn bis hierher in dieses elende Parkhaus zu verfolgen. Wo sie nun eine verdammte Leiche mit einer Kugel im Kopf am Hals hatte.
Andrea sparte es sich, Herdmann das alles ins Gesicht zu schreien, auch wenn sie große Lust dazu verspürte.
»Außerdem hatte er den Zettel ja gar nicht bei sich«, verteidigte sich Herdmann lahm. Er wusste, wie zornig sie war, bemühte sich verzweifelt, sie zu beschwichtigen. Über die Brüstung des Parkhauses hinweg warf er einen Blick in den Nieselregen hinaus. »Bestimmt hat er ihn unterwegs verloren. Ich hatte mit Tinte geschrieben, was du mir am Telefon gesagt hast. Und die ist bei dem Regen längst nicht mehr zu lesen.«
Andrea zwang sich zur Besonnenheit. Es reichte, wenn hier einer von ihnen beiden versagte. »Ja«, murmelte sie. »Vielleicht.«
Herdmann schob Akays Handy in seine Jackentasche. »Das entsorge ich nachher, und dann gibt es keine Hinweise auf uns.«
Dein Wort in Gottes Ohr, dachte Andrea. »Lass uns von hier verschwinden!«, befahl sie dann, und während sie gemeinsam mit Herdmann die kahle Betontreppe nach unten ging, wählte sie auf ihrem eigenen Handy eine Nummer.
»Akay ist tot«, erklärte sie, als am anderen Ende ein knappes »Ja?« erklungen war. Und sie fügte hinzu: »Wir konnten sicherstellen, dass er keine belastenden Informationen mitgenommen hat.«
Herdmann sah sie dankbar an bei dieser leichten Dehnung der Wahrheit.
Sie zögerte kurz, dann sagte sie: »Allerdings hat er kurz vor seinem Tod Tromsdorff angerufen.«
Ihr Gesprächspartner grunzte leise. »Und?«
»Er hatte keine Gelegenheit, etwas zu übermitteln, woraus sich irgendwas schließen lässt. Aber die SERV wird das nicht einfach auf sich beruhen lassen, fürchte ich. Du kennst sie.«
»Lass uns nachher darüber reden. Du weißt, was du vorher zu tun hast?«
Andrea warf einen Blick auf ihren Begleiter. »Natürlich. Ich kümmere mich darum und melde mich wieder.« Sie verabschiedete sich und legte auf. Mittlerweile hatten sie das untere Stockwerk erreicht und traten auf die Parkebene hinaus.
»War das Ludger?«, fragte Herdmann.
Innerhalb der Organisation, die Hiob darstellte, nannte niemand ihren obersten Anführer bei seinem richtigen Namen.
Andrea ignorierte die Frage. »Komm mit!«, befahl sie. Sie führte Herdmann aus dem Parkhaus hinaus, ein Stück die noch nicht asphaltierte Straße entlang und schließlich in einen anderen Rohbau hinein. Ein Einkaufszentrum wurde hier errichtet, eine riesige Shoppingmall, die bald einmal mehr als zweihundert Geschäfte beherbergen würde. Das erst halb fertige Gebäude war ein regelrechtes Labyrinth. Zusammen mit ihrem Begleiter ging Andrea durch die leeren dunklen Etagen bis ganz nach oben.
»Worum müssen wir uns hier denn kümmern?«, wollte Herdmann wissen, nachdem sie fast am anderen Ende der Passage angekommen waren.
Statt ihm eine Antwort zu geben, trat Andrea an einen Verteilerkasten heran, der direkt neben einem nur mit Dachlatten gesicherten Fahrstuhlschacht lag. Sie stellte ihre Handtasche darauf, drückte Herdmann die Taschenlampe in die Hand und begann, in ihrer Tasche herumzukramen.
»Was hast du vor?«, fragte Herdmann.
Wieder antwortete sie nicht, sondern holte der Reihe nach zwei nahezu identisch aussehende Lederarmbänder aus der Tasche, legte sie auf den Verteilerkasten und suchte weiter. Ohne die Hand aus der Tasche zu nehmen, schenkte sie Herdmann dann ein warmes Lächeln. »Typisch Frauenhandtasche, was? Kannst du mir mal Licht geben?«
Wie beabsichtigt, kam er ein Stück näher, begierig darauf, ihr zu helfen. »Was suchst du denn?«
Da zog sie die Hand aus der Tasche. In ihr lag eine kleine Spraydose. Der Sprühstrahl, den Andrea in Herdmanns Gesicht richtete, schimmerte im Schein der Taschenlampe leicht metallisch. Sie drehte den Kopf zur Seite, um nichts davon abzubekommen.
»Hey!«, stieß Herdmann aus. »Was soll das denn?«
»Einen Schuss hätte man gehört«, sagte Andrea freundlich.
Und plötzlich begriff er. Seine Augen weiteten sich. »Du hast …«
Sie nickte.
»Warum?«, ächzte er.
Sie verzichtete darauf, ihm zu erklären, dass Hiob Versager wie ihn in den eigenen Reihen nicht tolerierte. Mit medizinischem Interesse sah sie zu, wie Herdmann panisch zu zappeln begann. Waschlappen!, dachte sie verächtlich. Das Gift konnte noch gar nicht wirken, aber Herdmanns Todesangst spielte ihr wunderbar in die Karten. Auf diese Weise war es ein Leichtes für sie, dafür zu sorgen, dass er nicht hinunter und auf die Straße rannte.
Eine knappe Viertelstunde später trat sie in die Nacht hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen. Ein verwaschener Halbmond stand an dem schmalen Streifen Himmel, der zwischen dem Parkhaus und dem Einkaufszentrum zu sehen war. Sie betrachtete ihn eine Weile, dann zog sie ihr Handy hervor.
»Erledigt«, meldete sie, als Ludger ranging.
»Sein Handy?«
»Habe ich an mich genommen. Und das von Akay auch.« Sie dachte daran, wie leicht es gewesen war, Herdmann sein eigenes Handy und das von Akay wegzunehmen und ihm einen kräftigen Stoß zu versetzen, der ihn durch die Dachlatten und hinunter in den Fahrstuhlschacht schickte. Ein wenig schauderte sie bei dem Gedanken an das dumpfe Geräusch, als der Körper acht Stockwerke tiefer aufgeschlagen war.
»Gut. Wirf sie in irgendeinen Kanal. Was ist mit den beiden Leichen?«
»Herdmann dürfte für ein paar Tage unentdeckt bleiben. Er liegt am ganz anderen Ende einer Baustelle in einem Fahrstuhlschacht, und hier wird überall gerade nicht gearbeitet. Aber Akays Leiche werden sie finden, sobald sie den Ort seines letzten Telefonats anpeilen. Kannst du jemanden schicken, der ihn von hier wegschafft?«
»Keine Chance. Jeder Einzelne von uns ist mit Vorbereitungen beschäftigt.«
Andrea fluchte leise.
»Nicht so schlimm«, beruhigte Ludger sie. »Bevor Labor oder Gerichtsmedizin irgendwas Brauchbares haben, ist unser Vorhaben längst in die Tat umgesetzt.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, murmelte Andrea.
»Bist du wirklich sicher, dass es Akay nicht gelungen ist, irgendwelche Informationen über Hiob durchzugeben? Unser Plan steht kurz vor der Vollendung, und wir können keine Komplikationen mehr gebrauchen.«
»Ganz sicher.« Andrea nickte unwillkürlich. Es fühlte sich falsch an, aber zum Glück konnte Ludger sie nicht sehen. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, von dem verschwundenen Zettel zu erzählen, entschied sich aber dann dagegen. Sie war verantwortlich dafür, dass dieser Zettel überhaupt existierte. Und sie war mit verantwortlich dafür, dass Akay entkommen konnte. Ludger hatte schon mehr als einmal nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass er Fehler nicht tolerierte. Andrea hatte keine Lust, Herdmanns Schicksal zu erleiden. Besser also, ihr Anführer und die anderen erfuhren nichts von dem Zettel.
»Gut«, entschied Ludger, nachdem ein paar Sekunden in Schweigen verstrichen waren. »Lassen wir die SERV sich um al-Sadiq kümmern. Damit dürften sie beschäftigt genug sein, um uns nicht in die Quere zu kommen.«
Diese Worte ließen Andrea lächeln. Sie steckte die Hand in ihre Jackentasche. Dabei streiften ihre Fingerspitzen die beiden Lederarmbänder, die sie vorhin dort hineingeschoben hatte. Sie hob den Blick zum Mond hinauf und betrachtete ihn ein paar Sekunden lang.
Wie schön er war!
Sie wischte das Lächeln von ihrem Gesicht.
Dann legte sie auf.
2. Kapitel
Die Geräusche der nahen Stadtautobahn klangen lauter als sonst, weil es die halbe Nacht hindurch geregnet hatte. Das Rauschen der vorbeifahrenden Autos drang durch das gekippte Schlafzimmerfenster. Mit hinter dem Kopf verschränkten Händen lag Faris Iskander auf dem Bett und starrte gegen die Decke. Julia schlief neben ihm auf dem Bauch. Ihr linker Arm ruhte auf seiner Brust. Schweiß perlte zwischen ihrer und seiner Haut. Es kitzelte, wenn Faris Atem holte.
»Kannst du wieder nicht schlafen?« Julias Stimme war ein träges Gemurmel, halb erstickt von den Falten des Lakens, das sie vor dem Gesicht zusammengeknüllt hatte, als müsse sie ihm ein Geständnis abpressen. Sie schälte sich aus dem Stoff und wandte den Kopf so, dass sie Faris ansehen konnte.
Das Licht der Straßenlaterne, das von draußen hereinfiel, zeichnete ihre Züge weich.
»Doch«, antwortete er auf ihre Frage. »Ich bin eben erst wach geworden.«
Es war die Wahrheit. Was er jedoch verschwieg, war der Traum, aus dem er nur wenige Minuten zuvor hochgeschreckt war. Dieser sonderbare Traum, der alle Albträume, die er jemals gehabt hatte, in den Schatten stellte.
In diesem Traum saß er mit jemandem auf einer beigefarbenen Couch. Er wollte den Kopf wenden, um nachzusehen, wer es war, aber er konnte es nicht. Er war dazu verdammt, absolut regungslos dazusitzen, ein Gefühl, das in ihm ein tiefes Grauen auslöste. Er bekam keine Luft.
Die Gestalt neben ihm streckte eine Hand aus und berührte ihn am Unterarm. Er wollte aufspringen. Wollte schreien. Sich übergeben. Er konnte keinen Muskel rühren. Alles, was er tun konnte, war dazusitzen und auf diese Hand zu starren, die ihn festhielt. Auf die Hand und auf das Lederarmband, das um das Gelenk geschlungen war.
Ein abgenutztes Lederarmband mit arabischen Schriftzeichen. Er kannte es gut. Es hatte einmal ihm gehört, aber Andrea Roth, seine Therapeutin, hatte es ihm weggenommen. Es erinnere ihn zu sehr an seine tote Exfreundin, hatte sie ihm gesagt. Er solle versuchen, nicht mehr so oft an sie zu denken. Er solle nach vorn schauen.
Nach vorn schauen!
Faris schnaubte leise.
Andrea hatte ihm auch erklärt, dass der Traum eine Art Ausweichmanöver seines Unterbewusstseins war. Er hatte so viele furchtbare Dinge erlebt und durchlitten, dass er wahrscheinlich genug Stoff für 365 verschiedene Albträume gehabt hätte, für jede Nacht des Jahres einen. Aber sein Geist hatte sich entschieden, alle in einen einzigen zusammenfließen zu lassen und das Grauen, das er empfand, auf dieses an sich harmlose Detail, das Armband, zu richten.
Julia drehte sich auf die Seite und bettete den Kopf auf den angewinkelten Arm. Die andere Hand ließ sie auf seiner Brust liegen. Sie krümmte die Finger ein wenig, sodass er ihre kurz geschnittenen Nägel spüren konnte. »Ich erkenne immer noch nicht, wann du mich anlügst.« Es lag kein Vorwurf in ihrer Stimme, nur diese leichte Verwunderung, die sie stets zu verspüren schien, wenn sie ihn ansah, und die er sich nie erklären konnte.
Er schloss die Augen.
»Woran denkst du?« Julia nahm die Hand von seiner Brust. Leicht legte sie sie an seine Wange, sodass er den Bart spüren konnte, den er sich seit einiger Zeit wachsen ließ.
Dann verschwand die Hand wieder.
Faris spürte an Julias Bewegung, dass sie sich auf den Ellenbogen stützte, um ihn betrachten zu können. Langsam öffnete er die Augen. Das Laken hatte rote Striemen an ihrer Wange hinterlassen, er fuhr sie mit dem Zeigefinger nach.
Als er nach mehreren Minuten noch immer nichts gesagt hatte, seufzte sie, setzte sich auf und zog die Bettdecke um ihren nackten Leib. Im Schneidersitz starrte sie die Brandnarbe und die beiden frisch verheilten Schusswunden auf seiner Brust an. »Gott, Iskander«, sagte sie. »Du bist ganz schön kaputt, weißt du das?«
Er wusste nicht, ob sie seinen Körper oder seine Seele meinte.
»Liegst hier mit mir in der Kiste. Warum stehst du nicht auf und gehst? Zu ihr?« Bei den letzten beiden Worten lag ein ganz kleines Beben in ihrer Stimme, und er beschloss, so zu tun, als habe er es nicht gehört.
Ihre Worte hatten in ihm Erinnerungen wachgerufen, Erinnerungen an einen regnerischen Abend. Mit Gewalt schob er sie von sich.
»Ich bin jetzt hier bei dir«, sagte er ruhig.
»Ja.« Sie schnaufte.
Ihre blonden Haare waren kurz geschnitten, so wie immer.
Bei ihrem ersten gemeinsamen Abendessen hatte er ihr erzählt, dass er lange Haare mochte, und aus irgendeinem Grund war er erleichtert gewesen, als sie tags darauf zum Friseur ging und ihren für Einsätze so praktischen Kurzhaarschnitt nachschneiden ließ.
»Seit drei Wochen schlafe ich besser«, sagte er. »Besser jedenfalls als früher.«
Früher hatte er oft nächtelang gar nicht schlafen können. Er hatte sich wie ein Junkie auf Entzug gefühlt. Monatelang. Vor drei Wochen dann hatte Julia ihn zum ersten Mal hierher mit zu sich nach Hause genommen.
»Nur Sex!«, hatte sie gekeucht, als er sie noch im Flur gegen die Wand gepresst und in wilder Verzweiflung geküsst hatte. Mit aller Kraft hatte sie ihn von sich weggedrückt und ihm bestimmt in die Augen gesehen. »Nur Sex, keine emotionalen Verwirrungen, okay?«
Und er hatte es ihr versprochen. Er war froh über ihre Worte gewesen, denn schon einmal hatte er versucht, dieses elende schwarze Loch tief in seinem Innersten zu füllen, indem er sich an den warmen Körper einer Frau klammerte.
Ira.
Der Name war da, ohne dass er etwas dagegen tun konnte.
Warum gehst du nicht zu ihr?
Im Gegensatz zu damals bereitete ihm das hier mit Julia jedoch kaum Schuldgefühle, was der Grund dafür war, weshalb er seit dieser ersten wilden Nacht schon mehrfach wieder hergekommen war.
»Nur Sex!«, sagte Julia jetzt warnend, und er ahnte, dass sich seine Gedanken auf seine Züge gestohlen hatten.
»Klar«, murmelte er und ließ sie in dem Glauben, dass er über sie nachgedacht hatte.
Sie öffnete den Mund, aber das Klingeln ihres Handys kam ihr zuvor. Sie verdrehte die Augen, dann lehnte sie sich nach hinten, um nach dem Telefon zu angeln, das sie zusammen mit ihrer Dienstpistole neben das Bett auf eine als Nachttisch dienende Seemannskiste gelegt hatte. Beiläufig schob sie dabei die Waffe ein Stück zur Seite. Als sie auf das Display sah, rümpfte sie die Nase. »Tromsdorff«, sagte sie. »Sorry, da muss ich rangehen.« Sie nahm den Anruf an. »Lautenschläger?«
Tromsdorff war der Gründer und Leiter der SERV, einer Sondereinheit des LKA Berlin, die zuständig war für die Ermittlung bei religiös motivierten Verbrechen. Er war Faris’ direkter Vorgesetzter, nicht jedoch der von Julia.
Faris verschränkte die Arme hinter dem Kopf und versuchte, nichts zu empfinden. Es gelang nicht. Es störte ihn, dass Robert Tromsdorff Julia anrief, auch wenn er nicht genau wusste, warum.
Julia lauschte eine ganze Weile lang schweigend. Faris konnte die Stimme am anderen Ende der Leitung nur als undeutliches Gemurmel wahrnehmen, aber an der Art, wie Julia sich plötzlich aufrechter hinsetzte, erkannte er, dass ihr nicht gefiel, was sie hörte.
»Verstehe«, murmelte sie. »Bist du sicher?«
Wieder redete Tromsdorff. Julia bestätigte mehrmals. Einmal sah sie Faris dabei nachdenklich an. Und mit den Worten »Ich bin unterwegs« legte sie schließlich auf. Auf der Unterlippe kauend, starrte sie aus dem Fenster in die Dunkelheit hinaus.
Faris wartete, ob sie ihm sagen würde, was geschehen war, aber sie schwieg. Lange.
»Julia?« Er bohrte beide Ellenbogen in die Matratze. »Was ist los?« Seine Narben ziepten leicht.
»Ich wusste, es ist keine gute Idee«, sagte sie.
»Was?«
»Mit dir ins Bett zu gehen.«
Ihre Worte trafen ihn an einer Stelle tief in der Brust. »Wieso?«
Julia beugte sich über ihn und gab ihm einen langen Kuss auf den Mund. Sie schmeckte noch nach dem indischen Curry, das sie gestern Abend gegessen hatten. Ihre Haut roch nach Schweiß und seinem eigenen Aftershave. »Wie sagt man so schön? Never fuck the company!«
Er verstand nicht. Ratlos schaute er an sich hinab. Eine der Kugeln, die ihn bei seinem letzten Einsatz getroffen hatten, schien immer noch in seinem Schulterblatt zu stecken. Ein kalter Knoten, der Schmerzen in seinen Arm ausstrahlte wie ein Stück Trockeneis.
Mit einer schnellen, zornig aussehenden Bewegung schwang Julia die Beine aus dem Bett, ließ die Decke fallen und warf das Handy auf den Nachtschrank. Das helle Narbengewebe dicht über ihrer Hüfte hob sich deutlich sichtbar gegen ihre leicht gebräunte Haut ab. Faris wusste nicht, ob Julias Bräune von regelmäßigen Solariumbesuchen herrührte oder von einem noch nicht lange zurückliegenden Urlaub. Was er jedoch wusste, war, dass auch sie schon einmal im Dienst angeschossen worden war.
»Julia!«, mahnte er. »Was ist los?«
Sie begann, ihre Sachen zusammenzuraffen. »Zieh dich an!«, blaffte sie. »Ich weiß zwar nicht, warum, aber offenbar bekommst du endlich den Einsatz, auf den du dich schon so lange vorbereitest.«
Die U-Bahn ruckelte über eine Weiche, und das Licht flackerte dabei. Aus. An. Aus.
Amira umklammerte die Griffe der Tasche, die sie auf dem Schoß stehen hatte, und atmete tief durch. Genau wie sie es gelernt hatte, zu Hause, wo die Bomben am Ende fast täglich vom Himmel fielen und der Wind den Trümmerstaub über das Land wehte wie das Leid der Menschen. Gelbe Erde. Das war es, was Amira einfiel, wenn sie an zu Hause dachte. Gelbe Erde und die Flecken darauf schwarz von Fliegen.
Das U-Bahn-Licht ging wieder an. Die junge Frau, die Amira gegenübersaß, schien zur Frühschicht zu müssen. Warum sonst sollte sie um diese Uhrzeit schon unterwegs sein? Die Frau trug eine Jeans und darüber eine dicke Daunenjacke. Sie lächelte freundlich, aber Amira lächelte nicht zurück, sondern richtete den Blick auf den Saum ihres Mantelärmels, mit dem sie schon eine ganze Weile nervös spielte. Obwohl sie nicht lächelte, war sie froh. Froh, weil das Licht hier in Deutschland immer wieder anging. Froh, weil Deutschland ein helles Land war.
Und gleichzeitig brodelte genau deswegen dieser Zorn in ihr.
Eine Zeit lang waren die Menschen ihr gegenüber auffallend freundlich gewesen, was, wie sie wusste, mit den Fernsehbildern zusammenhing, die jubelnde Menschen zeigten und Luftballons und eilig von Hand gekritzelte Plakate.
Refugees welcome.
Wie lange war das jetzt her?
Amira lehnte den Kopf an die Scheibe des Waggons und schloss die Augen. Sie wollte dem Blick der Frau ausweichen, der um ein Gespräch bettelte. Warum nur interessierten sich plötzlich so viele Deutsche für ihre Geschichte? Die Menschen begannen ein Gespräch meist mit der Frage »Woher kommen Sie?«. Manchmal antwortete Amira ihnen. Sie erzählte dann von den vergeblichen Gebeten ihrer Großmutter, die um Frieden flehte, von der gelben Erde, den Trümmern der Häuser und von den Fliegen. Oft wurden die Blicke der Menschen dann düster. Amira konnte die Scham in ihren Augen sehen, und sie verstand nicht, warum diese Menschen sich dafür schämten, in einem Land aufgewachsen zu sein, in dem Frieden herrschte. Frieden seit über siebzig Jahren schon.
In Amiras Erinnerung schrieben die Fliegenschwärme noch immer schwarze Bilder und Muster in den fahlen Himmel. Dann sang der Wind, aber Amira konnte sich nicht mehr an seinen Klang erinnern.
Hier in Deutschland hatte sie den Wind noch nie singen hören.
Die U-Bahn hielt an einem Bahnhof. Bismarckstraße stand in weißen Buchstaben auf einem blauen Schild. Als Amira aufstand, nickte die Frau ihr lächelnd zu. Amira ging an ihr vorbei zur Tür, und sie spürte die Blicke des alten Mannes in ihrem Rücken, der sie vorhin schon mehrmals gemustert hatte.
Sie wandte den Kopf.
Der Mann lächelte nicht. Er sah müde aus und ein bisschen wütend. Amira konnte die Fragen in seinen Augen lesen. Die Fragen, die ihr wieder häufiger begegneten, seit das freundliche Lächeln der Menschen zusammen mit den Luftballons und den Willkommensschildern verschwunden war.
Was will die hier?
Konnte die nicht dort bleiben, wo sie herkommt?
Mit diesem Mann würde Amira gern reden. Sie würde ihm ebenfalls von der gelben Erde erzählen und von dem weiten Himmel, aber in dieser Erzählung würde sie die Fliegenschwärme weglassen. Und dann würde sie sich still und heimlich freuen, wenn die Fragen in seinen Augen anschließend noch stärker flackern würden.
Was will die hier?
In letzter Zeit hatte sie sich das selbst auch immer wieder gefragt, aber natürlich hatte sie es nie laut ausgesprochen. Ihr Vater hatte damals entschieden, in dieses helle Land zu kommen.
Und sie hatte sich gefügt. Genau wie ihr Bruder Tarik.
Was blieb ihnen anderes übrig?
Sie trat auf den Bahnsteig und fuhr mit der Rolltreppe eine Etage nach oben zum Gleis 2, wo alles nagelneu glänzte, weil hier vor anderthalb Jahren eine Bombe explodiert und danach alles neu errichtet worden war. Ein Künstler hatte die Wand zwischen den beiden Gleisen mit einer arabischen Straßenszene verziert, Amira sah bunte Lehmhäuser, die von einer untergehenden Sonne angestrahlt wurden, orange und rot und purpurfarben. Nachtblaue Schatten lagen auf der gelben Erde, und eine Frau in einem ebenfalls nachtblauen Tschador stand vor einem der Häuser. Sterne waren auf ihr Gewand gestickt, und Amira musste an den weiten Himmel denken und an ihre Großmutter. Ihre Großmutter, die ihr immer Geschichten von Muhammads Stuten erzählt hatte und davon, wie sehr diese Stuten den Propheten geliebt hatten.
Hier in diesem hellen Land gab es nur sehr wenige Geschichten über den Propheten. Hier erzählten sie den Kleinsten Märchen von bösen Eltern, die ihre Kinder im Wald aussetzten und sie einer noch böseren Hexe überließen.
»Die Hexe musste braten, die Kinder geh’n nach Haus«, sang Amira vor sich hin, als sie die öffentliche Toilette betrat und mit dem Blick die gekachelten Wände absuchte. Die Überwachungskamera hing in einer Ecke über dem linken von drei Waschbecken, und genau wie Abdu ihr gesagt hatte, war die Linse des Objektivs mit schwarzer Farbe angesprüht.
Amira lächelte.
»Es wird für alles gesorgt sein«, hatte Abdu ihr versprochen, und sie wusste, er würde Wort halten.
Sie betrat eine der Kabinen, verschloss sie sorgfältig hinter sich und legte Abaya und Hidschāb ab. Darunter trug sie Jeans und Sweater. Sie bückte sich, nahm eine kleine Schachtel aus der Tasche. Öffnete sie.
Eine Spritze lag darin. Naloxon. Die schwarzen Buchstaben glänzten auf dem Glas, ebenso wie die Nadel im Licht der Neonröhren glänzte. Amira zuckte zusammen, als sie sich durch den Stoff der Jeans hindurch das Mittel in den Oberschenkelmuskel injizierte.
Die hellblaue Jacke, die sie sich gleich darauf anstelle des langen Mantels überstreifte, endete auf Höhe ihrer Hüftknochen … was sich unangenehm anfühlte. Sie hatte gewusst, dass sie sich nackt vorkommen würde, aber dass es so schlimm wäre … Sie zog die Kapuze hoch und bedeckte so ihr Haar wenigstens teilweise.
Sie hatte Abdu gefragt, ob der Allmächtige nicht zornig auf sie sein würde, wenn sie Sein Gebot, ihren Körper zu verhüllen, verletzte.
»Manchmal müssen wir Dinge tun, die in Seinen Augen frevelhaft sind, um dabei mitzuhelfen, Sein Reich auf Erden zu errichten«, hatte er ihr erklärt. »Sei ohne Furcht. Der Herr ist barmherzig mit denen, die ihn anbeten.«
Jetzt atmete Amira einmal tief durch, faltete Mantel und Kopftuch zusammen und verstaute sie sorgsam in der Tasche.
»Wenn du wieder hinausgehst«, hatte Abdu gesagt, »wirst du nicht mehr Amira sein.«
Sie verließ die Toilettenkabine und trat vor den Spiegel. Ein schockierend fremdes Gesicht sah ihr entgegen, umrahmt von der Kapuze, unter der ihre langen braunen Locken hervorschauten.
Abdu hatte recht gehabt.
Sie straffte die Schultern, hob das Kinn.
Du bist jetzt nicht mehr Amira.
Du bist jetzt eine Soldatin des Herrn.
Sei ohne Furcht.
3. Kapitel
Julia war gerade im Bad verschwunden und hatte das Radio dort angeschaltet, als Faris’ Handy klingelte. Er wälzte sich auf die Seite, sodass er nach seiner Jeans angeln konnte, die er am Abend zuvor einfach auf den Boden vor dem Bett geworfen hatte. Das Handy steckte in einer der Gesäßtaschen. Er zog es hervor und warf einen Blick auf das Display.
Robert Tromsdorff.
Faris atmete tief durch, dann nahm er den Anruf an und meldete sich mit einem knappen »Iskander«.
»Du klingst nicht, als hätte ich dich geweckt«, sagte Tromsdorff anstelle einer Begrüßung. Etwas in Faris straffte sich. Sein Herzschlag beschleunigte ein wenig. Es fühlte sich gut an.
»Ich war wach.«
Tromsdorff wusste von seinen Schlafstörungen, aber er ließ Faris’ Antwort unkommentiert. »Bist du nicht zu Hause? Ich habe versucht, dich auf deinem Festnetz zu erreichen.«
Darauf reagierte Faris nur mit einem unbestimmten Brummen. Im Bad begann die Dusche zu rauschen und übertönte die Musik aus dem Radio. Faris schwang die Beine über die Bettkante. Der mit Laminat ausgelegte Fußboden fühlte sich seidig an unter seinen Füßen.
»Wo bist du?«, fragte Tromsdorff. »Wir brauchen dich hier im War Room. Es sieht aus, als wäre Stunde X gekommen.«
Stunde X.
Wie lange hatte er darauf gewartet, diese Worte zu hören?
Faris rieb sich über den Bart an seiner linken Wange. Mit den Zehenspitzen fuhr er über eine kaum spürbare Erhöhung zwischen zwei Bodenpaneelen. Leimreste. Der Handwerker, der das Laminat verlegt hatte, hatte gepfuscht.
Er schloss die Augen, versuchte zu ergründen, was er in diesem Augenblick empfand. Erleichterung, stellte er verblüfft fest. Ihm war nicht klar gewesen, wie sehr es ihn belastete, sich in Bereitschaft zu halten, Tage und Wochen und Monate an einer Tarnung zu arbeiten und dabei nie zu wissen, ob die Stunde X, der Moment, in dem sein Einsatz wirklich begann, überhaupt je kommen würde. Es fühlte sich an, als sei in seinem Innersten endlich ein Geschwür geplatzt, das ihn die ganze Zeit gequält hatte, ohne dass er es wirklich wahrgenommen hatte.
»Sofort?«, fragte er.
»Ja. Sofort.«
Im Bad drehte Julia das Wasser ab.
Faris überlegte. Sollte er Tromsdorff sagen, dass er bereits Bescheid wusste? Dass er sich bei Julia befand? Tromsdorff war nicht nur sein Chef, sondern auch ein Freund. Aber Julia hatte eben schon recht gehabt.
Never fuck the company.
Es würde nur zu Komplikationen führen, wenn ihre Beziehung bekannt werden würde.
Und vermutlich waren Komplikationen dieser Art das Allerletzte, was sie jetzt gebrauchen konnten.
Stunde X.
Die Musik im Bad dröhnte dumpf. Irgendetwas Hartes mit viel Gitarre, das er nicht kannte.
Er hatte eine Gänsehaut.
»Worum geht es?« Durch die Leitung konnte er Papier rascheln hören.
Tromsdorff nannte nur einen Namen, und wie so viele, sprach er ihn falsch aus. »Muhammad al-Sadiq.«
Faris nahm unwillkürlich die Schultern zurück und spannte die Bauchmuskeln an wie in Erwartung eines Hiebes.
»Ich komme«, sagte er dann, während er aufstand, doch zu seiner Verblüffung erwiderte sein Chef:
»Nein. Ich komme und hole dich ab. Dann haben wir Gelegenheit, vorher noch über einiges zu reden. Wo bist du?«
Faris zögerte, und er wusste, dass das Tromsdorff nicht entging. Wenn sein Chef vorher allein mit ihm reden wollte, dann musste das seine Gründe haben. Faris bohrte Daumen und Ringfinger in die inneren Augenwinkel. Unterdessen verstrich die Gelegenheit, Tromsdorff zu sagen, dass er sich nicht die Mühe machen musste, ihn abzuholen. Dass Julia ihn einfach mit zum Columbiadamm nehmen konnte. »Ich bin in ungefähr zwanzig Minuten zu Hause.« In seinem Mund breitete sich ein schaler Geschmack aus. Wann hatte er angefangen, nicht mehr ehrlich zu Robert zu sein?
»Ich komme dahin«, versprach Tromsdorff.
»Gut.« Nachdem er aufgelegt hatte, sank Faris auf die Bettkante zurück und blieb regungslos sitzen, während die eisige Februarluft durch das gekippte Fenster strömte und um seine nackten Knöchel und Waden strich.
Nur wenige Minuten später kam Julia mit noch feucht glänzender Haut aus dem Bad. Faris stand angezogen am Fenster. Er drehte sich um und sah zu, wie Julia die Waffe vom Nachtschrank nahm und am Gürtel ihrer Jeans befestigte.
»Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die ihre Knarre mit ans Bett nimmt«, sagte er.
Sie warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Als ob du schon in vielen Frauenschlafzimmern gewesen wärst!«
»Tromsdorff hat mich gerade auch angerufen.«
Sie hielt inne, sah ihn an.
»Er will vorher noch mit mir reden. Er holt mich von zu Hause ab.«
»Du hast ihm nicht gesagt, dass du bei mir bist«, stellte sie fest und ließ den Saum ihrer Bluse über die Waffe fallen.
»Du auch nicht.«
»Stimmt.« Sie grinste, und Faris hätte gern gewusst, was sie dachte. »Soll ich dich eben zu dir rüberfahren?«
Nur ein paar Minuten später bogen sie in Julias gelbem Mini in die Friesenstraße ein, wo Faris seit Kurzem wohnte. Julia hielt in zweiter Reihe neben den parkenden Autos, genau vor der Buchhandlung mit dem vielsagenden Namen Hammett auf dem schwarz-gelben Firmenschild. »Raus mit dir«, sagte sie. »Bevor Tromsdorff aufkreuzt und uns zusammen sieht.«
Seit einer knappen Stunde saß sie jetzt schon hier auf dem Bahnsteig. Sie langweilte sich, und gleichzeitig war sie aufgeregt, und obwohl man sie gelehrt hatte, mit beidem umzugehen, wünschte sie sich, die Zeit würde schneller vergehen. Zum dritten Mal innerhalb der letzten zwei Minuten blickte sie auf die alte Bahnhofsuhr am Kopfende des Gleises, las das kleine Messingschild darunter, das an die Opfer des verheerenden Bombenattentats vor anderthalb Jahren erinnerte.
»Deine Taten werden elegant sein«, hatte Abdu gesagt. »Elegant. Und effektiv.«
Die Soldatin verspürte Stolz darüber, dass er sie ausgewählt hatte. Plötzlich überkam sie das Bedürfnis zu kontrollieren, ob die Spraydose noch da war. Sie beugte sich zu ihrer Tasche hinab, zog den Reißverschluss auf.
Natürlich war die Dose da.
Sie lag zwischen den Falten der Abaya, die matte, silbrige Oberfläche glänzte schwach im Licht der bläulichen Deckenbeleuchtung. Ihre Oberfläche fühlte sich kalt an.
Unheimlich.
Die Soldatin verbot sich diesen Gedanken.
Schritte ertönten, ein Mann betrat den Bahnsteig mit einem Handy am Ohr. »Ja, Johannes«, sagte er. »Ich bin’s. Sag mal, können wir das Meeting mit Schulze nachher um eine Stunde nach hinten verschieben?« Im Vorbeigehen musterte er die Soldatin.
Viel zu lange. Oder?
»Es wird sich anfühlen, als stünde dir dein Vorhaben auf die Stirn geschrieben, aber das ist nur Einbildung«, hatte Abdu gesagt. Und dann hatte er ihr befohlen: »Wenn die Uhr fünf zeigt, gehst du zum Taxistand an der Ecke Wilmersdorfer Straße.«
Und genau das tat die Soldatin jetzt.
Die Luft in Faris’ Wohnung roch abgestanden, nach einer Mischung aus angefaulten Äpfeln und altem Zigarettenrauch, der eine Erinnerung war an einen Abend vor ein paar Tagen, an dem Faris’ jüngere Brüder Reza und Hazim ihn besucht hatten.
Faris ging in die Küche. Ein Schwarm Essigfliegen schwirrte um die Obstschale auf dem Kühlschrank, in der sich neben ein paar Äpfeln auch eine matschige Banane befand. Er kippte den Inhalt der Schale in den Mülleimer. Die winzigen Fliegen stoben in die Luft und umtanzten ihn wie ein Schwarm Mücken. Er ignorierte sie, ging in sein Schlafzimmer.
Das Bett war gemacht, wenn auch nachlässig. Auf dem Nachtschrank am Kopfende lagen zwei Bücher, die er gerade parallel las, ein Thriller eines berühmten amerikanischen Autors, den der Buchhändler von nebenan ihm empfohlen hatte, und der aktuelle Roman von Haruki Murakami. Faris’ Blick streifte das gerahmte Foto daneben, auf dem ein kleines blondes Mädchen auf einem Dreirad saß und mit großen, für ihren hellen Teint ungewöhnlich braunen Augen in die Kamera starrte. Etwas Forschendes lag in ihrem Blick, das Faris wie jedes Mal, wenn er es wahrnahm, schlucken ließ.
Die Schranktür war nur angelehnt. Er zog sie auf und nahm eine Jeans heraus. Gerade als er auch noch nach einem Shirt greifen wollte, klingelte es an der Haustür.
Mit der Hose in der Hand ging er öffnen.
Draußen stand Robert Tromsdorff, wie gewöhnlich in Jeans und Sakko, das ein wenig zerknittert aussah. Seine an den Schläfen angegrauten Haare trug er kürzer als früher, und da war etwas an ihm, was Faris verriet, dass er in dieser Nacht nur wenig Schlaf bekommen hatte.
Faris schüttelte leicht den Kopf. »Du siehst aus, als hättest du in deinen Klamotten gepennt.«
Tromsdorff stieß ein resigniertes Schnauben aus. »Genau genommen, habe ich gar nicht geschlafen.«
Ohne weiteren Kommentar ließ Faris ihn eintreten.
»Wolltest du gerade unter die Dusche?«
Faris nickte, schob sich an ihm vorbei und ging ins Schlafzimmer zurück, um sich auch noch seine restlichen Klamotten zu holen. Plötzlich war die Erleichterung darüber, dass es endlich losging, wie weggeblasen.
Tromsdorff folgte ihm, blieb jedoch in der Zimmertür stehen. »Mach ruhig. Ich warte so lange.«
Faris nahm ein Longsleeve aus dem Schrank und Boxershorts aus seiner Kommode und ging dann duschen. Als er aus dem Badezimmer trat, stand Tromsdorff an seinem Bett und hielt den Fotorahmen in der Hand.
»Sie wachsen so unfassbar schnell, oder?« Er wusste, dass das Mädchen auf dem Bild Faris’ dreijährige Tochter Lilly war. Und natürlich wusste er auch, dass Faris erst vor knapp einem Jahr erfahren hatte, dass Lilly sein Kind war. Tromsdorff war derjenige gewesen, der es ihm schonend beigebracht hatte. Damals.
Faris starrte auf die Fotografie, ohne auf die ohnehin rhetorisch gemeinte Frage einzugehen.
»Wann hast du sie zuletzt gesehen?«, fragte Tromsdorff, und aus irgendeinem Grund befiel Faris ein leichtes Unbehagen. Konnte es sein, dass sein Chef mit dem Gedanken spielte, ihm von dem bevorstehenden Einsatz abzuraten? Fast schien es so.
Da war auf einmal eine greifbare Spannung zwischen ihnen im Raum, die ihm wie ein Kribbeln das Rückgrat hinunterkroch.
»Vergangenes Wochenende«, antwortete er.
Tromsdorff lächelte. »Das ist gut.«
Das ist es wirklich, dachte Faris, auch wenn er sich wieder wie ein Versager fühlte. Aber fühlte er sich, was Lilly anging, nicht andauernd wie ein Versager? Immerhin war er unfähig, auch nur durch diese verflixte Gartenpforte zu treten …
Die Sonne hatte geschienen am vergangenen Sonntag und seinen Umriss als harten Schlagschatten auf den Boden geworfen. Es hatte sich angefühlt, als seien seine Füße plötzlich in den Asphalt eingesunken.
Feigling!, hatte er sich selbst beschimpft und sich doch nicht rühren können, erst recht nicht, als sich im Erdgeschoss eine Gardine bewegt und er das schmale Gesicht seiner Schwester Anisah dahinter erahnt hatte.
Hatte sie Lilly auf dem Arm?
Er war drauf und dran kehrtzumachen, doch da wurde die Haustür geöffnet. Heraus kam sein Schwager Samir.
»Faris«, begrüßte er ihn. »Willst du nicht reinkommen?« Sein Tonfall klang ruhig, fast ein wenig beschwichtigend, und Faris fragte sich, womit er diese unverhoffte Freundlichkeit verdient hatte.
Er zwang sich, nicht den Kopf zu schütteln.
»Anisah hat mich gebeten, dir zu sagen, dass sie sich freuen würde.« Samir zögerte. »Und Lilly sicher auch.« Die Gardine war mittlerweile wieder an Ort und Stelle gefallen. Faris glaubte, durch die offen stehende Haustür das fröhliche Juchzen eines Kindes zu hören, aber er hätte nicht sagen können, ob es von seiner Tochter kam oder von einem von Anisahs und Samirs eigenen Kindern.
Er rührte sich nicht, wünschte sich aber, dass es Lilly gewesen war.
»Anisah fragt sich noch immer, wieso das Jugendamt Lilly zu uns gegeben hat«, sagte Samir völlig unvermittelt. »Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll.«
Dass ich unfähig bin, mich selbst um sie zu kümmern, dachte Faris, aber er wusste, dass es Samir nicht darum gegangen war. Sein Schwager war informiert darüber, dass der Innensenator sich persönlich dafür eingesetzt hatte, dass Lilly nicht in der Obhut des Jugendamtes bleiben musste, nachdem ihre Mutter gestorben war und man seine eigene Eignung als Vater völlig zu Recht infrage gestellt hatte.
»Der Innensenator war mir etwas schuldig«, erklärte Faris knapp. Und genau so war es. Der Innensenator hatte sich für Lilly eingesetzt, nachdem Faris ihm versprochen hatte, nach den verheerenden Ereignissen am Brandenburger Tor vor einem Jahr den Dienst bei der SERV nicht zu quittieren. Dass Lilly in einer intakten Familie aufwachsen konnte, war eine Art Bezahlung dafür, dass Faris sich bereit erklärt hatte, als verdeckter Ermittler zu arbeiten. Samir und Anisah wussten jedoch weder von dieser Übereinkunft mit dem Innensenator noch von Faris’ Undercover-Job.
»Hmhm«, machte Samir. Er war schon früher gut darin gewesen zu erkennen, wann sein Schwager nicht ganz ehrlich zu ihm war, und er war es auch jetzt noch.
Faris wollte etwas hinzufügen, aber er wusste nicht, was er noch sagen sollte, und bevor er sich etwas zurechtlegen konnte, trat Anisah aus der Haustür. Lilly saß auf ihrer Hüfte, und beide schauten sie in seine Richtung.
Er wollte auf sie zugehen, aber seine Beine waren wie festgewachsen.
Sein Blick fiel auf Anisahs unter Lillys Po verschränkte Hände, und etwas krampfte sich in seiner Brust zusammen. Von seinem Standort aus konnte er den längst verheilten Stumpf ihres linken Zeigefingers nicht sehen, aber er wusste nur allzu gut, dass er da war. Erinnerungen begannen in seinem Kopf herumzuwirbeln: Anisahs schriller Schmerzensschrei, dann das Bild von ihrem abgetrennten Finger auf seinem Handydisplay. Der dilettantisch lackierte rote Fingernagel, Leichen und Flammen und Blut, immer wieder Blut … Sein Magen drohte zu revoltieren, und nur unter Aufbietung aller Kräfte schaffte er es, die Bilder in seinem Kopf zu verscheuchen.
Samirs Blick wanderte von Faris zu Lilly und wieder zurück. Er schien kurz zu überlegen, bevor er sich umwandte, den Gartenweg entlang zu seiner Frau ging und ihr das Kind abnahm.
Mit dem Mädchen auf dem Arm kam er zu Faris zurück, blieb in einigen Schritten Entfernung stehen.
»Schau mal, Lilly«, sagte er. »Faris ist da.«
Er sagte nicht dein Vater. Er sagte nie dein Vater, und Faris konnte das Gefühl nicht benennen, das dadurch in ihm ausgelöst wurde. Ihm war schwindelig.
Schüchtern verbarg die Kleine den Kopf an Samirs Halsbeuge. Über ihren Scheitel hinweg sah Samir Faris an. »Eines Tages wird sie wissen wollen, warum du dich nicht um sie gekümmert hast«, sagte er leise.
Langsam nickte Faris. Sein Blick begegnete dem seiner Schwester. »Ich weiß.« Er verspürte den Wunsch, irgendetwas zu zertrümmern.
Samirs Augen waren düster. »Anisah hat mich gestern gefragt, ob ich dich für einen Feigling halte.«
Faris war sicher, die Ansicht seines Schwagers dazu zu kennen. Herrgott, er selbst hielt sich ja für einen Feigling.
Aber Samir verblüffte ihn. »Ich habe Nein gesagt.«
Faris schwieg. Wartete auf den Hieb, der gleich kommen würde.
Und erneut verblüfften ihn Samirs Worte. »Ich weiß, dass du selbst glaubst, es liege daran, dass du Anisahs Nähe nicht erträgst. Und nach allem, was passiert ist, wäre es kaum eine Schande, Faris.«
Faris zuckte die Achseln, doch Samir war immer noch nicht fertig mit ihm.
»Es liegt nicht an Anisah, dass du nicht durch diese Pforte gehen kannst. Ich glaube, es liegt daran, dass du ganz tief in dir drinnen Angst davor hast, Lilly wehzutun. Es liegt daran, dass du Polizist bist, Faris.«
Faris senkte den Blick und kämpfte gegen den Abwehrreflex. Seine Arbeit als Polizist war seit Jahren ein Streitthema zwischen ihm und seiner Familie. Aber vermutlich hatte Samir recht. Tief in seinem Innersten glaubte Faris, dass Lilly, wenn er für sie nicht mehr als ein ab und zu auftauchender Fremder war, nicht darunter leiden würde, wenn er eines Tages nicht mehr von seinem Dienst zurückkehren würde.
Vielleicht war es das, was ihn davon abhielt, durch diese elende Gartenpforte zu treten.
»Ich weiß, dass du das nicht hören willst«, murmelte Samir, »aber alles, was du tun müsstest, wäre, den Dienst zu quittieren.«
In Faris’ Erinnerung war die Stimme des Innensenators erklungen. Nennen wir es eine Win-win-Situation, Kommissar Iskander. Sie arbeiten undercover für uns. Und Ihre Tochter läuft nicht Gefahr, eine lange Zeit im Heim leben zu müssen.
Faris hatte den Blick gehoben, als er daran gedacht hatte. Anisah hatte noch immer auf der obersten Treppenstufe gestanden.
Faris erinnerte sich gut daran, wie dankbar er ihr dafür gewesen war, dass sie die Hände hinter dem Rücken verborgen hatte …
Mit einem schweren Seufzen stellte Tromsdorff jetzt das Foto zurück. Und berührte die graue Schachtel auf Faris’ Bett. Die Schachtel, die normalerweise auf dem obersten Bord seines Kleiderschrankes stand.
Faris biss die Zähne zusammen, so fest er konnte.
Tromsdorff beobachtete seine Reaktion. Er öffnete die Schachtel und nahm eine handliche mattschwarze Waffe heraus. »Eine Česká?«, fragte er, ohne von dem Ding aufzusehen. »Ich vermute mal, die stammt vom Schwarzmarkt?«
Faris schwieg. Was hätte er auch schon sagen können?
Tromsdorff betrachtete die Waffe genauer. »Sie ist geölt und gut in Schuss.«
Faris warf einen Blick auf das Foto seiner Tochter auf dem Nachtschrank. »Ich konnte mir noch nicht abgewöhnen, sie regelmäßig zu reinigen.«
»Faris …«
Faris wusste, jetzt würde das kommen, weswegen sein Chef eigentlich hier war.
»Stunde X«, sagte Tromsdorff, suchte kurz nach den passenden Worten und fügte hinzu: »Sie werden dich auf al-Sadiq ansetzen.«
»Ja, das hast du schon am Telefon gesagt.« Faris sah seinem Chef in die Augen.
»Al-Sadiq sitzt zurzeit.« Tromsdorff legte behutsam die Pistole in die Schachtel zurück, dann machte er den Deckel zu. »Und zwar in Karlshorst.«
»In Karlshorst.«
Tromsdorff nickte.
Karlshorst war ein erst kürzlich erbautes hochmodernes Gefängnis, das eine ganze Reihe Besonderheiten hatte. Eine dieser Besonderheiten war, dass es eine der ersten Einrichtungen dieser Art war, die nicht auf Länder-, sondern auf Bundesebene betrieben wurden.
»Und?«, hakte Faris nach, weil er immer noch nicht begriff, worauf sein Chef eigentlich hinauswollte.
»Dass eine verdeckte Ermittlung in der Abgeschlossenheit eines Gefängnisses hochgefährlich ist, muss ich dir vermutlich nicht sagen. Das Team wird dir nachher genauere Informationen dazu liefern. Aber es gibt etwas, das ich dir lieber nicht vor allen anderen sagen wollte …« Er nahm die Schachtel hoch, wog sie in den Händen, stellte sie endlich an ihren Platz im Schrank zurück. Ohne sich zu Faris umzudrehen, sagte er: »Ira arbeitet in Karlshorst, Faris. Seit einiger Zeit schon.«
Ira.
Den Namen ausgesprochen zu hören fühlte sich an wie ein Tritt in die Kniekehlen. Faris wusste nicht, was er sagen sollte, und der Reaktion nach zu urteilen, erging es Tromsdorff genauso.
Auch er schwieg lange. Endlich wandte er sich um. »Egal was nachher geschieht und ich vor den anderen von dir verlange – denk daran, dass du den Einsatz ablehnen kannst, wenn er dir zu heikel erscheint. Du musst das nicht machen, Faris, hast du mich gehört?«
In Faris spannte sich etwas.
»Hast du verstanden, Faris?«, wiederholte Tromsdorff.
Faris nickte. Er trat an seinem Chef vorbei und schloss die Schranktür. »Gehen wir!«
Im Radio lief Personal Jesus von Depeche Mode.
Elias trommelte den Rhythmus auf dem Lenkrad seines Taxis mit und versuchte zu verstehen, wovon das Lied eigentlich genau handelte. Außer ein paar wenigen Worten jedoch – someone who cares,all alone und irgendwas, das sich wie depress oder so ähnlich anhörte – klang für ihn alles wie Kauderwelsch. Kein Wunder. In Englisch war er schon immer eine Niete gewesen. Sein Englischlehrer hatte ihn kurz vor seinem letzten Schultag zur Seite genommen und ihm geraten, sich einen Beruf zu suchen, in dem er niemals würde Englisch sprechen müssen.
»Keine Sorge, Herr Römer«, hatte Elias ihm geantwortet. »Ich mache später mal was mit Autos. Denen ist es egal, ob man Englisch oder Deutsch spricht, wenn man unter ihnen drunterliegt.«
Was mit Autos!
Elias stieß Luft durch die Nase. Was er damals im Sinn gehabt hatte, war eine Lehre zum Automechaniker gewesen. An alten Karren rumzuschrauben und sie wieder flottzumachen, vielleicht sogar ein bisschen flotter, als erlaubt war – das war es, wovon er geträumt hatte. Nie im Leben hätte er daran gedacht, irgendwann mal seine Kohle mit Taxifahren zu verdienen.
Warum nur war es so verdammt schwer, einen Ausbildungsplatz zu bekommen? Weil der Notendurchschnitt auf deinem Hauptschulzeugnis eine Vier vor dem Komma hat, Alter!, höhnte eine kleine gemeine Stimme in seinem Hinterkopf.
»Halt einfach das Maul!«, brummte Elias.
»Reach out and touch …«, sang er lauthals mit. Er wollte immer ein »me« hinzufügen, aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass Depeche Mode an dieser Stelle etwas anderes sang. Das könnte er eigentlich mal googeln, dachte er. Dann gähnte er.
Seine Schicht war zum Glück fast zu Ende.
Es war eine beschissene Nacht gewesen, er hatte keine zweihundert Euro verdient, und er wusste, dass Herr Özdem, sein Chef, ihm Vorwürfe machen würde. Es waren immer die gleichen Sätze, mit denen der Alte seinem Ärger Luft machte, wenn die Kasse seiner Meinung nach nicht stimmte: »Glaubst du etwa, der Wagen fährt mit heißer Luft?« Und: »Musst dich eben mehr anstrengen!«
Elias seufzte.
Wenn er nachher nach Hause kam, würde Jenny, seine Freundin, schon bei der Arbeit sein. Schade eigentlich. Er hätte sie gerade jetzt gern bei sich gehabt, hinten auf dem Rücksitz des Taxis, rittlings auf ihm. Er grinste breit. Jenny war es auch egal, ob er Deutsch oder Englisch sprach, wenn er unter ihr lag. Sie hingegen war allerdings ziemlich gut in Französisch …
Ein Klopfen an der Scheibe riss ihn aus seinen lüsternen Gedanken, und er zuckte zusammen. Er hatte die junge dunkelhaarige Frau in der hellblauen Jacke zwar aus dem U-Bahnhof kommen sehen, aber dass sie auf sein Taxi zugesteuert war, war ihm bei seinem Tagtraum glatt entgangen. Jetzt setzte er sich eilig aufrechter hin.
Mit einem Kopfnicken bedeutete er der jungen Frau, dass er frei war.
Sie glitt neben ihn auf den Beifahrersitz.
Ungewöhnlich, dachte er. Die meisten Frauen stiegen hinten ein. Sie fanden das sicherer, und vermutlich war das auch so. Erst neulich hatte er mitbekommen, wie sich zwei Kollegen über ihre weiblichen Fahrgäste unterhalten und dabei nicht gerade jugendfreie Fantasien ausgetauscht hatten.
»Wohin soll’s gehen?«, fragte er und ließ den Motor an.
»Bahnhof Zoo«, sagte sie.
Elias seufzte. Wieder nur eine Kurzstrecke. »Geht klar.« Er startete das Taxameter, dann setzte er den Blinker und fädelte sich in den Verkehr ein.
Die junge Frau öffnete den Reißverschluss ihrer Tasche, schob die Hand hinein und ließ sie dort.
»Sie haben da aber keine Knarre drin?«, scherzte Elias.
Die junge Frau lächelte zurückhaltend und schüttelte den Kopf. Sie hatte ihm noch kein einziges Mal in die Augen gesehen, irgendwie war ihr Blick sogar haarscharf an ihm vorbeigeglitten, als sie ihm ihr Ziel genannt hatte.
Er zuckte die Achseln. Vermutlich war sie schüchtern. Sie sah arabisch aus. Vielleicht hatte sie einen dieser prüden Autoritätsknochen als Vater. Davon hörte man in der letzten Zeit ja leider immer öfter.
Ob er es riskieren konnte, einen kleinen Umweg zu fahren, um den Zähler wenigstens ein bisschen in die Höhe zu treiben? Er setzte den Blinker nach rechts und bog in die Leibnizstraße ein.
4. Kapitel
Seit einigen Monaten gehörte die SERV, die Sondereinheit für die Ermittlung bei religiös motivierten Verbrechen, nicht mehr zum LKA 1, sondern zur Abteilung 5 des Landeskriminalamtes. Das bedeutete, sie residierte seitdem nicht mehr in der Keithstraße, sondern am Columbiadamm, wo der Polizeiliche Staatsschutz untergebracht war.
Das Großraumbüro, das das Team auch hier auf den kämpferischen Namen War Room getauft hatte, lag im dritten Stock des Gebäudes. Es war um einiges größer und auch moderner als das alte Büro, und Faris kam sich hier noch immer fremd vor. Die gesamte Einrichtung wirkte surreal auf ihn – die hellgrauen Wände und Decken, der dunkelblaue Teppich, die robust aussehenden Metallmöbel und sogar die kühlen Halogenspots. Und ebenso surreal fühlte es sich jetzt an, als er eintrat und feststellte, dass sich niemand in dem Raum befand. Nur gedämpfte Stimmen drangen durch eine offen stehende Tür auf der rechten Seite.
Tromsdorff durchquerte den War Room und ging auf die Tür zu, die in einen überdimensionierten Besprechungsraum führte, der viel zu groß war für die recht überschaubare Gruppe an Anwesenden. Zwei moderne Smartboards hingen im rechten Winkel an den gegenüberliegenden Wänden. Mehrere Fotos einer Leiche und eines Tatorts flimmerten darauf, und an dem Steuerpult davor, dessen Oberfläche aus einem weiteren Bildschirm bestand, standen Julia und neben ihr Ben Schneider, der auf einer virtuellen Tastatur irgendetwas eintippte.
Über das Pult hinweg begegnete Julia Faris’ Blick. Nichts in ihrer Miene gab auch nur den geringsten Aufschluss darüber, dass er noch vor Kurzem mit ihr im Bett gewesen war.
Warum nur störte ihn das?
Er beschloss, sich nichts anmerken zu lassen, nickte ihr zu und wandte sich dann an Ben, während Tromsdorff zu einer Gruppe Anzugträger ging.
Bens wie immer eintönig sandfarben gehaltene Kleidung saß locker, offenbar hatte er in der letzten Zeit ein wenig abgenommen. In seinen ungewöhnlich strahlend blauen Augen erschien ein Lächeln, als er Faris entdeckte.
»Hey, Alter! Mit Bart sieht du immer noch scheiße aus!«
Bevor Faris darauf etwas erwidern konnte, trat Shannon Starck zu ihnen, eine durchtrainierte Frau mit raspelkurzen Haaren und deutlich definierten Muskeln an Oberarmen und Schultern.
»Faris«, sagte sie, reichte ihm erst die Hand, nur um ihn gleich darauf ruppig zu umarmen. Die Geste wirkte übertrieben emotional, zumal er und Shannon sich gestern erst noch gesehen hatten.
Er machte sich los. »Hey! Ist die Kacke hier so am Dampfen, dass du anfängst, dich wie ein Mädchen zu verhalten?«
Sie knuffte ihn gegen den Oberarm.
Ben lachte. »Seit Gitta in Rente ist, glaubt sie wohl, wenigstens ab und zu ihre weibliche Seite rauslassen zu müssen.« Er verdrehte übertrieben die Augen. »Mich küsst sie jeden Tag dreimal ab. Ekelig, sag ich dir!«
»Idiot!« Statt in sein Lachen einzustimmen, warf Shannon einen Kugelschreiber nach ihm. Er duckte sich, und das Geschoss verfehlte ihn nur knapp.
Faris grinste. Sie alle vermissten Gitta Müller, die früher in der Keithstraße nicht nur die Abteilungssekretärin gewesen war, sondern mit ihrer mütterlichen Art auch eine Ansprechpartnerin für all ihre Sorgen und Nöte. Gittas Tochter hatte vor ein paar Monaten ein behindertes Kind geboren, und Gitta war daraufhin in den vorgezogenen Ruhestand getreten, um sich um die beiden zu kümmern.
Während er noch darüber nachdachte, wie hart das Leben mit manchen Menschen umsprang, fiel Faris’ Blick auf einen Mann, der etwas abseits an der Wand neben dem Kaffeetisch lehnte. Der Mann trug Jeans, ein langärmliges Shirt und robuste Stiefel. Auf den ersten Blick wirkte er überaus trainiert und fit, obwohl seine grauen Haare und der sorgsam gestutzte graue Bart darauf hindeuteten, dass er die fünfzig bereits überschritten hatte. Seine Augen hatten etwas Frostiges. Wie von jemandem, der zu viel gesehen hat und es nicht mehr vergessen kann, schoss es Faris durch den Kopf.
Statt näher zu treten, senkte der Mann nur das Kinn zu einem spöttischen Gruß. Faris hielt seinem forschenden Blick stand, auch wenn er sich dabei wie auf eine Nadel aufgespießt fühlte.
Arschloch!, dachte er, und neben ihm lachte Shannon auf, als hätte sie seine Gedanken gelesen.
»Gestatten: Hartmut Marian. Er ist nicht so ein Idiot, wie er auf den ersten Blick scheint.«
Faris nickte. »Na dann.«
Hartmut Marian war von Tromsdorff erst kürzlich in die SERV geholt worden, aber Faris war ihm bisher noch nicht begegnet, weil sie sich auf verschiedenen Einsatzgebieten tummelten. Ihm heute zum ersten Mal gegenüberzustehen, gerade jetzt, wo aufgrund einer Bedrohungslage sein eigener Einsatz unmittelbar bevorstand, fühlte sich irgendwie falsch an. Faris wusste, dass Tromsdorff zusammen mit Marian bei den Blauhelmen in Somalia gedient hatte. Und er wusste auch, dass Marians Aufklärungsquote als Kriminalermittler hoch war. Darüber hinaus wusste er so gut wie nichts über den Mann, außer dass Tromsdorff ihm vertraute.
Das hätte ihm eigentlich reichen sollen.
Tromsdorff beendete sein kurzes Gespräch mit den Anzugträgern. Einer davon, ein hochgewachsener, geleckt wirkender Mann in dunkelblauem Dreiteiler, räusperte sich, dann trat er in die Mitte des Raumes. »Alle mal herhören! Kommissar Iskander ist jetzt da, und wir können anfangen.«
Es war der Direktor des Landeskriminalamts, Abteilung 5, Marvin Andersen. Der Mann, der die SERV aus der Abteilung 1 herausgelöst und dem Polizeilichen Staatsschutz angegliedert hatte. Faris hatte früher schon oft mit ihm zu tun gehabt. Andersen war ein ruhiger, geradliniger Beamter, der seine Abteilung mit großer Effizienz führte.