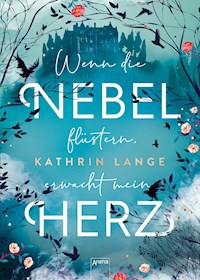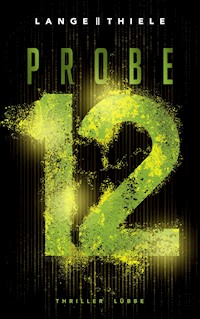
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie sind tödlich. Und sie sind außer Kontrolle
Als die Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg ihren ehemaligen Mentor Anasias in Georgien besucht, gerät sie mitten in einen tödlichen Angriff auf ihn. Zuvor kann er Nina jedoch verraten, dass es ihm gelungen ist, ein Medikament gegen die gefährlichsten multiresistenten Keime der Welt zu finden. Musste er deswegen sterben? Zusammen mit dem Foodhunter Tom Morell, dessen Tochter an einem dieser Keime erkrankt ist, versucht Nina, die Forschungsergebnisse nachzuvollziehen. Aber Nina und Tom sind nicht die Einzigen, die hinter Anasias‘ Forschung her sind, und ihre Gegner schrecken weder vor Entführung und Erpressung noch vor Mord zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinnenTitelImpressumWidmungZitateMontag. Tiflis. PrologTEIL 1: RIEN NE VAS PLUS1 Eine Woche später. Wieder Tiflis. Wieder Montag.23456 Dienstag.78910TEIL 2: NESSUN DORMA1 Mittwoch.234 Donnerstag.567 Freitag.89 Samstag.10 Anderthalb Wochen später. Dienstag.1112 Mittwoch.13TEIL 3: DARWINIAN DANCE1 Sonntag. Der Abend der Gala.234 Montag.5 Freitag. Der Tag der BundestagsdebatteGlossarTipps zur Vertiefung in das ThemaNachwort (Vorsicht, Spoiler!)DanksagungÜber dieses Buch
Sie sind tödlich. Und sie sind außer Kontrolle Als die Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg ihren ehemaligen Mentor Anasias in Georgien besucht, gerät sie mitten in einen tödlichen Angriff auf ihn. Zuvor kann er Nina jedoch verraten, dass es ihm gelungen ist, ein Medikament gegen die gefährlichsten multiresistenten Keime der Welt zu finden. Musste er deswegen sterben? Zusammen mit dem Foodhunter Tom Morell, dessen Tochter an einem dieser Keime erkrankt ist, versucht Nina, die Forschungsergebnisse nachzuvollziehen. Aber Nina und Tom sind nicht die Einzigen, die hinter Anasias’ Forschung her sind, und ihre Gegner schrecken weder vor Entführung und Erpressung noch vor Mord zurück.
Über die Autorinnen
Kathrin Lange schreibt erfolgreich Romane für Erwachsene und Jugendliche. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
Susanne Thiele ist Leiterin der Presse- und Kommunikationsstelle des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig. Die Mikrobiologin und Biochemikerin hat bereits ein Sachbuch zum Trendthema Mikrobiom verfasst.
L A N G E || T H I E L E
T H R I L L E R
L Ü B B E
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: René Stein, Kusterdingen
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotive: © shutterstock.com: Avesun | Sashkin
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0980-4
luebbe.de
lesejury.de
Wir widmen dieses Buch zwei Menschen,ohne die es diese Geschichte nie gegeben hätte.Felix d’Herelle, dem bekannten Phagenpionier, undHelga Thiele-Messow, deren guter Menschenkenntniswir es zu verdanken haben,dass wir uns überhaupt kennenlernten.
Kathrin Lange und Susanne Thiele
»Wir hören auf, nach Monstern unter unserem Bett zu suchen, wenn wir begriffen haben, dass sie in uns sind.«
Charles Darwin zugewiesen (1809–1882), Naturforscher
»Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen.«
Marie Curie (1867–1934), Physikerin und Chemikerin
Montag. Tiflis.Prolog
Die Stadt hatte Augen. So jedenfalls fühlte es sich an, wenn Georgy Anasias durch die Straßen ging.
Mit Schweiß auf der Stirn und klopfendem Herzen blieb er stehen. Die windschiefen Häuser der Altstadt von Tiflis mit ihren typischen weißen Holzbalkonen schienen sich einander zuzuneigen und miteinander zu tuscheln.
Unsinn!
Anasias zog ein Taschentuch hervor und wischte sich damit über das Gesicht. Seit mehreren Wochen schon hatte er das Gefühl, dass jemand ihn beobachtete. Es gab nur sehr subtile Anzeichen. Wenn er morgens in sein Labor kam, dann standen die Chemikalien nicht mehr exakt so, wie er sie am Abend zuvor zurückgelassen hatte. Probenröhrchen steckten anders. Seine Pipetten in der Schublade schienen von fremden Händen berührt worden zu sein. Die Leute vom Wachdienst des Instituts hatten versprochen, die Augen aufzuhalten – wie nett, schließlich bezahlte er sie ja genau dafür. Aber Anasias wusste, dass die Männer ihn für paranoid hielten. Paranoid! Er! Er zählte sich zu den rationalsten Menschen auf diesem Planeten. Nein, er war sich absolut sicher, dass er ausspioniert und bestohlen wurde. Irgendjemand war hinter seiner Forschung her, und das war ja auch kein Wunder …
Er steckte das Taschentuch ein. Die beiden Päckchen, die er zum Schutz vor dem Nieselregen – und vor feindlichen Blicken – unter seinem Mantel verborgen hatte, schienen sich in seine Brust zu brennen. Wenn er sie nur endlich los wäre!
Mit weit ausgreifenden Schritten ging er weiter. Raus aus den winkeligen Gassen, dann die Tashkentistraße hinunter in Richtung Medizinische Fakultät. Hier kannte er sich aus. Was nicht hieß, dass er sich hier sicherer fühlte. Seit Wochen fühlte er sich nirgendwo mehr sicher. Was, wenn der Unbekannte es nicht nur auf seine Forschung, sondern auch auf ihn abgesehen hatte?
Wie weit würde man gehen, um das in die Finger zu kriegen, was sich unter seinem Mantel befand?, fragte er sich.
Er hörte die kleine Versammlung schon von Weitem – das gellende Geräusch einer Handvoll Trillerpfeifen, eine durch ein Megafon verstärkte Stimme, die die Leute anwies, fleißig zu filmen und zu posten.
Die wöchentliche Demonstration der Pandemic Fighters. Dann musste heute Montag sein, dachte Anasias. Er hatte die letzten Tage fast rund um die Uhr gearbeitet und dabei jegliches Zeitgefühl verloren.
An der Kreuzung zur Vasha Pzavela Allee blieb er stehen. Rings um ihn herum standen junge Leute, die ganz offensichtlich auf dem Weg zu der Demonstration waren. Genau wie er warteten sie darauf, dass die Ampel auf Grün schaltete. Sein Herz war kurz vor dem Zerspringen.
Ein schwarzer SUV hielt neben ihm. Getönte Scheiben. Unmöglich zu sehen, wer in dem Wagen saß. Waren das seine Verfolger? Anasias wich einen Schritt zurück und rempelte aus Versehen dabei eine junge Frau an, die einen hellblauen Parka und zerrissene Jeans trug.
»Professor Anasias!« Die junge Frau schaute ihn verwundert an. »Wollen Sie mit uns demonstrieren? Wie wunderbar!« So, wie sie mit ihm sprach, war sie eine seiner Studentinnen, aber er konnte sich nicht an ihr Gesicht erinnern.
»Nein. Nein, eigentlich nicht.« Abwehrend hob er die Hände. Die Päckchen unter seinem Mantel kamen ins Rutschen, und er presste sie fester gegen seinen Körper. Mit einem flauen Gefühl im Magen spähte er an der jungen Frau vorbei in Richtung SUV.
Regentropfen rannen an dem glänzenden schwarzen Lack entlang nach unten. Eine weiße Wolke stieg aus dem Auspuff in die kühle Luft. Regungsloses Verharren.
Herzklopfen.
Dann schaltete die Ampel für die Autos auf Grün, der SUV fuhr los, bog keine anderthalb Meter neben Anasias nach rechts ab und war gleich darauf im fließenden Verkehr verschwunden.
Anasias atmete erleichtert aus.
»Geht es Ihnen nicht gut, Professor?«, fragte die Studentin. »Sie sehen sehr blass aus.«
»Alles gut.« Er zwang sich zu einem Lächeln, musste sich aber erneut den Schweiß von der Stirn wischen. »Ich bin nur ein bisschen zu schnell gegangen.« Er richtete den Blick auf die Menschen vor dem Universitätsgebäude. Knapp dreißig Demonstranten waren es mittlerweile, vermutlich wie immer hauptsächlich Medizinstudenten. Was vor der weltweiten Corona-Pandemie nur eine kleine Vereinigung von Medizinern gewesen war, hatte sich danach zu einer ernstzunehmenden Stimme des Protests erhoben. Weltweit gingen Menschen auf die Straßen, forderten die Regierenden in allen Ländern auf, etwas gegen …
Anasias kappte den Gedanken. Er hatte gerade andere Probleme. Naheliegendere. Er konzentrierte sich wieder auf seine Umgebung.
Die Blumenrabatten vor dem Unigebäude trieften vor Feuchtigkeit. In der Luft lag der Geruch, der so typisch für Tiflis war, eine Mischung aus Autoabgasen und dem würzigen Aroma der Pinien am Straßenrand. Die meisten Demonstranten hatten im Schatten eines der Bäume Schutz vor dem Nieselregen gesucht. Anasias’ Blick wanderte über die selbstgemalten Schilder, auf denen teilweise schon die Farbe verlief.
Be prepared!, stand auf einem, während alle anderen Schilder in Georgisch beschriftet waren: Infektionsforschung vorantreiben!, #bewarebadbugs #boostgoodbugs und Corona 2.0 verhindern und die Menschheit retten! Dazu immer wieder eine fast künstlerisch anmutende Welle, die sich schäumend brach – das Logo der Pandemic Fighters.
Anasias musste lächeln, als er auf einem der Schilder die Zeichnung eines Virus entdeckte, der einer Mondlandefähre ähnelte. Die junge Frau, die das Schild hielt, erkannte er wieder. Sie war wirklich eine seiner Studentinnen. Und auch die Darstellung des Bakteriophagen auf dem Schild, eines sogenannten »Bakterienfressers«, war ihm überaus vertraut, denn die Phagenforschung war sein Spezialgebiet, sein Lebensinhalt.
Noch einmal presste er die beiden Päckchen unter dem Mantel fester an seinen Körper.
»Schön, dass ihr alle da seid«, hörte er den jungen Kerl am Megafon sagen. Er wusste, dass der Mann sich bei Ärzte ohne Grenzen engagierte und so etwas wie der Anführer der hiesigen Pandemic Fighters war.
Die Fußgängerampel sprang auf Grün um. Die Menschen ringsherum setzten sich in Bewegung, und er ließ sich mit ihnen treiben. Etliche Autos fuhren vorbei. Keiner davon war ein schwarzer SUV.
Der Anblick der Demonstranten festigte etwas in Anasias. Plötzlich wusste er wieder, warum er sich von den subtilen Anzeichen der Bedrohung nicht einschüchtern lassen durfte. Seine Arbeit war wichtig. Immens wichtig sogar.
Er starrte auf die gemalte Welle. »… die Menschheit retten«, murmelte er. Die gesamte Menschheit würde er mit seiner Forschung zwar nicht retten können, aber wenigstens einem Teil konnte er helfen.
Der junge Mann mit dem Megafon zog einen zusammengefalteten Zettel aus der Tasche und warf einen Blick darauf. »Wir haben uns hier versammelt«, begann er, »weil die Mächtigen immer noch nicht aufgewacht sind. In den Jahren 2020 und 2021 hat die Corona-Pandemie weltweit Millionen Tote gefordert und der Weltwirtschaft weitreichende und existenzielle Schäden zugefügt. Wir alle hier wissen, dass die nächste Pandemie nur eine Frage der Zeit ist, und es werden von Tag zu Tag mehr, die deswegen beunruhigt sind. Was wir nicht wissen: inwieweit diese neue Pandemie von einem bis jetzt noch unbekannten Virus ausgelöst werden wird oder von einem Bakterium. Vielleicht, und das ist in meinen Augen das beängstigendste Szenario, liebe Freundinnen und Freunde, wird es auch ein Superbug sein, der …«
Anasias hörte den weiteren Ausführungen nur mit halbem Ohr zu, denn er kannte die Forderungen der Pandemic Fighters in- und auswendig. Spanische Grippe, SARS, Aids, Schweinegrippe, MERS, Ebola und Covid-19 – das waren die Schlagworte für die Epidemien des 20. und 21. Jahrhunderts. Und sie alle hatten eine Gemeinsamkeit: Sie waren Zoonosen. Zunehmende Umweltzerstörung, Klimawandel und weltweiter Hunger führten zu immer engerem Zusammenleben von Wildtier und Mensch. Was zur Folge hatte, dass es immer wahrscheinlicher wurde, dass ein Erreger die Artengrenze überwand und auch den Menschen befiel. Corona war da nur der Anfang gewesen.
»Zoonosen sind nicht die einzige Bedrohung«, führte der junge Mann weiter aus. »Wir alle hier wissen, dass wir kurz davor stehen, in eine Post-Antibiotika-Ära zu rasseln, in der Infektionen wieder wie im Mittelalter bekämpft werden müssen. Wir wissen, dass da etwas auf uns zukommt wie ein Tsunami. Ein Tsunami, den allerdings kaum jemand wahrnimmt, weil er im Zeitlupentempo heranrollt. Das Auftauen des Permafrostes in Sibirien durch den Klimawandel …«
Anasias’ Aufmerksamkeit wurde abgelenkt, als er den schwarzen SUV wiederentdeckte. Oder war es ein anderer? Diese bulligen Dinger sahen doch alle gleich aus! Langsam rollte der Wagen an ihm vorbei und behinderte dabei den fließenden Verkehr.
Anasias sah die Reflexion der Pinien über den schwarzen Lack und die getönten Scheiben huschen. Unsichtbare Gestalten dahinter. Sein Herz setzte aus, als eine der Scheiben zwei Fingerbreit hinuntergefahren wurde. Würde man jetzt auf ihn schießen?
Er konnte sich nicht rühren, wartete einfach nur auf den Schuss. Ob es wehtat, wenn sich eine Kugel ins Herz bohrte?
Doch es fiel kein Schuss. Keine Waffe erschien in dem Fensterspalt, während der SUV vorbeirollte und zwischen den anderen Wagen des Stadtverkehrs verschwand. In Anasias’ Ohren rauschte es. Er hörte die Stimme des Redners, aber die Worte erreichten kaum seinen Verstand.
»… bereits vor Corona starben jährlich weltweit 700.000 Menschen an multiresistenten Keimen, aber …«
Mit dem Arm presste er die Päckchen fester an sich. Die junge Studentin, die ihn eben an der Ampel angesprochen hatte, warf ihm einen Seitenblick zu und lächelte.
Anasias wog seine Optionen ab. Er wollte diese junge Frau nicht in Gefahr bringen, aber was blieb ihm anderes übrig? »Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten?«, fragte er mit belegter Stimme.
»Klar.«
Anasias zog die Studentin mit sich, bis die Menge sich um sie beide schloss. Dann holte er die Päckchen unter dem Mantel hervor. Eines war mehr als dreißig Zentimeter groß und schwer, das andere kleiner. Die Adresse, die Anasias mit fahriger Hand auf beide gekritzelt hatte, befand sich im Ausland, genauer gesagt in Berlin.
»Würden Sie direkt im Anschluss an diese Demonstration diese Päckchen für mich bei der Post aufgeben?«, fragte Anasias.
Die Studentin sah ein wenig verwundert aus. »Natürlich, Professor!« Sie nahm die Päckchen, und genau wie er verbarg sie sie unter ihrem Parka, um sie vor dem Nieselregen zu schützen, der schnurgerade auf sie herabrieselte.
Sehr gut!
Anasias zog seine Geldbörse und gab der jungen Frau genug Geld, damit sie zweimal Luftfracht bezahlen konnte, und legte noch etwas drauf, sozusagen als Vergütung.
»Soll ich Ihnen die Quittung in Ihr Büro bringen?«, fragte sie.
»Das wird nicht nötig sein.« Anasias dankte der jungen Frau. Dann warf er einen letzten Blick auf den Redner und auf die Schilder mit der Welle.
Ein Tsunami in Zeitlupe, dachte er fröstelnd, während er die Demonstration verließ und sich auf den Weg zurück zu seinem Institut machte, dem Delbrück Phage Research Center.
TEIL 1RIEN NE VAS PLUS
»Man findet Phagen praktisch überall, und sie sind so spezifisch, dass sie schädliche Bakterien vernichten können, ohne der natürlichen Gemeinschaft von Mikroorganismen in unserem Körper zu schaden.«
Dr. Christine Rohde, Phagen-Expertin am Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
Eine Woche später. Wieder Tiflis. Wieder Montag.
1
Das Hotelzimmer war klein und ein bisschen zu vollgestellt für Ninas Geschmack. Der Gast, der vor ihr hier gewohnt hatte, schien das Please-do-not-smoke-Schild auf dem Schreibtisch ignoriert zu haben. Der Raum roch unangenehm nach einer Mischung aus kaltem Rauch und dem Lavendelraumspray, mit dem das Zimmermädchen versucht hatte, den Gestank zu überdecken.
Völlig erschlagen von der Reise setzte sie die medizinische Maske ab, die sie auf Flugreisen immer noch trug, warf das Ding in den Papierkorb und ließ ihre Tasche neben dem Bett zu Boden fallen. Dann trat sie ans Fenster und riss es auf. Die Aussicht entschädigte für den Mief im Zimmer: Über die abendlich erleuchtete Altstadt hinweg konnte sie bis zum Mtatsinda blicken, dem Hausberg von Tiflis. Die kühle Luft war so klar, dass Nina sogar das von Scheinwerfern angestrahlte Riesenrad auf dem Hügel ausmachen konnte. Sie musste lächeln. Georgy war mit ihr früher oft in dem Vergnügungspark dort oben gewesen.
Bei dem Gedanken an ihren Ziehvater und Mentor zog sich ihr Herz zusammen. Seit Georgy sie vorletzte Woche angerufen hatte, machte sie sich Sorgen um ihn. Obwohl er ihr von den Fortschritten erzählt hatte, die seine Forschungsarbeit machte, hatte er bedrückt geklungen. Irgendwie atemlos. Fast gehetzt. Und das hatte überhaupt nicht zu ihm gepasst, denn gewöhnlich redete er wie ein Wasserfall, wenn er mit einer seiner Arbeiten so kurz vor dem Durchbruch stand wie gerade mit diesen neuen Super-Therapie-Phagen.
Besorgt hatte sie ihn gefragt, ob er krank sei, aber er hatte verneint.
Kein Wort hatte sie ihm geglaubt, darum hatte sie Maren Conrad angerufen, Georgys wissenschaftliche Kooperationspartnerin, die seit neun Jahren gemeinsam mit ihm an der Entwicklung der zwölf Superphagen arbeitete und gleichzeitig eine gute und langjährige Freundin von Nina war. Maren hatte Georgys seltsames Verhalten auch schon bemerkt, aber keine plausible Erklärung dafür gehabt. Und weil Nina gerade einen längeren Artikel für DIEZEIT abgeschlossen hatte, konnte sie sich ein paar Tage freinehmen. Gleich am nächsten Tag hatte sie sich in einen Flieger gesetzt.
Sie kannte Georgy Anasias schon, seit sie ein kleines Mädchen war. Nachdem ihre Eltern als politisch Verfolgte aus der DDR hatten flüchten und sie zurücklassen müssen, hatte er sich zusammen mit Ninas Großmutter um sie gekümmert. Er hatte in ihr die Liebe zur Wissenschaft geweckt, sodass sie nach dem Abitur Mikrobiologie studiert hatte. Sehr zu seinem Leidwesen war sie jedoch nicht in die Forschung gegangen, sondern hatte ihre zweite große Leidenschaft, das Schreiben, mit der ersten verbunden und sich für eine Laufbahn als Wissenschaftsjournalistin entschieden. Seit einigen Jahren schrieb sie erfolgreich für mehrere angesehene Magazine. Ein Jahr vor Corona hatte sie sogar eine vielbeachtete Reportage über Antibiotikaresistenzen geschrieben und war damit für den Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus nominiert worden.
Gähnend wandte Nina sich vom Fenster ab und ging in das winzige, weißgekachelte Bad. Der Flug hierher war unbequem gewesen. Sie hatte keine Direktverbindung bekommen, darum war sie über Istanbul geflogen, wo sie fast vier Stunden auf den Anschluss hatte warten müssen. Sie drehte den Wasserhahn auf, gab sich zwei Portionen Flüssigseife in die Handfläche und wusch sich gründlich die Hände. Danach kehrte sie ins Zimmer zurück. Ein leichter Wind bauschte die altmodischen Gardinen und brachte den Geruch von Pinien mit sich.
Sollte sie sich gleich bei Georgy melden, oder sollte sie sich erstmal die Reisemüdigkeit aus den Knochen laufen? Nina entschied sich für Letzteres. Sie hob ihre Reisetasche auf das Bett, zog den Reißverschluss auf und nahm ihre Joggingklamotten heraus.
Als sie anderthalb Stunden später verschwitzt und zufrieden wieder im Hotelzimmer ankam, war ihr Bedürfnis, Georgys Stimme zu hören, so groß, dass sie noch in Laufklamotten nach ihrem Handy griff. »Hallo, Georgy!«, begrüßte sie ihn.
»Nina!« Er klang überrascht und euphorisch. »Wie schön, deine Stimme zu hören! Du, ich habe es dir vor lauter Arbeit noch gar nicht erzählt. Stell dir vor: Ich habe das Dutzend zusammen! Auch der zwölfte Phagencocktail arbeitet perfekt! Das Schätzchen lysiert die Bakterien zuverlässig, wie Pacman die Punkte im Labyrinth.« Er lachte. Es klang, als habe er vor langer Zeit vergessen, wie es ging, und es gerade eben wiederentdeckt.
»Das ist wunderbar!«, stieß Nina hervor. Während er ohne Punkt und Komma geredet hatte, war sie ins Bad gegangen und hatte sich halb in die Dusche gebeugt, um das Wasser anzustellen, aber jetzt richtete sie sich wieder auf. Ein Gefühl wie ein Stromstoß durchfuhr sie. Seit fast zehn Jahren arbeitete Georgy Anasias daran, gegen jene zwölf multiresistenten Bakterienstämme alternative Therapien zu finden, die von der WHO als höchstgefährlich eingestuft worden waren. Dabei hatte er sich ganz auf sogenannte Bakteriophagen, kurz Phagen, konzentriert, die in Osteuropa seit über hundert Jahren erfolgreich Verwendung fanden, um Infektionen zu bekämpfen. Schon die Soldaten der Roten Armee waren in Ermangelung teurer Medikamente wie Antibiotika mit Phagen behandelt worden, und mittlerweile erwies sich die Phagentherapie als ernstzunehmende Alternative besonders bei der Behandlung von Menschen, die auf die geläufigen Antibiotika nicht mehr ansprachen. Im Delbrück Phage Research Center, das Georgy leitete und das nach dem weltberühmten Eliava-Institut das nächstgrößere war, bewahrten sie Patienten davor, dass ihnen Arme oder Beine amputiert werden mussten, oder sie fanden Mittel, um schwerstentzündete Wunden zu heilen.
»Schätzchen?«
Georgys Stimme holte Nina aus ihren Gedanken, und sie begriff, dass sie eine Weile lang nicht richtig zugehört hatte. Während er geredet hatte, war sie ins Zimmer gegangen und hatte sich auf der Bettkante niedergelassen. Jetzt rieb sie sich die noch verschwitzte Stirn. »Ja. Entschuldige, ich bin ziemlich erschossen.«
»Ich sagte gerade, dass es so schade ist, dass du in Berlin bist. Ich würde so gern mit dir und Maren diesen Erfolg feiern!«
Sie richtete den Blick auf das Bild an der Wand neben dem Bett, ein gerahmter Druck von van Goghs Sonnenblumen. In wie vielen Hotelzimmern überall auf der Welt hatte sie das schon gesehen? »Ich bin in Tiflis, Georgy«, würgte sie den nächsten Redeschwall ihres Mentors ab.
»… eben das nächste Mal …« Er verstummte. »Was?«, fragte er verdattert.
Nina musste lächeln. »Ich bin in Tiflis«, wiederholte sie.
»Wieso das?«
Auf einmal klang er misstrauisch. Natürlich: Er vermutete, dass sie sich Sorgen um ihn machte, und genau das hasste er wie die Pest. Dass ihre Sorge groß genug gewesen war, um sie ganze neun Stunden mit Dutzenden anderer Menschen in einen engen Flieger gepfercht hierher kommen zu lassen, würde sie ihm ganz gewiss nicht auf die Nase binden. Also dehnte sie die Wahrheit ein kleines bisschen. »Ich will eine Reportage schreiben und dachte mir, dass dein aktuelles Projekt da gut reinpasst.«
»Aber Kind! Liebe Güte, warum hast du mir nichts gesagt!«
»Ich wollte dich überraschen.«
»Du weißt, dass ich keine Überraschungen mag.« Er klang beleidigt. »Sag jetzt nicht, Maren wusste Bescheid, dass du kommst.«
»Nein.«
»Gut für sie! Du hast mich um den Genuss der Vorfreude gebracht, und das nehme ich dir übel, weißt du das?«
Nina wusste, dass er sich anstrengen musste, schmollend zu klingen. »Dafür ist die Überraschung jetzt umso größer.«
»Ja. Das ist sie in der Tat.« Nina konnte leises Klirren hören. Es klang, als würde er Gläser aus einem Schrank holen, »Weißt du was? Komm her! Am besten sofort! Ich wollte eigentlich Feierabend machen, aber ich rufe Maren an und sage ihr, sie soll nochmal herkommen. Lass uns zusammen feiern, an dem Ort unseres Triumphs! Was meinst du?«
Bei dem Wort feiern musste Nina unwillkürlich an diverse feuchtfröhliche Episoden denken, die sie und Maren verbanden. Sie kannten sich seit Studienzeiten, in denen sie einmal kurz in denselben Mann verliebt gewesen waren. Aber beide hatten sie schnell gemerkt, dass der Typ ein Blender war. Ihrer beider Liebeskummer hatten sie einen Abend lang gemeinsam in sehr viel Alkohol ertränkt, was dazu geführt hatte, dass sie kichernd von der Polizei aufgegriffen und nach Hause eskortiert worden waren. Die Vorstellung, Maren wiederzusehen und mit ihr Georgys und ihren Triumph zu feiern, freute Nina.
»Natürlich komme ich«, sagte sie. »Aber ich war gerade joggen. Ich muss erst duschen und mich umziehen.«
»Wo wohnst du?«
Sie nannte ihm den Namen des Hotels und war froh darüber, dass er nicht schon wieder beleidigt war. Seine Wohnung lag ganz in der Nähe des Instituts, war allerdings winzig und so vollgestopft mit Büchern, dass es keinen einzigen freien Quadratmeter gab. Aus diesem Grund machte Georgy jedes Mal einen Riesenaufwand daraus, auf eigene Faust ein Hotel für Nina auszusuchen, zu buchen – und natürlich auch zu bezahlen.
»Sehr gut«, sagte er jetzt aber nur. »Nimm ein Taxi, dann kannst du in spätestens einer Stunde hier sein.«
Victor Wolkows Augen brannten vom langen Starren auf das hell erleuchtete Delbrück Phage Research Center. Er kniff sie zusammen, kurz nur, damit Misha auf dem Beifahrersitz es nicht bemerkte. Auf keinen Fall wollte er, dass sein Partner glaubte, er würde hier anfangen zu flennen. Auch wenn ihm tatsächlich danach zumute war.
Er riss sich zusammen und zwang sich, nichtan Juri zu denken. Aber es ging nicht. Das gellende Geräusch der Nulllinie überlagerte seine Gedanken, und das Bild eines blassen, mageren Kinderkörpers, der unter all diesen Kabeln fast verschwand, flackerte vor seinem geistigen Auge auf.
Victor räusperte die Enge in seiner Kehle fort. Er war Profi, Herrgott! Sein Name stand für schnelle und diskrete Ausführung jedweden Auftrags. Keine Fragen. Keine Bedenken. Und schon gar kein Gewimmer.
Er wandte sich zur Seite und schaute den Mann an, mit dem er diese Sache hier zusammen durchziehen würde: Michail Rassnow, den alle nur Misha nannten. Was in Victors Augen zwar überhaupt nicht zu seinem hünenhaften, muskulösen Aussehen passte, sehr wohl aber zu seinem hübschen Gesicht, auf das Frauen flogen wie Bienen auf den Honig. Eine Nachbarin kümmerte sich in Moskau um die drei Katzen, die Misha von der Straße aufgelesen und gerettet hatte. Victor wusste auch, dass Misha seine Geheimdienstvergangenheit gern nutzte, um die ein oder andere zweibeinige Mieze von der Straße zu locken.
Er und Misha. Ein eingespieltes Team. Mehr brauchte es nicht.
Misha war, genau wie Victor selbst, in Schwarz gekleidet und hatte die Sturmhaube schon aufgesetzt, sie aber noch nicht über das Gesicht gezogen.
»Warten Sie, bis die Außenbeleuchtung abgeschaltet wird, dann ist das Institut bis auf Ihre Zielperson verlassen.« Das hatte sein Auftraggeber Victor am Telefon mitgeteilt. »Das wird gegen 20 Uhr der Fall sein.«
Jetzt schaute Victor auf die Uhr an seinem Handgelenk.
19.57 Uhr.
»Bereitmachen!«, befahl er.
Misha zog die Sturmhaube über das Gesicht, sodass im Halbdunkel des Wagens nur noch das Weiß seiner Augen zu sehen war. Victor tat es ihm gleich und ging in Gedanken noch einmal die detaillierten Anweisungen durch: Sie sollten warten, bis alle Angestellten das Institut verlassen hatten, dann dort einbrechen und einem gewissen Professor Georgy Anasias eine einzige Frage stellen: Wo sind das Buch und die zwölf Ampullen? Sein Auftraggeber hatte Victor von beidem Fotos geschickt. Das erste zeigte eine große Kladde, dunkelgrau eingebunden und mit einer Prägung auf dem Umschlag: Laboratory Journal. Das zweite Foto war das Bild von einem Reagenzglasständer, in dem zwölf Röhrchen mit einer klaren Flüssigkeit standen. Die Anweisung, was zu tun war, wenn sie alles in Händen hielten, war unmissverständlich. Die schwere Sporttasche im Kofferraum, deren Inhalt Misha besorgt hatte, würde dabei eine wesentliche Rolle spielen.
Eins nach dem anderen.
Am Delbrück Phage Research Center wurde die Außenbeleuchtung ausgeschaltet. Für ein, zwei Sekunden kam es Victor so vor, als falle er in einen tiefen schwarzen Brunnenschacht, dann gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit.
»Los geht’s!«, sagte er.
Anasias’ linke Hand kribbelte, aber das lag sicher nur daran, dass er das Telefon so fest umklammert hielt.
Nina war in Tiflis! Was für ein wunderbarer Zufall. Einen Augenblick lang gestattete er sich Freude darüber. Dann aber gewannen die Unruhe und die Angst die Oberhand. Was, wenn Nina durch seine unsichtbaren Verfolger in Gefahr geriet?
In den vergangenen Tagen, seit er das Laborjournal und eine Probe seiner wertvollen Phagen von der Studentin bei der Post hatte aufgeben lassen und damit in Sicherheit gebracht hatte, war das Gefühl der Beklemmung etwas geringer geworden. Was auch immer passieren mochte: Er hatte dafür gesorgt, dass sein Vermächtnis weiterleben würde. Aber trotzdem konnte diese Gewissheit seine Angst nur teilweise mildern. Noch immer fühlten sich die Schatten zu düster, fremde Menschen zu fremd und neue Situationen zu beängstigend an.
Anasias atmete durch.
Beruhig dich! Hier im Center bist du sicher!
Er wählte eine Nummer. Es dauerte nur zwei Herzschläge lang, bevor jemand dranging.
»Conrad?« Die Stimme von Maren klang verschlafen. Sie hatte in der letzten Zeit ganze Nächte durchgearbeitet und sich vermutlich heute endlich einmal früh hingelegt.
»Maren, hier ist Georgy. Habe ich dich etwa geweckt?«
»Georgy.« Maren seufzte hörbar. »Entschuldige. Nein, nein. Schon gut! Was ist?«
Anasias schob das schlechte Gewissen beiseite. »Hättest du Zeit, kurz in mein Büro zu kommen? Ich habe eine kleine Überraschung für dich.«
»Was für eine Überr…«
»Das siehst du dann«, unterbrach Anasias sie und blickte auf die drei Sektflöten, die er aus dem Schrank in der Teeküche genommen hatte. Eine Flasche Ukrainskoye hatte er schon vor Wochen gekauft und kaltgestellt. Er fühlte sich, als hätte er sie schon im Blut, und er konnte einfach nicht mehr an sich halten. »Nina ist in Tiflis, Maren!«
»Nina?«, stieß Maren hervor.
»Ja. Ich wollte dich eigentlich damit überraschen, aber … Egal! Ich würde gern mit euch beiden hier anstoßen. Nina kommt in einer halben Stunde ins Institut, und ich …« Irgendwo im Haus ertönte ein lauter Knall. Anasias zuckte zusammen.
»Was war das?«, erkundigte sich Maren. Täuschte er sich, oder klang auch sie plötzlich angespannt?
Sofort fing Anasias’ Herz wieder an zu jagen. »Ich weiß nicht.« Angestrengt lauschte er. Nichts. Stand irgendwo ein Fenster offen und war vom Wind zugeschlagen worden? Er spürte, wie seine Handflächen feucht wurden.
»Okay«, sagte Maren. »Ich bin eigentlich schon zu Hause. Aber ich mache mich gleich nochmal auf den Weg. Soll ich eine Flasche Sekt mitbringen?«
»Was?« Anasias war einen Moment lang abgelenkt gewesen. »Nein, nein. Ich habe schon eine gekauft.«
»Gut. Ich bin so schnell wie möglich da.«
Er lächelte, aber es fühlte sich falsch an. »Ich freue mich, meine Liebe.« Mit zitternden Fingern legte er auf.
Der Flur sah genauso aus, wie Victor sich eine Forschungseinrichtung vorstellte. Linoleumfußboden, die Wände in einer undefinierbaren gelbgrünen Farbe gestrichen. Zwischen den Büro- und Labortüren Bilder an den Wänden, deren Motive ihm vollkommen schleierhaft waren. Kopfschüttelnd betrachtete er die bunten Strukturen, Zellen vermutlich, mit einem Mikroskop aufgenommen. Wenn sein kleiner Juri mit Wachsmalstiften gemalt hatte, war ungefähr dasselbe dabei herausgekommen …
Mit zusammengepressten Zähnen vertrieb Victor die Erinnerung an seinen toten Sohn und warf Misha einen Blick zu. In dessen Augen stand Betretenheit, weil ihm eben diese dämliche Tür zugefallen war. Zum Glück hatte das Geräusch niemanden alarmiert.
Victor zwang seine Kiefer auseinander, er musste locker bleiben. An einer der vielen Türen blieb er stehen. Prof. Dr. Georgy Anasias stand auf dem kleinen Schild daneben.
Victor wechselte einen Blick mit Misha. Dann legte er die Hand auf die Klinke und drückte sie lautlos hinunter.
2
Durch das offene Fenster des Raucherraumes war der Rettungswagen schon von Weitem zu sehen. Tom Morell lehnte mit der Hüfte an der Fensterbank, nahm einen Zug von seiner Zigarette und beobachtete, wie der rot-weiß gestreifte Wagen am Hohenzollernkanal entlangfuhr und auf dem Gelände des zur Charité gehörigen Loring-Klinikums verschwand. Nur Blaulicht, kein Martinshorn, dafür langsame Fahrt.
Tom nahm einen letzten Zug, ignorierte das ungute Rumoren in seinem Unterbauch, weil er wusste, dass es allein von seiner Nervosität kam. Die schwere Darminfektion, die er sich vor knapp einem Jahr als Souvenir von einer Reise nach Indien mitgebracht hatte, war vollständig ausgeheilt.
Er drückte die Zigarette aus. Der Aschenbecher war übervoll, aber er quetschte seine Kippe noch irgendwie hinein. Dann starrte er auf das Feuerzeug, mit dem er die ganze Zeit herumgespielt hatte, ein kitschiges Ding in knalligem Pink mit einem Einhorn darauf, das ein Auge aus einem kleinen blauen Strassstein hatte. Seine Tochter Sylvie hatte ihm das Ding irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, und seitdem hielt er es in Ehren, auch wenn es ihm schon manchen Spott von Freunden und Bekannten eingebracht hatte. Mit dem Daumen strich er über das Fabeltier, dann seufzte er und steckte das Feuerzeug in seine Hosentasche. Der ekelige Geruch aus dem vollen Aschenbecher vermischte sich mit dem würzigen des ersten Herbstlaubes, der von draußen hereinwehte.
Die Klinik lag zu idyllisch für seinen Geschmack.
Tom zog einen winzigen Teddy unter seiner Lederjacke hervor. Er starrte dem Tier in die braunen Knopfaugen. »Wollen wir?«, fragte er und bewegte den Teddy so, dass es aussah, als schüttele er den Kopf. In diesem Moment wäre er überall lieber gewesen als ausgerechnet hier.
Hör auf, dir selbst leidzutun!
Seufzend steckte er den Teddy zurück in die Jacke und machte sich auf den Weg zum Krankenzimmer seiner Tochter.
Seine Frau Isabelle war natürlich schon da, als er mit Haube, hellblauem Kittel, Einweghandschuhen und Mundschutz vermummt das Zimmer betrat. Über ihren eigenen Mundschutz hinweg funkelte sie ihn an, weil er ein paar Minuten zu spät war.
Er ignorierte ihren Unmut, er war ihn gewohnt.
Betont gut gelaunt wandte er sich zuerst an seine Tochter. Täuschte er sich, oder wirkte Sylvie heute noch blasser als sonst? Dünn und zerbrechlich, wie sie war, sah sie aus wie eine Elfjährige, dabei war sie seit ein paar Monaten schon fünfzehn. Es zog Tom das Herz zusammen, als er daran dachte, wie sehr er sich Anfang Juni beeilt hatte, um es rechtzeitig zu Sylvies Geburtstagsfeier zu schaffen. Hätte er doch diesen elenden Flieger damals besser verpasst!
Aber das hatte er nicht.
Und seine Tochter zahlte jetzt den Preis dafür.
»Hey, Dikdik«, sagte er und hielt Sylvie den Teddy hin. »Guck mal, ich hab dir was mitgebracht.«
Sylvie verdrehte die Augen. Die Ringe darunter waren so tief, dass sie blau wirkten. »Paps! Ich hab dir schon hundertmal gesagt, du sollst mich nicht so nennen!«
Er hatte ihr den Spitznamen gegeben, als sie angefangen hatte zu krabbeln. Kaum größer als eine afrikanische Zwergantilope war sie damals gewesen, und damals hatte sie den Namen auch geliebt. Da war sie allerdings noch nicht in der Pubertät gewesen. Und vor allem: Früher hatte sie nicht mit einem Dutzend Schläuche und Drähte verkabelt auf einer Isolierstation gelegen und um jeden Atemzug gerungen.
Sylvies Immunsystem war zu stark geschwächt, um den Teddy auch nur anzufassen, also lehnte Tom ihn in sicherer Entfernung gegen eine leere Kaffeetasse.
»Danke«, sagte Sylvie schon versöhnlicher. »Der ist ja voll süß.«
»Er heißt Puck«, sagte Tom. »Wie in Der Sommernachtstraum.«
»Klar«, meinte Sylvie. »Hey, Puck.« Sie hob matt die Hand und winkte dem Teddy zu.
Tom knirschte mit den Zähnen, weil auch diese Geste ihm das Herz zerriss. Er spürte, dass Sylvie nur ihm zuliebe das Spiel mit dem Teddy mitmachte. Insgeheim fand sie sich zu alt dafür, das war ihm bewusst, und es irritierte ihn massiv.
Wann war aus seinem todkranken kleinen Mädchen eine junge Dame geworden?
Um seine Gefühle unter Kontrolle zu bringen, wandte er sich zu seiner Noch-Ehefrau um. »Hallo, Isabelle«, murmelte er.
Sie nickte knapp, dann richtete sie den Blick auf seine ausgetretenen Timberland-Boots. »Kommst du direkt aus der Sahara, oder was?«
Er konnte es unter dem blauen Kittel nicht sehen, aber er war sicher, sie trug darunter ein elegantes Kostüm. Sie trug immer Kostüme. An ihren Ohrläppchen glänzten Perlenohrringe, die er an ihr noch nie bemerkt hatte. Ob sie die von einem neuen Typen hatte? Durch ihre Einweghandschuhe erkannte er, dass sie ihren Ehering abgenommen hatte.
Die Erkenntnis war ein Stoß irgendwo dort, wo sein Herz saß.
»Schaff dir endlich vernünftige Schuhe an!«, maulte sie.
Er atmete tief durch.
Das hier war nur der Anfang einer ganzen Reihe von Vorwürfen, die gleich noch kommen würden, das wusste er aus Erfahrung. Aber er wusste auch, dass sie diese Vorwürfe brauchte, um ihm seine sehr viel größere Schuld – die an Sylvies Erkrankung – nicht ins Gesicht zu schreien. Scheingefechte, dachte er. Die beiden letzten Male am Krankenbett ihrer Tochter hatten damit geendet, dass Isabelle angefangen hatte zu weinen. Natürlich hatte sie ihm auch dafür die Schuld gegeben.
Es war der rote Faden, der sich durch ihre Ehe zog: Etwas ging schief, Isabelle gab ihm die Schuld. In den sechzehn Jahren, die sie verheiratet waren, hatte er den wachsenden Ansprüchen seiner Frau selten genügt. Manchmal hatte er das Gefühl, dass sie ihn nur geheiratet hatte, damit sie jemandem die Schuld geben konnte.
Tom knirschte mit den Zähnen. Wut war besser als Angst, auch das wusste er.
»Wieso?«, erkundigte er sich darum gespielt gleichgültig. »Was stimmt denn mit meinen Schuhen nicht?« Mit einem ebenfalls gespielten überraschten Gesichtsausdruck schaute er an sich hinab. Seine alte Lederjacke hatte er draußen an der Garderobe gelassen. Die ausgeblichene Jeans und das Hemd, das er locker über dem Gürtel trug, waren unter dem Kittel nicht zu erkennen. Nur die Boots, mit denen er schon um die halbe Welt gereist war, schauten unter dem Saum hervor.
Sylvie lachte leise. »Mama hasst diese Schuhe, Papa!« Sie zischte das Wort in exakt demselben Tonfall, den auch Isabelle angeschlagen hätte. Gleich darauf hustete sie angestrengt. Tom konnte das Rasseln in ihrer Lunge hören, dieses grausame Geräusch, das ihn bis in seine Träume verfolgte.
Isabelle rang hinter ihrer Maske um Fassung. Er sah die Müdigkeit in ihren Augen. Er wusste, sie schlief vor lauter Sorge um Sylvie seit Monaten kaum noch. »Pünktlich bist du auch nicht gewesen«, murmelte sie.
Darauf erwiderte Tom nichts.
Stimmt, dachte er. Weil ich genau wie du eine Höllenangst vor dem habe, was Dr. Heinemann uns gleich zu sagen hat.
Kriminalkommissarin Christina Voss von der Abteilung Polizeilicher Staatsschutz des LKA Berlin seufzte, als sie nach einem Tag voller nutzloser Klinkenputzerei in ihr Büro zurückkehrte und von der stickigen Luft in dem Raum fast erschlagen wurde. Zu gern hätte sie jetzt einfach Feierabend gemacht, aber leider hatte Tannhäuser, ihr Vorgesetzter, noch eine abendliche Teambesprechung angesetzt.
Mist, verdammter!
Voss zog ihre Jacke aus, hängte sie in den Schrank und durchquerte den Raum, riss die Fenster auf und machte sich anschließend daran, die Kaffeemaschine auf dem Aktenschrank anzuschmeißen. Sie würde wieder die ganze Nacht in ihrem Bett rotieren, wenn sie so spät noch Kaffee trank, aber sie brauchte dringend Koffein, wenn sie dieses blöde Meeting auch noch durchstehen wollte. Das Wochenende steckte ihr in den Knochen. Missmutig starrte sie auf den Aktenstapel, der sich auf ihrem Schreibtisch türmte. Obenauf lag die Anzeige gegen einen jungen Typen, der mit Neonfarbe Bill Gates lükt an die Wand einer U-Bahn-Station geschrieben hatte. Sie empfand das dringende Bedürfnis, ihm Nachhilfe in Rechtschreibung zu geben.
Sie schob die Akten zur Seite, ließ sich missmutig auf ihren Stuhl fallen und dachte nicht zum ersten Mal heute an ihr Date vom Samstagabend. Sie hatte sich mit einem Kollegen von der Abteilung 1 getroffen. Es war ein angenehmer Abend gewesen, sie hatten sich gut unterhalten, und Iskander hatte etwas an sich gehabt, das sie faszinierte. Trotzdem hatte sie instinktiv beschlossen, dass es kein weiteres Treffen geben würde, und ihn gestern Nachmittag angerufen, um ihm das zu sagen.
Sie schaltete den Computer an, und als er hochgefahren war, starrte sie eine Sekunde lang auf das Hintergrundbild der Desktopoberfläche. Darauf befand sich ein abgewandeltes Chandler-Zitat, das aussah wie mit einer altmodischen Schreibmaschine geschrieben. Knallhart und hoffnungslos sentimental, lautete es. Wie immer, wenn sie es ansah, kam sie sich albern und ein wenig melodramatisch vor, aber sie konnte sich irgendwie auch nicht davon trennen. Sie verdrängte den Gedanken an das Date mit dem verkorksten Kollegen, rief die Startseite des digitalen Aktenarchivs des Berliner LKA auf und prüfte, ob es in den Fällen, die sie zu bearbeiten hatte, neue Erkenntnisse oder Ermittlungsansätze gab.
Fehlanzeige.
Sie war schon drauf und dran, das Programm wieder zu schließen, als ihr Blick auf die rechte obere Ecke des Monitors fiel. Dort tauchten in schneller Reihenfolge Kurznachrichten über die neuesten in die Datenbank eingegebenen Polizeiberichte auf. An einer davon blieb ihr Blick hängen.
Prometheus, lautete sie.
Aus reiner Neugier klickte sie den Link an. Seit einer knappen Woche tauchten überall in Berlin sonderbare Botschaften auf – hauptsächlich in Altersheimen und Kliniken. Alle diese Botschaften waren mit einem Laserdrucker auf DIN-A4-Blättern ausgedruckt worden und enthielten einen Kupferstich von einem an einen Felsen geketteten Mann, der von Adlern umlagert wurde. Die Berliner Presse hatte sich begierig auf diese rätselhaften Flugblätter gestürzt und den Urheber Prometheus genannt. Prometheus war nur deswegen ein Fall für die Polizei geworden, weil eine seiner Nachrichten in einem extrem gut gesicherten Bereich des Loring-Klinikums aufgetaucht war, und zwar in der Isolierstation für hochinfektiöse Patienten.
Der neu eingegebene Bericht informierte Voss darüber, dass ein weiterer dieser seltsamen Zettel aufgetaucht war:
Vergesst nicht, dass ihr sterblich seid.
Was für ein Unsinn!, dachte sie, klickte aber trotzdem die in der Fallakte hinterlegten Fotos der anderen Botschaften an, insgesamt vier verschiedene.
Ich werde euch das Feuer der Erkenntnis bringen.
In meinem Feuer wird eure Selbstherrlichkeit brennen.
Durch das Feuer der Erkenntnis werdet ihr gereinigt werden.
Und eben die neueste mit der Erinnerung daran, dass alle Menschen sterblich waren. Zumindest Letzteres, dachte Voss, klang wie eine Drohung, aber das war es dann auch schon. Solange es keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Anschlag oder ein anderes Verbrechen gab, galt die Maxime: Prometheus war nur ein weiterer dieser Spinner mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein, ein analoger noch dazu. Natürlich tauchten immer wieder Fotos von den Zetteln im Internet auf, immer verbunden mit der geraunten Frage: Wer ist Prometheus? Aber bisher gab es keinerlei Hinweise darauf, dass er – oder war es eine Sie? – seine seltsamen Botschaften selbst über das Netz verbreitete.
»Idiot!«, murmelte Voss, schloss die Akte wieder und schaute auf die Uhr. Gleich musste sie zu diesem bescheuerten Meeting. Sie gähnte allein bei dem Gedanken daran. Zum Glück war der Kaffee endlich durchgelaufen.
Das Taxi fuhr an der Medizinischen Fakultät der Universität von Tiflis vorbei, wo eine Straßenkehrerkolonne damit beschäftigt war, herumfliegende Handzettel und zerrissene Plakate zusammenzufegen. Nina konnte nicht erkennen, was auf den Plakaten stand, nur die Logos mit einer stilisierten Welle zeigten ihr, dass hier kürzlich eine Demonstration der Pandemic Fighters stattgefunden hatte.
Sie lächelte in sich hinein. Erstaunlich, was mit den Mitteln von Social Media heutzutage alles möglich war. Dadurch war die Fridays-for-Future-Bewegung erst riesengroß geworden, und jetzt schienen Ärzte ohne Grenzen und die Fighters, wie sie kurz und knapp genannt wurden, es tatsächlich zu schaffen, dass sich auch ihr Kampf gegen Antibiotikaresistenzen zu einer weltweiten Protestbewegung entwickelte. Zu einem Teil war das Corona zu verdanken, noch mehr aber der Tatsache, dass führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen beunruhigenden Anstieg von schwersten Krankheitsverläufen in Zusammenhang mit multiresistenten Erregern feststellten.
Sie presste die Lippen aufeinander, als sie an die Worte von Maria Helena Semedo dachte, der Generaldirektorin der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die befürchtete, dass die nächste Pandemie eine bakterielle sein würde – und viel tödlicher.
»Unfassbar, was die für Dreck machen.«
Die brummelige Stimme des Taxifahrers riss Nina aus ihren Gedanken. Sein Georgisch hatte einen schwer verständlichen Dialekt, irgendwas Südwestliches, Adscharien oder so. Nina hatte zusätzlich zu dem Deutsch und Georgisch, die sie seit ihrer Kindheit sprach, im Laufe der Jahre vier weitere Sprachen gelernt, darunter auch Russisch. Sie hielt sich für begabt in dieser Hinsicht, aber sie musste sich trotzdem anstrengen, um den Fahrer zu verstehen.
»Die Demonstranten?«, fragte sie.
Er nickte heftig, und der Wagen machte einen kleinen Schlenker, der Ninas Herz stocken ließ. Überhaupt fuhr der Kerl ruppig und aggressiv, wie vermutlich neunzig Prozent aller Taxifahrer überall auf der Welt. Nina war schon ein wenig schlecht, aber sie hoffte, die Übelkeit würde spätestens verflogen sein, wenn sie mit Georgy anstoßen musste.
»Klar. Wer sonst?« Der Taxifahrer klang nicht so, als hege er allzu große Sympathien für die Demonstranten. »Jeden Montag treffen die sich hier und krakeelen rum, statt zu arbeiten, wie es sich für anständige Leute gehört!«
Nina überlegte kurz, ob sie sich auf eine Diskussion über die Wichtigkeit des Ansinnens einlassen sollte. Sie hatte eigentlich keine Lust dazu, aber vielleicht lenkte es sie ja von dem selbstmörderischen Fahrstil des Mannes ab. »Das Problem der Antibiotikaresistenzen ist ähnlich bedrohlich für die Menschheit wie der Klimawandel«, sagte sie.
Seine Reaktion bestand in einem höhnischen Schnauben. »Klimawandel! Antibiotikaresistenzen! Junge Leute, die keine Lust haben, zur Schule zu gehen! Das ist das Problem! Eine aufsässige Jugend, die glaubt, alles besser zu wissen! Ich kann auch nicht einfach meine Arbeit schwänzen und stattdessen irgendwelche Plakate in die Luft halten. Dabei gäbe es etliche Sachen, für die ich demonstrieren könnte. Gerechte Bezahlung zum Beispiel! Dieses verdammte Uber verdirbt uns doch …«
Den Rest seiner schwerverständlichen Tirade blendete Nina aus und wartete darauf, dass sie in die Levan-Gouta-Straße einbogen, in der Georgys Forschungseinrichtung lag.
Als der Fahrer vor dem Institut hielt, blickte er auf das Schild vor dem Gebäude. »Delbrück Phage Research Center. Was ist das denn?« Die Frage klang ehrlich interessiert.
»Hier werden alternative Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten entwickelt, für die die weltweit gängigen Medikamente nicht wirken. Sogenannte Bakteriophagen.«
»Bakteriowas?«
»Bakteriophagen. Das sind nützliche Viren, die sich wie Parasiten auf Bakterien als Wirtszellen spezialisiert haben. Hier in diesem Institut schickt man sie los, wie kleine Auftragskiller, und im Körper eines Patienten …« Ihr ging auf, dass der Fahrer schon das Interesse verloren hatte. »Na ja«, murmelte sie mit einem Schulterzucken. »Innovative Forschung, eben.«
»Ah«, sagte der Taxifahrer im vergeblichen Versuch, höflich zu sein. »Klingt wichtig.«
Leicht verlegen öffnete Nina die Tür, stieg aus und zahlte. Sie gab dem Taxifahrer ein üppiges Trinkgeld und verbuchte es auf ihrem Karmakonto zur Hälfte als Wiedergutmachung für ihre Geschwätzigkeit und zur Hälfte als Dankesopfer dafür, dass sie die Fahrt überlebt hatte.
Über den breiten Weg ging sie auf den Haupteingang des Instituts zu, bog jedoch direkt davor nach rechts ab. Von ihren früheren Besuchen wusste sie, dass es auf der Rückseite einen Hintereingang gab, der eine Klingel besaß.Seltsam, dachte sie beim Umrunden des Gebäudes. Die gesamte Außenbeleuchtung war abgeschaltet. Der kleine Garten, der sich an die Rückseite des Instituts schmiegte, lag in tiefer Dunkelheit. Nur das Murmeln der Kura, des in der Nähe vorbeifließenden Flusses, war zu hören – und das Geräusch des Straßenverkehrs, das jedoch von den Bäumen gedämpft wurde. Die Stille war so drückend, dass Ninas Ohren sich anfühlten, als seien sie verstopft.
Nirgendwo im Gebäude brannte Licht, außer in Georgys Büro.
In seinem matten Schimmer trat Nina an die Hintertür, klingelte und wartete. Keine Reaktion. Sie klingelte noch einmal. Dabei fiel ihr auf, dass das Geräusch der Glocke ungewöhnlich laut klang. Sie sah genauer hin.
Die Tür stand ungefähr einen Fingerbreit offen.
Die Stille drinnen wirkte noch undurchdringlicher als die draußen. Die Deckenbeleuchtung war ausgeschaltet, nur die Notausgangsschilder brannten und tauchten den Flur in unheimliches grünliches Licht. Etwas in Nina war in den Alarmmodus gegangen. Ihr Herz klopfte bis zum Hals, und das Blut rauschte in ihren Ohren.
»Georgy?« Zaghaft erhob sich ihre Stimme über die Stille. »Georgy?«, fragte sie noch einmal, lauter jetzt.
Keine Antwort.
Sie ging den Flur entlang, vorbei an der Teeküche, aus der es schwach nach Kuchen roch. An den Wänden hingen großformatige Aufnahmen, alle mit einem Elektronenmikroskop erstellt: Hanta-Virus. Grippeviren. Ebola.
Georgys Bürotür befand sich zwischen dem Marburg-Virus und der Aufnahme eines stäbchenförmigen Pseudomonas-Bakteriums, das aussah, als sei es mit Fell überzogen. Trotz ihrer Anspannung musste Nina schmunzeln. Georgy und sein Mikrobenzirkus. Die Tür zu Georgys Büro war genau wie die Eingangstür nur angelehnt. Licht fiel durch den Spalt auf den Flur und malte einen langen gelblichen Balken auf das Linoleum. Nina streckte die Hand aus und schob die Tür weiter auf. »Georgy, bist du hier irgendwo?«
Sein Büro war verwaist.
Der Monitor seines Computers war eingeschaltet, ein Bildschirmschoner lief und zeigte ein weiteres Elektronenmikroskop-Foto.
Nina näherte sich dem Schreibtisch, auf dem das für Georgy so typische kreative Chaos herrschte: Bücher, Stifte, Notizhefte und Dutzende Computerausdrucke, alles in einem wilden Durcheinander. Eine Kaffeetasse stand auf einem windschiefen Stapel Manuskriptseiten. Seinem Aussehen nach zu urteilen, war der Kaffee schon seit Stunden kalt.
Nina wandte sich ab. Vielleicht war Georgy in die kleine Institutsklinik gegangen, wo er stets eine Handvoll zahlungskräftiger Patienten mit seinen Phagen behandelte und auf diese Weise einen Teil seiner teuren Forschungstätigkeit finanzierte. Aber die Klinik lag ein paar Straßen weiter, dachte Nina. Schwer vorstellbar, dass Georgy sie eilends hierher zitierte, nur um dann das Gebäude zu verlassen.
Also gab es eigentlich nur einen Ort, wo er stecken konnte – bei der Phagensammlung.
Sie machte sich auf den Weg in den Keller.
Auch in der Phagensammlung brannte Licht, das sah sie schon von der Treppe aus. Ihre Anspannung wich, und mit schnelleren Schritten marschierte sie auf die metallene Doppeltür zu. Georgy kam oft allein hier herunter, um seine Schätze zu betrachten.
Bei der Sammlung handelte es sich um seinen ganzen Stolz, ein Archiv tiefgefrorener Phagen, das bereits eine hundertjährige Geschichte aufwies und das Georgy zusammen mit der Institutsleitung vor Jahren übernommen hatte. In diesen Kellerräumen befand sich eine der ältesten und größten Phagensammlungen weltweit. Exemplare von Tausenden der heilenden Viren wurden hier in flüssigem Stickstoff oder gefriergetrocknet aufbewahrt, wo sie auf ihren Einsatz warteten.
»Georgy?«, rief Nina, bevor sie die Tür aufzog. Sie wollte ihn nicht erschrecken. Seit er kürzlich am Telefon so sonderbar geklungen hatte, fürchtete sie, dass mit ihm gesundheitlich etwas nicht in Ordnung war. Und auf keinen Fall wollte sie, dass er einen Herzinfarkt erlitt, wenn sie sich einfach hinterrücks an ihn heranschlich.
Als sie den langgestreckten, fensterlosen Raum mit den großen Stahlschränken betrat, war es allerdings Nina, die sich fast zu Tode erschrak: Eine Frau stand vor ihr. Es war Maren. Ihr Rock, ihr Blazer und auch ihre Bluse waren in Unordnung, vor allem aber waren sie über und über mit Blut besudelt! Mit weit aufgerissenen Augen taumelte sie auf Nina zu.
»Gott sei Dank!«, ächzte sie, dann stolperte sie Nina direkt in die Arme.
Nina stieß vor Schreck einen Schrei aus und fing sie auf. »Was ist pass…« Sie unterbrach sich, als sie Männerbeine hinter einem gemauerten Labortisch hervorragen sah.
Georgy!
Sie hastete um den Labortisch herum. Und schrie zum zweiten Mal auf.
Georgy lag lang ausgestreckt da, halb auf der Seite, halb auf dem Bauch. Er war bewusstlos, aber was noch viel schlimmer war: Er war über und über bedeckt mit kleinen und größeren Schnitten! Blut sickerte aus seinen Handflächen, aus Wunden an seinen Unterarmen, seinem Hals und sogar seinem Bauch. Eine Hand hatte er in Richtung Tür ausgestreckt, als habe er sich von dort rettende Hilfe erhofft, bevor er bewusstlos geworden war. Und offenbar hatte er sich von weiter hinten bis hierher geschleppt, denn da war auch eine lange Schleifspur aus Blut.
Durch die getönten Scheiben des SUV blickte Victor zurück zum Institut. Die Außenbeleuchtung war noch immer abgeschaltet, und aus irgendeinem bescheuerten Grund war er froh darüber. Die Vorstellung, dass die klassische georgische Fassade dieses Kastens in reinem Weiß leuchtete, während drinnen dieser … seine Gedanken stockten … dieser alte Knacker da an den Wunden starb, die Misha ihm zugefügt hatte, kam ihm blasphemisch vor.
Er schüttelte die Benommenheit ab. Misha, der wie zuvor auf dem Beifahrersitz saß, war dabei, die Klinge seines mattschwarzen Butterflys von Anasias’ Blut zu reinigen. Er tat es mit einer Zärtlichkeit, als liebkose er eine willige Gefährtin, dachte Victor. Ihm war ein wenig schlecht, in Mishas Augen jedoch lag ein zufriedenes Glitzern, das ihn zutiefst abstieß. Es war eine Sache, bei einem Auftrag zu tun, was nötig war. Es dann aber auch noch zu genießen …
Misha war, während er den Professor bearbeitet hatte, ja beinahe einer abgegangen. Immerhin: Seine Kreativität mit dem Messer hatte ihnen die benötigte Information geliefert, und sie wussten jetzt, wo das Laborjournal und diese Medikamentenproben waren. Gefallen würde es ihrem Auftraggeber allerdings kaum.
Victor nickte Misha zu. Der nahm ein kleines Gerät aus der Tasche, das einer Fernbedienung ähnelte, nur dass es weniger Tasten hatte. Er tippte eine Zahlenkombination ein. Eine Diode sprang von Grün auf Rot, und Misha nickte zum Zeichen, dass es nun kein Zurück mehr gab.
Victor bezwang seine Übelkeit, dann legte er einen Gang ein und gab Gas. Wenn das Dreckszeug in Anasias’ Büro in die Luft flog, wollte er nicht in der Nähe sein.
3
Dr. Heinemann empfing Tom und seine Noch-Ehefrau in seinem klimatisierten Büro in der zweiten Etage des Klinikums. Von hier aus fiel der Blick über einen Taxistand hinweg auf einen kleinen Parkplatz, der offenbar für Ärzte reserviert war. Bullige SUV, bevorzugt in den Farben Schwarz oder Anthrazit, und eine Handvoll knallbunter, flacher Sportflitzer, deren Marken Tom nicht kannte, aber er hatte sich noch nie groß für Autos interessiert. Außerdem gab es gerade sehr viel wichtigere Dinge, um die seine Gedanken kreisten.
»Danke, dass Sie beide sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben«, sagte Dr. Heinemann, nachdem er erst Isabelle und dann Tom freundlich zugenickt hatte. Er war einer der Menschen, die es sich nach der Corona-Pandemie nicht wieder angewöhnt hatten, ihrem Gegenüber die Hand zu geben. Er war um die fünfzig, groß, schlank, und er behandelte Sylvie, seit klar geworden war, worunter sie litt. Tom und Isabelle waren also nicht zum ersten Mal in diesem Raum.
»Bitte, setzen Sie sich doch!« Der Arzt nahm hinter seinem Schreibtisch Platz.
Tom richtete den Blick auf die Schale mit Stiften, die neben der Computertastatur stand. Ein Kugelschreiber darin stammte von einer billigen Hotelkette, das war ihm schon beim letzten Mal aufgefallen.
Isabelle nahm ganz vorn auf der Kante des Stuhles Platz. Die Füße in ihren eleganten, hochhackigen Schuhen stellte sie akkurat nebeneinander, die Hände faltete sie auf dem Schoß. Tom konnte deutlich die Sehnen an ihren Handrücken sehen, so fest drückte sie zu.
Er hätte gern ihre Hand genommen, aber natürlich ließ er es bleiben.
Im vergangenen Oktober war er im Auftrag eines befreundeten Sternekochs in Indien gewesen, um ihm neues Trendfood für sein In-Restaurant in Friedrichshain zu besorgen. Das war Fehler Nummer eins gewesen. Fehler Nummer zwei war, dass er in einer der unzähligen Garküchen in Hyderabad ein indisches Curry gegessen hatte, woraufhin er eine höllische Nacht auf der Toilette seines Hotelzimmers verbracht hatte. Sein indischer Kollege, mit dem zusammen er unterwegs war, hatte ihm am nächsten Tag aus einer Apotheke Colistin besorgt, ein Antibiotikum, das in Deutschland als Notfall-Antibiotikum streng gehütet wurde, in Indien aber frei verkäuflich war. Das hatte Tom allerdings erst sehr viel später erfahren. Zunächst einmal war es ihm innerhalb von Stunden wieder besser gegangen. Er hatte keine Ahnung davon gehabt, dass in seinem Körper durch die Einnahme dieses Antibiotikums ein Darmkeim namens E. coli eine gefährliche Resistenz gegen Colistin herausbilden konnte. Und so hatte er seinen Körper in einen Brutkasten für eine Art mikrobiologische Zeitbombe verwandelt. Als er dann einige Tage später zurück nach Berlin geflogen war, um es noch rechtzeitig zum fünfzehnten Geburtstag von Sylvie zu schaffen, hatte er, ohne es zu ahnen, diesen Keim durch normalen Hautkontakt auf seine Tochter übertragen. Sylvie war eine Muko – sie litt seit ihrer Geburt an Mukoviszidose. In den Tagen nach ihrem Geburtstag dann war es ihr ziemlich schlecht gegangen, und Dr. Heinemann hatte Tom auch damals zu einem Gespräch gebeten – zunächst ohne Isabelle. Damals hatte Tom ihm sofort angesehen, dass er keine guten Nachrichten hatte. »Sie wissen, dass Sylvie mit Pseudomonas aeruginosa zu kämpfen hat«, hatte der Arzt mit ernster Miene gesagt, und Tom hatte genickt.Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa war ein ganz typischer Keim, der sich bei Muko-Patienten mit ihren häufigen Krankenhausaufenthalten und unzähligen Antibiotikatherapien irgendwann unweigerlich einschlich, so auch bei Sylvie. Doch bis zu diesem Zeitpunkt war der Erreger einigermaßen gut behandelbar gewesen.
»Ja«, hatte er darum gesagt. »Und ich weiß auch, dass Sie eine Reihe Medikamente haben, die Sie gegen Pseudomonas einsetzen können.«
Der Arzt nickte. »Damit hätten wir Sylvie auch eigentlich jahrelang ohne Probleme behandeln können.«
»Eigentlich«, echote Tom.
Dr. Heinemann legte die Fingerspitzen aneinander. »Sylvies Pseudomonas-Stamm hatte vorher schon eine Reihe Resistenzen, die wir, wie gesagt, einigermaßen im Griff hatten. Aber leider befindet sich im Körper Ihrer Tochter jetzt auch noch das resistente Kolibakterium, Herr Morell, das sie sich von Ihnen eingefangen hat. Und es kam zu einem horizontalen Gentransfer zwischen beiden Erregern.«
»Das heißt?« Tom musste schlucken.
»Sie können sich das so vorstellen: Sylvies Pseudomonas verhält sich wie ein bakterieller Kleptomane und versucht, alle möglichen Eigenschaften von anderen Bakterienstämmen zu übernehmen. So auch bei Sylvie – der Pseudomonas hat sich die Resistenz von Ihrem Darmkeim angeeignet.« Dr. Heinemann lächelte traurig. »Die Bakterien tauschen ihre Genabschnitte wie Kinder Pokémon-Karten.«
»Ich verstehe immer noch nicht, was das bedeutet«, sagte Tom, obwohl ihm längst ein Verdacht gekommen war.
»Ich neige sonst eher dazu, vorsichtig zu formulieren«, erklärte Dr. Heinemann, »aber bei Ihnen würde ich gern ganz offen sein. Was wir hier bei Ihrer Tochter haben, ist der mikrobiologische Super-GAU.« An dieser Stelle hatte Sylvies Arzt eine bedeutsame Pause gemacht, bevor er fortfuhr. »Ich fürchte, gegen den Erreger, unter dem Sylvie leidet, hilft fast nichts mehr.«
Die Erinnerung an dieses frühere Gespräch kreiste in Toms Kopf, während er jetzt doch noch Isabelles Hand nahm und festhielt. Ihre Finger waren eiskalt. Durch seine Sorglosigkeit im Umgang mit dem indischen Colistin hatte er die Zukunft seiner Tochter zerstört, dachte er, und wenn … Ihm wurde bewusst, dass er nicht darauf geachtet hatte, was Dr. Heinemann sagte, und dass sowohl Isabelle als auch der Arzt ihn musterten.
»Wie geht es Ihnen, Herr Morell?«, erkundigte Heinemann sich bei ihm.
»Gut.« Er vermied es, Isabelle anzusehen. »Aber ich denke, wir sind nicht hier, weil Sie sich nach meinem Befinden erkundigen wollen, oder?«
Dr. Heinemann atmete tief durch. »Nein.« Er rief Sylvies Krankenakte auf, drehte seinen Monitor so, dass Tom einen Blick darauf werfen konnte, und fasste zusammen, was bisher geschehen war. »Ihre Tochter befindet sich seit dem 17. Juni mit einer Pneumonie bei uns in Behandlung. Bisher haben wir ihre Lungenentzündung mit einer Standard-Inhalationstherapie mit Colistin und Tobramycin behandelt, aber ihr Zustand hat sich unter dieser Therapie leider verschlechtert. Darum haben wir für den Erreger ein aktuelles Antibiogramm erstellt und festgestellt, dass er zusätzlich zu den bereits bekannten Resistenzen auch noch eine gegen Colistin aufweist. Das heißt, wir mussten eine Anpassung der Therapie vornehmen.« Er räusperte sich und fuhr fort. »Ich habe die Therapie dann auf neue noch mögliche inhalative Antibiotika-Kombinationen mit Aztreonam und Levofloxacin umgestellt. Da das nicht die gewünschten Ergebnisse brachte, sind wir – in Abstimmung mit Ihnen – vor zwei Wochen auf die Alternativbehandlung mittels Ciprofloxacin oral übergegangen.«
Die verschiedenen Medikamentennamen, die er seit seinem ersten Gespräch mit Heinemann wieder und wieder gehört hatte, rauschten an Tom vorbei. Er dachte daran, wie Sylvie sich über die ständigen wechselnden Medikamente beklagt hatte. Sie hatte die häufigen Inhalationen und Tabletten satt, denn sie brachten eine Menge Nebenwirkungen mit sich, und besser ging es ihr dadurch auch nicht wirklich.
Heinemann klickte in der Akte eine Seite weiter. Seine Miene verfinsterte sich zunehmend. »Leider mussten wir feststellen, dass auch Ciprofloxacin nicht zu einer gewünschten Besserung des Allgemeinzustandes Ihrer Tochter geführt hat. Im Gegenteil: Mittlerweile kam auch noch eine Harnwegsinfektion dazu. Darum habe ich eine aktuelle Erreger-Kultur anlegen lassen.« Heinemanns Mauszeiger glitt über einen Eintrag in der Akte. Ein Haufen Zahlen, die Tom nicht das Geringste sagten. »Ich fürchte, ich muss Ihnen sagen, dass uns die Optionen ausgehen.«
Einen Moment lang war es sehr still im Raum. Tom konnte hören, wie unten auf dem Parkplatz eine Autotür zugeschlagen wurde. Gleich darauf sprang ein Motor an und ein Wagen fuhr davon.
»Das bedeutet?«, brachte endlich Isabelle die Frage über die Lippen, die auch in Toms Hinterkopf hämmerte.
Heinemann sprach betont sachlich. »Das bedeutet, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass es ein pan-resistenter Pseudomonasstamm ist, unter dem Ihre Tochter leidet.«
»Pan-resistent?«, fragte Isabelle.
»Das ist ein Erreger, der gegenüber allen gängigen Antibiotika resistent ist. Wir sind so gut wie machtlos dagegen.« Sylvies Arzt senkte den Kopf und rieb sich die Stirn. Für einen kurzen Moment kam seine professionelle Maske ins Rutschen, und Tom konnte die tiefe Betroffenheit dahinter sehen.
Es berührte ihn, dass augenscheinlich selbst der Profi mitlitt, aber das Gefühl wurde sofort überlagert von der Sorge um Sylvie.
»Was bedeutet so gut wie?«, fragte Isabelle.
Tom glaubte, die Antwort bereits zu kennen. Es fühlte sich an, als würde etwas in seinem Inneren ins Rutschen geraten. Überbringen Sie mir hier gerade das Todesurteil meiner Tochter? Isabelle entzog ihm die Hand, dabei hätte er ihren Halt gerade jetzt gut brauchen können.
Heinemann fuhr sich über Mund und Kinn. »Es gibt vielleicht noch eine letzte Therapieoption. Dabei würden wir unterschiedliche Antibiotikagruppen kombinieren und intravenös verabreichen, in der Hoffnung, damit vielleicht noch irgendeine Wirkung zu erzielen. Infrage kommen dafür Tobramycin mit Ceftazidim oder Meropenem. Aber ich fürchte, die Therapie ist sehr langwierig, extrem schmerzhaft, und vor allem hat sie starke Nebenwirkungen.«
»Was könnte denn noch schlimmer sein als das, was meine Tochter schon durchgemacht hat?«, fragte Tom. Er brauchte dringend eine Zigarette. Er schob die Hand in die Tasche seiner Jeans und umklammerte das Einhorn-Feuerzeug. Der kleine Strassstein grub sich tief in seine Handfläche.
»Sie müssen mit sehr heftigen Nebenwirkungen rechnen: Nierenprobleme, allergische Reaktionen, Neurotoxizität bis hin zu Gleichgewichtsstörungen. Etwas, das ebenfalls auftreten kann, ist ein bleibender Tinnitus oder sogar der komplette Verlust der Gehörfunktion.«
Isabelle schluchzte auf.
Tom sah, wie ihre Hand in Zeitlupe zu ihrem Gesicht wanderte und sich auf ihren Mund presste. »Und wenn diese letzte Therapie auch nicht …« Seine Stimme versagte.
Heinemann blickte ihm geradeaus in die Augen. »Wenn auch diese letzte Medikamententherapie versagt, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir nichts mehr für Ihre Tochter tun können. Sie ist dann austherapiert.«
Tom wollte den Kopf schütteln, aber es ging nicht. Er hatte es doch kommen sehen, warum schockierte ihn diese Nachricht dann so sehr?
Isabelle ließ die Hand wieder sinken. »Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, Doktor Heinemann? Ich meine: Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, muss es doch andere Medikamente geben, um Sylvie …«
»Antibiotika sind in Deutschland nun mal die Standardtherapie, allerdings …« Heinemann zögerte. »Tatsächlich gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit, aber jede einzelne davon befindet sich noch im experimentellen Status. Antikörpertherapien oder Phagen zum Beispiel sind aktuell in Deutschland nicht zugelassen.«
Isabelle fuhr halb aus ihrem Stuhl hoch. »Das ist mir völlig egal! Es geht um meine Tochter! Diese … Phagen, von denen Sie gesprochen haben, was müssten wir tun …«
»Frau Morell!«, unterbrach Heinemann sie erneut. »Selbst wenn es Phagen gäbe, die Ihrer Tochter helfen würden, würden wir sie nie im Leben in dieses Land kriegen …« Er hielt kurz inne, weil Isabelle vehement den Kopf schüttelte, sprach dann aber weiter: »Ohnehin: Lassen Sie uns doch erst einmal abwarten, wie wir mit der intravenösen Kombitherapie vorankommen. Wenn sie wirkt, brauchen wir uns keine weiteren Gedanken zu machen.« Er wechselte einen langen Blick mit Tom, der davon Magenkrämpfe bekam.