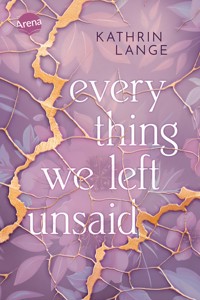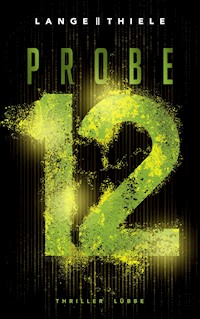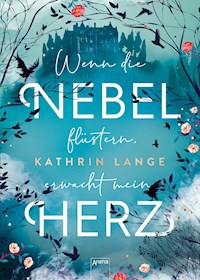Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rubikon Verlag e.K.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn eine jahrhundertealte Seuche aus der Arktis zurückkehrt?
Als in Berlin Obdachlose an Milzbrand sterben, ist Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg alarmiert. Die Fälle erinnern an ein Ereignis in Alaska vor 10 Jahren, als das Auftauen des Permafrostbodens einen tödlichen Erreger freisetzte. Ebenfalls in Alaska verschwindet Ninas Freund, der Milzbrand-Forscher Gereon Kirchner. Nina bittet ihren Bekannten Tom Morell, dorthin zu reisen und herauszufinden, was passiert ist. Schon kurz nach Toms Ankunft taucht in einem Eistunnel eine Frauenleiche auf. Ist Gereon schuld an ihrem Tod? Hat er gar mit dem qualvollen Tod der Obdachlosen in Berlin zu tun? Während Tom und Nina versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, müssen sie begreifen, dass sie gegen einen sehr viel mächtigeren Gegner kämpfen, als sie dachten ...
»Hoch spannend« STERN über PROBE 12
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinnenTitelImpressumWidmungZitatePrologZeitungsartikelHeute – Teil 1: Veränderung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. KapitelTeil 2: Kipppunkt1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. KapitelTeil 3: Kaskade1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. KapitelTeil 4: Transformation1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. KapitelNachwort (Vorsicht Spoiler!)Lesetipps zur Vertiefung des ThemasDanksagungÜber dieses Buch
Was, wenn eine jahrhundertealte Seuche aus der Arktis zurückkehrt? Als in Berlin Obdachlose an Milzbrand sterben, ist Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg alarmiert. Die Fälle erinnern an ein Ereignis in Alaska vor 10 Jahren, als das Auftauen des Permafrostbodens einen tödlichen Erreger freisetzte. Ebenfalls in Alaska verschwindet Ninas Freund, der Milzbrand-Forscher Gereon Kirchner. Nina bittet ihren Bekannten Tom Morell, dorthin zu reisen und herauszufinden, was passiert ist. Schon kurz nach Toms Ankunft taucht in einem Eistunnel eine Frauenleiche auf. Ist Gereon schuld an ihrem Tod? Hat er gar mit dem qualvollen Tod der Obdachlosen in Berlin zu tun? Während Tom und Nina versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, müssen sie begreifen, dass sie gegen einen sehr viel mächtigeren Gegner kämpfen, als sie dachten … »Hoch spannend« STERN über PROBE 12
Über die Autorinnen
Kathrin Lange wurde 1969 in Goslar am Harz geboren. Obwohl sie sich beruflich der Hundestaffel der Polizei anschließen wollte, siegte am Ende ihre Liebe zu Büchern, und sie wurde zuerst Buchhändlerin und dann Schriftstellerin. Heute ist sie Mitglied beim PEN und bei den International Thriller Writers und schreibt erfolgreich Romane für Erwachsene und Jugendliche. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen, wo sie sich für Leseförderung und die Integration von Geflüchteten engagiert.
Susanne Thiele – geb. 1970, Leiterin der Presse- und Kommunikationsstelle des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig. Die studierte Mikrobiologin und Biochemikerin hat für verschiedene Tageszeitungen und Journale geschrieben. Sie moderiert Expertendiskussionen und ist in der Medienszene hoch vernetzt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Türklinke – Wie Mikroben unseren Alltag bestimmen (2019 bei HEYNE) war ihr erstes Sachbuch zum Trendthema Mikrobiom und gute und schädliche Keime in unserem Alltag.
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Textredaktion: René Stein, Kusterdingen
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © Sashkin/shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4232-0
luebbe.de
lesejury.de
Wir widmen dieses Buch unseren Kindern und allen zukünftigen Generationen.
Denn die größte Torheit, die ein Mensch begehen kann,ist, wenn er mir nichts dir nichts durch Verzweiflungund Schwermut sein Ende herbeiführt.
Miguel de Cervantes
Silaup asijjipallianinga.
(Übersetzt: der sich schrittweise vollziehende Wetterwechsel. Wortneuschöpfung der Inuit.)
Prolog
Zehn Jahre zuvor. Arctic Village, Nordalaska
Mit einem Ruck fährt Joseph in die Höhe. Ist er eingeschlafen? Er hat sich doch so fest vorgenommen, nur für ein paar Minuten die Augen zu schließen und dann weiterzulernen. Wie spät ist es? Durch das winzige Fenster dringt graues Licht herein, aber daran lässt sich das hier oben im äußersten Norden selten sagen. Sie befinden sich oberhalb des Polarkreises. Um diese Jahreszeit ist es hier fast rund um die Uhr hell.
Er setzt sich hin, sieht sich in der engen Kammer um, in der seine ganze Familie schläft. Die Mutter liegt auf dem Rücken und schnarcht. Die Flasche mit dem billigen Bourbon, die sie am Nachmittag angebrochen hat, steht auf dem kleinen Kästchen neben ihrem Bett. Zwei Fingerbreit. Mehr ist nicht mehr drin.
Der Geruch des scharfen Whiskeys überlagert den von altem Schweiß und sauren Körperausdünstungen, den die Mutter verströmt. Sie muss etwas von dem Bourbon verschüttet haben. Joseph schnauft durch. Wenigstens riecht es ausnahmsweise einmal nicht nach Erbrochenem.
Er sieht auf die alte Küchenuhr, die über der Kammertür hängt und die noch der Vater gekauft hat. Halb fünf. Er hat mehr als zwei Stunden geschlafen. Noch mal, verdammt! Damit ist der Großteil seiner kostbaren freien Zeit, die ihm zum Lernen bleibt, verstrichen. In spätestens einer halben Stunde wird er anfangen müssen, das Abendessen zu kochen, wenn seine kleinen Geschwister nicht schon wieder hungrig ins Bett gehen sollen.
Das Schnarchen der Mutter setzt kurz aus. Ebenso kurz hofft er, sie würde aufwachen, würde auf magische Weise plötzlich nüchtern sein. Eine richtige Mutter. Eine, die sich kümmert. Die ihm über den Kopf streicht, ihn anlächelt und ihm sagt: »Ich bin stolz auf dich«, während sie sich an den Herd stellt und dafür sorgt, dass er und die Kleinen etwas zu essen bekommen. Der er beim Zubereiten des Karibufleisches zuschauen kann, während er seine Schulbücher vor sich liegen hat und versucht, diese komplizierten Rechnungen zu verstehen, die er brauchen wird, wenn er irgendwann wirklich einmal auf die Highschool gehen will.
Aber all das sind dumme Träume.
Die Mutter dreht sich mit einem Röcheln auf die andere Seite und schnarcht weiter.
Seufzend schwingt Joseph die Beine aus dem Bett. Der aus groben Bretterbuden bestehende Fußboden ist kalt unter seinen Fußsohlen, doch das macht ihm nichts aus. In der Baracke, die der Staat Alaska der Mutter, ihm und seinen drei Geschwistern nach dem Tod des Vaters ganz in der Nähe vom Khaali Lake zugeteilt hat, ist es immer kalt, aber wenigstens den eisigen Wind sperrt das feste Mauerwerk aus.
Seine Mutter röchelt im Schlaf.
Er verscheucht all diese rebellischen Gedanken. Sie erfüllen ihn nur mit dieser bleiernen Traurigkeit, vor der Großmutter ihn immer gewarnt hat. Diese Traurigkeit, die einem bis tief in die Knochen kriecht und jede Kraft und jedes Lachen raubt wie eine schwere Krankheit, gegen die es kein Mittel gibt. Er reckt sich, gähnt einmal und tritt an die Haustür, um nachzusehen, wo seine Geschwister sind. Die Kleinen spielen abends meistens mit den anderen Kindern der Barackensiedlung am Hang hinter den Häusern. Er kann ihr Gekreische und ihr Gelächter hören.
Die Sonne scheint, und die Luft ist sommerlich warm. Es riecht nach Holzfeuern und dem Duft des blühenden Landes.
Alles ist gut.
Er tritt aus dem Haus, zieht sorgfältig die Tür hinter sich zu und geht um die Ecke zu dem in den Boden eingelassenen Eiskeller, in dem alle Familien der Siedlung ihr Fleisch und andere Lebensmittel lagern. Er hält inne, bevor er den Verschlag erreicht. Bei den Kleinen scheint irgendwas passiert zu sein. Aus dem fröhlichen Gelächter und Gekreische sind Schreie geworden.
Ihm gefriert das Herz. Er macht auf dem Absatz kehrt und rennt in die Richtung, aus der das Schreien kommt.
Er sieht schon, was passiert ist, als er um die letzte Baracke der Reihe kommt. Der Hang dahinter, eine lang abfallende Flanke aus blanker Erde und Eis, ist ins Rutschen gekommen. Auf einer Breite von fünf großen Männerschritten klafft eine Lücke, wo zuvor irgendwelche Pflanzen gewachsen sind. Die Erde hat sich in eine Schlammlawine verwandelt und ist bis an die Wand der letzten Baracke gerutscht.
»Seid ihr in Ordnung?«, schreit Joseph schon von Weitem. Im Laufen zählt er die Kinder durch, sucht nach seinen Geschwistern. Alice. Die Kleinste. Sie steht da und starrt mit großen Augen auf den Erdrutsch. Ihr Teddy, wie die Küchenuhr im Schlafzimmer ein Mitbringsel vom Vater, baumelt in ihrer rechten Hand, den Daumen der linken hat sie in den Mund gesteckt und saugt aufgeregt daran herum.
Grace. Die Zweitkleinste steht ebenso verblüfft neben ihrer kleinen Schwester.
Er atmet erleichtert auf. Die Mädchen sind in Sicherheit. Sie liegen nicht unter dem Berg aus schwerer, nasser Erde und ersticken an dem Schlamm, der ihnen in Mund und Nase dringt.
Aber wo ist Adam?
Joseph bleibt bei den beiden Mädchen stehen. »Wo ist euer Bruder?«, herrscht er sie an.
Alice hebt den Blick zu ihm auf. Tränen treten ihr in die Augen, aber bevor er ihr sagen kann, dass er es nicht so gemeint hat, sind auch mehrere andere Leute da. Erwachsene.
»Ist wer verschüttet worden?«, schreit Edward, ein Nachbar von ihnen, der sie manchmal besuchen kommt, wenn ihre Mutter nüchtern ist. Joseph und die Kleinen müssen dann jedes Mal die Hütte verlassen, bis Edward nach einer Weile wieder ins Freie tritt und sich dabei den Gürtel zumacht. Edward ist ein Bär von einem Mann, seine Stimme laut und dröhnend.
»Grace, ist da jemand drunter?«, fährt er Josephs Schwester an.
»Adam fehlt«, hört Joseph sich selbst sagen. Edward wird dafür sorgen, dass alles gut wird, denkt er.
Edwards Sohn Michael ist ebenfalls da. Er will seinem Vater helfen, doch der blafft ihn an: »Bleib, wo du bist!«
Etwas ratlos und beleidigt bleibt Michael stehen. Er ist ein paar Jahre älter als Joseph, und Joseph bewundert ihn, weil er so klug ist. Der wird später auf jeden Fall aufs College gehen, davon ist Joseph fest überzeugt. Jetzt aber fällt erst mal Edward auf die Knie und gräbt mit bloßen Händen in dem schwarzen, nach Fäulnis riechenden Boden.
Joseph will es ihm gleichtun, aber Michael hält ihn am Arm fest.
»Nein!«, sagt er, und Joseph gehorcht. Die Angst um seinen kleinen Bruder hat ihn fest im Griff, lässt seine Füße am Boden kleben. Zum Glück kommen jetzt nach und nach andere Erwachsene. Das halbe Dorf ist da, um zu helfen. Jemand bringt eine Schaufel.
»Los!«, schreit ein anderer. »Schneller!«
Sie graben und schaufeln wie die Verrückten. Das Herz schlägt Joseph bis zum Hals. Bitte nicht!, kreischt es wieder und wieder in seinem Kopf. Nicht Adam! Nicht mein Bruder!
»Sie werden sie retten.« Das Walross steht plötzlich neben ihm, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie tastet nach Josephs Hand, und er weiß, sie will ihn trösten und ihm Mut machen. Trotzdem entzieht er sich ihr. Ihre Hände sind unangenehm weich und andauernd feucht, und er ekelt sich davor. Es ekelt ihn auch, dass diese fette Tusse ihm ständig schöne Augen macht, obwohl sie schon siebzehn ist und er erst fünfzehn. Von den älteren Jungs im Dorf interessiert sich niemand für sie, was kein Wunder ist, denn sie ist nicht nur zu fett, sondern dazu auch noch unscheinbar. Und weil sie das weiß, redet und lacht sie ständig zu laut. Darüber hinaus ist sie unfreundlich. Und dick. Joseph kennt kaum jemanden, dessen Gegenwart ihm mehr auf die Nerven geht als die von diesem Mädchen.
»Alles wird gut werden«, hört er sie sagen. »Du wirst sehen!«
Er nickt nur und rückt noch ein Stück von ihr ab.
»Da ist was!«
Edwards Ruf erscheint ihm wie ein Sonnenstrahl, der durch das Dunkel aus Verzweiflung und Panik stößt. Ein Arm kommt zum Vorschein, bedeckt von dem schwarzen, stinkenden Schlamm sieht die Hand schneeweiß aus. Joseph erkennt das aus Tiersehnen geflochtene Band um das Handgelenk.
»Das ist Adam!«, schreit er und will sich auf seinen Bruder stürzen.
Doch Michael hält ihn erneut fest. »Alles wird gut!«, sagt er leise, und das Walross nickt beflissen.
»Hab ich ihm auch schon gesagt.«
»Wir haben ihn!« Edward und ein anderer Mann zerren den kleinen Körper aus der dunklen Erde. Josephs Herz setzt aus, als er das Gesicht seines Bruders sieht, das über und über mit Schlamm bedeckt ist und wirkt wie das eines Erdgeistes.
»Er bekommt keine Luft!« Edward säubert mit raschen Griffen Mund und Nase des Jungen. »Bringt mir Wasser!«, schreit er. »Schnell!«
Und bevor Joseph sich rühren kann, ist da ein Eimer. Edward nimmt ihn, schüttet die Hälfte des Wassers über Adams Kopf. Er schlägt Adam auf den Rücken, wischt wieder über seine Nase, pult mit den Fingern Schlamm und halb verfaulte Pflanzenreste aus seinem Mund.
Und dann – es fühlt sich an, als sei ein ganzes Jahr verstrichen – hustet Adam. Weiterer Schlamm sprudelt ihm aus Mund und Nase, aber er holt japsend Luft, würgt, hustet erneut.
»Er lebt!« Joseph weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist wahr. Adam lebt. Es geht ihm gut.
Vor lauter Erleichterung sinkt er selbst auf alle viere nieder. Keucht.
»Heilige Mutter Gottes!«, stößt eine Frau hervor. »Sind das Knochen?«
Sie deutet genau in die Mitte der Stelle, wo die Erde ins Rutschen gekommen ist. Und sie hat recht: Dort, wo noch vor wenigen Minuten Permafrostboden gewesen ist, ragen dunkle Stöcke hervor, die sich beim zweiten Blick als Rippen herausstellen.
Ein Stück weiter links liegt ein Schädel.
»Die sind von Karibus«, sagt das Walross, und Joseph nickt. Er kennt die typische Form dieser Schädel nur zu gut.
»Die müssen Jahrzehnte hier in der Erde gelegen haben«, murmelt Edward. Er bückt sich, hebt einen Brocken auf, wischt ihn sauber. Es ist ein Wirbel, denkt Joseph, und dann sieht er, dass der halbe Hang mit Knochensplittern und Schädelteilen durchsetzt scheint.
Aus einem Artikel der Fairbanks Tribune
Hitze in Alaska fordert neue Milzbrand-OpferWann gibt es endlich Entwarnung in Arctic Village – Opferzahl steigt auf 14
Arctic Village: Die sommerlichen Temperaturen von bis zu 35 Grad haben in Arctic Village zu einem Erdrutsch geführt und dabei gefährliche Milzbrandbakterien freigesetzt, die in alten Gebeinen von Karibus überdauerten. Die Zahl der Opfer, die sich bei dem Unglück mit dem Erreger infizierten, stieg jetzt auf 14 Personen. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC ist vor Ort, um die nötigen Maßnahmen zu treffen.
Wie unsere Zeitung berichtete, kam es Anfang August nahe Arctic Village, in einer indigenen Siedlung südlich der Yukon-Koyokuk Census Area, Alaskas bekanntem Naturschutzgebiet, durch das Auftauen des Permafrostbodens zu einem Hangabrutsch größeren Ausmaßes. Ein Kind wurde verschüttet, jedoch durch das schnelle Eingreifen der Dorfbewohner vorerst gerettet. Erst nach der Rettungsaktion wurde das Ausmaß der eigentlichen Katastrophe sichtbar: In dem Abbruchhang befanden sich Knochen von Karibus, die mit Milzbrand Bacillus anthracis – kurz Anthrax – verseucht waren. Innerhalb weniger Stunden erkrankten zuerst die verschütteten Kinder und kurz danach auch alle Helfer. Mittlerweile sind vierzehn Menschen von den siebzehn Erkrankten, bei denen das CDC den Erreger nachweisen konnte, verstorben. Drei der Infizierten schweben aktuell nach wie vor in Lebensgefahr, wie die Familien unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilten.
»Wir haben es hier mit einem sehr aggressiven Milzbranderreger zu tun, der ein tödliches Toxin im Körper bildet«, sagt Dr. John Ramirez von der US-Seuchenschutzbehörde CDC. »Die Opfer haben sich durch den direkten Kontakt über die Haut und die Schleimhäute infiziert.« Die Experten gehen davon aus, dass die Karibus bei einer Ende des 19. Jahrhunderts in Alaska grassierenden Milzbrand-Seuche verendet sind und von damaligen Einwohnern nachlässig vergraben wurden. »Nur so erklärt es sich, warum die Knochen durch den Erdrutsch wieder ans Tageslicht kamen, und mit ihnen der Erreger«, sagte der Experte.
Auf die Nachfrage, ob eine Gefahr für die Menschen in der Region bestünde, erklärte Ramirez, dass weitreichende Maßnahmen unternommen würden, um einen noch größeren Ausbruch der Seuche zu verhindern. Das Gebiet um Arctic Village wurde weiträumig abgeriegelt. Allerdings hätten einige Bewohner das Dorf mittlerweile verlassen. Eine mobile Tierkadaververbrennungsanlage beseitige sowohl die freigelegten Knochen als auch einige zahme Tiere der Dorfbewohner, die sich angesteckt hatten.
»Wir haben den Fall jetzt unter Kontrolle«, informierte Dr. John Ramirez. »Das ist aber nicht der erste Fall. 2016 gab der Permafrost in Sibirien ebenfalls mit Anthrax verseuchte Rentierkadaver frei, woraufhin ein Junge an Milzbrand verstarb. Durch das stetige Auftauen des gefrorenen Bodens durch den Klimawandel müssen wir in Zukunft vermehrt mit solchen Zwischenfällen rechnen und gut vorbereitet sein.«
Heute
Teil 1: Veränderung
1. Kapitel
Gereon Kirchner verfluchte die Helligkeit des endlosen Polartages, weil sie ihm den Schlaf raubte. In diesen Breitengraden sank die Sonne auch nachts nicht tiefer als sechs Grad unter den Horizont. Was bedeutete: Es war jetzt, gegen vier Uhr morgens, immer noch hell genug, um im Freien ohne Lampe eine Zeitung zu lesen. Oder eine schmale, schlaglochübersäte Schotterstraße entlangzufahren, die ihn zum Permafrost-Camp führte.
Seinem Ziel.
Die Straße machte einen Bogen und führte danach an einem übermannshohen Maschendrahtzaun entlang, bis sie auf einen Parkplatz mündete. An dessen Ende befanden sich ein Tor und ein Wachhäuschen, das tagsüber als Kassenhäuschen für Touristen diente, die das Camp besichtigen wollten. Gereon fuhr bis vor das Tor.
»Hey, Paul!«, begrüßte er den Wachmann.
»Dr. Kirchner.« Paul Wilson streckte den Kopf aus dem Fenster des Häuschens. »Was machen Sie denn zu so unchristlicher Zeit hier?«
Gereon lächelte den Mann an. »Konnte nicht schlafen, da dachte ich mir, ich kann mich genauso gut um meine Arbeit kümmern.«
Paul schien das nicht zu wundern. Die Jungs vom US Army Corps of Engineers, die das Wachpersonal des Camps stellten, waren es gewohnt, mit Wissenschaftlern zu tun zu haben, die manchmal mitten in der Nacht auf irgendeine Idee kamen und diese dann sofort überprüfen mussten. »Ja«, erwiderte er. »Geht vielen so, wenn sie hier hochkommen. Die Mitternachtssonne, oder?«
»Genau.«
»Gerade ist noch eine andere Wissenschaftlerin aus Deutschland hier«, sagte Paul. »Der geht es ähnlich wie Ihnen. Sie kam eine Weile fast nur nachts zum Arbeiten. Sagt, das liegt am Jetlag.« Er grinste.
Gereon nickte. Den Jetlag spürte er selbst noch in allen Knochen.
»Wie es scheint, hat sie sich aber mittlerweile an unsere Zeitzone gewöhnt«, plauderte Paul fröhlich weiter. »Seit Sie hier sind, ist sie nachts nicht mehr aufgetaucht.«
»Vielleicht geht sie mir ja aus dem Weg«, meinte Gereon scherzhaft. Dann wies er auf das Tor und bedeutete dem Wachmann damit, dass er gern mit seinem Wagen auf das Gelände fahren würde.
»Moment!« Pauls Kopf verschwand, gleich darauf glitt das Tor auf metallenen Rollen knirschend zur Seite.
»Danke!«, rief Gereon, dann fuhr er an, rollte auf das Gelände und fuhr eine weitere Schotterpiste entlang bis zum Besucherzentrum.
Wie diese unbekannte deutsche Forscherin vermutlich auch, war er als Gastwissenschaftler hier.
Das Camp, das sogenannte Permafrosttunnel-Projekt, gehörte zu einer groß angelegten Forschungsinitiative der US-Army, die seit den 1960er-Jahren existierte und in den vergangenen sieben oder acht Jahren – seitdem die Warnungen des Weltklimarates von Jahr zu Jahr immer drängender und alarmierender geworden waren – von mehr und mehr Klimaforschern aus aller Welt besucht wurde. Hier wurden wichtige Forschungen darüber angestellt, wie das Auftauen des Permafrostes mit der menschengemachten Erderwärmung zusammenhing und, wichtiger noch, was für Auswirkungen es auf die weitere Erderwärmung haben würde. Gereon kannte sich mit den genauen Betätigungsfeldern der anderen Wissenschaftler nicht aus, aber immerhin wusste er, dass der Permafrost, also gut jenes Viertel der Nordhalbkugel, dessen Boden das ganze Jahr über gefroren war, überaus sensibel auf die globale Erderwärmung reagierte. Eine der Wissenschaftlerinnen, mit der er sich erst neulich kurz unterhalten hatte, hatte ihm erklärt, dass es extrem wichtig war, diese Region hier sorgfältig zu überwachen und kleinste Veränderungen zu dokumentieren. Es ging dabei um Kippelemente des Klimas, lauter wichtiges, aber in seinen Augen auch höchst kompliziertes Zeug.
Ihn selbst interessierte viel eher die andere Funktion, die das Camp noch hatte. Hier wurden nämlich auch regelmäßig mikrobiologische Proben genommen und erforscht, um damit Ausbrüchen von Seuchen zuvorkommen zu können, die möglicherweise weltweite Auswirkungen zeigen konnten. Er selbst war wegen solcher mikrobiologischer Proben hier.
Er parkte vor dem Besucherzentrum, das sich in einem dieser typischen amerikanischen Blockhäuser befand. Mit von der Fahrt steifen Gliedern stieg er aus und blickte am Besucherzentrum vorbei auf eine Art Verschlag aus rotem Holz, der aussah wie ein Gartenschuppen. Es war jedoch alles andere als das. Hinter der niedrigen Tür des »Schuppens« befand sich nämlich der Eingang zu einem mehrere hundert Meter langen Tunnelsystem, das man in das ewige Eis getrieben hatte. Es war gespickt mit Forschungsapparaten und Messinstrumenten von Geologen, Mikrobiologen und Klimaforschern aus aller Welt.
Er nahm sein Handy aus der Tasche und tippte eine rasche Nachricht an seinen Geschäftspartner Mike.
Ich hole jetzt die Proben. Alles wird gut werden!
Als die beiden Häkchen des Messengers blau wurden, wusste er, dass Mike die Nachricht gelesen hatte. Er wartete trotzdem, bis eine Antwort einging. Es war nur ein einzelner hochgereckter Daumen.
Gereon grinste, aber das Grinsen erlosch, als er sah, dass seine Akkuanzeige auf zwanzig Prozent stand. Er musste sich wirklich langsam einmal ein neues Handy zulegen. Mike lachte ihn schon aus, weil er die Entscheidung aus Nachhaltigkeitsgründen wieder und wieder rauszögerte.
»Ressourcensparen ist ja cool«, hatte Mike erst vor ein paar Wochen zu Gereon gesagt. »Aber wenn der Geschäftsführer einer wichtigen Medizinfirma nicht erreichbar ist, weil sein Akku leer ist, kann uns das sehr schnell sehr viel Geld kosten.«
Womit er vermutlich recht hatte. Mit einem Seufzen steckte Gereon das Handy weg, öffnete den Kofferraum, hob einen Koffer heraus und trug ihn zum Tunneleingang. Dort nestelte er einen Schlüssel aus der Tasche und schloss die Tür auf. Das System bestand aus insgesamt drei Tunneln, von denen der Hauptgang waagerecht in den Berg hineinführte und hoch genug war, dass ein Mann aufrecht darin stehen konnte. Der Boden, die Wände und auch die Decke über Gereons Kopf bestanden aus Permafrost – gefrorener Erde, vermengt mit Pflanzenteilen, Wurzeln, Gräsern und ab und an dem Knochen irgendeines Tieres. Ungefähr nach zwanzig Metern zweigte rechts ein Tunnel ab, und dieser führte schräg nach unten durch die Schichten der Erdzeitalter in die Vergangenheit.
Das Innere des Tunnels empfing ihn mit Dunkelheit und Kälte und mit dem schwachen Geruch von verrottendem Pflanzenmaterial. Gereon ließ die Tür hinter sich zufallen. Für eine Sekunde stand er in dumpfer Finsternis, bevor seine Finger den Schalter fanden und er die Tunnelbeleuchtung anschaltete. In fahlem, bläulichem Licht der LEDs lag eine Kälteschleuse vor ihm, die man aus dicken, undurchsichtigen Plastikfolien errichtet hatte. Dahinter erstreckte sich ein schier endlos wirkender Gang durch das Eis, in dessen Innerem es konstant minus ein Grad Celsius kalt war. Die Forschenden taten alles, damit das auch so blieb: Jeder, der hier hereinwollte, musste durch die Schleuse, die die Wärme draußen hielt. Allerdings bewies der leichte Verwesungsgeruch, dass die Bemühungen nicht zu hundert Prozent erfolgreich waren. Das Eis taute an der Oberfläche der Tunnelgänge, dadurch wurden Jahrhunderte lang eingeschlossene Pflanzenbestandteile und Tierkadaver freigelegt, die nun zu verrotten und zu verwesen begannen.
Ab und an war das leise Plopp eines fallenden Wassertropfens zu hören.
Gereon rang die Beklemmung nieder, die ihn jedes Mal überfiel, wenn er hier herunterkam.
Er ging an der ersten Abzweigung vorbei, bis er zu einer zweiten kam. Auch hier führte ein Tunnel nach rechts vom Haupttunnel weg. Dieser zweite Tunnel allerdings wies leicht aufwärts und war erst vor wenigen Monaten gegraben worden. Und noch etwas war anders. Dieser Tunnel hier war verschlossen mit einer provisorischen, aber sehr effektiven Sicherheitsschleuse aus Plastik, an der auf Augenhöhe ein Biohazard-Schild angebracht war. Dahinter lag Gereons Ziel.
Kadaver.
Überreste von vor vielen Jahren verendeten Karibus.
Und für Gereon der wertvollste Schatz der Erde. Er betrat die Schleuse, nahm seinen biologischen Schutzanzug vom Haken und schlüpfte hinein. Anschließend setzte er die Respiratorhaube auf, die über einen Schlauch in einen Luftfilter an seinem Gürtel mündete. Einweghandschuhe vervollständigten sein Sicherheitsoutfit, dann erst verließ er die Schleuse auf der anderen Seite und näherte sich den Kadavern. Bevor er sich ihnen jedoch zuwenden konnte, stutzte er. Direkt neben den Knochen standen zwei große Säcke, die bei seinem letzten Besuch noch nicht hier gewesen waren. Im blauen Licht der Tunnelbeleuchtung war ihre Aufschrift zwar gut zu lesen, aber sie ergab in Gereons Augen nicht den geringsten Sinn.
Aluminiumpulver.
Wozu schaffte jemand mehr als zwei Zentner Aluminiumpulver hierher in den Gang? Ihm wollte partout kein Versuchsaufbau einfallen, der das nötig gemacht hätte, aber das war auch egal. Hier unten arbeiteten zurzeit mindestens sechs verschiedene Teams mit wechselnden Leuten aus aller Welt, und in den meisten Fällen wusste ein Team nicht allzu genau, was die anderen machten. Oft interessierten sie sich auch nicht besonders dafür, weil sie mit ihren Gedanken viel zu sehr in ihre eigene Forschung vertieft waren.
Die Leute, die das Alupulver hier deponiert hatten, würden schon wissen, was sie taten. Achselzuckend wandte Gereon sich den halb verwesten Kadavern zu. Im Licht der LED-Lampen wirkten sie wie immer ein wenig gruselig auf ihn: Da waren dunkel verfärbte Rippenbögen, die aus schwarzem Muskelfleisch ragten, struppiges Fell, das sich kaum von der umgebenden Erde abhob, außerdem Kieferknochen mit dem Gebiss von Pflanzenfressern, Wirbel. Hufe. All das war der Grund, weswegen er vorgestern von Berlin aus erst nach Anchorage und dann mit einem kleineren Flieger nach Fairbanks gekommen war. Die Kadaver gehörten zu einer Karibuherde, die vor mehr als hundert Jahren friedlich im Grasland geweidet hatte, bis eine heimtückische Seuche sie dahingerafft und die geologischen Veränderungen des Kontinents sie mit Erdmassen verschüttet hatten. Nun waren sie zufällig wieder aufgetaucht, als die Geologen diesen weiteren Tunnel ins ewige Eis getrieben hatten. Und wie zur Mahnung trugen sie immer noch die Erinnerung daran in sich, was ihnen den Garaus gemacht hatte: Anthrax.
Was sie genau zu dem machte, weswegen Gereon hier war.
In wenigen Tagen würde er zurück nach Deutschland reisen, sein Flug war gebucht und alle nötigen Formulare, die es brauchte, um die Proben, die er aus den Kadavern extrahiert hatte, nach Hause zu schaffen, waren ausgefüllt und genehmigt worden.
Er atmete durch. Wenn er nur erst in diesem Flieger saß, dann hätte er auch das letzte Hindernis auf dem langen und steinigen Weg zum Erfolg überwunden. Dann würde er endlich die wichtigste Arbeit seines Lebens zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und die Welt mit einer neuartigen Krebstherapie beschenken, die er aus diesem besonderen Anthraxstamm entwickeln würde. Einen Paradigmenwechsel im Kampf gegen diese elende Krankheit würde er einleiten … Ein verträumtes Lächeln hob seine Mundwinkel, doch dann riss er sich zusammen.
Das alles lag im Moment noch in der Zukunft. Hier und jetzt musste er sich erst mal auf seine Arbeit konzentrieren.
Fast ein bisschen wehmütig wandte er sich von den Knochen ab und ging ein paar Schritte tiefer in den Tunnel hinein, der an dieser Stelle eine Biegung machte. Hinter der Kurve hatten die anderen Mikrobiologen, die wie er an den Kadavern forschten, einen kleinen mobilen Sicherheitskühlschrank installiert, in dem sie ihre sensiblen Proben aufbewahrten. Dort lagerte Gereon auch seine eigenen – Gewebe von den Karibus, sorgsam gefriergetrocknet und verpackt in ungefähr fingerdicke Probenfläschchen aus transparentem Sicherheitsglas. Er lächelte bei dem Gedanken daran. Eigentlich hatte er vorgehabt, morgen Vormittag hierherzukommen und diese Proben für den Transport via Flugzeug vorzubereiten. Aber da diese elende Mitternachtssonne ihm den Schlaf raubte, konnte er das genauso gut auch jetzt gleich machen.
Er stellte den Koffer neben seinen Füßen ab, streckte die Hand nach dem Kühlschrank aus, öffnete ihn. Seine Proben befanden sich im untersten Fach in einem Metallständer, der mit seinem Namen und dem seiner Firma – Janus Therapeutics – beschriftet war. Zwei Röhrchen, die die Welt verändern würden, weil er mit ihrem Inhalt viele Krebsarten behandelbar machte, die bisher kaum zu heilen waren.
Gereon holte den Ständer aus dem Kühlschrank, entnahm ihm eines der Röhrchen und hielt es gegen das Licht. Die dunkelbraunen Gewebeproben darin ähnelten mit ihrer krümeligen Form grob gemahlenem hellbraunem Kaffeepulver.
»Hallo, Schätzchen«, murmelte Gereon. Dann bückte er sich, entnahm dem Koffer eine dieser türkisfarbenen Sicherheitstransportboxen, die er für Janus Therapeutics hatte entwickeln lassen und die er eigens für diesen Zweck mitgebracht hatte. Sie enthielt vier identische Glasröhrchen, die allerdings alle leer waren. Gereon nahm zwei davon heraus, steckte sie in den Metallständer und schob stattdessen seine beiden Probenröhrchen in die Halterungen. Dann verschloss er die Transportbox und versiegelte sie. Er dekontaminierte sie außen mit verdünnter Bleiche, und während die vorgeschriebene Viertelstunde verging, bis die Lösung wirkte, ließ er seinen Blick interessehalber über den Inhalt des Kühlschranks wandern. Da waren verschiedenste Bodenproben, Knochenreste, Gewebe und Blut gelagert. Bei all diesen Gefäßen, Reagenzgläsern und Petrischalen fiel sein Blick schließlich noch auf etwas anderes. Ganz unten, im untersten Fach und bis an die Rückwand des Kühlschranks geschoben, stand ein türkisfarbenes Probentransportkästchen, wie das, das er eben dekontaminierte.
Weil es genauso aussah wie sein eigenes, erregte es Gereons Neugier, und er tat, was eigentlich ein No-Go war: Er nahm das Kästchen heraus und klappte es auf.
Und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen.
Bevor sein Verstand so richtig begriffen hatte, was er da sah, ertönten hinter ihm Schritte. Erstaunt darüber, dass außer ihm um diese nächtliche Uhrzeit noch jemand hier herunterkam, und mit einem Anflug von schlechtem Gewissen, weil er fremde Forschungsarbeit angefasst hatte, wandte er sich um. Eine Gestalt, die wie er einen Schutzanzug trug, steuerte auf ihn zu. Ganz kurz kam ihm die Situation unwirklich vor, und im ersten Moment hätte er nicht zu sagen vermocht, woran das lag.
»Hallo, Gereon«, sagte die Gestalt, und da erst erkannte Gereon, wer unter dem Anzug steckte.
»Was machst du denn hier?«, keuchte er.
2. Kapitel
Nina Falkenberg stand mit einem Kaffee in der einen Hand auf dem Balkon ihrer kleinen Wohnung in Pankow, blickte auf die Straße hinunter und versuchte, mit der anderen Hand eine aufdringliche Mücke zu vertreiben, die es auf ihren Hals abgesehen hatte. Eigentlich hätte sie einen längeren Artikel über die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise wenigstens halb fertig haben sollen, aber sie konnte sich nicht konzentrieren. Was auch daran lag, dass die Hitze, die seit fast zwei Wochen auf der Hauptstadt hockte wie eine Henne auf ihren Eiern, die Temperaturen in ihrer kleinen Wohnung auf weit über achtundzwanzig Grad hatte steigen lassen. Der Hauptgrund allerdings, warum Ninas Gedanken wieder und wieder abschweiften, war ihr aktueller Freund Gereon. Seit ein paar Tagen war er in Alaska, hatte sich aber bisher noch kein einziges Mal gemeldet, obwohl sie verabredet hatten, einander einmal am Tag wenigstens eine kurze Nachricht zu schreiben. Auf Ninas letzte SMS – Alles okay bei dir? – war keine Reaktion erfolgt, und die tiefe Unruhe, die sein Schweigen in ihr verursachte, überraschte sie. Gewöhnlich war sie nämlich keine Frau, die ihren Partner gängelte oder von ihm verlangte, ihr jederzeit Rechenschaft darüber abzulegen, wo er sich gerade befand und was er tat. Darüber hinaus waren Gereon und sie noch nicht allzu lange zusammen, und Nina war sich ihrer Gefühle für ihn nicht zu hundert Prozent sicher. Sie hatte Gereon nach einer kurzen, aber extrem intensiven Episode mit einem anderen Mann kennengelernt. Allerdings – und das mochte durchaus der Grund für ihre Unruhe sein – war Gereon ziemlich überraschend und auch ein wenig überhastet nach Alaska aufgebrochen. Es ginge um Janus Therapeutics, hatte er ihr nur gesagt.
Janus Therapeutics. Das war der Name von Gereons Medizin-Start-up. Gereon hatte es gegründet, nachdem er vor zehn Jahren Teil eines internationalen Spezialistenteams gewesen war, das bei einem verheerenden Milzbrandausbruch im Norden von Alaska, in einem kleinen Ort namens Arctic Village, zurate gezogen worden war. Nachdem der tauende Permafrost dort mehrere mit Milzbrand verseuchte Karibukadaver freigegeben hatte, hatte der Erreger fast zwanzig Menschen das Leben gekostet. Für Gereon jedoch hatte sich die Katastrophe als Segen herausgestellt – und vielleicht würde es das auch bald für die ganze Welt sein. Denn ihm und seinen Leuten war es gelungen, aus dem gefährlichen Gift des Milzbrandbakteriums ein hochinnovatives Krebsmedikament zu entwickeln, eine neue Art der Behandlung, die in der Krebsmedizin geradezu euphorisch aufgenommen worden war. Unter dem Namen JanuThrax befand sich dieses Medikament gerade im Zulassungsverfahren für den Einsatz am Menschen, und die Ergebnisse aus der klinischen Studie Phase I waren so überzeugend, dass Gereon sich berechtigte Hoffnungen auf den ganz großen Coup machen konnte, Medizinnobelpreis und unfassbarer finanzieller Erfolg rückten näher.
Auf dem Flughafen war nicht genug Zeit gewesen, um ihr zu erklären, was ihn mitten in diesen wichtigen Studien nach Alaska führte, aber ein paar Tage darauf hatte Gereon länger mit Nina telefoniert und ihr gesagt, worum es bei seiner Reise ging. Seinen Worten zufolge hatte man im Permafrost von Alaska hundert Jahre alte Karibukadaver gefunden. Offenbar betrieb die US-Army in der Nähe von Fairbanks ein Forschungsprojekt, in dem es um Klima- und Medizinforschung ging, und als man dort einen neuen Tunnel ins Eis gebohrt hatte, hatte man Teile einer Karibuherde freigelegt, die sich nach all den Jahren noch in ziemlich gutem Zustand befand. Ein ganzes mikrobiologisches Team war inzwischen hektisch dabei, die Erreger in diesen Kadavern zu sichern, und Gereon hatte für Janus Therapeutics eine Chance gesehen, sich weitere interessante Bakterien und gegebenenfalls auch Viren für seine Forschung zu sichern.
Natürlich war das eine überaus wichtige und zukunftssichernde Sache, und trotzdem ärgerte Nina sich ein wenig darüber, dass er sie dafür so völlig ignorierte. Auch wenn sie natürlich Verständnis dafür hatte, dass seine ganze Konzentration seiner Arbeit galt. Sie war immerhin selbst Mikrobiologin, sie verstand ihn nicht nur, sie fühlte auch mit ihm.
Trotzdem könntest du dich wenigstens kurz mal melden, dachte sie seufzend, strich sich durch die kurzen Haare und schaffte es endlich, die Mücke zu erschlagen, die es auf sie abgesehen hatte. Routinemäßig betrachtete sie sie, um festzustellen, ob es sich bei ihr um eine sogenannte Tigermücke handelte, eine invasive Art, die Krankheiten wie das gefährliche Dengue-Fieber übertragen konnte und vor einiger Zeit auch in Berlin aufgetaucht war. Bei ihrem Quälgeist handelte es sich jedoch um eine normale Stechmücke, was Nina die Pflicht abnahm, das Tier zu melden. Sie trank einen weiteren Schluck Kaffee und betrachtete die Fassade der Bierklause, der Kneipe, die gegenüber auf der anderen Straßenseite lag. Ganz kurz flackerte eine Erinnerung in ihrem Kopf auf. Dieselbe Fassade der Kneipe, aber die Straße davor nicht trocken und sonnendurchglüht, wie gerade, sondern in einen reißenden Fluss verwandelt, dessen braun-trübes Wasser bis auf Hüfthöhe an die Häuser schwappte und die Keller flutete. Ein roter Kleinwagen, der von der Flut mitgerissen wurde, am Steuer ein Mann mit vor Entsetzen geweitetn Augen und auf der Rückbank ein Kind, das beide Hände flach an die Scheibe gepresst hatte …
Sie blinzelte das Bild fort. Die Überschwemmung, die Pankow völlig unerwartet getroffen hatte, lag jetzt vier Wochen zurück, und trotzdem quälten die Bilder Nina noch manchmal.
Vor den Fluten war es erst wochenlang extrem trocken gewesen, sodass der Boden sowohl in Berlin als auch im umgebenden Brandenburg das viele Wasser des darauffolgenden Starkregens nicht mehr aufnehmen konnte. In der Folge war nicht nur die Panke über die Ufer getreten, sondern das Wasser war aus allen Abwasser- und Gullydeckeln regelrecht in die Höhe geschossen. Ein paar Tage später, nachdem das Wasser wieder abgeflossen war und die Menschen sich an die Aufräumarbeiten machten, hatte Nina erfahren, dass in ihrer Straße eine alte Frau und ihre dreijährige Enkeltochter in einem Keller von der Flut überrascht worden und ertrunken waren. Auch von diesen beiden träumte sie seitdem manchmal nachts, genauso wie von dem Kind auf dem Rücksitz des roten Wagens.
Sie vertrieb die Erinnerung dadurch, dass sie den Blick auf die Bierklause richtete. Früher war der Laden rund um die Uhr geöffnet gewesen, aber seit der Überschwemmung hatte er geschlossen. Die eigentlich hellgraue Fassade der Kneipe hatte ungefähr bis Hüfthöhe eine schmutzig beigebraune Färbung angenommen. Die Fenster, die den Wassermassen nicht standgehalten hatten, waren vernagelt. Sprayer hatten die Sperrholzplatten mit bunten Tags versehen, was den Anblick auf Nina noch trostloser wirken ließ. Jemand hatte quer über die Tags ein DIN-A3-großes Plakat gekleistert, das in Giftgrün auf schwarzem Grund verkündete:
Stoppt endlich unsere toxische Beziehung zur Natur!
Das Plakat war eines von mehreren, die mit unterschiedlichen Sprüchen, aber immer der gleichen giftgrünen Schrift vergeblich versuchte, die Menschen aufzurütteln. Gerade gestern hatte Nina eines gesehen, auf dem Ihr seid das Virus, unter dem die Erde leidet! gestanden hatte.
Ihr Blick schweifte zu der Galerie, die direkt neben der Kneipe lag und mit ihrem Angebot abstrakter Gemälde und Kunstgegenstände aus Metall und Stein so gar nicht zu dem rustikalen Eckkneipencharme der Bierklause passte. Die Eigentümer der Galerie hatten nur zwei Wochen nach dem Hochwasser bereits wieder geöffnet, weil sie die Kosten für die Renovierungsarbeiten aus eigener Tasche vorstrecken konnten.
Nachdenklich biss Nina sich auf die Unterlippe und beobachtete dabei, wie eine alte Dame den Bürgersteig entlangspaziert kam. Sie sah die Frau oft, die fast immer geblümte Kleider trug und eine billig aussehende Handtasche bei sich hatte. Meistens kam die alte Dame irgendwann im Laufe des Vormittags die Straße herunter, blieb ab und zu stehen und verschwand zwischen den parkenden Autos, nur um kurz darauf mit fröhlichem Gesichtsausdruck weiterzugehen. Nina hatte keine Ahnung, was sie trieb, und nicht zum ersten Mal nahm sie sich vor, sie irgendwann einmal abzupassen und sie danach zu fragen.
Jetzt erst mal wischte sie sich den Schweiß von Stirn und Oberlippe. Das Thermometer hinter ihr an der Hauswand zeigte vierunddreißig Grad, was für Anfang Juli zwar ungewöhnlich, aber auch nicht völlig befremdlich war.
Sie atmete tief durch. Ihr Kaffee war zur Neige gegangen, der letzte Schluck längst kalt geworden. Unten auf der Straße folgte die Stadt ihrem trägen Hitzewelle-Rhythmus. Ein Martinshorn ertönte ein paar Straßen weiter, wurde lauter, dann wieder leiser, bis es verstummte. Ein Nachbar kam aus der Haustür, blieb stehen, wie um zu überlegen, wo er sein Auto abgestellt hatte. Er warf einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk. Nina fragte sich, ob er die Zeit checkte oder vielmehr seine Pulsfrequenz. Seit es in der Stadt von Jahr zu Jahr wärmer wurde, liefen immer mehr Menschen mit Pulsuhren am Handgelenk herum, die unter anderem die Funktion besaßen, vor Herzanfällen zu warnen. Was auch immer der Mann unten auf dem Bürgersteig kontrolliert hatte, er nickte zufrieden, dann eilte er in Richtung Breitkopfstraße davon. Ein paar Tauben flatterten vor seinen Füßen auf und ließen sich hinter ihm wieder auf dem glühenden Asphalt nieder.
Nina trank den letzten Schluck Kaffee und schüttelte sich. Sie hasste kalten Kaffee. Sie warf einen Blick auf die altmodische Herrenarmbanduhr, die eine Erinnerung an ihren Ziehvater Georgy war. Kurz vor zehn. Das bedeutete, dass es in Alaska jetzt fast Mitternacht war. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, Gereon einfach anzurufen, aber obwohl sie wusste, dass er nur sehr wenig Schlaf brauchte, zögerte sie.
Wenn er Zeit hatte, würde er sich schon melden.
Sie legte das Telefon mit dem Display nach unten auf den Balkontisch und überlegte, ob sie sich noch einen Kaffee machen sollte.
Sie war gerade auf dem Weg in die Küche, als sie einen Anruf erhielt. Eilig stellte sie die Tasse auf den Schrank neben ihrer Flurgarderobe und lief zurück auf den Balkon. Sie hatte das Handy schon halb am Ohr, als sie erst sah, dass es nicht Gereon war, sondern Rüdiger Neumann. Was wollte der denn? Sie kannte Rüdiger von ihrer gemeinsamen Zeit auf der Journalistenschule in Hamburg, wo sie zusammen bei einem bekannten Boulevardjournalisten Seminare besucht hatten. Im Gegensatz zu ihr selbst, die nach der Ausbildung den Weg als Wissenschaftsjournalistin eingeschlagen hatte, war Rüdiger dem Beispiel seines Dozenten gefolgt und ebenfalls Boulevardjournalist geworden. Aktuell arbeitete er für die Hauptstadtausgabe einer überregionalen Zeitung, deren Headlines Nina jeden Tag beim Bäcker las.
Rüdiger meldete sich nur, wenn er etwas wollte. Neugierig, was es wohl war, ging sie ran.
»Hallo, Rüdiger.«
»Moin, Nina.« Rüdiger hatte eine raue Stimme, viel zu tief dafür, dass er keine eins sechzig maß und vermutlich gerade mal fünfzig Kilo wog. Wenn man genau hinhörte, merkte man ihm seine hanseatische Herkunft auch nach Jahren in Berlin immer noch an. Wie es seine Art war, kam er sofort zur Sache. »Sag mal, du bist doch Mikrobiologin. Kennst du dich mit Anthrax aus?«
Sie nahm das Handy mit nach drinnen. Anthrax. Aus Rüdigers Mund klang das bedrohlich, fand sie, und es brauchte definitiv einen weiteren Kaffee. »Ein wenig.« Sie klemmte das Telefon zwischen Ohr und Schulter und füllte den Siebträger mit frischem Kaffeepulver.
»Okay. Dann hast du sicher von der Anthraxinfektion in dieser Ziegenherde in Berlin gehört.«
Das hatte sie notwendigerweise. »Klar. Hast du nicht auch darüber geschrieben?« Es war eine rhetorische Frage. Sie wussten beide sehr genau, wie Rüdigers Headline gelautet hatte: Fluten fördern Killerkeime aus Berlins Boden!
Rüdiger lachte nur leise.
Nina verzog das Gesicht. »Außerdem liegt das Gehege nur anderthalb Kilometer von meiner Wohnung entfernt.«
»Okay«, sagte Rüdiger. »Was kannst du mir über dieses Virus sagen?«
»Zunächst mal, dass es kein Virus ist, sondern ein Bakterium. Warum interessierst du dich immer noch dafür?«
Darauf ging er – ganz Boulevardjournalist – nicht ein. »Kannst du mir in ganz kurzen Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen Viren und Bakterien ist?«
Obwohl es sie ein wenig ärgerte, dass er sie als Quelle für Informationen benutzte, die er ganz leicht durch zwei Minuten googeln selbst herausfinden konnte, gab sie ihm die gewünschte Antwort. »Bakterien sind eigenständige kleine Lebewesen, die nur aus einer Zelle bestehen, Einzeller sozusagen. Viren sind viel kleiner – nur ein Hundertstel davon – und werden nicht zu den Lebewesen gezählt. Sie brauchen immer eine Wirtszelle, um sich fortzupflanzen. Das Virus dockt an die Zelle an und lässt seine benötigten Bausteine von ihr produzieren. Dazu dringen sie in eine Zelle ein, laden ihr eigenes Erbgut dort ab und programmieren die Zelle um, um neue Viren zu bilden. Irgendwann platzt die Zelle, setzt die ganzen neuen Viren frei, die wiederum andere Zellen kapern, und immer so weiter.«
»Und Bakterien tun das nicht.«
»Nein.«
»Aber sie dringen auch in Zellen ein.«
Du hast das alles doch längst selbst recherchiert, dachte Nina bei sich. Was fragst du mich? Laut sagte sie: »Ja. Bakterien docken auch an Oberflächen von Zellen an und können in sie eindringen.«
»Wie zum Beispiel Anthrax.«
Jetzt ahnte sie, worauf er hinauswollte. »Hör zu, Rüdiger. Wenn du denkst, dass du aus dem Milzbrandausbruch bei der Ziegenherde einen weiteren Sensationsartikel zusammenschrauben kannst, muss ich dich enttäuschen.«
»Kannst du mir trotzdem noch ein bisschen mehr darüber erzählen?«
Sie seufzte. »Also gut. Um zu verhindern, dass du Unsinn schreibst …«
»Hey! Das nehme ich dir übel!«
Sie ignorierte seinen Versuch, einen schmierigen Scherz zu machen. »Also. Milzbrand, wissenschaftlich Anthrax genannt, war ursprünglich eine Krankheit von Webern und Gerbern. Bacillus anthracis, das ist der Erreger, der Milzbrand verursacht, ist ein natürlich vorkommendes Bakterium und befällt hauptsächlich Huftiere. Darum sind früher oft Häute und Felle von Rindern, Ziegen oder Schafen damit kontaminiert gewesen, was die Krankheit zu einer typischen Berufskrankheit eben von Gerbern gemacht hat. Der Milzbranderreger, der die Ziegen im Bürgerpark befallen hat, stammte aus einer ehemaligen Gerberei am Ufer der Panke und wurde durch die Überschwemmung neulich an die Oberfläche gespült, sodass er die Tiere befallen konnte. Das kommt ab und zu mal vor. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber da steckt keine reißerische Terrorstory drin.«
Wenn er ihr anhörte, dass seine Art sie abstieß, so ließ er es sich nicht anmerken. Er hatte schon früher auf der Journalistenschule ein bemerkenswert dickes Fell gehabt, dachte Nina.
»Weißt du, wie lang die Inkubationszeit ist?«
»Nicht genau. Zwischen ein paar Stunden und mehrere Tage, würde ich vermuten. Ich bin aber nicht sicher.«
»Und überträgt sich Anthrax von Mensch zu Mensch?«
Das tat es nicht, oder nur in sehr seltenen Fällen, dachte Nina, aber sie war es nun leid, hier das Informationshäschen für ihn zu spielen. »Hör zu, Rüdiger. Wie ich schon sagte: Darin steckt keine neue Sensation, die du …«
»Schon klar«, fiel er ihr ins Wort. »Bei den Ziegen hatte niemand außer der Natur seine Finger im Spiel …« Er ließ den Satz so vielsagend in der Luft hängen, dass Nina wusste, er wollte, dass sie nachhakte.
Sie tat ihm den Gefallen nicht. Sie schwieg einfach.
Er gab ein ganz leises, enttäuschtes Schnaufen von sich, bevor er seine Bombe platzen ließ. »Was wäre aber, wenn wir Hinweise darauf haben, dass es bei dem Milzbrandausbruch nicht bei Ziegen geblieben ist?«
»Wie meinst du das?«
Mit seinen nächsten Worten bewies er, wie gut informiert er wirklich war. »Bei den Ziegen hat das Veterinäramt damals Spezialisten vom Friedrich-Loeffler-Institut hinzugezogen. Der Ausbruch wurde offiziell für beendet erklärt. Die Gerberei gilt als Ursprung, da hast du recht. Soweit wir aber aus einer unserer Quellen wissen, macht das ZBS im Moment gerade ebenfalls Anthrax-Untersuchungen.«
Nina horchte auf.
Hinter dem Kürzel ZBS verbarg sich das Zentrum für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene, das dem Robert Koch-Institut angegliedert war.
»Wenn das ZBS involviert ist«, sagte sie, »dann gehen die Behörden davon aus, dass eine Gefahr für die Menschen besteht.« Die Worte verursachten ihr trotz der schwülen Hitze eine Gänsehaut. Der Kaffee war durchgelaufen, sie verzichtete darauf, den Siebträger zu entriegeln und sofort sauber zu machen. Stattdessen nahm sie die Tasse, ging mit ihr zum Kühlschrank und gab einen Schuss Milch dazu.
»Mein Gedanke«, sagte Rüdiger unterdessen. Er klang zufrieden – und sie wurde sich bewusst, dass sie ihm gerade doch auf den Leim gegangen war. Vermutlich hatte sie ihm soeben die Aussage einer anderen Quelle bestätigt. Sie würde besser auf der Hut sein müssen.
»Wenn das ZBS involviert ist, heißt das also, dass es einen Anthraxausbruch bei mindestens einem Menschen gab?«, hakte er nach.
»Oder zumindest den Verdacht darauf.«
Er hatte sich jetzt an ihr festgebissen. »Ich habe das mal ein bisschen recherchiert, vor allem in der Fachpresse. Janus Therapeutics arbeitet mit Anthrax, stimmt’s?«
In Ninas Magen bildete sich ein kalter Knoten. Das war also der eigentliche Grund für seinen Anruf! Er wusste, dass sie in Gereons Firma Janus Therapeutics mit Anthrax-Erregern arbeiteten, und wollte von ihr Informationen darüber haben!
Sie gab sich unwissend. »Wenn du es recherchiert hast, wird es wohl stimmen.«
Er lachte. »Komm schon, Nina! Seitdem ihr zusammen auf dem Presseball letztens aufgetaucht seid, weiß jeder, dass du mit Gereon Kirchner liiert bist. Und du kannst mir nicht weismachen, dass du als schlaue Mikrobiologin noch nie mit deinem Akademiker-Schatz über dessen Forschungstätigkeit gesprochen hast.«
Da lag er richtig. Natürlich wusste sie, dass ein Anthrax-Erreger die Basis für das Krebsmedikament war, das Gereons Firma entwickelte. Gereon und sein Team hatten es geschafft, das Milzbrand-Gift unschädlich zu machen, um das Bakterium als eine Art Taxi zu nutzen, das medizinische Antikörper genau zu ihrem Bestimmungsort in kranke Zellen schleuste. Aber sie würde einen Teufel tun und Rüdiger das erzählen. Auf keinen Fall würde sie ihm helfen, seinen nächsten reißerischen Artikel zu schreiben, noch dazu einen, bei dem er Gereon ins Visier seiner selbstgerechten investigativen Ermittlungen nahm. Also schwieg sie einfach. Sie war inzwischen mit ihrem Kaffee zu ihrem Schreibtisch im Arbeitszimmer gegangen und schaute auf das Dokument mit ihrem Klimaartikel. Der Cursor blinkte anklagend im oberen Drittel der sonst noch leeren Seite, und sie schloss das Dokument. Dabei fiel ihr Blick auf das gerahmte Foto von Gereon, das neben dem Computer stand. Es zeigte ihn bei einer der Klimademos, an denen er teilnahm, wann immer es zeitlich für ihn passte. Er trug Jeans und ein lässiges T-Shirt, aus dessen rechtem Ärmel sein Tattoo hervorragte – eine klassische Darstellung eines Januskopfes mit zwei in entgegengesetzte Richtung blickenden Gesichtern. Bei dem Anblick musste Nina lächeln. Das Tattoo hatte sie vergangenen November – als sie in einer Bar in Friedrichshain gesessen und versucht hatte, über einen anderen Mann hinwegzukommen – dazu gebracht, Gereon anzusprechen. »Cooles Tattoo«, hatte sie gemeint, und er hatte gelacht.
»So einen originellen Anmachspruch habe ich ja noch nie gehört!«, hatte er betont ironisch gesagt und sich dabei über seine damals millimeterkurz geschnittenen, blonden Haare gestrichen. Danach hatten sie sich zwei Stunden lang sehr angeregt unterhalten …
»Komm schon, Nina!«, drängte Rüdiger jetzt.
Nina schüttelte den Kopf. »Kein Kommentar«, sagte sie und biss sich auf die Lippe, weil sie ahnte, dass Rüdiger das nur noch griffiger machen würde. Wenn er sich erst einmal in eine Story verbissen hatte, war er schlimmer als ein Terrier, und sich eine Skandalstory über eine angesehene Berliner Medizinfirma aus den Fingern saugen zu können, war so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für ihn. Es war also gut möglich, dass hier gerade Ungemach auf Janus Therapeutics zukam. Bevor Nina sich klar darüber wurde, was sie nun tun sollte, änderte Rüdiger seine Taktik.
»Woran arbeitest du gerade?«, fragte er.
Okay. Das war jetzt also offensichtlich der Versuch, sie durch Interesse an ihrer eigenen Arbeit so zu entspannen, dass er ihr später weitere Informationen entlocken konnte. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf meinte sie nur: »An einem Artikel über die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise.«
Wie erhofft, fand er das eher langweilig. »Klingt interessant«, erwiderte er lahm, und sie musste lachen. Es verging ihr jedoch wieder, als er hinzufügte: »Du meinst, so was wie Hitzetote und einen Haufen Zahlen und so, und das alles einigermaßen verständlich geschrieben, in der Hoffnung, dass Lieschen Müller es auch endlich mal kapiert?«
Seine hörbare Herablassung ärgerte sie, aber noch mehr ärgerte sie das Wechselbad der Gefühle, das sie in Gesprächen mit ihm schon früher auf der Journalistenschule gehabt hatte. Sie teilte seinen Zynismus nicht, aber immer, wenn sie mit ihm zu tun hatte, fragte sie sich nach dem Grund. Denn zumindest in einer Hinsicht stimmte sie ihm zu: Sie konnte noch so viele Artikel mit den reinen Fakten füllen – sie hatte in letzter Zeit immer öfter das Gefühl, dass sie damit nicht wirklich etwas bewirkte.
Rüdiger schien ihre Gedanken zu erahnen und legte nach: »Oder bist du endlich auch dazu übergegangen, von armen, kleinen Eisbären auf ihrer wegschmelzenden Scholle zu schreiben?«, lästerte er.
»Keine Eisbären«, sagte sie schroff.
»Klar«, sagte Rüdiger. »Die gute alte, sachliche Nina. Aber du hast schon recht. Ich meine, die armen Bärchen da oben sind viel zu weit weg. Lieschen Müller hier in Deutschland liest von ihnen und denkt sich: betrifft mich nicht, bevor sie die Dusche zwei Grad wärmer stellt. Daran konnte ja langfristig nicht mal ein russischer Despot etwas ändern, der dem Westen den Gashahn abdreht. Haben wir doch kürzlich alle erst gesehen, wie das läuft: Die Politik konzentriert sich darauf, neue Flüssiggasterminals zu bauen, vor arabischen Despoten den Kotau zu machen oder über Fracking zu diskutieren, statt endlich die Energiewende auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen.« Er seufzte schwer, und sie spürte, dass ihn das wirklich umtrieb. »Ich glaube schon, dass die Bevölkerung eher bereit ist, sich für den Klimaschutz zu engagieren, wenn sie endlich begreift, dass es dabei auch um die eigene Haut geht.«
Auch wenn Nina seine zugespitzte Meinung über verschnarchte Politiker nicht zu hundert Prozent teilte, mit Letzterem hatte Rüdiger genau ihren Punkt getroffen. Wenn sie einen Magazinbeitrag schrieb, dann erreichte sie nur Leute, die sich des Themas ohnehin schon bewusst waren und sich damit auseinandersetzen wollten.
Rüdiger lachte auf. »Vielleicht sollte ich mich des Themas mal annehmen. Ich meine, wenn wir titeln: Jeder ist gefragt, wenn wir diese Krise abwenden wollen!, dann bringt das vermutlich mehr, als du mit all deinen Artikeln zusammen erreichen könntest.«
Sosehr Nina diese Worte auch ärgerten, sie schwieg dazu. Selbst wenn sie seit jeher der Meinung war, dass sich ein guter Journalist mit keiner Sache gemeinmachen sollte, nicht einmal mit einer guten, konnte sie sich trotzdem des Gedankens nicht erwehren, dass Rüdiger mit seiner Einschätzung nicht ganz danebenlag.
»Ich muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen«, sagte sie.
»Schade. Ich hatte gedacht, du könntest mir ein bisschen mehr über Janus Therapeutics erzählen.« Er machte eine bedeutungsvolle Pause und fügte dann fast lauernd hinzu: »Ich meine, nicht, dass ich was Falsches schreibe. Rein aus Versehen, natürlich.«
Sie ging auf die kaum verhohlene Drohung nicht ein. »Ich kann dir nicht helfen, Rüdiger. Und wie gesagt: Ich muss jetzt weiterarbeiten.«
»Wenn du meinst.« Er verabschiedete sich und legte auf. Er war eindeutig verstimmt, aber das konnte sie nicht ändern.
In Gedanken ging sie das Gespräch noch einmal durch. Es war offensichtlich, dass Rüdiger Janus Therapeutics aufs Korn genommen hatte. Wenn es wirklich stimmte, was er ihr erzählt hatte – dass das ZBS Ermittlungen im Fall des Milzbrandausbruchs in der Ziegenherde aufgenommen hatte –, dann war das nicht gut für Gereons Firma. Zwar arbeitete man dort nach den höchsten Sicherheitsstandards. Gereon hatte ihr irgendwann einmal erzählt, dass er persönlich dafür gesorgt hatte, dass man in der Firma die gesetzlichen Vorgaben sogar übererfüllte. Trotzdem konnte nur allzu leicht ein falscher Verdacht auf ihn und seine Leute fallen. Nina sah bereits Rüdigers reißerische Schlagzeile vor sich: Berliner Medizinfirma verantwortlich für Anthraxtote in der Stadt?
Natürlich versehen mit einem Fragezeichen, damit man ihm keine Falschinformation vorwerfen konnte. Das wäre auf so vielen Ebenen eine Katastrophe für Gereons Forschung, dass es Nina regelrecht die Kehle zusammenzog.
Sie warf einen Blick auf ihr Display. Immer noch kein Anruf von ihm und nach wie vor auch keine Textnachricht. Sie starrte sein Foto auf dem Schreibtisch an. »Melde dich«, murmelte sie. Natürlich hörte er ihre Aufforderung nicht, also legte sie ihr Handy neben den Laptop und rief den halb fertigen Klimaartikel wieder auf. Sie markierte das unausgegorene Textfragment und löschte es, sie würde mit diesem Kram heute ja doch kein Stück mehr weiterkommen. Sie schloss das Dokument, überlegte kurz, dann öffnete sie die Mediathek eines privaten TV-Senders und klickte eine Dokumentation über Janus Therapeutics an, die erst vor ein paar Wochen gedreht worden war. Unterlegt mit Laboraufnahmen und Bildern des Firmengebäudes in Berlin-Pankow, erklärte eine Stimme aus dem Off: »Janus Therapeutics gilt als internationale Hoffnung im Kampf gegen Krebs, weil man hier einen radikal neuen Ansatz der Tumortherapie vertritt. Dr. Gereon Kirchner, einer der beiden Inhaber, erklärt mit seinen eigenen Worten die Wirkweise der neuen Therapie.«
Der Bericht schnitt auf eine Aufnahme von Gereon, der in einem weißen Kittel mit Janus-Therapeutics-Logo vor einer Laborbank stand. Im Hintergrund sah man die typischen Regale mit Chemikalien in Glasflaschen mit bunten Deckeln. Geradeaus blickte Gereon in die Kamera und sagte mit seiner tiefen, ruhigen Stimme: »Kurz gesagt handelt es sich bei JanuThrax um einen ganz neuen Therapie-Ansatz, mit dem wir effektive Medikamente in eine resistente Krebszelle schleusen. Sie müssen sich das so vorstellen: Bei verschiedenen Krebsarten haben sich Antikörper als effektives Mittel erwiesen, weil sich mit ihren spezifischen Rezeptoren Strukturen, sogenannte Antigene, an der Oberfläche von Krebszellen blockieren lassen. Das Immunsystem erkennt die Krebszellen dann als fremd und kann sie abwehren. Bei manchen Brustkrebstumoren wird das heute schon so gemacht. Nun liegen aber bei einigen Krebsarten diese Rezeptoren leider im Inneren der Zelle und damit außer Reichweite der Antikörper. Und da kommt JanuThrax ins Spiel, ein Milzbrand-Toxin, das Profi darin ist, große Enzyme ins Zellinnere zu schleusen. Wir mussten uns bei Janus Therapeutics lediglich fragen, wie wir Milzbrand-Toxin unschädlich machen können, um das auf diese Weise entschärfte Proteingemisch mit maßgeschneiderten Antikörpermedikamenten neu zu beladen und ins Innere der Tumorzelle zu schleusen, wo es seine Wirkung entfalten kann. Wir machen also im Prinzip nichts anderes, als den nun harmlosen Milzbranderreger als ein Trojanisches Pferd zu nutzen, in dessen Bauch ein Heilmittel eingeschleust wird.«
»Sie arbeiten also mit einem Erreger, der potenziell tödlich für Menschen ist, weil er Milzbrand auslöst?«, fragte eine Reporterin, und Nina sah den Schatten, der über Gereons Miene fiel. Sie wusste, dass er sich über die Frage geärgert hatte, immerhin hatte er der Frau kurz zuvor erzählt, dass sie das Milzbrandgift unschädlich gemacht hatten. Er antwortete jedoch sehr sachlich und geduldig. »Es stimmt, dass wir mit einem speziellen Milzbrand-Stamm aus der Natur arbeiten, ja. Wir machen uns dabei, wie gesagt, die Fähigkeit des Bakteriums Bacillus anthracis zunutze, ganz effektiv in menschliche Zellen einzudringen. Wenn man dem Toxin den Stachel zieht und es mit den notwendigen Antikörpermedikamenten belädt, transportiert es unseren Wirkstoff sozusagen huckepack in die Krebszellen, sodass die Antikörper dann die Rezeptoren im Innern der Krebszellen blockieren und sie abgetötet werden können. Wir haben dafür, wie gesagt, das tödliche Bakterientoxin so verändert, dass der sogenannte letale Faktor ausgeschaltet ist. JanuThrax greift nur die entarteten Zellen an. Gesundes Gewebe bleibt gänzlich unberührt.«
»Aber um das alles zu erreichen, arbeiten Sie mit Gentechnik?«, fragte die Reporterin weiter.
Gereons Miene verdüsterte sich noch ein wenig mehr. »Ja. Wir haben die Erfolgsaussichten unserer Methode bei Mäusen nachgewiesen. Mittlerweile befinden wir uns in den klinischen Studien der Phase I, um die Sicherheit der Therapie beim Menschen zu prüfen, und …«
Nina stoppte den Beitrag. Gereon hatte ihr von dem Interview erzählt, und er hatte sich ziemlich über die Art der Befragung geärgert. Jetzt hatte sie eine ungefähre Ahnung davon, warum.
3. Kapitel
Die Luft, die durch das geöffnete Fahrerfenster strömte und Tom Morells mal wieder viel zu lange Locken zauste, war immer noch überraschend warm, dafür, dass er sich in der Nähe des Polarkreises befand und es bereits nach neun Uhr abends war. Natürlich hatte er gewusst, dass die Landschaft in diesen Breiten im Sommer eisfrei war, aber naiverweise hatte er nicht damit gerechnet, dass das Thermometer hier tagsüber auf weit über zwanzig Grad kletterte. Und er hatte auch nicht damit gerechnet, dass er noch gegen Abend eine Sonnenbrille tragen musste, weil das Licht der tief stehenden Sonne so sehr blendete. Wenn er die Augen schloss, konnte er direkt vergessen, dass er sich hoch im Norden von Kanada befand, im Goldgräberland des Yukonterritoriums. Die Luft roch nach Erde, nach dem Laub der Weißfichten und ein klein wenig nach den leuchtend violetten Blüten der Fireweeds. Aus dem Radio des Geländewagens, den er in White Horse gemietet hatte, drang mit nervtötendem Knistern unterlegte amerikanische Popmusik. Sie ging ihm schon seit ein paar Kilometern auf die Nerven, darum drehte er sie ab. Kurz darauf hielt er an einer Wegkehre, von der sich ein Blick weithin über das leicht abfallende Land bot. Er stieg aus und genoss die flirrende Stille, die stets auf zu viel Lärm folgte. Als er durchatmete, fühlte es sich an, als würde die klare Luft jede einzelne Zelle seines Körpers fluten und alle Anspannung von ihm nehmen, die er in den vergangenen Wochen empfunden hatte. Da kümmerte es ihn auch kaum, dass er sofort zum begehrten Opfer von ein paar Moskitos wurde, die hier oben in diesem Jahr – jedenfalls den Erzählungen der Einheimischen zufolge – eine wahre Plage waren. Kurz fiel sein Blick auf den goldenen Ehering an seiner rechten Hand, und er gestattete sich, die Augen zu schließen. Er würde jetzt nicht an Isabelle denken!, nahm er sich vor, aber natürlich war das illusorisch. Immer wieder wanderten seine Gedanken zu seiner Ehefrau, die ihre Ehe gerade mal wieder in eine schmerzhafte On-off-Beziehung verwandelte. Vor allem aber dachte er daran, was Isabelle ihm bei ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung an den Kopf geworfen hatte: dass er ihren Ansprüchen niemals genügen würde, dass er ein Loser war, dass sie ihn niemals hätte heiraten dürfen. All das warf er ihr nicht vor, denn es entsprach zumindest in Teilen der Wahrheit. Immerhin schlug er sich mit seinen fast vierzig Jahren immer noch als Reiseblogger und Foodhunter durch – und dieses unstete, immer ein wenig abenteuerliche Leben gefiel ihm auch noch.
Wirklich schmerzhaft für ihn war eigentlich nur, dass Isabelle ihm genau deswegen ihre gemeinsame Tochter Sylvie entzog. Denn natürlich hatte seine Noch-Frau sie mitgenommen, als sie ausgezogen war.
»Ach, Sylvie …«, murmelte er. Er nestelte das pinkfarbene Feuerzeug aus der Tasche, das seine mittlerweile sechzehnjährige Tochter ihm irgendwann einmal geschenkt hatte und das mit der kitschigen Darstellung eines Einhorns bedruckt war. Der Strassstein, der das Auge des Tieres gebildet hatte, war vor längerer Zeit schon verloren gegangen. Das Feuerzeug selbst war darüber hinaus längst leer, aber Tom brachte es nicht übers Herz, es wegzuwerfen. Dazu verband es ihn viel zu sehr mit seiner Tochter. In Gedanken rechnete er aus, wie spät es jetzt gerade wohl in Deutschland war. Auf jeden Fall sehr früh am Morgen, was bedeutete, dass Sylvie vermutlich demnächst aufstehen würde.
Er steckte das Feuerzeug weg, nahm die Packung Camels aus der Jackentasche und klopfte eine Zigarette heraus. Das Feuerzeug, mit dem er sie anzündete, hatte er vor ein paar Tagen in Vancouver gekauft. Es war ein einfaches Billigding, und in einem Anflug von Nostalgie und Sehnsucht nach seiner Tochter hatte er sich für eines in einem leuchtenden Pink entschieden. Der Typ an der Kasse der Tankstelle hatte ihn mit einem Stirnrunzeln angesehen, und Tom hatte sich einen Spaß daraus gemacht, ihm anzüglich zuzuzwinkern.
Nina hätte darüber sehr gelacht …
Der Gedanke überfiel ihn so hinterrücks wie ein Guerilla-Kämpfer, der im Unterholz seiner Gedanken gelauert hatte. Hastig versuchte Tom, ihn zu verdrängen, aber das funktionierte ebenso wenig wie zuvor bei Isabelle. Dass seine Ehefrau ihn mal wieder verlassen hatte, war ihm im Grunde egal. Nein, mehr noch, es war ihm sogar recht, weil er selbst schon seit Langem der Meinung war, dass sie niemals hätten heiraten dürfen. Vergangenen Herbst dann, als er Nina Falkenberg kennengelernt hatte, war er sogar drauf und dran gewesen, Isabelle für sie zu verlassen. Allein Sylvie war der Grund gewesen, dass er es dann doch nicht getan hatte. Er hatte seiner Tochter eine Scheidung nicht zumuten wollen.
Isabelle allerdings schien diese Bedenken nicht zu haben …
Kopfschüttelnd sog er an seiner Zigarette und befahl seinen Gedanken, sich nicht schon wieder im Kreis zu drehen.