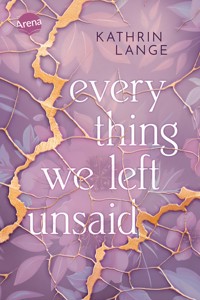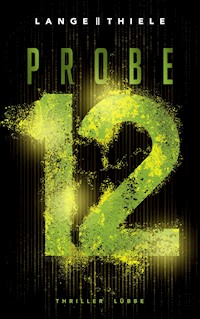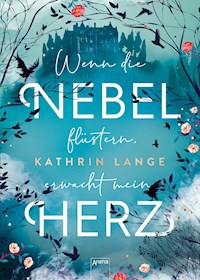4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DIE TÖDLICHE JAGD NACH EINER KETZERSCHRIFT Südfrankreich im Jahre 1209: Während die Truppen des Papstes im Krieg gegen die Ketzer das Land verwüsten, erfährt die Messingschmiedin Anne von einem geheimnisvollen astronomischen Manuskript. Sie macht sich auf die Suche nach der verschollenen Schrift, die einst im Besitz ihres Vaters war. Doch das bleibt nicht ohne Folgen. Es zeigt sich nämlich, dass so mancher bereit ist, für das kostbare Dokument bis zum Äußersten zu gehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Kathrin Lange
Das achte Astrolabium
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
DIE TÖDLICHE JAGD NACH EINER KETZERSCHRIFT
Südfrankreich im Jahre 1209: Während die Truppen des Papstes im Krieg gegen die Ketzer das Land verwüsten, erfährt die Messingschmiedin Anne von einem geheimnisvollen astronomischen Manuskript. Sie macht sich auf die Suche nach der verschollenen Schrift, die einst im Besitz ihres Vaters war. Doch das bleibt nicht ohne Folgen. Es zeigt sich nämlich, dass so mancher bereit ist, für das kostbare Dokument bis zum Äußersten zu gehen ...
Über Kathrin Lange
Kathrin Lange wurde 1969 in Goslar geboren und ist gelernte Verlagsbuchhändlerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern bei Hildesheim und arbeitet als Mediendesignerin. Im Rowohlt Taschenbuch Verlag ist bereits ihr erster Roman, «Jägerin der Zeit», erschienen.
Mehr über die Autorin erfahren Sie auf der Homepage www.kathrin-lange.de.
Inhaltsübersicht
Zwei Menschen waren wichtig,
um dieses Buch zu schreiben:
Stefan, mein Mann,
mit dem ich auf festem Grund wandere,
und Martin Brunold,
der mir den Weg zu den Sternen zeigt.
Danke euch beiden!
«Die Wissenschaft kann nämlich erst durch Erfahrung ergriffen werden.»
(Petrus Alfonsi, Brief über das Studium)
Prolog
Ein Dorf in der Nähe von Béziers, Herbst 1208
Der Gestank in der Kammer war unerträglich. Zwar brannten in allen Ecken Binsenlichter, flackerten an gegen die trübe Finsternis des Raums, aber auch ihr Rauch konnte die Ausdünstungen des Sterbenden nicht vertreiben.
Eine Frau mit schmalen, fein gemeißelten Gesichtszügen betrat die Kammer und verzog das Gesicht. Sie bedeckte Mund und Nase mit einer Hand und sah sich um. Die hellblonden, glatten Haare, die ihr wie feine Vogelfedern ins Gesicht hingen, wirkten stumpf.
Die Kammer enthielt nichts als ein einfaches Lager aus einem Strohsack in einem grob gezimmerten Bettkasten. Auf ihm lag der Sterbende.
Bleich war er, seine Wangen wirkten eingefallen, und die Hände, die er auf der grauen Decke ausgestreckt hatte, waren zu knotigen Fäusten geballt. Ab und zu hustete er. Es war ein trockener, gequälter Husten, der die Frau zusammenzucken ließ.
Sie zögerte einen Augenblick, dann trat sie an das Lager.
«Vater?» Sie beugte sich steif über den Sterbenden, voller Abwehr, als müsse sie ihren Oberkörper dazu zwingen, sich ihm zu nähern. «Du wolltest mich sehen?»
Der Mann reagierte nicht sofort. Seine Augen waren geschlossen, die Wimpern ruhten auf den spitzen Wangenknochen wie Schatten. Seine Haut hatte den Farbton von altem Pergament.
«Komm her.» Seine Faust klopfte auf die Bettkante, ohne sich zu öffnen.
Die Frau folgte der Bewegung mit den Augen. Zögernd ließ sie sich seitlich auf der Bettkante nieder, die Hände hielt sie im Schoß gefaltet. Ihr einfaches, bäurisches Gewand rutschte hoch und enthüllte ihre bloßen Füße.
Wieder hustete der Sterbende. Diesmal zuckte die Frau nicht zusammen.
Die Tür öffnete sich, und ein Mann im Gewand eines Priesters trat herein. Er musterte die Szene, die sich ihm bot, und nickte. «Gut, dass du gekommen bist.»
Die Frau erwiderte den Blick des Priesters. Um ihren Mundwinkel zeigte sich ein Zug von Härte, verschwand jedoch sofort wieder. Ihr Blick heftete sich erneut auf den Sterbenden.
Der öffnete die Augen. Seine Lider flatterten, und kurz sah es so aus, als wollten sie sich dem Willen des Mannes widersetzen und wieder nach unten sinken. Dann jedoch klärte sich der Blick des Sterbenden. Seine Faust wanderte auf die Frau zu, erreichte ihren Oberschenkel und blieb liegen.
Die Frau warf einen weiteren Blick in Richtung des Priesters. Der hatte inzwischen die Tür geschlossen und sich mit vor der Brust verschränkten Armen dagegen gelehnt.
Die Frau nahm die Hand des Sterbenden, und er umklammerte ihre Finger mit solcher Kraft, dass seine Knöchel weiß wurden.
«Clothilde!» Wie ein Hauch kam der Name von seinen Lippen. «Komm näher.»
Die Frau schluckte, aber schließlich beugte sie den Nacken und neigte ihr Gesicht zu dem Sterbenden hinab. Sie holte durch den Mund Luft, als der Atem des Mannes sie streifte.
«Ich muss dir etwas Wichtiges sagen, bevor Gott mich zu sich nimmt.» Kurz schlossen sich die Augen des Mannes, aber er riss sie mit einem Ruck wieder auf. Es sah aus, als wollten seine Augäpfel sie anspringen.
Die Frau fuhr zurück, dann beugte sie sich wieder vor.
Ein Binsenlicht zischte leise, und seine Flamme begann zu zittern.
«All die Jahre, die vergangen sind», begann der Sterbende, «habe ich dich meine liebe Tochter genannt. Ich habe zugesehen, wie du aufwuchst, wie du zur Frau wurdest. Du bist hübsch geworden, meine Tochter, das weißt du, nicht wahr?» Er wartete auf Zustimmung und fuhr dann fort: «Dennoch liegt über deinem Leben eine Lüge, und dieser Pfaffe da, der mir seit Tagen seine Anwesenheit aufzwingt, hat mich gedrängt, diese Lüge nicht mit mir ins Grab zu nehmen.»
Der Priester schnaubte.
Die Frau strich sich mit der freien Hand ihre Haare hinter das Ohr. «Wovon sprichst du?»
«Deine Mutter, Clothilde – sie war nicht mein Eheweib!»
Clothilde zog die Nase kraus. Sie hatte eine sehr schmale Nase, deren Rücken scharf gezeichnet war wie eine Messerklinge. «Das weiß ich längst! Glaubst du, die Leute im Dorf hätten nicht dafür gesorgt, dass ich es erfahre?»
Der Sterbende lachte, und das Geräusch war kaum von seinem Husten zu unterscheiden. «Doch, natürlich. Deine Mutter kam in das Dorf, als du noch sehr klein warst.»
Schweigen tropfte in die Kammer. Das Binsenlicht zischte lauter und verlosch dann. Der Priester stieß sich von der Tür ab, zündete ein neues an und stellte es an die Stelle des alten.
«Ich – klein? Was soll das heißen?», flüsterte Clothilde.
«Es heißt …» Explosionsartiges Husten riss dem Sterbenden die Worte von den Lippen. «… es heißt, dass du nicht meine Tochter bist.»
Clothilde wollte aufstehen, aber die Hand des Sterbenden ließ es nicht zu. Mit erstaunlicher Kraft zog er sie zurück auf die Bettkante. «Lauf nicht weg! Es gibt noch so viel, was ich dir sagen muss.»
Ein Wirbel von Gefühlen zeichnete sich auf den Zügen der Frau ab, Erschrecken, Zweifel, Angst, aber auch Neugierde und etwas Helles, Leuchtendes. Etwas wie Hoffnung.
«Dein Vater ist ein Mann namens Jehuda ben Moïse.»
«Ein Jude?»
«Nein. Er konvertierte bereits vor vielen Jahren zum Christentum.»
«Lebt er noch?»
«O ja.»
«Kennst du ihn? Wo wohnt er?»
Hilfe suchend drehte der Sterbende dem Priester das Gesicht zu, doch der nickte und stieß das Kinn vor, als wolle er den Mann vorantreiben.
«Er wohnt nirgends. Er sitzt in einem Verlies in Maraussan. Seit vielen Jahren schon.»
Düsternis fiel über Clothildes Gesicht und löschte das Helle aus. «Was hat er getan?»
«Das weiß ich nicht. Deine Mutter hat mir nur einmal erzählt, dass seine eigene Familie ihn gefangen hält. Sie war überzeugt davon, dass er unschuldig eingesperrt wurde.»
«Dann war er der Grund, dass sie …» Clothilde presste die Lippen aufeinander, bis sie nur noch ein blutleerer Strich waren. Dann holte sie tief Luft. «… dass sie sich erhängt hat?»
Der Priester hüstelte leise, aber der Sterbende beachtete ihn nicht. Clothilde machte einen neuen Versuch aufzustehen, doch der Sterbende ruckte hoch. Seine freie Hand krallte sich in ihren Oberarm und zerrte sie gegen ihren Willen herab, so weit, dass ihre Wange seine Lippen berührte, als er antwortete: «Möglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht viel, außer, dass du aufhören solltest, einen Schuldigen für den Tod deiner Mutter zu suchen. Was geschehen ist, ist ganz allein ihre Schuld. Sie hat den Knoten geknüpft, und sie ist von dem Schemel gesprungen. Gott hat längst über sie gerichtet!»
Clothilde machte sich los. Hastig trat sie einen Schritt zurück, rieb sich den Oberarm und schaute mit steinerner Miene auf den Sterbenden hinunter. «Nein!», zischte sie. «Das ist nicht wahr! Jemand hat sie dazu getrieben!» Dann, als hätte sich ein unsichtbarer Bann gelöst, der sie an den Sterbenden gekettet hatte, fuhr sie herum und eilte zur Tür.
Der Priester trat ihr in den Weg und legte die Hand auf den Türriegel. Er blickte ihr ernst und ein wenig traurig ins Gesicht. «Euer Vater wird bald sterben!», sagte er leise. «Verlasst ihn nicht so.»
Clothildes Blick war starr. «Er ist nicht mein Vater!», knurrte sie heiser. Sie griff nach dem Riegel, und der Priester nahm die Hand fort. Mit einem harten Ruck riss sie die Tür auf.
«Zum Teufel mit ihm!», fügte sie hinzu.
April, 1209 n. Chr.
Buch 1 Saturn
«Ein alter, großer, müder Planet der Verachtungen, der Pein und der Traurigkeiten.»
Ali ben Ragel, Über die Urteile der Sterne,
11. Jahrhundert
1. Kapitel
In der Nacht vor St. Notker leuchteten die Sterne über Béziers an der Himmelskugel, als habe jemand einen perlenbesetzten Schleier über sie gebreitet. Am nördlichen Horizont glänzte Kassiopeia mit solch schimmernder Eleganz, dass es Anne schwer fiel, den Blick von ihr abzuwenden. Zwischen zwei Atemzügen war es ihr, als schwebe sie inmitten all der Sterne, eines festen Halts beraubt und gewichtslos wie ein Engel. Die Milchstraße lag wie ein heller Schal auf dem Horizont und umfing die dunklen Schatten der weit entfernten Berge wie mit der zartesten Spitze. Andromeda war vor einer guten Stunde untergegangen, und Perseus, der seiner Geliebten auf alle Ewigkeit folgt, schickte sich gerade an, es ihr gleichzutun.
Anne unterdrückte einen Seufzer der Zufriedenheit. Wie immer, wenn sie nachts unter freiem Sternenhimmel stand, auf der Dachterrasse ihres Hauses, die ihr Vater eigens für die Beobachtung der Sterne hatte bauen lassen, spürte sie eine große innere Ruhe. Dann glaubte sie, einen winzigen Zipfel der Schöpfung nicht nur mit ihren eigenen Augen sehen zu können, sondern ihn auch zu verstehen. Tief in ihrem Innersten. Es war ein Verstehen mit dem Herzen, und jeden Abend genoss Anne dieses kurze Gefühl aufs Neue, bevor sie sich an ihre Arbeit machte.
Heute jedoch kam sie gar nicht erst dazu, denn hinter ihr auf der Treppe ertönten Schritte. Leichte Schritte waren es, nicht das schwerfällige Poltern, mit dem ihr Vater normalerweise die steile Stiege erklomm. Eine Frau.
«Anne?» Ein Haarschopf erschien über der Brüstung. Das Gesicht darunter, schmal und ein wenig kantig, schimmerte im Licht der Sterne.
«Ich bin hier, Madeleine.» Anne ließ sich auf die Bank fallen, die ihr Vater sich vor einigen Monaten gekauft hatte, damit er sich in den langen Nächten der Sternenbetrachtung hin und wieder setzen und seine alten, müden Beine ausruhen konnte.
Die Frau überwand die letzten Stufen der Treppe und betrat die Dachterrasse. Nach einem kurzen Blick in den Himmel kam sie zu Anne und setzte sich neben sie. Madeleine war, ebenso wie Anne, gerade zwanzig geworden, aber im Gegensatz zu ihr, die noch bei ihrem Vater lebte, war Madeleine bereits seit einem Jahr Witwe. Ihr Mann, ein angesehener Tuchhändler aus Castres, war auf einer seiner Reisen in den Alpen in einen Fluss gefallen und anschließend an einer Lungenentzündung gestorben. Er hatte Madeleine nicht nur das Haus neben dem von Annes Vater vermacht, sondern dazu zwei prall gefüllte Lagerschuppen, einen in Montpellier und einen in Albi. Madeleine war durch seinen Tod nicht nur zu einer reichen, sondern auch zu einer höchst begehrten Frau geworden. Béziers Junggesellen standen Schlange, um sie zu ehelichen, doch obwohl das offizielle Trauerjahr seit fast einem Monat abgelaufen war, machte Madeleine nur wenig Anstalten, sich für einen von ihnen zu interessieren.
«Puh!» Sie blies gegen die Strähnen, die ihr verschwitzt ins Gesicht hingen. «Was für ein Tag!»
Anne lächelte in die Dunkelheit. Madeleine liebte es, wenn ihr Geschäft brummte, aber fast noch mehr liebte sie es, darüber zu klagen, wie viel sie zu tun hatte.
«Drei Ballen Croisé, drei Ballen Finette, natürlich beides aus Utrecht, dazu ein halber Ballen Triester Seide und ein halber Ballen dunkelblauer Samt aus Venedig – und was macht der Tölpel? Lässt die Ochsen durchgehen, der Karren kippt um, und alles landet im Dreck der Ruelle Pézenas! Kannst du dir das vorstellen?»
Anne lachte. Der Tölpel, das konnte nur Jérome sein, Madeleines Lagerverwalter, über den sie mit solcher Hingabe Tag für Tag herzog, dass sich in Anne der Verdacht regte, Madeleine könne ihn als neuen Ehemann ins Auge gefasst haben. Sie unterdrückte ein Seufzen. Insgeheim beneidete sie Madeleine um die Leichtigkeit, mit der sie sich damals für den Tuchhändler aus Castres entschieden hatte und mit der sie über kurz oder lang auch einen neuen Mann aussuchen würde. Madeleine verwandte nicht viel Eifer auf die Frage, ob die Männer sie auch liebten. Sie war durch und durch praktisch veranlagt und würde den Bewerber wählen, der ihr am meisten Vorteile einbrachte.
«Ich habe heute Nachmittag Charles auf dem Markt von Maureilhan gesehen», berichtete die Tuchhändlerin, als hätte sie Annes Gedanken gelesen.
Anne brummte etwas Unverständliches.
Madeleine beugte sich vor und spähte in ihr Gesicht, aber es war zu dunkel, um sie etwas erkennen zu lassen. Mit einer wegwerfenden Geste lehnte sie sich wieder zurück und streckte die Beine aus. «Ich frage mich immer wieder, was du gegen ihn hast!»
«Nichts.» Anne hatte wirklich nichts gegen Charles de Lespignian. Als Sohn eines Hauptmanns der Stadtwache diente er seit zwei Jahren selbst dort. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich und sah recht gut aus mit seinen tief liegenden, fast glühenden Augen und dem schwarzen, lockigen Haar. Er war charmant, humorvoll und aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch treu. Er hatte nur einen einzigen Nachteil.
Er war dumm.
Anne zog die Nase kraus, denn ihr fiel das letzte Zusammentreffen mit Charles ein. Sie hatten sich zufällig getroffen, ebenfalls auf dem Markt in Maureilhan. Anne war auf dem Weg zu einem ihrer eigenen Kunden gewesen. Zwar half sie ihrem Vater bei dessen Tätigkeit als Messingschmied, aber nebenbei verdiente sie sich ab und an ein wenig Geld mit der Niederschrift von Briefen für Menschen, die des Schreibens nicht mächtig waren. Nach einem Augenblick peinlichen Schweigens hatte Charles angeboten, sie zu begleiten, und sie hatte keinen Grund gesehen, es ihm zu verweigern. Bei dem Kunden jedoch, einem steinalten Töpfermeister, hatte er sich dann so dämlich angestellt, dass Anne der Auftrag beinahe durch die Lappen gegangen wäre. Sie erinnerte sich noch deutlich daran, wie er dem Alten jovial auf die Schulter geklopft und gedröhnt hatte, ein Mann habe es nicht nötig, sich mit der niederen Tätigkeit des Lesens und schon gar nicht mit dem Schreiben zu befassen. Er, der Töpfermeister, sei schließlich der beste Beweis dafür, dass man zu Wohlstand und Ansehen gelangen konnte, ohne es zu beherrschen. Anne hatte Charles gegen das Schienbein getreten, aber das hatte ihn nicht davon abgehalten nachzuschieben, das Schreiben sei ohnehin eine Tätigkeit für Pfaffen und Weibsleute.
Erst nach Annes wütender Zurechtweisung auf der Straße hatte er begriffen, dass der Töpfermeister zeit seines Lebens mit großer Begeisterung gelesen und auch selbst seine Geschäftsbriefe geschrieben hatte. Er war nun bloß halb blind und konnte es zu seinem großen Bedauern nicht mehr selbst tun.
Anne lehnte sich zur Seite und grub die Finger in die Erde eines Topfes, in dem sie im Frühjahr Kräuter zog.
«Was hat er gesagt?», fragte sie.
«Nicht viel. Ich glaube, sein Missgeschick von neulich ist ihm peinlich. Er will dir offenbar ein Geschenk machen und hat mich gefragt, was du wohl gerne hättest.»
«Ein hellblaues Seidentuch.»
Madeleine lachte. Sie wusste, dass Charles Anne bereits zwei dieser Tüchlein geschenkt hatte, für die diese keinerlei Verwendung hatte. Sie zerrissen ihr allenfalls unter den Händen, weil sie durch ihre Arbeit oftmals so raue Haut hatte.
Anne schüttelte sich. «Ich hasse Hellblau!»
«Ich weiß. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass du Grün bevorzugst.»
«Wenn du das tust, dann …» Anne schlug spielerisch nach Madeleine, traf sie aber nicht. «Obwohl …» Sie überlegte. «Vielleicht solltest du es doch tun, sonst kommt er nächstens noch mit einem Ring daher.» Sie prustete los, und Madeleine fiel ein.
«Genau», kicherte sie. «Weil du dir keinen selber machen kannst.»
Robert, Annes Vater, hatte sich als Messingschmied darauf spezialisiert, aus dem goldähnlichen Metall Schmuckstücke herzustellen, die sich auch weniger wohlhabende Händler und Handwerker für ihre Frauen und Töchter leisten konnten. Im Laufe der letzten acht Jahre hatte er in Ermangelung eines Sohns Anne die Feinheiten seines Handwerks beigebracht. Gerade vor wenigen Tagen hatte er gestichelt, wenn sie so weitermachen würde wie bisher, würde sie ihn in ihrer Kunstfertigkeit bald überholt haben. Anne drehte an einem schmalen Goldring, den sie an ihrer linken Hand trug. Eine feine Lorbeerranke war in ihn eingraviert. Robert hatte ihn ihr geschenkt, nachdem sie ihr erstes Buch in lateinischer Sprache durchgelesen – und auch verstanden – hatte.
Ein goldener Lorbeer für meine gelehrte Tochter!
Das waren seine Worte gewesen, als er ihn ihr überreicht hatte. Und François, ihr Pate, hatte strahlend vor Stolz daneben gestanden.
Der Ring war der einzige Schmuck, den Anne trug.
«Nein, dann doch lieber ein Seidentuch, schließlich ist meine beste Freundin ja auch keine Tuchhändlerin.»
Sie kicherten noch eine Weile, doch verstummten sie schließlich und saßen schweigend nebeneinander.
«Trotzdem solltest du dir bald darüber klar werden, ob du ihn willst oder nicht», sagte Madeleine mit ernster Stimme.
«Ich weiß.» Anne blies Luft durch die gespitzten Lippen. «Manchmal liege ich nachts wach und zermartere mir den Kopf darüber, was ich will.»
«Erzähl mir nicht, dass du das nicht genau weißt!»
Anne hob die Hände und fuhr sich durch ihr lockiges Haar. Wie immer auf der Dachterrasse hatten sich die einzelnen Strähnen durch den Nachtwind zu festen Knoten versponnen, und sie blieb mit den Fingern in ihnen hängen. «Ja, im Grunde weiß ich es.» Sie wollte einen Mann, der ihr gewachsen war, der sich für die Dinge interessierte, die sie begeisterten: ihre Arbeit als Messingschmiedin. Die gelegentlichen Aufträge als Schreiberin. Und den nächtlichen Sternenhimmel.
Besonders der Sternenhimmel, denn mit ihm hing jener Teil ihres Lebens zusammen, den sie am meisten mochte, den sie auf gar keinen Fall missen wollte.
Ihre Arbeit als Astrolabienbauerin.
Messing war das ideale Metall für sternenkundliche Instrumente aller Art, für tragbare Sonnenuhren, für Säulchenuhren, aber auch für Armillarsphären und Astrolabien, die man benötigte, um die Sterne zu beobachten und ihre Stellung am Himmel zu vermessen. Irgendwann im Laufe seines Lebens hatte Annes Vater begonnen, sich für diese Geräte zu interessieren, die hauptsächlich in den geistigen Zentren der arabischen Welt hergestellt wurden. Er hatte angefangen, Schriften über die Betrachtung und die Vermessung des Himmels zu sammeln, und alles über den Bau solcher Instrumente gelernt. Dann hatte er sich darangemacht, sie selbst zu konstruieren. Schnell hatte er sich weit über die Grenzen Béziers hinaus einen Ruf erworben – ja, er war stolz, das sagen zu können –, sogar weit über die Grenzen des Königreiches hinaus. Inzwischen zählten Gelehrte aus allen Teilen der Welt zu seinen Kunden, Männer aus den großen Klöstern im Norden des Heiligen Römischen Reiches, aus den Herzogtümern Sachsen und Franken, aber auch aus Apulien oder Sizilien. Ein Astrolabium hatte er sogar an einen Händler aus Byzanz verkauft, nachdem er dem Mann zufällig in Montpellier begegnet war.
Ebenso wie mit der Fertigkeit des Messingschlagens hatte Robert Anne mit der Kunst des Astrolabienbaus vertraut gemacht. Mit seiner Faszination für den Sternenhimmel hatte er sie ohnehin bereits als Kind angesteckt. Das Studium des Himmels und das Handwerk, Anne wollte keines von beiden missen, um welchen Preis der Welt auch immer.
«Aber abgesehen davon», nahm sie das Gespräch wieder auf, das durch ihr Schweigen ins Stocken geraten war, «kann ich Vater ohnehin nicht einfach allein lassen. Wer kümmert sich um ihn, wenn ich heirate und fortgehe?»
«Wenn du Charles heiraten würdest, müsstest du nicht fortgehen. Ihr könntet deinen Vater zu euch nehmen, wenn es nötig wird – aber so weit ist es ja noch lange nicht, oder?»
Anne ließ die Frage in der Finsternis stehen. Sie wollte Madeleine gegenüber nicht zugeben, dass sie sich um ihren Vater Sorgen machte. Sicher, er war ein alter Mann. Er war bereits alt gewesen, als sie auf die Welt gekommen war, über vierzig Jahre. Früher hatte sie es nur nie wahrgenommen. Robert war genauso schnell und leichtfüßig die Treppe zum Dach hinaufgestürmt wie sie, wenn es darum ging, eine neue Beobachtung zu machen. Und er hatte jeden einzelnen Stern genau erkennen können. In der letzten Zeit jedoch war sein Gang schwerfällig geworden. Manchmal klagte er über Schmerzen in den Gelenken, und beim Sterneschauen musste er immer häufiger die Augen zusammenkneifen, um überhaupt etwas erkennen zu können.
«Ach, Anne!» Madeleine tastete nach Annes Hand. «Du wirst mir ewig ein Rätsel bleiben!» Die Haut der Tuchhändlerin war weich und ein bisschen glitschig, so als habe sie sich die Hände mit einer Art Öl eingerieben. Anne beschloss, sich mehr um die Pflege ihrer eigenen Finger zu kümmern. Sie erwiderte Madeleines Händedruck und legte den Kopf in den Nacken. Die alte Giebelwand hinter der Bank hatte noch ein wenig von den Sonnenstrahlen des vergangenen Tages gespeichert. Die Wärme ließ Annes Scheitel prickeln.
Zwei besonders helle Sterne standen direkt über ihnen, einer im Bild des Großen Bären, einer in seinem Hüter.
«Schön sind sie», murmelte Madeleine plötzlich und ließ Annes Hand wieder los. Anne blickte aus den Augenwinkeln zur Seite und sah, dass auch ihre Freundin in den Himmel schaute. «Aber was beim Bild der Heiligen Jungfrau fasziniert dich so an ihnen?»
Anne verschränkte die Arme hinter dem Kopf. «Manchmal sehe ich die Geschichten, die sie erzählen, und manchmal sehe ich nur ihr Funkeln und Leuchten. Ist dir mal aufgefallen, dass einige von ihnen nicht weiß sind?» Sie wartete, bis Madeleine zustimmend brummte, dann fuhr sie fort: «Der da zum Beispiel, sieh mal, wie er schillert.»
«Rot, jetzt ein bisschen gelblich. Hmhm.» Madeleines Finger fuhr von dem bezeichneten Stern ein Stück nach links über den Himmel. «Schau mal, der da. Der ist noch viel bunter.» Madeleine zeigte auf einen Lichtpunkt, dessen Farbe zwischen Weiß und Blau changierte.
«Saturn.» Anne lächelte leicht. «Ja, der ist auffällig, nicht wahr? Aber er ist kein Stern.»
«Nicht?» Madeleine kratzte sich im Nacken.
«Nein, er ist ein Planet.»
«So.»
In der Dunkelheit wurde Annes Lächeln breiter. «Man nennt die Planeten auch Wandelsterne.»
«Und warum?»
«Weil sie sich anders bewegen als die anderen.»
Madeleine schniefte leise. «Die Sterne bewegen sich?»
So ungläubig klang sie, dass Anne laut auflachte. «Natürlich! Sag nicht, das ist dir noch nie aufgefallen!?»
«Sterne sind helle Punkte am Himmel. Da bewegt sich doch nichts!»
«Wann hast du schon mal länger als ein, zwei Augenblicke in den Himmel geschaut?» Anne nahm die Hände aus dem Nacken. «Man sieht es nur, wenn man Geduld hat. Die Sterne wandern ebenso über den Himmel wie die Sonne. Sie gehen im Osten auf und im Westen unter, und dabei ziehen sie jede Nacht eine kreisrunde Bahn quer über den Himmel.» Sie überlegte, ob sie genauer auf die Bewegungen des Himmels eingehen sollte, als Madeleine laut gähnte.
Anne nahm es als Zeichen dafür, dass ihr Gespräch über Sterne und Planeten beendet war. Inzwischen musste es fast auf Mitternacht zugehen. Sie setzte sich auf, um die Freundin zu verabschieden, aber Madeleine machte keine Anstalten, sich zu erheben.
«Hast du schon gehört, wer gestern Nacht gestorben ist?», fragte sie.
«Nein, wer denn?»
«Moïse ben Tibbon.»
«Wie schade!» Anne teilte Madeleines Vorliebe für Klatschgeschichten über die Reichen und Mächtigen der Stadt nicht. Moïse ben Tibbon war ein extrem wohlhabender jüdischer Kaufmann mit einer Leidenschaft für die Schriften der alten griechischen Gelehrten gewesen. Einmal, vor vielleicht zehn Jahren, hatte er bei Robert eine Armillarsphäre in Auftrag gegeben. Nachdem Robert sie ihm geliefert hatte, war er mit glühenden Wangen nach Hause zurückgekehrt und hatte von der Bibliothek des Mannes berichtet. Er besaß offenbar eine stattliche Sammlung arabischsprachiger Texte von Aristoteles-Schülern wie Eudemos von Rhodos oder Callipos von Cyzicus, darüber hinaus Texte von Platon, Plinius und vielen anderen Gelehrten.
«… immerhin hat die alte Maria aus der Ruelle des Halles mir erzählt, dass das Erbe unermesslich sein soll.» Die Art, wie Madeleine den Satz beendete, ließ Anne begreifen, dass sie eine Antwort erwartete, und sie erkannte, dass sie der Freundin eine ganze Weile nicht zugehört hatte.
«Ja? Kann sein.»
Madeleine boxte sie in die Seite. «Ich meine, es ist doch zu aufregend! Moïses Sohn Samuel wird das gesamte Vermögen erben. Er muss mit niemandem teilen, Anne, stell dir das mal vor! Obwohl: Es geht ja das Gerücht, dass er noch einen Bruder haben soll, aber der ist seit vielen Jahren verschollen.»
«Kann schon sein. Was weiß ich.» Anne hatte keine Lust auf ein solches Gespräch, und sie hoffte, dass die Freundin das begreifen würde.
Madeleine begriff. Sie verstummte und starrte einige Herzschläge lang schweigend vor sich hin. Dann stand sie auf und streckte sich. «Es ist spät! Du solltest auch wieder hineingehen.»
«Gleich.»
Madeleine war schon mit einem Fuß auf der Treppe, da schien ihr etwas einzufallen. Sie schlug sich vor die Stirn. «Ich Esel! Da hätte ich doch fast vergessen, warum ich eigentlich gekommen bin! Ich wollte dir sagen, dass ich morgen mit Jérome und Nadir für ein paar Tage nach Narbonne reisen muss. Kümmerst du dich um die Hühner, und vielleicht auch ein bisschen um die Katze?»
«Natürlich. Ist es etwas Geschäftliches?» Madeleine hatte zwei Cousinen in Narbonne, aber sie besuchte sie so gut wie nie.
«Ja. Nadir hat erzählt, dass im Hafen von Saint-Sebastien zwei Schiffe mit Wolle aus Korsika eingetroffen sind. Ich habe eine große Bestellung über eine halbe Karrenladung Köper angenommen, und der Kunde ist wählerisch. Er besteht auf erstklassiger Qualität.»
Anne erhob sich. Die beiden Frauen umarmten sich zum Abschied, dann lief Madeleine die Treppe hinunter.
Anne lauschte, wie die Schritte ihrer Freundin und deren leises Summen unten in der Ruelle des Artisans verklangen. Dann richtete sie den Blick wieder auf Saturn. Dicht über dem Horizont stand er, bald würde er von einem der beiden Türme an der Porte Olivier verdeckt werden. Sie ließ ihren Blick über den Himmel wandern, tastete mit den Augen über die bekannten Bilder, formte unsichtbare Verbindungslinien, die ihr als Pfade dienten, und schließlich hatte sie gefunden, was sie suchte.
Jupiter.
Sie stieß einen leisen Seufzer aus. Der Planet funkelte dicht neben einem der hellsten Sterne des Bilds Löwe.
«Du kleiner Mistkerl!», murmelte sie durch zusammengebissene Zähne. «Wie lange willst du mich noch an der Nase herumführen?»
«Vater?» Annes Nacken schmerzte ein wenig von der unbequemen Haltung, in der sie die letzte Stunde verbracht hatte. Sie lockerte die Schultern und betrat die Küche.
Ihr Vater war nicht dort. Anne trat an den Herd, schürte das Feuer und stellte sich einen kleinen Messingtopf in die Glut, in den sie einen Becher Wasser füllte. Sie hatte Lust auf einen starken Kräutersud vor dem Zubettgehen. Das Getränk würde sie schläfrig machen und sie die Frustration über Jupiter und sein unerklärliches Verhalten vergessen lassen.
Über die Schulter rief sie ein zweites Mal: «Vater?»
Ein leises Scharren über ihrem Kopf antwortete ihr. Sie blickte zur Decke und lächelte. Obwohl es inzwischen weit nach Mitternacht sein musste, arbeitete Robert noch in seiner Werkstatt, die sich genau über der Küche befand.
Anne legte noch ein Holzscheit auf das Feuer und ging dann nach oben. Die schmale Treppe, die direkt aus der Küche ins obere Stockwerk führte, endete auf einem winzigen Absatz, von dem drei Türen abgingen. Zwei davon führten zu Annes und Roberts Schlafräumen, die dritte rechter Hand in Roberts Werkstatt.
Anne klopfte an, dann öffnete sie vorsichtig die Tür. Robert saß auf einem dreibeinigen Schemel an seiner Werkbank, über etwas gebeugt, das Anne von ihrem Standort aus nicht sehen konnte. Ein leises Quietschen ertönte, und sie wusste, dass er an dem Instrument herumfeilte.
«Was ist?», fragte er, ohne sich umzuwenden.
«Hast du einen Moment Zeit?» Anne trat ein und schloss die Tür hinter sich. Im Raum, der von einem ganzen Dutzend Kerzen recht gut erhellt wurde, roch es nach Wachs und dem feinen, kaum wahrnehmbaren Aroma von Messing. Seit sie ein Kind war, hatte Anne versucht, für dieses Aroma Worte zu finden, und es war ihr nie gelungen. Es legte sich auf ihre Zunge wie ein kühler Belag, und manchmal glaubte sie, es an den Zähnen zu spüren, aber sie hätte nicht zu sagen vermocht, wie es roch.
Robert zog die Feile noch zweimal über sein Werkstück und legte sie dann zur Seite. Anne sah, dass es ein recht grobes Werkzeug war. Offenbar war Roberts Arbeit noch nicht sehr weit gediehen.
Sie trat neben ihn. Er hielt eine flache Messingplatte in Händen, aus der ein Halbkreis ausgesägt war. An ihrer Stärke – sie war fast so dick wie ein kleiner Finger – erkannte Anne, dass es sich bei dem Werkstück um ein Dorsum handelte, um die Grundplatte eines Astrolabiums, auf der später alle anderen Teile befestigt werden würden.
«Du feilst schon, obwohl du noch gar nicht mit dem Ausbohren fertig bist?» Anne tippte gegen das Messing. Üblicherweise achtete Robert darauf, seine Arbeitsschritte in exakt der richtigen Reihenfolge durchzuführen: Erst übertrug er mit einem Eisenzirkel von einer seiner Konstruktionszeichnungen einen Kreis auf die Messingplatte, dann bohrte er auf diesem Kreis dicht an dicht feine Löcher, anschließend brach er die auf diese Weise hergestellte Scheibe heraus und feilte die feinen Zähne glatt. Dass Robert mit dem Feilen angefangen hatte, bevor er mit dem Bohren fertig war, erschien Anne ungewöhnlich.
Er wischte sich über Gesicht und Stirn und blies sich einige weiße Haarsträhnen aus den Augen. «Ja. Ich konnte den Bohrer nicht mehr halten.» Er präsentierte Anne seine zu Fäusten geballten Hände, an denen die Knöchel heute dicker waren als sonst.
«Soll ich dir helfen?» Es wäre nicht das erste Dorsum, das Anne ausgebohrt hätte. Sie hatte bereits eine ganze Hand voll von ihnen hergestellt, sie mit dem ebenfalls aus dickem Messing bestehenden Limbus verlötet und auf diese Weise die Matern hergestellt, die Robert dann mit den restlichen Einzelteilen zu kompletten Astrolabien vervollständigte. Ihre Finger waren die harte Arbeit gewohnt.
«Nein, nein. Schon gut. Ich wollte ohnehin Schluss machen für heute.» Robert legte das halbfertige Dorsum fort. Anne sah die feinen, kreisförmigen Linien darauf, die später das Himmelsgewölbe abbilden würden. Der Anblick beruhigte sie. Beim letzten Astrolabium hatte er diese wichtige Arbeit vergessen, bevor er mit dem Bohren angefangen hatte. Die Scheibe war für seine Zwecke unbrauchbar gewesen und Robert danach eine Woche lang entsetzt über sich selbst, weil ihm ein so dummer Fehler unterlaufen war.
Nachdem Robert die Fäuste zweimal geöffnet und wieder geschlossen hatte, sah er zu Anne auf. Seine Augen schienen gerötet, aber das waren sie oft, wenn er bei Kerzenlicht arbeitete. «Nun?»
«Ich war gerade oben auf dem Dach.»
«Ich weiß. Hat Madeleine dich gefunden?»
«Ja. Hast du sie zu mir hochgeschickt?»
«Mhm. Was wollte sie?»
«Mir nur sagen, dass sie morgen für ein paar Tage nach Narbonne fährt.» Anne verzog das Gesicht. «Und mir wegen Charles ins Gewissen reden.»
Robert hatte damit begonnen, seine Knöchel zu massieren, aber jetzt hielt er inne. «Du kannst nicht für den Rest deines … meines Lebens hier bei mir bleiben, Anne! Madeleine hat schon Recht. Du musst dir endlich einen Mann suchen.»
Anne presste die Lippen zusammen und erwiderte nichts. Ein anderer Vater hätte das längst für mich getan, dachte sie und spürte einen Stich im Herzen. Du willst nicht, dass ich fortgehe, Vater, und du weißt genau, dass ich das weiß. Die Gedanken fühlten sich falsch an. Hatte sie nicht eben noch gedacht, dass sie gar nicht heiraten wollte? Konnte es sein, dass sie sich insgeheim doch danach sehnte?
«Möglich», wehrte sie dieses Thema ab. «Aber darum geht es mir nicht.»
Robert lächelte. «Nein. Darum geht es dir nie. Es geht dir immer nur um die Sterne, nicht wahr?»
«Wie dir.»
Sie lachten gemeinsam, aber es war ein angespanntes, beinahe trauriges Lachen. «Was wolltest du fragen?»
Anne holte tief Luft. Jetzt musste sie es ihm beichten. «Ich habe vor zwei Monaten damit begonnen, die Planeten zu studieren.»
Robert drehte sich mit seinem Schemel ganz zu ihr um, und die Beine des Möbels schrammten laut über den hölzernen Fußboden. «So? Ich kann mich erinnern, dass ich dich gebeten hatte, es nicht zu tun.»
Anne schämte sich, weil sie seiner Bitte – nein, seinem Befehl, denn das war es gewesen – nicht nachgekommen war. Kurz vor Weihnachten hatte sie ihn nach den Eigenarten der Planeten gefragt. Damals hatte sie in einem Brief, der aus einem seiner Bücher gefallen war, einen Hinweis auf seltsame Anomalien der Planetenbewegung gelesen und war neugierig geworden. Umso erstaunter war sie gewesen, als Robert ihr auf ihre Frage hin harsch über den Mund gefahren war. Zwar hatte er sofort eingelenkt und sich für seinen groben Ton entschuldigt, aber er hatte keine weiteren Fragen nach den Planeten geduldet und jene Worte ausgesprochen, die ihr noch allzu gut in den Ohren klangen: Die Sternenkundigen vor uns haben es vermieden, diesem Problem mehr Beachtung zu schenken als unbedingt nötig. So werden wir es auch halten!
Anne hatte noch am selben Tag begonnen, die Bahn des Jupiters zu studieren.
«Ich weiß, du musst deine Gründe haben, es mir zu verbieten», sagte sie jetzt und trat einen Schritt näher an ihren Vater heran. «Aber ich konnte mich nicht beherrschen, Vater! Dein Verbot hat mich so neugierig gemacht.»
Robert seufzte. «Ich hätte es wissen müssen.» Er hob beide Hände, um Anne am Näherkommen zu hindern. Was war das für eine Miene, fragte sie sich. War er wütend? Nein, eher zutiefst erschöpft.
Anne schluckte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihr Ungehorsam ihn derart treffen würde. «Diesmal geht es dir nicht darum, dass ich noch nicht genug weiß, um zu begreifen, nicht?»
Manche Beobachtungen hatte er ihr früher aus diesem Grund verwehrt, aber die Planetenstudien, das begriff sie plötzlich, sollte sie aus einem anderen Grund nicht durchführen.
Sie sah ihn den Kopf schütteln.
Rasch senkte sie den Blick. «Darf ich dich trotzdem fragen?»
Robert lachte wieder, aber diesmal klang es überhaupt nicht fröhlich. «Ich werde dich im Keller anbinden müssen, um dich davon abzuhalten, fürchte ich.»
Kurz erwog sie zu behaupten, es sei gar nicht so wichtig, es würde sie schon nicht mehr interessieren. Das wäre jedoch eine Lüge gewesen.
«Jupiter wandert über den Himmel», begann sie vorsichtig und tastete dabei mit den Blicken über die tiefen Linien im Gesicht ihres Vaters. «Aber sein Abstand zu den Sternen verändert sich, und zwar auf seltsame Weise.»
Robert erhob sich und begann, in der Werkstatt hin und her zu gehen. Die Metallspäne knackten leise unter seinen Schuhen. Anne griff nach dem halbfertigen Dorsum, ließ ihren Zeigefinger über die gefeilte, messerscharfe Kante wandern und wartete. Er weiß es nicht!, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. Er hat sich selbst nie mit den Planeten beschäftigt, und jetzt ist es ihm unangenehm, das zuzugeben. Oder er ist kläglich gescheitert. Beides schien Anne nicht sehr wahrscheinlich.
Endlich seufzte ihr Vater, blieb mitten im Raum stehen und wandte sich zu ihr um. Sie erschrak. Ein Ausdruck war in seinen Augen erschienen, der sie frösteln ließ. Er sah traurig aus. Unendlich traurig, wie nach einem schweren Verlust. «Wenn du möchtest, dann werde ich dir morgen eine weitere Lehrstunde über den Astrolabiumbau geben, ja?»
Anne sog die Wangen zwischen ihre Zähne. «Du weichst mir aus, Vater. Das funktioniert schon lange nicht mehr.»
Robert setzte sich wieder. «Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, sehr unbefriedigend für dich ist. Aber es wäre mir überaus wichtig, dass du aufhörst, dich mit den Planeten zu beschäftigen.»
Anne runzelte die Stirn. «Und warum?»
Robert rieb sich über das Kinn, wobei seine Bartstoppeln ein schabendes Geräusch verursachten. «Ich möchte es nicht. Kannst du das nicht akzeptieren?»
Anne ließ sich Zeit mit einer Antwort. Dann zuckte sie die Achseln. Was blieb ihr auch anderes übrig?
Der Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte, lag auf einem schmutzigen Strohsack, als die Tür zu seinem Verlies aufschwang. Das Quietschen der rostigen Angeln drang ihm durch Mark und Bein.
Er hob den Kopf. Ein rötlicher Lichtschein malte einen schmalen Balken auf den steinernen Fußboden. Fackellicht, dachte der Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte.
«Dein Vater ist tot.» Es war eine kühle, barsche Stimme, und sie überbrachte die Nachricht ohne die geringste Regung.
Der Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte, schloss die Augen und sandte seinen Dank gen Himmel. Warum er das tat, wusste er nicht genau, aber er wusste, dass er lange auf diese Nachricht gewartet hatte.
Sehr lange.
Die Tür schwang ein wenig weiter auf, und der Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte, setzte sich auf.
Es dauerte einen Moment, bevor die Stimme wieder erscholl: «Komm endlich!»
«Sagt mir erst, wie ich heiße!» Die Stimme des Mannes, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte, war rau, sie klang wie eingerostet. Wie lange hatte er nicht mehr gesprochen?
«Du scherzt, nicht wahr?» Ein Kopf erschien in der Lichtspalte. Ein Helm, glänzendes Metall von einem Kettenhemd, braune Haare und Augen. Der Wachmann war jung.
«Ich scherze nicht. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern.»
«Jehuda. Jehuda ben Moïse ben Tibbon.»
Der Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnert hatte, lauschte dem Klang der Worte nach. Sie hörten sich vertraut an. Er formte sie mit den Lippen. Seine Zunge sprach den Namen und stolperte über das Wort Moïse. Der Sohn Moïses. Etwas in ihm regte sich. Er spürte, wie Zorn in ihm aufwallte.
Er war nicht Moïses Sohn.
In diesem Verlies hatte er aufgehört, es zu sein.
Jehuda ben Tibbon. Das war sein Name!
Er stemmte sich aus seiner sitzenden Position in die Höhe. Seine Hüftgelenke protestierten mit dumpfem Schmerz, aber schließlich stand er. Seine ersten zwei, drei Schritte waren unbeholfen. Er humpelte, dann wurde es besser. Vor den drei Stufen zur Verliestür blieb er stehen. «Warum lasst Ihr mich frei?»
«Mach endlich!»
Der Mann, der Jehuda ben Tibbon hieß, knurrte leise, wie er es immer getan hatte, wenn einer seiner Bewacher ihn durch das Fensterchen in der Tür angesprochen hatte. Jetzt jedoch hielt er inne. Er war kein Tier mehr. Er hatte einen Namen. Und man ließ ihn frei. Er setzte einen Fuß auf die unterste der Stufen.
Der Wachmann streckte ihm die Fackel entgegen, um ihm zu leuchten, und das Licht blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen und rührte sich nicht.
«Oh, zu hell? Warte.» Die Fackel wurde gesenkt.
«Danke.» Das Wort lag so schwer auf seiner Zunge, als sei es aus Stein.
«Schon gut. Komm jetzt, alter Mann.»
«Wartet! Wer hat Euch den Auftrag gegeben, mich freizulassen?»
«Du weißt es nicht?» Der Wachmann klang ehrlich erstaunt.
Er wusste es. «Meine Tochter.» Er war Jehuda ben Tibbon, und er hatte eine Tochter. Wie lange war es her, dass sie das erste Mal zu ihm gekommen war? Dass sie durch die Klappe in der Tür mit ihm gesprochen hatte? Er hatte keine Zeitvorstellung, aber er erinnerte sich, dass er nur den allerkleinsten Teil der langen Jahre seiner Kerkerhaft gewusst hatte, dass er eine Tochter besaß.
«Ja. Jetzt beweg dich endlich.»
Bevor der Wachmann sich abwenden konnte, gelang es dem Mann, der Jehuda ben Tibbon hieß, einen Blick in sein Gesicht zu werfen. Es war ein hübsches Gesicht. Jehudas Hand wanderte hinab zu seinen eigenen zerlumpten Beinlingen, die ihn nur unvollkommen verhüllten. Die Fingerspitzen stießen gegen den Griff eines Messers.
Der Wachmann sah die Bewegung. «Mach keine Dummheiten!», warnte er. «Deine Tochter hat mir erzählt, dass sie dir ein Messer gegeben hat. Sie hat gesagt, ich soll mich vor dir vorsehen.»
Der Mann, der Jehuda hieß, ließ den Messergriff los, hob die Hand und erstarrte. War das wirklich seine Hand, dieses gekrümmte, gichtige Ding, das mehr einer Kralle glich als einem menschlichen Körperteil? Er versuchte, die knotigen Finger zu einer Faust zu ballen, und sie reagierten mit dem altvertrauten brennenden Schmerz. Ja, es war seine Hand!
Er schluckte schwer.
Sein Oberkörper sackte wie von selbst nach vorne, er ließ den Kopf sinken. Rechts und links neben seinem Gesicht sah er weiße Haare herunterhängen. Schneeweiß! Wie lange hatte er im Finstern gehockt, dass seine Haare weiß geworden waren, ohne dass er es bemerkt hatte? Er erinnerte sich daran, dass sie einmal schwarz gewesen waren, schwarz wie die Nacht, die er liebte. Er tastete über sein Gesicht. Seine schmale Nase. Ob die Wimpern ebenfalls weiß geworden waren? Er befühlte sie. Lang waren sie noch. Lang und seidig.
Um seinen Hals baumelte eine Kette mit einem fast handtellergroßen Anhänger. Er griff danach. Es war eine goldene Scheibe, in die fünf verschiedenfarbige Steine eingelassen waren. Ihr Glanz war unter all dem Dreck nur schwer zu erkennen.
Sein Befreier drehte sich zu ihm um und schaute auf seine knotigen Hände. «Was ist?»
Er schüttelte den Kopf. «Nichts. Ich bin alt geworden.»
Der Befreier nickte schlicht. «Ja, das bist du. Zweiunddreißig Jahre sind eine sehr lange Zeit. Jetzt komm endlich, bevor wir bemerkt werden.»
Langsam sank sein Arm nach unten. Auch diese Bewegung schmerzte, ebenso wie der nächste Schritt die Stufen hinauf. Er spürte, wie ihn das Gehen anstrengte. Sein Herz jagte, und seine Lunge brannte, und dennoch konnte er sich auf nichts anderes konzentrieren als auf die Worte seines Befreiers. Zweiunddreißig Jahre!
«Komm schon!»
Zorn wallte in ihm auf. Hatte der Mann nicht genügend Geld erhalten, um ihn mit der gebührenden Achtung anzusprechen? Er überwand die letzte Stufe. «Junger Mann?»
Der Befreier blieb erneut stehen. «Was ist denn?»
«Ihr kennt meinen Namen.»
«Natürlich.»
«Ihr wisst also, wer ich bin.»
Der Befreier blinzelte erstaunt. Seine Fackel hielt er jetzt wieder hoch erhoben, aber inzwischen war das Licht nur noch halb so schmerzhaft. «Natürlich weiß ich, wer du …»
Der Mann, der Jehuda hieß, näherte sein Gesicht dem des Befreiers. Ekel zeichnete sich in dessen Zügen ab. Er wich dem bohrenden Blick aus.
«Also?» Der Zorn wallte heiß und befriedigend durch Jehudas Körper.
«Natürlich weiß ich, wer Ihr seid», wiederholte der Bewacher tonlos.
Jehuda grinste. Seine verkrampften Muskeln entspannten sich.
Er wies mit dem Kinn den Gang hinauf, an dessen Ende sich eine weitere Tür befand. «Wenn ich da hindurch bin, dann bin ich ein freier Mann.»
Der Blick des Wachmanns zuckte zu dem Messer an Jehudas Hüfte. Jehuda nahm den Griff in die Faust. Es fühlte sich gut an. Richtig. War es nicht erst gestern gewesen, dass er eine Waffe wie diese geführt hatte? Bilder flammten vor seinem inneren Auge auf, ein junger Mann, abwehrend erhobene Hände, eine Blutspur, die sich in weitem Bogen über eine weiße Wand zog.
Jehuda steckte das Messer fort und verneigte sich leicht vor dem Befreier. «Ich danke Euch.»
Dann wandte er sich um und ging.
2. Kapitel
Der Fremde, der Galien de Montgris gegenübertrat, besaß das Gesicht aus seinen Albträumen. Bleiche Züge, eine schmale Nase, große, braun-schwarze Augen mit langen, seidigen Wimpern. Glatte, glänzende Haare in bläulich schimmerndem Schwarz.
Galien prallte zurück und suchte mit seinen Augen über der Schulter des Fremden nach Jean, seinem Großknecht, der mit gesattelten Pferden bereitstand und auf ihn wartete. Dann heftete er den Blick wieder auf den Fremden. Mit nichts hatte er weniger gerechnet, als ausgerechnet hier in Épernon an die Albträume aus seiner Kindheit erinnert zu werden! Er war im Auftrag seines Halbbruders, des Grafen von Montfort, hier, um Gäste im Empfang zu nehmen, denen sie bis Épernon entgegengeritten waren.
«Entschuldigt!», sagte der Fremde mit leiser, sanft klingender Stimme in schlecht verständlichem Französisch. «Ich wollte Euch nicht erschrecken!»
Galien fasste sich, aber er musste dazu beide Hände zu Fäusten ballen. Sein Herzschlag, der sich beim Anblick des Mannes unwillkürlich beschleunigt hatte, beruhigte sich wieder. «Ihr habt mich nicht erschreckt. Ich dachte nur einen Moment lang, Euer Gesicht schon einmal gesehen zu haben.»
Der Fremde lächelte und entblößte dabei ebenmäßige und sehr weiße Zähne. «Seid Ihr schon einmal in Béziers gewesen, oder in Montpellier?»
«Nein, warum?»
«Dann können wir uns noch nicht begegnet sein. Ich bin zum ersten Mal in Épernon.»
Galien nickte gemessen. Es war wohl besser, dachte er, dem Mann nicht zu erzählen, dass sein Erscheinen Erinnerungen in ihm wachgerufen hatte, die er längst vergessen geglaubt hatte. Erinnerungen an schweißgebadete Nächte, in denen ihn das Gesicht des Fremden aus den Schatten heraus angestarrt hatte.
«Mein Name ist Elias ben Aaron ben Tibbon. Ich bin unterwegs nach Montfort.»
«Ich stamme aus der Nähe von Montfort.» Galien leckte sich über Lippen, die mit einem Mal trocken waren. Fast hätte er auf Okzitanisch geantwortet, aber etwas hielt ihn davon ab, obwohl er die Sprache wahrscheinlich besser beherrschte als Elias das Französische. Seine Mutter hatte es ihm beigebracht, und sie hatte darauf bestanden, dass er es flüssig sprechen lernte, obwohl sie seit 32 Jahren nicht mehr in ihrer Heimat im Süden gewesen war.
«Ich weiß. Ich habe mit Eurem Diener gesprochen, und er sagte es mir.» Elias wies hinter sich auf Jean. Als dieser bemerkte, dass Galien den Blick auf ihn richtete, grinste er breit und entblößte dabei seine Zahnlücke.
«Ah, ja.» Galien zwang sich, Jeans Feixen zu ignorieren. «Wenn ich Euch in irgendeiner Weise behilflich sein kann, so lasst es mich wissen. Allerdings: Solltet Ihr Euch entscheiden, uns bis Montfort zu begleiten, müsst Ihr Euch noch einige Tage gedulden. Ich bin hier, um auf die Gesandtschaft von Abt Arnaud zu warten.»
Elias schüttelte den Kopf. «Danke. Bevor ich mich an Graf Simon wende, habe ich hier in der Gegend noch einiges zu erledigen.»
Galien musterte den Fremden. Er trug Kleidung, die hier oben im Norden ungewöhnlich war; sein Gewand fiel weit und faltenreich herab, beinahe wie das eines Sarazenen. An seinem breiten, durchbrochenen Gürtel hingen mehrere bunte Beutel, einige aus Samt, einige aus grobem Leinenstoff. Dazu trug er ein langes, leicht gekrümmtes Schwert, einen Dolch und einen Gegenstand, der in Galiens Augen wie ein eigenartig geformter Schlüsselbund aussah. «Wie der Zufall es will, befindet sich der Graf selbst ebenfalls hier. Zumindest wird er morgen in Épernon sein, heute ist er mit einigen seiner Männer auf der Jagd. Wenn Ihr also einen Tag wartet, könntet Ihr ihn hier antreffen.»
«Wie bedauerlich! Ich habe eine Verabredung in Rambouillet, die ich unbedingt einhalten muss.»
«Das ist von hier einen guten Tagesritt entfernt. Einen knappen, wenn Ihr ein schnelles und ausdauerndes Pferd habt.»
«Das habe ich.» Elias deutete mit dem Kinn über Galiens Schulter, der sich umwandte. Dort stand ein Pferd, wie er noch nie zuvor eines gesehen hatte. Ein Hengst, klein und zierlich. Seine Sehnen und Muskeln zeichneten sich unter dem dünnen, rötlichen Fell deutlich sichtbar ab. Ein schlanker Kopf reckte sich stolz in die Luft, seine Augen waren riesig und glänzten feucht. Für Galien sah es aus, als beobachte das Pferd seinen Herrn genau.
«Ist das eines dieser Wüstenpferde?» Galien hatte von den zierlichen, aber zähen und ausdauernden Tieren der Sarazenen gehört, bis heute aber niemals eines zu Gesicht bekommen.
Elias nickte. «In der Tat! Ihr habt ein gutes Auge für Pferde! Die meisten Menschen, die Tariq zum ersten Mal sehen, machen sich über ihn lustig.»
Galien zuckte die Achseln. Zu gerne hätte er das ungewöhnliche Tier, das noch dazu einen sarazenischen Namen trug, genauer in Augenschein genommen, aber er wollte Elias nicht um Erlaubnis bitten. Wenn dieser Mann mit seinem bleichen Gesicht auch eindeutig kein Sarazene war, so hatte Galien doch genug Geschichten darüber gehört, wie heikel ihre Besitzer mit den Wüstenpferden waren. «Verlasst Épernon in Richtung Osten. Die Straße wird Euch bis vor die Tore von Rambouillet führen.»
Elias neigte den Kopf. «Ich danke Euch. In Montfort werden wir uns vielleicht erneut begegnen. Es wäre mir eine Ehre.»
Galien lächelte dem Fremden zu. «Mir ebenso.» Mit den Augen folgte er dem Mann, der zu seinem Tier ging. Der Hengst begrüßte ihn, indem er den Kopf senkte und ihm gegen die Brust stieß.
«Na? Begehrliche Blicke?» Jean hatte sich Galien genähert, ohne dass dieser es bemerkt hatte.
Jetzt stupste Galiens eigenes Pferd, ein kräftiger Dunkelbrauner mit breiter Blesse, ihn an die Schulter und prustete ihm ins Genick.
«Schluss jetzt!» Galien nahm Jean die Zügel aus der Hand und verzichtete darauf klarzustellen, ob er mit seinem Großknecht oder dem Pferd gesprochen hatte. «Freilich», beantwortete er dann Jeans Frage. «So ein Pferd zu reiten, muss der Himmel auf Erden sein!»
«Vielleicht könnt Ihr den Grafen überreden, auf dem Markt in Rochefort nächste Woche eines zu kaufen.» Auch Jean blickte Elias ben Tibbon nach, als dieser den hellen Hengst wendete und in einer der Gassen verschwand.
«Baptiste und Lothar würden Augen machen! Aber ich glaube nicht, dass es in Rochefort solche Pferde zu kaufen gibt.» Galien riss sich vom Anblick der leeren Gasse los. «Komm. Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Abt nicht warten lassen wollen.»
Die Abtei von St. Thomas in Épernon war reich. Ihre Kirche ragte massiv und trutzig in die Höhe, als wolle sie Reisende schon von weitem darauf aufmerksam machen, dass hier einflussreiche Mönche lebten. Um die Kirche standen weit verstreut Dutzende von Wirtschaftsgebäuden, die meisten aus Fachwerk und mit holzschindelgedeckten Dächern. Dank der frühen Jahreszeit sahen die Wiesen um das Anwesen grün und saftig aus – sie würden erst später im Jahr verdorren und wie braune Flecken unter der sengenden Sonne liegen. Die Apfel- und Birnbäume standen in voller Blüte.
Die Kirche war von einer Mauer umgeben. Als Galien und Jean durch das Rundbogentor auf den Platz vor ihr ritten, erblickten sie eine Gruppe von ungefähr zwanzig Mönchen und Kriegern. Einige der Mönche saßen noch auf ihren Pferden, auf denen sie mit ihren nackten Beinen seltsam fehl am Platze wirkten, andere waren bereits abgestiegen und unterhielten sich mit den Domherren und den Laienbrüdern des Klosters.
Mitten unter den Mönchen, von denen die meisten das graue Gewand und Skapulier der Zisterzienser trugen, stand ein Mann, der die anderen um Haupteslänge überragte. Er war schlank und beinahe kahl, was seinem Gesicht mit der langen Nase ein gestrenges Aussehen gab. Auch er war wie ein Zisterziensermönch gekleidet, aber alles, seine Haltung, sein Gebaren und auch die selbstbewusste Rede, die er führte, zeigte Galien, dass dies der Mann war, den zu treffen er hergeschickt worden war.
Er lehnte sich zu Jean hinüber. «Sieh mal, das ist Arnaud Amaury, Abt von Cîteaux. Päpstlicher Gesandter und Herr über ein ganzes Heer von Legaten, die hier im Norden unterwegs sind, um den Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu predigen.»
«Steht wirklich ein Kreuzzug bevor?» Jean riss die Augen auf, was seinem Gesicht ein jungenhaftes Aussehen gab. Obwohl er mit seinen vierundzwanzig Jahren nur etwa zwei Jahre jünger war als Galien, wuchs ihm noch immer kein richtiger Bart.
«Innozenz will es so, aber derzeit sieht es wohl danach aus, als bliebe es ein frommer Wunsch.»
«Ich glaube, mein Lieber, da täuschst du dich.» Die Worte ließen Galien und Jean herumfahren. Hinter ihnen stand ein weiterer Mönch. Sein Habit war schmutzig und an einer Stelle bis fast hinauf zum Knie eingerissen. Er hatte ein rundes Gesicht, das von ungewöhnlich großen braunen Augen dominiert wurde. Kuhaugen, hatte Galien als Junge gespottet, und der so Verspottete hatte es gutmütig über sich ergehen lassen.
«Pierre!» Galien stieg aus dem Sattel und erwiderte die herzliche Umarmung des Mönchs. «Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist! Was ist dir geschehen?»
Pierre lächelte schmerzlich und rieb sich die Hüfte. «Ein Sturz vom Pferd. Ich fürchte, diese Biester und ich, wir werden in dieser Welt niemals Freunde werden.»
Galien lachte. «Das glaube ich auch nicht. Aber sag: Was tust du hier?»
«Ich begleite Onkel Guy.» Pierres Stimme war sanft und voll. «Simon hat ihn herbefohlen. Ebenso wie dich, vermute ich? Hat er dich gebeten, die päpstliche Delegation nach Montfort zu geleiten?»
Galien nickte. «Es war allerdings mehr ein Befehl.»
«Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einem Befehl Folge geleistet hättest.» Forschend sah Pierre Galien ins Gesicht. Der Mönch war nur wenige Jahre älter als er, knapp dreißig, aber sein hellbraunes Haar wurde bereits schütter. Das Leben im Kloster hatte jedoch noch keine einzige Falte in sein freundliches Gesicht gezeichnet.
«Nein, wohl eher nicht.» Galien schmunzelte. Graf Simon hatte in der Tat erneut versucht, ihm zu beweisen, wer der mächtigere von ihnen beiden war, indem er die Reise nach Épernon angeordnet hatte. Galien hatte sich nur gefügt, weil seine Mutter ihn gebeten hatte, nicht immer wieder Öl ins Feuer ihres alten Streits zu gießen. «Simon ist übrigens mit seinen Männern auf der Jagd.»
Pierre verzog das Gesicht. «Ohne dich.» Es war eine Feststellung, aber Galien ahnte die Frage dahinter.
«Ja. Du weißt, dass ich es vorziehe, mich nicht unter Simons Getreue zu mischen.»
«Warum nicht? Immerhin bist du sein Bruder!»
«Sein Halbbruder», korrigierte Galien. «So Leid es mir tut, an unserem Verhältnis hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.»
Simon war der älteste Sohn des vierten Grafen von Montfort und dessen Gattin Amicie. Galien dagegen, ebenfalls ein Sohn des Grafen, war unehelich geboren – der alte Graf hatte sich in seine Mutter verliebt, lange nachdem Simon geboren worden war. Zeit ihres Lebens hatte Simon Galien dafür verantwortlich gemacht, dass Amicie so beleidigt worden war. Er empfand seinen Halbbruder als lästigen Nebenbuhler.
Pierre starrte auf die schmale Narbe an Galiens Unterlippe. Sie war das Überbleibsel einer Prügelei, die Galien mit dem Grafensohn ausgetragen hatte, als sie beide noch Kinder gewesen waren; ein kleines äußeres Zeichen ihres schwelenden Konflikts.
Galiens Mittelfinger tastete über die Narbe, und er grinste den Mönch an. «Sagen wir, wir können es miteinander aushalten, seit Vater tot ist und Simon die Grafschaft geerbt hat. Lieben wird er mich nie, aber ich ihn auch nicht.»
«Nein.» Pierre klang traurig. «Wie schade.»
Galien erkannte in ihm mühelos den Träumer wieder, der er als Junge gewesen war. Bevor Pierre mit vierzehn Jahren als Novize ins Kloster von Vaux-de-Cernay eingetreten war, hatte er eine Zeit lang auf der Burg gelebt. Sein Vater hatte mit dem Gedanken gespielt, ihn zum Ritter ausbilden zu lassen, und so hatte Pierre viel Zeit an Simons Seite verbracht, um von ihm zu lernen. Er hatte den deutlich älteren Grafensohn mit der glühenden Bewunderung eines kleinen Bruders angehimmelt. Als Pierre sich schließlich doch entschieden hatte, Novize zu werden, hatte Simon kein Verständnis dafür aufbringen können. Im Kloster, wo die gräflichen Söhne seit Generationen eine Ausbildung im Lesen und Schreiben erhielten, hatte Pierre dann Galien kennen gelernt. Sie waren beste Freunde geworden. Bis heute wünschte sich Pierre nichts mehr, als dass die beiden Männer, denen er in Freundschaft und brüderlicher Liebe zugetan war, einander mehr als widerwillige Duldung entgegenbrächten.
«Und wobei täuschte ich mich?», fragte Galien fröhlich, um von dem unangenehmen Thema abzulenken.
«Nun, es ist richtig, dass der Papst den Kreuzzug seit Jahren vergeblich predigt. Es blieb sein frommer Wunsch, wie du sagst. Bisher jedenfalls. Aber vermutlich bist du nicht darüber informiert, dass König Philipp vor wenigen Tagen die drei weltlichen Anführer des Kreuzzugs ernannt hat.»
Galien war verblüfft. «Nein, das wusste ich nicht. Der Papst bittet doch seit Jahren um Unterstützung, und seit Jahren lehnt der König ab, weil er zu sehr mit seiner Fehde gegen England beschäftigt ist. Und auf einmal hilft er doch? Und wem hat er die Leitung des Kreuzzugs übertragen?»
«Dem Grafen von Nevers, Herzog Odo von Burgund und Graf Gaucher von Saint-Pol. Abt Arnaud wurde damit beauftragt, den Kreuzzug den Adligen hier oben im Norden zu predigen.»
«Das wissen wir bereits.»
«Dann ist Arnauds Schreiben bei Simon eingetroffen?»
«Ja. Montfort ist vorbereitet auf seinen Besuch, und Simon hat mir befohlen, dem Abt seine Freude und die Ehre darüber auszudrücken, dass er unter seinem Dach einzukehren beliebt.» Bei diesen Worten verzog Galien das Gesicht.
«Weißt du, warum er sich entschieden hat, ausgerechnet heute auf die Jagd zu gehen und dem Abt erst morgen seine Aufwartung zu machen?»
Galien zuckte die Achseln. Natürlich war es eine Taktik des Grafen, am Tag von Arnauds Ankunft nicht anwesend zu sein. Zwar hatte er sich selbst auf den Weg gemacht, um die Abordnung nach Montfort zu geleiten, was deutlich machte, dass er Arnauds Rang anerkannte. Doch nun gab er dem Bedürfnis nach, dem Abt seinen eigenen Rang zu demonstrieren, indem er ihn einen Tag warten ließ.
Galiens Blick wanderte über die Gesandtschaft und die Krieger, die sie begleiteten. Auch wenn Abt Arnaud das schlichte graue Gewand seines Ordens trug, so eilte ihm doch der Ruf voraus, ein Mann zu sein, der das gute Leben zu schätzen wusste. Genau in diesem Moment sah der Abt auf, und ihre Blicke trafen sich. Er löste sich aus der Menge seiner Begleiter und kam auf Galien zu.
«Ihr müsst der Graf von Montfort sein!» Er breitete seine Arme aus, als wolle er Galien umarmen, hielt jedoch einen Schritt vor ihm an und reichte ihm seine ringgeschmückte Hand.
Galien küsste den größten der bunten Steine. «Nein, ehrwürdiger Vater», sagte er, als er sich wieder aufrichtete. «Ich bin Galien de Montgris. Graf Simon ist heute leider verhindert, obgleich er sich in der Stadt befindet. Er schickt mich, Euch die Ehre zu erweisen.»
Wenn Arnaud mit diesem Empfang unzufrieden war, so ließ er es sich nicht anmerken. Ein strahlendes Lächeln glitt über seine Züge und verursachte unter seinem Kinn eine dicke Hautfalte. «Sehr schön! Wir sind vor einer halben Stunde erst eingetroffen. Wir kommen vom Herzog von Burgund. Er hat bereits das Kreuz genommen, und mit ihm einige andere, wie die Grafen von Dreux, Nevers und Auxerre. Und es heißt, der Bruder des Erzbischofs von Canterbury, Walter Langton, sei ebenfalls bereit. Meine Soldaten müssen sich nun erst einmal um die Pferde kümmern, außerdem warten wir noch auf eine Gesandtschaft aus Paris. Sie soll dieser Tage hier eintreffen. Sobald Euer Herr bereit ist, können wir nach Montfort aufbrechen.»
«Natürlich.» Widerwille stieg in Galien hoch, und er biss die Zähne zusammen. Simon war nicht sein Herr!
3. Kapitel
Die Porte Saint-Saturnin ragte düster in den blauen Himmel. Die beiden Türme, die das Tor flankierten, warfen scharfe Umrisse vor die Füße des Priesters. François de Lunel blieb stehen. Eigentlich hatte er es eilig, denn obwohl er als Seelsorger an der Sainte-Madeleine tätig war, forderte der Bischof von Béziers in regelmäßigen Abständen seine Dienste als Sekretär an. Meist arbeitete er an zwei Tagen in der Woche für den bischöflichen Palast, und heute hatte man ihn mit einer Botschaft zum Pfarrer von Saint-Saturnin geschickt, einer Kirche östlich der Stadtmauern.
Ihm blieb nur eine knappe Stunde für den Weg, für das Gespräch mit dem Pfarrer und die Rückkehr in den Palast. Dort warteten zwei Schreiben auf ihn, die beantwortet werden mussten. Und dann hatte er sich vorgenommen, heute Abend endlich einmal wieder seinem alten Freund Robert und dessen Tochter Anne einen Besuch abzustatten. Er hatte seine Patentochter seit Wochen nicht gesehen, und er sehnte sich nach einem Abend bei gutem Essen und einem gelehrten Gespräch mit lieben Menschen.
Trotz seiner Eile gelang es ihm jedoch nicht, die Porte Saint-Saturnin zu durchschreiten, ohne den Blick an ihrem Tor hinaufwandern zu lassen.
Hier hatte er damals gestanden, als Elaine die Stadt verlassen hatte …
Mit einem Mal kehrte das Jahr 1177 in ganzer Unmittelbarkeit zurück. Und da stand sie vor ihm: Elaine, seine Schwester. Tränen schimmerten in ihren Augen, als sie ihm eine Hand an die Wange legte. Er fühlte den Schmerz, der ihm die Brust zerriss, die Vorahnung, sie niemals wiederzusehen, die Angst, sie ins Ungewisse zu schicken, sie einer fremden, schrecklichen Gefahr auszuliefern. Schlimmer war diese Qual in seinem Innersten als das Brennen der frischen Wunde, die sich quer über sein Gesicht zog und die ihn daran erinnerte, wie gefährlich es für Elaine wäre, hier zu bleiben.
«Ich bin bald wieder da», flüsterte sie mit erstickter Stimme. Sie war immer die stärkere von ihnen beiden gewesen, und sie war es auch jetzt. François rannen längst die Tränen das Gesicht hinunter.