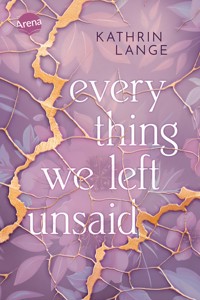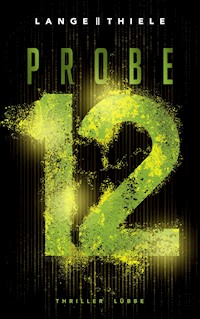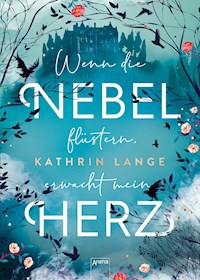4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitenwende bedroht das Abendland. Im beschaulichen Kloster St. Kyrillos trifft ein Schreiben der Kaiserin Theophanu ein und hebt die Welt der frommen Schwestern aus den Angeln: Die Äbtissin Alexandra und ihr Mündel Sophia erfahren, dass man ihnen nach dem Leben trachtet. Denn Theophanus Geheimnis ist mächtig genug, um Kaiserthron und Heiligen Stuhl ins Wanken zu bringen. Ein großer historischer Roman um das Maß der Zeit und die Ordnung der Welt in den dunkelsten Jahren des Mittelalters
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Kathrin Lange
Jägerin der Zeit
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eine Zeitenwende bedroht das Abendland.
Im beschaulichen Kloster St. Kyrillos trifft ein Schreiben der Kaiserin Theophanu ein und hebt die Welt der frommen Schwestern aus den Angeln: Die Äbtissin Alexandra und ihr Mündel Sophia erfahren, dass man ihnen nach dem Leben trachtet. Denn Theophanus Geheimnis ist mächtig genug, um Kaiserthron und Heiligen Stuhl ins Wanken zu bringen.
Ein großer historischer Roman um das Maß der Zeit und die Ordnung der Welt in den dunkelsten Jahren des Mittelalters
Über Kathrin Lange
Kathrin Lange wurde 1969 in Goslar geboren und ist gelernte Verlagsbuchhändlerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern bei Hildesheim und arbeitet als Mediendesignerin. «Jägerin der Zeit» ist ihr erster Roman.
Mehr über die Autorin erfahren Sie auf www.kathrin-lange.de.
Inhaltsübersicht
Für Petra E.
«Denn falls es Zukünftiges und Vergangenes gibt, will ich wissen, wo sie sind … Wo immer sie also sind, was sie auch sind: Sie sind nur, wenn sie gegenwärtig sind. Wenn man Wahres erzählt, holt man Vergangenes aus dem Gedächtnis hervor.»
Augustinus, Confessiones XI, 23
Dramatis Personae
Theophanu*
Kaiserin des Weströmischen Reiches
Rainald von Gerresheim
ihr Getreuer
Alexandra von Apamea
Äbtissin des Klosters von St. Kyrillos
Sophia
ein Findelkind
Gero von Verla
Sophias Jugendfreund
Ludger von Verla
sein Vater, sächsischer Adliger,
Alexandras Gefolgsmann
Hermann
einer der Gefolgsleute Ludgers
Gerbert von Aurillac*
Leiter der Domschule von Reims, Gelehrter
Judith
Gerberts Haushälterin
Michael von Tours
ein gelehrter Astronom aus Byzanz
Marinos
der Byzantiner
Adam von Trier
Gefolgsmann des Marinos
Sigbert von Wenkheim
sächsischer Krieger
Theodor von Sesto
sächsischer Krieger, Gefährte Sigberts
Adalbert Vojtěch * bold="1"
ehemaliger Bischof von Prag
Carolus
Abt des Klosters von St. Otmar
Alban
der Graf von Spoleto
Christophoros von Laodicea
sein Kastellan
Otto III.*
Kaiserin Theophanus Sohn
Christophoros, der Mönch
Enkel des Christophoros
von Laodicea
Die historischen Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
Teil 1
Prolog
7. Jahr der Königskrönung Ottos III.: April
Die Kaiserin sah bleich aus.
Der schlanke, hoch gewachsene Mann, der ihr jetzt gegenübertrat, nahm die Schultern zurück, legte die Rechte an den Schwertknauf und deutete eine leichte Verbeugung an. Er war wie ein Krieger gekleidet, trug einen ledernen Harnisch, der von einer weiten, ärmellosen Tunika aus heller Wolle beinahe vollständig verdeckt wurde. In seinem breiten Gürtel steckten außer dem Schwert – einer mehr als armlangen, schmalen Sachsenklinge – ein zweischneidiger Scheibendolch und ein handlicher Streitkolben. Seine Züge verrieten eine hohe Geburt: die breite, energische Stirn unter dunklen, glänzenden Haaren, die schmale Nase, helle Augen, das feste Kinn. Die Lippen waren zu blutleeren Strichen zusammengepresst, und der Blick, mit dem der Mann seine Kaiserin musterte, verriet die Sorge, die er um sie empfand.
Sein Name war Rainald von Gerresheim, und er war der engste Vertraute der Kaiserin.
Seine Herrin sah sich unruhig um, doch die weiten, säulenbestandenen Gänge des merseburgischen Palastes schienen leer und still. Da zog sie ein Schriftstück aus den Tiefen ihres Gewandes, sorgfältig aufgerollt und mit einer geflochtenen Kordel verschnürt, jedoch ohne Siegel oder Kennzeichnung. «Bringt dies zu jener Frau, die ich Euch genannt habe.»
Rainald nahm das Schreiben und warf einen zögerlichen Blick darauf.
«Ihr müsst Euch beeilen», fuhr die Kaiserin fort. «Die letzte Nachricht an Carolus konnte ich noch unbemerkt aus dem Palast schaffen, aber inzwischen wurde bemerkt, dass ich Vorkehrungen treffe.»
Rainald steckte das Schreiben in seinen Gürtel. «Was wollt Ihr jetzt tun?» Die Augen hielt er unverwandt auf das Gesicht der Kaiserin gerichtet. Sichtbar zeichneten sich die Adern unter ihrer zarten Haut ab. Dunkle Ringe lagen unter ihren braunen Augen, deren Lider jetzt flatterten. Sie schwankte ein wenig, und Rainald griff nach ihrem Ellenbogen.
«Der Hof wird morgen oder übermorgen nach Nimwegen weiterreisen. Ich werde mitziehen.»
«Ihr müsst Euch ihrem Zugriff entziehen!»
«Ich kann nicht.» Sanft entwand die Kaiserin Rainald ihren Arm.
«Warum nicht? Ihr habt gehört, dass König Hugo Laon errungen hat. Die Herrschaft Eures Sohnes in Lotharingien ist damit gesichert. Ihr solltet jetzt an Euch denken.»
Die Kaiserin schüttelte den Kopf. Die dunklen Locken, die sie zu einer kunstvollen Frisur aufgesteckt hatte, wippten sachte. «Ich kann Otto nicht alleine lassen.»
«Dann werden sie Euch töten!»
Jetzt schloss die Kaiserin die Augen. «Möglicherweise.»
Rainalds Hand fuhr zum Schwertknauf. «Das kann ich nicht zulassen!»
«Rainald, Ihr seid in den letzten Jahren mein einziger Vertrauter gewesen. Glaubt mir, ich würde Euch bedingungslos mein Leben anvertrauen.» Sie streckte die Hand aus, als wollte sie ihm über die Wange streichen, berührte ihn jedoch nicht. «Doch Ihr könnt mir hier nicht helfen. Was wir wissen, darf nicht in Vergessenheit geraten. Aus unerfindlichem Grund bin ich mir dessen ganz sicher. Vielleicht gibt Gott mir diese Überzeugung ein, genauso, wie er mir damals diese Handschrift zeigte.» Sie unterbrach sich. «Es ist wichtig, dass Ihr …»
«Wichtiger, als meiner Kaiserin das Leben zu retten?»
«Ich bin nicht mehr die Kaiserin, sobald mein Sohn mündig wird, denkt daran.»
«Für mich werdet Ihr immer die Kaiserin sein.»
Sie lächelte. «Ich weiß. Geht jetzt. Bringt dieses Schreiben zu … Handelt in allem so, wie wir es besprochen haben. Carolus weiß Bescheid.» Sie unterbrach sich erneut und warf einen ängstlichen Blick über die Schulter. Der Säulengang hinter ihr war leer.
Rainald zögerte noch immer. Er trat einen Schritt zurück und ließ den Schwertknauf los. Endlich nickte er. «Wenn Ihr es so wollt.»
Ein Schatten flog über das Gesicht der Kaiserin. «Was ich will, Rainald, spielt keine Rolle.» Sie reichte dem Krieger beide Hände. Er ergriff sie, straffte die Schultern.
«Lebt wohl, Rainald. Ihr müsst gut auf Euch achten.»
Er versuchte etwas zu sagen, bekam aber keinen Ton heraus. So deutete er bloß eine Verbeugung an, drehte sich dann rasch um und eilte davon. Die Schritte seiner Stiefel hallten noch eine ganze Weile in den Gängen wider.
Die Kaiserin blieb allein zurück.
Ein kühler Windstoß fuhr durch die scheibenlosen Fensterlaibungen und hob einen der zum Schutz aufgehängten Vorhänge an. Die Kaiserin schauderte; es sah aus, als duckte sie sich vor einem unsichtbaren Schlag. Sie warf sich auf dem Absatz herum und eilte davon.
Den Mann mit dem kurz geschorenen, hellbraunen Haar und der spitzen Nase, der sie aus dem Schatten einer verzierten Säule heraus beobachtet hatte und sich jetzt lautlos zurückzog, bemerkte sie nicht.
1. Kapitel
Zwei Wochen später
Das Kloster von St. Kyrillos lag eine knappe Tagesreise vor den Stadttoren von Reims mitten im Fôret de la Montagne auf einem Hügel, dessen Hänge man gerodet hatte. Feste, steinerne Mauern umfriedeten das Gelände und boten Schutz vor den wilden Kreaturen des Waldes, vor Wölfen und Bären, vor den herumziehenden Vaganten und Wikingern, die in den letzten Jahren immer weiter nach Süden vorgedrungen waren.
Im Inneren der Mauern lag eine Hand voll Gebäude verstreut, gute, solide Häuser mit Wänden aus festem Holz und mit Stroh und Schindeln gedeckt. Es gab ein Küchenhaus, ein Refektorium, ein Dormitorium, in dem die zwei Dutzend Nonnen schliefen, sowie einige kleinere Gästehäuser. Die Kirche auf dem Platz in der Mitte war ebenfalls aus Holz errichtet, aber sie besaß eine eiserne Tür, und ein wertvolles Altarkreuz aus Gold mit einem Reliquiensplitter des heiligen Kyrillos wurde dort aufbewahrt. Beide Gegenstände waren Geschenke eines reichen Grafen, der vor Jahren fast im Wald erfroren wäre, als ihm die Vorsehung den Weg in die rettende Wärme des Klosters gewiesen hatte. Die Kirche besaß keinen Kreuzgang, und so waren die Nonnen, deren Leben nach den Vorgaben des heiligen Benedikt geregelt war, gezwungen, die Stunden des Studiums entweder im Freien zu verbringen oder Refektorium und Dormitorium dafür zu nutzen.
«Es hat aufgehört zu regnen. Wollen wir uns ein wenig die Beine vertreten, was meinst du?» Eine Frau von ungefähr vierzig Jahren steckte den Kopf aus der Kirchentür und warf einen Blick in den Aprilhimmel, an dem Wolkenfetzen von einem scharfen Wind dahingetrieben wurden. Sie war in Gewänder gehüllt, die sie als Äbtissin des Klosters auswiesen, und ihre Haare lagen in weichen, braunen Wellen auf ihren Schultern. Früher hatte sie sich Alexandra von Apamea genannt, doch diesen Namen trug sie seit Jahren nicht mehr. Sie machte einen Schritt aus der Kirche und drehte sich zu ihrer Begleiterin um. Sophia mochte etwa neunzehn Jahre zählen, doch aus ihrem hübschen Gesicht mit der etwas zu spitzen Nase blickten zwei dunkle, verständige Augen.
«Gerne», entgegnete sie. «Wenn ich noch länger hier eingesperrt bleiben muss, fange ich an zu schreien.»
Es regnete seit Tagen in Strömen, und im Kloster waren alle aufs äußerste gereizt, denn das Wetter zwang die Nonnen, auf engstem Raum miteinander auszukommen.
Die Äbtissin überquerte den mit Feldsteinen gepflasterten Hof vor dem Kirchenportal und blieb an dessen Rand stehen. Ihr Blick fiel auf das nasse, niedergedrückte Gras und den aufgeweichten Weg. «Ist es so schlimm?»
«Johanna tut alles, um mir das Leben so unerträglich wie möglich zu machen.»
«Du übertreibst.» Vorsichtig setzte Alexandra einen Fuß auf das Gras und befand es für fest genug, um darüber zu gehen.
«Das stimmt nicht. Sie kann mich nicht leiden. Ich glaube, sie stört sich an meiner ungeklärten Stellung hier im Kloster.»
Sie erreichten die Hauptpforte, die um diese Tageszeit weit offen stand. Einer der Bauern aus dem nahe gelegenen Dorf, das dem Kloster gehörte, nutzte die Regenpause ebenfalls. Er trieb zwei Ziegen durch das Tor, die für das Küchenhaus bestimmt waren. Als er Alexandra erblickte, beugte er ehrfürchtig den Kopf. «Guten Tag, Mutter.»
«Hristof.» Alexandra lächelte ihn an. «Gute Ziegen hast du da. Mathilde wird sich freuen.»
Sophia sah Hristof an, dass er sich über das Kompliment freute. «Der Segen des Herrn liegt auf diesem Kloster, seit Ihr hier seid, Mutter.»
Mit einer Handbewegung entließ Alexandra ihn und durchschritt das Tor. «Was meintest du damit, als du eben von deiner ungeklärten Stellung im Kloster sprachst?», wandte sie sich wieder an Sophia.
Das Mädchen kaute auf ihrer Unterlippe herum. «Ich bin keine Nonne, aber ich gehöre auch nicht ins Dorf. Ich bin wie ein ständiger Gast hier.» Sie sah Alexandra von unten an und drehte eine ihrer Locken um den Zeigefinger. «Und Ihr wisst selbst, dass Gäste unbequem werden, wenn sie zu lange bleiben.»
«Du bist kein unbequemer Gast, du bist …»
«Ein Geschenk Gottes, ich weiß. Als meine Mutter mich damals auf den Stufen der Kirche aussetzte, muss sie gewusst haben, dass Ihr mich in Eurem Kloster aufnehmen würdet. Ich möchte auch nicht undankbar sein, ich habe ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, und ich darf mit Euch Studien betreiben.»
«Immerhin habe ich dir alles beigebracht, was ich selbst weiß.»
Die Frauen stiegen Seite an Seite vorsichtig den gerodeten Hang zum Waldrand hinab.
«Ja. Ich weiß.»
«Was willst du dann noch?»
Sophia blieb stehen und musterte die Äbtissin. Für einen kurzen Augenblick konnte sie nicht entscheiden, ob es klug wäre weiterzusprechen. Alexandra hatte sie im Kloster aufgenommen, obwohl niemand wusste, woher sie kam oder wer ihre Eltern waren. Sie hatte einfach eines Tages auf den Stufen der Klosterkirche gelegen, ein Säugling noch, kaum drei oder vier Wochen alt. Alexandra hatte dafür gesorgt, dass sie gut gekleidet und ernährt wurde – und sie unterwiesen, kaum dass sie sieben Jahre gezählt hatte. Sophia hatte Latein gelernt und einige Brocken Griechisch, die Muttersprache der Äbtissin. Sie konnte nicht nur lesen, sondern auch schreiben, und mit Hilfe der Finger konnte sie sogar rechnen. Was also wollte sie noch?
Gero!, schoss es ihr durch den Kopf, aber sie zwang sich, den Gedanken nicht weiterzuverfolgen, weil er zu schmerzhaft war. Stattdessen gestand sie Alexandra, was ihr oft keine Ruhe ließ. «Ich möchte wissen, wer meine Eltern sind», sagte sie leise. «Und ich möchte mich an eine Mutter erinnern können, die mich in den Armen gehalten hat, als ich noch klein war. Die mir Schlaflieder sang …» Sie stockte, denn sie spürte plötzlich einen Kloß in ihrer Kehle. Hastig schluckte sie ihn hinunter. «Ich erinnere mich nur an die alte Irmina. Und sie konnte überhaupt nicht singen.»
Über Alexandras Gesicht war Düsternis gefallen, als hätten sich die Wolken am Himmel wieder zugezogen. Sophia sah, dass auch sie schlucken musste. Sie spürte, dass die Äbtissin um eine Antwort rang.
Sophia blinzelte. «Ach», sagte sie leichthin, «ich glaube, ich bin von diesem elenden Wetter angesteckt worden. Verzeiht mir. Ich bin Euch natürlich dankbar für alles, was Ihr getan habt.» Ein wenig ließ ihre Traurigkeit tatsächlich nach.
Inzwischen hatten sie den Waldrand erreicht. Der Weg verschwand unter den ausladenden, aber noch völlig kahlen Kronen der Bäume. Sie schlugen ihn nicht ein, sondern wandten sich nach links und gingen am Rande des Unterholzes weiter. Sophias Füße wurden langsam nass, aber sie achtete nicht darauf.
«Was hat Johanna denn schon wieder gesagt, das dich so unruhig macht?» Alexandra hielt den Blick auf das Gelände vor ihnen gerichtet.
«Nichts Besonderes. Sie spottet ein wenig, das ist alles.»
Jetzt musterte Alexandra Sophia eindringlich, und Sophia kam es vor, als dringe ihr Blick bis auf den tiefsten Grund ihrer Seele. Sie weiß, dass du nicht die Wahrheit sagst, schoss es ihr durch den Kopf. Doch Alexandra nickte.
«Ich werde mit ihr reden.»
«Sie kann es nicht verwinden, dass Ihr mich Euer Wissen gelehrt habt. Sie hält mich für einen unehelichen Bauernbastard, und dass ich besser schreibe als sie, macht sie fuchsteufelswild.»
«Es ist ihre eigene Schuld. Sie arbeitet schließlich nicht sorgfältig genug, du hingegen schon. Sie sollte lieber versuchen, sich zu verbessern, statt dich durch ihre scharfe Zunge zu verletzen.»
Als sie den Hügel etwa zur Hälfte umrundet hatten, wurde der Pfad am Waldrand so schlammig, dass sie lieber wieder umkehrten. Sie erreichten den Hauptweg genau in dem Moment, als Hufschläge laut wurden.
Ein einzelner Reiter kam in raschem Trab aus dem Wald, ritt an ihnen vorbei, ohne sie zu beachten, und verschwand durch das Tor ins Innere des Klosters.
«Ein Bote.» Alexandra blickte ihm hinterher. «Lass uns nachsehen, was er bringt.»
Als sie den Klosterhof betraten, war der Bote gerade dabei, sein Pferd an einem der in die Mauer eingelassenen Eisenringe festzumachen. Er hörte ihre Schritte und drehte sich um.
Sophia registrierte mit einem einzigen Blick seine kostbare Kleidung, die wertvollen Waffen und auch die edlen Gesichtszüge. Eine kaum wahrnehmbare Aura von Anspannung und Trauer umgab ihn, die Sophia frösteln ließ. Instinktiv spürte sie, dass der Mann mit schlechten Nachrichten kam.
Der Bote hatte Alexandra offensichtlich als die Äbtissin des Klosters erkannt. «Seid Ihr Alexandra von St. Kyrillos?» Seine Stimme war tief und ruhig. Sophia spähte unter ihren dunklen Locken hervor in sein Gesicht.
«Ja.» Alexandra trat auf den Mann zu. «Und wer seid Ihr?»
«Rainald von Gerresheim. Ich komme im Auftrag …» Sein Blick fiel auf Sophia. «Ich habe eine wichtige Nachricht für Euch. Können wir irgendwo ungestört reden?»
«Sophia ist meine engste Vertraute.»
«Dennoch muss ich Euch um eine Unterredung unter vier Augen bitten.» Rainalds Stimme duldete keinen Widerspruch. Überhaupt benahm er sich ausgesprochen selbstbewusst, wunderte sich Sophia. Der letzte Bote, den sie gesehen hatte, ein noch recht junger Mönch aus dem Reimser Domkapitel, der dem Kloster ein Schreiben des Erzbischofs überbracht hatte, war nervös und unterwürfig gewesen. Alexandra bewirkte dies bei den meisten Menschen, die sie nicht näher kannten. Ihr Auftreten war von großer Würde und Distanz gekennzeichnet. Dieser Bote hier jedoch sprach, als stünde er mit der Äbtissin auf einer Stufe. Sein Auftraggeber musste eine hoch gestellte Persönlichkeit sein.
«Gut. Folgt mir.» Alexandra wies Rainald den Weg zum Refektorium. Doch anstatt die Halle zu betreten, gingen sie weiter zu dem Haus, in dem Alexandras Kammer lag.
Nachdenklich sah Sophia ihnen nach. Ein ungutes Gefühl breitete sich in ihr aus. Ein Bote, der offensichtlich aus hohem Hause kam und den Alexandra sogar mit in ihre Kammer nahm? Hatte Sophia sich getäuscht, oder war Alexandra blass geworden, als er sich kurz vor der Nennung seines Auftraggebers unterbrochen hatte?
Sophia setzte sich auf die oberste der beiden Stufen, die zum Kirchenportal hinaufführten, und wartete.
Alexandra hatte mit einem Blick in die Augen des Boten verstanden. Sie kannte diesen Ausdruck, der gleichzeitig von Rastlosigkeit und Trauer sprach. Er verriet das Wissen um eine Situation, die nicht zu ändern war und die direkt in die Katastrophe führen würde.
Es fiel ihr schwer zu warten, bis sich die Tür zu ihrer Kammer hinter ihr geschlossen hatte. Kaum verriet das leise Klicken des Riegels, dass sie unter sich waren, fragte Alexandra: «Ihr kommt von der Kaiserin, nicht wahr?»
Rainald blieb für einen Moment reglos mitten im Raum stehen, der nichts enthielt außer einem Lager, einer eisenbeschlagenen Truhe, einem Hausaltar und einem Kreuz aus Buchenholz. Dann drehte er sich zu Alexandra um und nickte.
«Was ist mit ihr?» Alexandras Herz schlug dumpf in ihrer Brust. «Ist sie gestorben?»
«Noch nicht.»
Die zwei Worte reichten aus, um Alexandra eine Gänsehaut zu verursachen. «Was meint Ihr damit?»
«Die Kaiserin befindet sich in großer Gefahr, und darum hat sie mich zu Euch geschickt. Ich soll Euch dies hier übergeben.» Rainald holte ein Schriftstück aus dem Beutel, den er um die Schulter hängen hatte, ein Stück Pergament, auf dem weder Absender noch Siegel, noch ein Adressat auszumachen waren.
Mit zitternden Fingern nahm Alexandra das Schreiben entgegen, zögerte jedoch, den formlosen Wachsklumpen zu zerbrechen, der das Dokument vor unbefugten Augen schützen sollte.
Rainald stand aufrecht und völlig ruhig vor ihr und wartete, bis sie sich einen Ruck gab. Sie löste das Wachs vom Pergament, wo es einen dunklen, fast kreisrunden Fleck hinterließ, schob die Kordel ab und entrollte das Schreiben. Rasch überflog sie es.
Liebste Gefährtin! Ich schreibe Euch in höchster Bedrängnis und ohne Zeit für Erklärungen. Rainald von Gerresheim, der Euch dieses Schreiben überbringt, wird Euch alles Nötige berichten.
Nur so viel: Ich befinde mich in großer Gefahr, und es steht zu befürchten, dass ich nicht mehr lange leben werde. Höhere Mächte, die ihren Ursprung in Byzanz nehmen, haben meinen Tod beschlossen. Vor einigen Monaten erfuhr ich etwas, das ich nicht erfahren durfte. Stunden und Wochen haderte ich mit Gott ob dieser Bürde, die meine Seele zutiefst erschüttert hat. Nun jedoch, da ich an der Schwelle des Todes stehe, sehe ich deutlich vor mir, dass mein Wissen eine Bestimmung hat. Ich habe begriffen, dass vieles, was ich getan habe, auch wenn ich manches davon inbrünstig bereue, einem höheren Ziel dient. Was ich erfahren habe, darf nicht verloren gehen. Gott verlangt von mir, dass ich Euch mein Geheimnis aufbürde.
Mein Herz ist schwer, indem ich Euch dies schreibe, denn Eure Schwester Maria ist tot. Sie war es, die mich auf das Geheimnis stieß. Sie wurde von Romanos’ Schergen getötet, jenen Männern, die nun auch meinen Tod planen.
Erinnert Euch an die Gespräche, die wir in Ingelheim führten, als ich Euch von der Kalenderreform des Kaisers Konstantin berichtete. Sie ist von großer Bedeutung für das Verständnis meines finsteren Geheimnisses.
Rainald wird es Euch enthüllen. Gott sei mit Euch und halte seine Hand schützend über Euch. Theophanu, Kaiserin und Freundin.
Romanos’ Schergen!
Alexandra sah auf, ihre Finger bebten. «Die silentiarii sind hier?»
Rainald war die Überraschung anzusehen. «Ihr habt von ihnen gehört?»
«Als junges Mädchen wurde ich einmal durch Zufall Zeugin, wie zwei Schreiber aus einem öffentlichen Scriptorium abtransportiert wurden. Das Tuch, mit dem der eine von beiden zugedeckt worden war, verrutschte, als sie ihn auf den Karren legten, und ich konnte einen Blick auf den Toten werfen.» Die Erinnerung drängte sich mit Macht in Alexandras Bewusstsein, das Summen der fettglänzenden Fliegen über der Leiche, der süßliche Geruch des Todes. Bilder fielen über sie her, gegen die sie sich nicht wehren konnte. Schneeweiße Haut voll Blut und dann, in der Menschenmenge, dieses stechend schwarze Augenpaar … Sie schüttelte sich. «Sie hatten ihm die Kehle von einem Ohr bis zum anderen aufgeschlitzt. Als ich fragte, wer das getan hatte, sagte man mir, es müsse sich wohl um Tagediebe handeln, aber hinter vorgehaltener Hand machte rasch ein anderes Wort die Runde.»
«Die silentiarii.»
«Ja. Romanos’ Mörderbande. Man munkelte, sie hätten die beiden Schreiber zum Schweigen gebracht, weil sie sich geweigert hatten, ihren Teil der Reform durchzuführen, wie man es ihnen aufgetragen hatte.»
«Und?» Rainald lehnte sich gegen die Wand.
«Ich forschte nach, aber jeder, den ich darauf ansprach, erzählte mir, die silentiarii seien eine wahnwitzige Erfindung. Niemals, versicherte mir mein Vater, würde der Hof zu solch unchristlichen Mitteln greifen und zwei Schreiber auf diese Weise beseitigen.» Alexandra schwieg, von ihren Erinnerungen überwältigt.
Rainald wartete geduldig, bis sie weitersprach.
«Eines Tages jedoch kam mein Vater nach Hause, bleich wie der Tod. Er teilte uns mit, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass es kein Gerücht war – dass die silentiarii tatsächlich existierten. Romanos hatte …» Ihre Stimme versagte. «Mein Vater starb auf ähnliche Weise wie die beiden Schreiber.» Sie selbst hatte ihn gefunden, und noch heute träumte sie manchmal von dem vielen Blut. Überall war es gewesen – auf seiner Kleidung, auf dem Fußboden, den Wänden, sogar an der Decke.
«Euer Vater war Quaestor?»
«Ja. Er hatte den Auftrag, Urkundenfälschungen aufzudecken und zu verfolgen.» Alexandra lachte bitter auf. «Das klingt wie Hohn, nicht wahr?»
Rainald nickte, und ein Zittern ergriff Alexandra. «Warum jagen sie die Kaiserin?»
«Weil sie etwas weiß, das sie eigentlich nicht wissen dürfte.»
«So viel habe ich begriffen.» Alexandra hob das Schreiben leicht an. Sie sah Rainalds Blick auf sich ruhen und Bedauern darin.
«Euch ist klar, was die Kaiserin von Euch verlangt, nicht wahr?»
«Wenn die silentiarii herausfinden, dass sie das Wissen an mich weitergegeben hat, werden sie auch mich jagen.»
Wieder nickte er nur.
«Warum zögert Ihr?», fragte Alexandra. «Die Kaiserin hat Euch den Befehl erteilt, es mir zu sagen. Warum tut Ihr es nicht?»
Schweigen trat zwischen sie, das Alexandra schließlich brach. «Ich trat in Theophanus Dienste, als ich noch ein kleines Mädchen war. Am Anfang bestand meine Aufgabe einzig darin, ihr die Haare zu flechten. Sie sagte immer, ich könne Zöpfe machen so fein wie ein kostbares Geschmeide. Wir waren ungefähr gleich alt, und es dauerte nicht lange, da wurden wir Freundinnen. Wir teilten viele Geheimnisse. Als sie mich fragte, ob ich mit ihr nach Westen reisen wolle, habe ich nicht einen Augenblick lang nachgedacht, und dennoch …» Das Bild ihres Vaters kehrte zurück, seine leeren, offenen Augen. Sie reichte Rainald das Schreiben. «Geht», verlangte sie tonlos. «Geht, und lasst mich in Frieden!»
Rainald sah auf das Schreiben, nahm es jedoch nicht an. Er biss die Zähne so fest zusammen, dass die Muskeln an seinen Schläfen hervortraten.
Alexandra ließ die Hand nicht sinken. Sie sah zu ihm auf. «Bitte geht. Ich kann es nicht.»
Der Bote blieb nur kurz.
Sophia sah ihn und Alexandra wieder aus dem Haus kommen. Sie gingen zu seinem Pferd, wechselten noch ein paar Worte. Alexandra sah auf ein locker aufgerolltes Stück Pergament und hielt es Rainald dann hin.
«Es tut mir Leid», sagte sie. «Bittet die Kaiserin um Vergebung.»
In Rainalds Gesicht zeigten sich widerstreitende Gefühle, dann nahm er den Brief an sich. Er steckte ihn fort, schwang sich in den Sattel, wendete und ritt ebenso rasch davon, wie er gekommen war. Für einen kurzen Moment hallten die Hufschläge seines Pferdes in dem Winkel von Refektorium und Kirche seltsam verstärkt wider, bis sie leiser wurden und schließlich in der Ferne verklangen.
Alexandra blieb nachdenklich mitten im Hof stehen. Sie erwachte erst aus ihrer Erstarrung, als Johanna, die Schreiberin, aus dem Scriptorium kam und das Wort an sie richtete: «Mutter? Was habt Ihr?»
Alexandra schüttelte nur den Kopf. Sophia sah den Zug von Ärger im Gesicht der Schreiberin, wunderte sich aber nicht darüber. Johanna war oft missgelaunt.
Sophia kaute auf ihrer Lippe herum. Ihr blieb nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie Alexandra mit gesenktem Kopf zur Kirche hinüberging, schwer die zwei Stufen erklomm und dann im Inneren des Altarraumes verschwand.
Ein leichter Nebel war von der Saale her aufgezogen und hatte Merseburg mitsamt seinen beiden Pfalzanlagen und der mächtigen Königsmühle unten am Fluss in einen Schleier gehüllt, der von den umliegenden Hügeln aus undurchdringlich schien.
Michael von Tours hielt sein Pferd an einer Stelle an, die ihm einen guten Überblick über das umliegende Land gewährte. Ein einsamer Kirchturm ragte aus dem Nebel und wies ihm den Weg, den er nur ungern zu Ende brachte. Ein starkes Gefühl von Widerwillen griff nach ihm und ließ seinen Körper starr werden, so als wehrte sich jede einzelne seiner Fasern dagegen, in diese Stadt zu reiten.
Es war nicht die Stadt, die er fürchtete. Es war einer ihrer Bewohner.
Michael rieb sich über Hals und Nacken, wo die Haut bereits faltig wurde, obwohl er noch kein alter Mann war. Er war von kleiner, hagerer Gestalt und trug nachlässige Gewänder, denen anzusehen war, dass er auf sein Äußeres wenig Wert legte. Sein Untergewand schaute aus dem weiten Ausschnitt einer schmuddeligen Tunika hervor. Sie bestand aus dicker Wolle, die für die Jahreszeit viel zu warm schien. Schweiß stand ihm auf der Stirn und rieselte ihm ins Genick.
Er dachte an das erste Mal, als er von dem Mann gehört hatte, den er bald aufsuchen würde. Damals, kam es ihm in den Sinn, damals hatte er auch geschwitzt in der sengenden Sonne. Er hatte die Hitze für die Übelkeit verantwortlich gemacht, die ihn bei Gregors Anblick plötzlich ergriffen hatte. Doch natürlich hatte ihn nicht die Sonne gezwungen, in die Büsche zu stürzen und den Inhalt seines Magens über die Erde zu verteilen. Es waren Gregors zu knotigen Stümpfen verdrehte Hände gewesen, die hellen Knochen der Finger, die durch die Haut stachen, das blutüberströmte Gesicht, in dem eines der Augen erblindet war … Michael kämpfte gegen die Erinnerung an, aber sie war stärker als er. Plötzlich befand er sich wieder in Byzanz, plötzlich war es wieder jener Tag, an dem sein bester Freund beinahe gestorben wäre.
«Bei allen Heiligen!» Er stützte sich an einem Baumstamm ab und hielt sich den Magen. Langsam klang das Brennen in seiner Kehle zu einem unangenehm sauren Geschmack ab. «Was ist mit dir passiert?» Nur widerwillig drehte er sich zu Gregor um.
Der stand schwankend vor ihm, eine Hand vorgereckt, als müsste er um Halt flehen, und obwohl Michael vor seinen grauenhaft verdrehten Fingern zurückschreckte, kam er dem Freund doch zu Hilfe. Er stützte ihn, führte ihn sachte zu einem großen Stein. Gregor stöhnte auf, als er sich vorsichtig darauf niederließ, und seine Lider flatterten bedrohlich.
«Was ist passiert?», fragte Michael erneut, drängend jetzt, voller Entsetzen und Sorge.
«Marinos», hauchte Gregor. «Marinos hat mich erwischt.»
«Aber warum?»
«Er glaubte, ich wüsste …» Eine Schmerzwelle packte Gregor und ließ ihn vornüberkippen. Nur mit Mühe gelang es Michael, ihn vor einem Sturz zu bewahren. Er half ihm, sich wieder aufzurichten. «Ich hole einen Heiler!»
Doch Gregor hob eine Hand und hielt ihn mit dieser Geste zurück. Für einen Augenblick starrte er auf seine grässlich zugerichteten Finger, und dann, als schämte er sich ihrer, ließ er den Arm hastig sinken. «Ich habe ihm nichts verraten, Michael, das musst du mir glauben!»
Michael hatte die Augen so weit aufgerissen, dass er seine eigenen Wimpern spüren konnte. Er hatte keine Ahnung, wovon Gregor sprach.
«Was meinst …»
«Ich habe ihm nichts verraten, diesem …», Gregor schwankte, «… diesem Bastard von einem sil …» Bevor er das Wort zu Ende gesprochen hatte, verlor er das Bewusstsein. Er sackte in sich zusammen. Michael fing ihn auf und ließ ihn behutsam zu Boden gleiten. Einen Augenblick lang wagte er es nicht, Gregor allein zu lassen aus Angst, er könnte sterben, bevor er mit Hilfe zurück wäre. Aber dann rannte er doch los, durch die Gassen von Byzanz, und er schrie so laut um Hilfe wie niemals zuvor in seinem Leben …
Ein einzelner Sonnenstrahl durchdrang die Wolkendecke über Merseburg und brachte Bewegung in den Nebel, der über der Stadt lag. Unter großer Anstrengung gelang es Michael, sich aus dem Bann der eigenen Erinnerungen zu befreien. Immerhin lag das alles jetzt einige Jahre zurück. Gregor war nicht gestorben, auch wenn es eine Zeit lang so ausgesehen hatte. Doch seit diesem Tag war sein bester Freund nicht nur auf einem Auge blind, sondern auch so verkrüppelt, dass er nicht mehr in der Lage war, selbst zu schreiben. Er, der begabte Schreiber und Forscher.
Was es war, das er auch unter der Folter nicht verraten hatte, hatte er Michael zu dessen Schutz niemals gesagt.
Michael stieß einen so tiefen Seufzer aus, dass sein Pferd beunruhigt den Kopf hob. Es hatte keinen Zweck, hier noch länger herumzustehen. Mit einem Schnalzen trieb er das Tier an und lenkte es den Hügel hinunter.
Marinos befand sich in Merseburg.
Und Michael musste ihm gegenübertreten, egal, wie sehr sich alles in ihm auch dagegen sträubte.
Am nächsten Tag hatte die Frühlingssonne sich endlich gegen den Regen durchgesetzt. Wald und Wiesen begannen zu dampfen, und gegen Mittag war es so warm, dass Sophia froh war, in der kühlen Schreibstube zu sitzen. Vor ein paar Tagen hatte Frida, die seit dem Tod einer älteren Mitschwester das Amt der Kellermeisterin übernommen hatte, unten im Dorf ein paar Aussaatlisten erstellt. Sie wollte sie ins Mutterkloster schicken, damit man dort die Höhe der fällig werdenden Abgaben einplanen konnte. Aus diesem Grund hatte Alexandra Sophia gebeten, beim Kopieren der Listen behilflich zu sein.
Es fiel Sophia jedoch schwer, sich zu konzentrieren. Seit der Ankunft des Boten am Vortag hatte sie keine Gelegenheit gehabt, mit Alexandra zu sprechen, und so brannte die Neugier noch immer auf ihrer Seele. Beinahe genoss sie das Gefühl, denn es lenkte sie von ihrem eigentlichen Kummer ab.
Die Sonne fiel in langen, schrägen Bahnen durch die Fenster des Scriptoriums. Sophia hatte das Kinn in eine Hand gestützt und verfolgte den Flug eines Spatzenpaares, deren Körper huschende Schatten auf den Fußboden malten. So zu zweit durchs Leben zu fliegen!
«Die Äbtissin braucht die Liste noch heute Abend!» Johannas Stimme war spitz, beinahe ein wenig gehässig, und sie riss Sophia aus ihren Tagträumen. Missmutig warf Sophia der Schreiberin einen Blick zu. Johanna war, wenngleich schon deutlich über dreißig Jahre alt, fast einen halben Kopf kleiner als Sophia. Zwischen ihren Augenbrauen stand ein spitzes, zorniges V, das ihr ein düsteres, unzufriedenes Aussehen gab.
«Ja, ja.»
«Ihr braucht nicht so aufsässig zu sein», zischte die Schreiberin. «Jede andere hätte Alexandra schon bestraft.»
So ein Unsinn, dachte Sophia. Jetzt fängt sie wieder mit ihrer unseligen Litanei an!
«Ich frage mich ohnehin, warum die Äbtissin Euch hier im Kloster bleiben lässt», murmelte Johanna, den Kopfüber eine Urkunde gebeugt, die sie schreiben sollte. «Ihr hättet schon längst verheiratet werden müssen, dann würdet Ihr Eurem Mann und nicht uns auf der Tasche liegen. Gero von Verla wäre der einzige Kandidat weit und breit, fürchte ich. Aber ich kann verstehen, dass Ludger sich dagegen sträubt, seinen Sohn mit einem elternlosen …» Sie brach ab, als Sophia ihr einen finsteren Blick zuschoss.
Bauernbalg, das war das Wort, das sich die Schreiberin gerade noch verkniffen hatte. Sophia unterdrückte ihre Wut auf die Nonne, die mit ihren unbedachten und gehässigen Worten all ihren Kummer auf einen Schlag zurückgeholt hatte. Natürlich würde Gero sie nicht wollen. Brütend betrachtete sie ihre schmalen Hände mit den länglichen, hellen Nägeln. Waren das Bauernhände? Sie schluckte den Zorn hinunter, dafür legte sich die Traurigkeit umso schwerer auf sie. Mit zusammengebissenen Zähnen füllte sie die letzten beiden Zeilen ihrer Liste sorgfältig mit Zahlen, beugte sich über die Wachstafel, auf der Frida ihre Angaben vorgeschrieben hatte, und strich die beiden untersten mit so viel Druck durch, dass der Griffel laut über das Holz unter der Wachsschicht schrammte. Sophia war fertig, und sie würde Johanna ihre Unverschämtheit zurückzahlen. Sie nahm das Pergament hoch und schwenkte es sachte hin und her. «Wisst Ihr, was der Bote gestern wollte?»
Johanna sah von ihrer Arbeit auf. Ihre blauen Augen blickten sie eisig an, dann beugte sie den Kopf wieder über ihre Arbeit. «Nein.»
Sophia unterdrückte ein Lächeln. In Johannas Blick hatte sie lesen können, dass die Schreiberin ebenso neugierig war wie sie selbst. Außerdem war darin eine erschrockene Vermutung zu erkennen gewesen. Die Vermutung, dass sie, Sophia, Bescheid wusste. Befriedigt ließ Sophia die Schreiberin in dem Glauben. Sie beobachtete sie eine Weile, wie sie Buchstabe um Buchstabe malte und dabei die Zunge immer wieder zwischen die Zähne klemmte. Dann konnte sie sich einfach nicht mehr beherrschen und setzte nach: «Er hatte schlechte Nachrichten.»
«Möglich.» Johanna betrachtete ihre Federspitze und wechselte den Kiel gegen einen anderen aus.
Gerade, als Sophia erneut etwas sagen wollte, öffnete sich die Tür des Scriptoriums, und Alexandra trat ein. Sie sah müde und blass aus, gerade so, als habe sie in der Nacht kein Auge zugetan. Und irgendetwas an ihr hatte sich verändert. Es dauerte eine Weile, bis Sophia erkannte, was es war: Die Ruhe und Gelassenheit, die ihre Äbtissin üblicherweise ausströmte, waren verschwunden. Sie schien angespannt und ängstlich.
Alexandra warf einen Blick über Johannas Schulter auf die Urkunde. Dann jedoch wandte sie sich an Sophia: «Ich habe nach dir gesucht.»
«Ich war die ganze Zeit hier.»
Die Äbtissin nickte. «Wir müssen etwas Dringendes besprechen. Komm heute Abend nach der Komplet in meine Kammer.» Sie sah zu Johanna, die sich demonstrativ tiefer über ihre Arbeit beugte und so tat, als habe sie nichts gehört.
«Gut. Hier ist die Liste, die Ihr haben wolltet.» Sophia reichte der Äbtissin ihr Pergament. Die warf einen schnellen Blick darauf.
«Die Liste? Ach ja, danke.» Sie nahm sie, machte auf dem Absatz kehrt und war bereits in der Tür, als sie sich noch einmal besann. «Ach, Johanna, wie lange, glaubt Ihr, braucht Ihr noch für die Urkunde über Ludgers Lehen?»
Die Schreiberin zuckte hoch. «Es dauert noch eine Weile.»
Alexandra überwand mit einigen raschen Schritten die Entfernung zwischen der Tür und Johannas Pult und sah auf das Pergament der Schreiberin. «Ihr habt nur noch wenig Platz, ist Euch das bewusst?»
«Ich werde schon alles darauf unterbekommen.»
Sophia hielt den Atem an, weil sie erwartete, dass Alexandra Johanna sogleich wegen ihres respektlosen Tones zurechtweisen würde. Sie tat es jedoch nicht.
«Denkt auch an die Datumszeile», sagte sie.
«Aber die Urkunde ist zu Euren Lebzeiten ausgestellt, das sieht doch jeder. Reicht das nicht?»
Dunkle Flecken erschienen auf Alexandras Gesicht. «Es reicht nicht! Auch, wenn es Euch nicht passt, ich möchte auf diesem Schreiben ein Datum. Und wenn Ihr keinen Platz mehr dafür habt, dann werdet Ihr es noch einmal abschreiben müssen. Es wird Euch eine Lehre sein, in Zukunft nicht so großzügig mit dem Platz umzugehen.»
Sie war schon wieder an der Tür, als Johanna knurrte: «Und welches Datum soll ich nehmen?»
«Wie datieren wir hier im Kloster unsere Urkunden?»
«Nach unserem Gründungsjahr.»
«Na also.» Der ruhige Klang ihrer Stimme schwang noch nach, als die Äbtissin schon lange fort war.
Nachdenklich starrte Sophia ihr hinterher. Es war noch nie vorgekommen, dass Alexandra nicht mehr wusste, was sie in Auftrag gegeben hatte. Und noch nie war sie so fahrig und ungeduldig gewesen, nicht einmal mit Johanna.
Sophia schickte sich an, das Scriptorium ebenfalls zu verlassen.
«Wo wollt Ihr hin?», rief Johanna hinter ihr her.
«Ich bin mit meiner Arbeit fertig.» Im Gegensatz zu Euch. Sophia konnte sich nicht beherrschen. Sie schlug einen Bogen, der sie um Johannas Stehpult herumführte, und warf einen Blick über die Schultern der um einiges kleineren Schreiberin. Auf Anhieb fand sie zwei falsche Deklinationen in dem lateinischen Text.
Sie unterließ es, Johanna darauf hinzuweisen.
«He, träumst du?»
Ein Schatten fiel über sie.
«Gero!» Sophia fuhr hoch und merkte jetzt erst, dass sie unter den wärmenden Strahlen der Frühlingssonne eingedöst war. «Hast du mich erschreckt!» Sie zwang sich zu einer gelassenen Miene und ließ den Blick an seiner schlaksigen Gestalt bis zu den Stiefeln hinunterwandern. Wie immer, wenn sie ihn sah, konnte sie sich nicht vom Anblick seiner Hände und Unterarme losreißen. Gleichzeitig kräftig und langgliedrig waren seine Finger, und unter seiner Haut waren die Sehnen deutlich zu erkennen.
Gero war der Sohn von Ludger von Verla, dem sächsischen Adligen, der in der Nähe des Klosters von Alexandra einen Hof als Lehen erhalten hatte. Die Urkunde, die Johanna soeben ausstellte, diente dazu, dieses Lehen noch zu erweitern. Alexandra hatte die Entscheidung dazu vor wenigen Wochen getroffen. Damit wollte sie Ludger für die Treue belohnen, die er ihr jetzt schon jahrzehntelang hielt. Soweit Sophia wusste, war Ludger vor etlichen Jahren zusammen mit Alexandra aus Griechenland nach Reims gekommen.
«Warum schläfst du auf der Kirchentreppe?»
Sophia setzte sich aufrecht hin. «Ich habe den ganzen Vormittag im Scriptorium für Alexandra Saatlisten geschrieben und wollte mich ein bisschen ausruhen.»
«Ich glaube, du hast das Mittagsmahl verpasst.»
Sophia zuckte verlegen die Achseln und zupfte an ihrem Gewand. In diesem Augenblick war sie froh, dass Alexandra sie wie eine Adlige in edles Leinen kleidete.
Gero sah auf sie nieder und pustete von unten gegen die blonden Haare, die ihm wie immer viel zu lang ins Gesicht hingen. «Hast du dich wieder mit Johanna gestritten?»
Sophia rutschte ein wenig zur Seite, und Gero nahm es als Aufforderung, sich zu setzen. Ein Kribbeln erfasste Sophias Haut am Arm, dort, wo er sie beinahe berührte.
«Möglich.»
«Tu nicht so kühl», schalt er. «Man kann dir ansehen, dass sie dich wieder einmal getroffen hat.» Die Iris seiner hellen Augen wurde von einem schmalen, dunkelblauen Rand umschlossen und sah dadurch immer ein wenig strahlend aus.
Sophia rupfte einen Grashalm aus einem Büschel an der Kirchenmauer ab. Sie musste sich dafür weit vorbeugen, und auf diese Weise konnte sie dem Blick seiner klugen Augen ausweichen.
«Johanna ist eine dumme Gans! Sie weiß genau, dass du ihr um Längen voraus bist, und das ärgert sie.»
«Ich glaube, am meisten ärgert sie, dass Alexandra mich ihr vorzieht.»
Gero lachte leise, und das Kribbeln rann Sophias Nacken hinauf. «Natürlich. Weil du die bessere Schreiberin bist. Das ist ja auch kein Wunder, bei dem Ehrgeiz, den du an den Tag legst. Latein, Griechisch, ich wünschte, ich hätte dein kluges Köpfchen.» Er machte Anstalten, ihr mit dem Fingerknöchel gegen die Stirn zu klopfen, tat es dann aber doch nicht, sondern ließ den Arm wieder sinken. Sophia sah, dass eine leichte Röte seine Wangen überzog.
«Du kannst auch Latein. Alexandra hat uns beide zusammen unterrichtet.»
«Ja, aber mir musste sie geduldig alles dreimal erklären, was du gleich beim ersten Mal begriffen hast.»
Sophia dachte nach. «Meinst du, dass die Tochter eines Bauern so schnell lernen könnte wie ich?»
«Natürlich, warum nicht? Mein Vater hat eine Menge Bauern in seinem Gefolge, die verständiger sind als ich.» Gero grinste. «Aber wenn du jemandem erzählst, dass ich das zugegeben habe, bekommen wir Ärger!»
Über Sophias Gemüt senkte sich ein Schatten. Gero beugte sich vor. «Oh, war das die falsche Antwort?» Er zögerte, doch dann legte er vorsichtig eine Hand auf die Finger, die Sophia auf ihren Knien ineinander verschränkt hatte. Sophias Herzschlag beschleunigte sich. «Wenn ich eines ganz fest glaube, Sophia», sagte er, «dann ist es, dass du niemals die Tochter eines einfachen Bauern sein kannst.»
Sophia wagte nicht, ihren Blick zu heben. «Danke.» Wenn sie nur nicht das Gefühl gehabt hätte, dass er das gesagt hatte, um ihr eine Freude zu machen.
«Gero. Hier seid Ihr.» Die feste Stimme ließ Gero herumfahren, als fühlte er sich bei etwas Verbotenem ertappt. Alexandra war um die Ecke der Kirche gebogen. «Euer Vater bittet mich, Euch auszurichten, dass Ihr auf dem Heimweg nach der alten Gundis sehen sollt. Es ging ihr gestern nicht gut. Und bringt ihm einen Beutel mit ihrem getrockneten marrubium mit. Ich glaube, Relindis quält wieder ihr altes Leiden.» Alexandra lächelte schwach. «Wenn Ihr Eure Unterredung beendet habt, sucht bitte nach Hristof und sagt ihm, dass seine Dienste gebraucht werden. Eines der Mutterschafe hat sich ein Bein gebrochen. Ach, und sagt Eurem Vater, er soll endlich einmal dafür sorgen, dass Ihr einen vernünftigen Haarschnitt erhaltet!»
Gero senkte den Kopf und nickte knapp. Alexandra wollte schon gehen, doch sie besann sich eines Besseren. Ihr Blick wanderte über die beiden jungen Leute. Plötzlich konnte Sophia spüren, dass die Äbtissin nur mit Mühe ihre Gefühle unterdrückte. Von ihr strömten Trauer und Angst aus wie ein durchdringender Geruch.
«Geht es Euch nicht gut?», fragte Sophia.
Alexandra warf einen raschen Blick über die Schulter. «Wir sprechen später darüber. Komm heute nicht nach der Komplet in meine Kammer, sondern während der Messe ins Scriptorium.» Mit diesen Worten ging sie endgültig, und Sophia schaute ihr nachdenklich nach.
«Irgendetwas stimmt mit ihr nicht.»
«Wie kommst du darauf?» Gero setzte sich wieder, und sie tat es ihm nach.
«Ich weiß nicht. Gestern Abend ist ein Bote gekommen, und seitdem ist sie so abwesend.»
«Wahrscheinlich hat er schlechte Nachrichten gebracht.»
«Ja, aber es ist mehr als Traurigkeit, findest du nicht?»
Gero dachte darüber nach und zuckte die Achseln. «Keine Ahnung.»
Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Sophia konnte spüren, wie ihr Kopf wieder anfangen wollte zu grübeln, aber irgendwie ließ Geros Gegenwart es nicht zu, dass sie erneut von Traurigkeit eingehüllt wurde.
«Wie stellst du dir dein Leben vor?», fragte sie Gero unvermittelt.
«Wie meinst du das?»
«Na ja, wie soll dein Leben weitergehen?»
Gero stülpte die Unterlippe vor. «Hm. Erst mal will ich meine Studien fortsetzen. Und meine Schwertübungen vorantreiben. Dann, denke ich, werde ich irgendwann den Hof meines Vaters übernehmen.»
Er hatte nicht davon gesprochen, sich eine Frau nehmen zu wollen. «Warum bleibst du hier?»
«Du meinst, warum ich nicht zu einem Freund meines Vaters gehe und mich zum Krieger ausbilden lasse?» Gero sah Sophia in die Augen und ihr wurde warm. Sie senkte die Lider.
«Vielleicht, weil ich nicht will.»
«Dein Vater hat schon immer viel zu viel darauf gegeben, was du willst.»
Gero grinste. «Ich bin sein einziger Sohn.»
«Ja. Aber warum willst du nicht von hier weg?»
Er zuckte erneut die Achseln und sprang auf die Füße. «Ich sollte jetzt gehen. Mein Vater erwartet mich, und ich muss vorher noch Hristof Bescheid sagen.»
«Sehen wir uns morgen?»
«Natürlich.» Gero machte auf dem Absatz kehrt und lief davon.
Sophia sah ihm nach und gab sich dem Bedauern hin, dass er fort war. Wieder hatte sie es nicht geschafft, ein offenes Gespräch mit ihm zu führen. Gero würde irgendwann in der nächsten Zeit mit einer reichen Sächsin verheiratet werden, und dann wäre es vorbei mit den Treffen im Schatten der Klostermauer oder auf der Kirchentreppe. Sophia erschauerte. Es kam ihr vor, als sei etwas von Alexandras neuer Unruhe auf sie übergegangen. Vielleicht sollte sie doch den Schleier nehmen …
Das Kloster besaß keine Glocke, und so benutzte man eine Art eisernen Gong, um die Nonnen zur Messe zu rufen. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit rief dieser Gong zur Komplet. Sein Klang wehte weithin über das Land. Sophia wusste, dass man ihn, wenn der Wind günstig stand, bis zu Ludgers Herrenhaus hören konnte.
Sie stand im Schatten des Scriptoriums und sah zu, wie die Nonnen eine nach der anderen in der Kirche verschwanden. Als Letzte gingen Frida und Johanna hinein, die den anderen am Portal mit brennenden Fackeln geleuchtet hatten. Die Tür fiel ins Schloss, und kurze Zeit später hörte man die Nonnen den ersten Hymnus anstimmen.
Alexandra erschien nur wenige Augenblicke später, als habe auch sie in der Dunkelheit gewartet.
«Sophia. Komm mit.»
Sophia fuhr erschrocken herum. Alexandra griff nach ihrer Hand und zog sie ins Innere des Scriptoriums.
Drinnen war es stockfinster, nur die Fenster zeichneten sich als hellere Vierecke gegen die Schwärze der Nacht ab. Sophia sah, wie der Mond von einer rasch dahineilenden Wolke verdeckt wurde.
Alexandra entzündete eine der Fackeln, die in eisernen Wandhaltern steckten, und das spärliche Licht riss ihre angespannten Züge aus der Finsternis. Tiefe Falten hatten sich in ihre Haut gegraben, die jetzt in dem flackernden Licht noch deutlicher ins Auge fielen.
«Was ist passiert?» Sophia trat neben die Äbtissin.
«Der Bote, der gestern gekommen ist, er hatte sehr schlechte Nachrichten.»
«Welche denn?»
Alexandra fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Ihre Haare hatten im Licht der Fackel einen stumpfen Glanz. «Meine Schwester ist gestorben.»
«Das tut mir Leid.»
«Ich habe sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, und ihr Tod liegt auch schon länger zurück. Ich habe nur jetzt erst davon erfahren. Die Nachricht von größerer Bedeutung aber ist: Es kann sein, dass auch Kaiserin Theophanu bald stirbt.»
«Die Kaiserin?» Sophia fühlte, wie ihr Herz aussetzte. Nie im Leben hätte sie vermutet, dass der Bote von der Kaiserin gekommen war. Sicher, sie wusste, dass Alexandra früher einmal zum Hofstaat gehört hatte. Sie war damals mit Theophanu aus Byzanz gekommen, als die Kaiserin mit Otto II. verheiratet werden sollte. Doch solange Sophia sich zurückerinnern konnte, hatte die Äbtissin niemals Kontakt mit dem Hof gehabt. Was hatte dies nur zu bedeuten?
«Es ist besser, wenn du so wenig wie möglich weißt. Nur so viel: Es kann sein, dass ich das Kloster demnächst verlassen muss. Und ich muss wissen, was in diesem Fall mit dir geschehen soll.»
«Das Kloster verlassen?», wiederholte Sophia wie eine Närrin.
«Was soll ich mit dir machen, wenn ich fortmuss, Sophia? Das Beste für dich wäre wohl, wenn du hier bliebest.»
Sophia nickte, ohne darüber nachzudenken. Zu nahe waren noch ihre Überlegungen vom Nachmittag: den Schleier nehmen und im Kloster bleiben. Doch diesen Gedanken hatte sie gehegt, als sie noch angenommen hatte, Alexandra würde bis zu ihrem Tod Äbtissin bleiben. Sollte sie nun fortgehen, sah die Sache für Sophia plötzlich ganz anders aus. «Nein!», erwiderte sie, und das eine Wort überschnitt sich mit ihrem letzten Nicken.
Alexandra zog eine Braue in die Höhe.
In Sophias Kopf rasten die Gedanken. Die Nonnen würden eine neue Vorsteherin wählen, und sie würden sich dabei zwischen wenigen Frauen entscheiden, die bereits jetzt herausragende Stellungen im Kloster innehatten: Frida, zum Beispiel, die Kellermeisterin, oder Gertrud, die zuständig war für alles, was durch Schenkung, Zins oder Kauf an das Kloster geriet.
Und auch Johanna war eine durchaus denkbare Anwärterin auf das Amt, denn Alexandra hatte ihr vor etwas mehr als einem Jahr die Verantwortung für die Sakristei übergeben, um ihre ständige Eifersucht auf Sophia zu besänftigen. Genutzt hatte es nicht viel, es hatte im Gegenteil nur dazu geführt, dass Johanna sofort versucht hatte, einen Großteil der Nonnen auf ihre Seite zu ziehen und gegen Sophia aufzuwiegeln.
Es war durchaus möglich, dass Johanna die neue Äbtissin des Klosters werden würde, und abgesehen davon: Würde Sophia es ertragen können, in Geros Nähe zu sein, sobald er einmal verheiratet war?
«Nein», sagte sie noch einmal.
Alexandra nickte. «Gut.»
«Aber wohin soll ich dann?»
«Ich werde darüber nachdenken. Heute habe ich dich hierher gebeten, weil ich zuerst eine Entscheidung von dir brauchte. Da du nicht hier bleiben willst, sorge dafür, dass du von heute an zu jedem Augenblick abreisebereit bist. Du besitzt nicht viel; halte alles zusammen, sodass du schnell ein einfaches Bündel schnüren kannst.» Alexandra nahm Sophia bei den Armen und bohrte ihren Blick in sie. Sophia glaubte, in dem Flackern, das die Äbtissin zu erfüllen schien, versinken zu müssen. «Und nun höre gut zu. Du darfst niemandem, ich wiederhole, Sophia, niemandem von diesem Gespräch erzählen. Hast du mich verstanden?»
«Ich …»
«Niemandem! Auch nicht Gero. Versprich es mir, Sophia!»
Sophia nickte verwirrt. «Gut.»
«Versprich es!»
«Ich verspreche es.»
Endlich ließ Alexandra ihre Oberarme wieder los. Sophia unterdrückte den Impuls, sich die schmerzenden Stellen zu reiben. In dem Moment, als Alexandras Gesicht in die Schatten zurückwich, erlosch auch das Flackern in ihren Augen. Wahrscheinlich war es nur der Widerschein der Fackel gewesen, dachte Sophia.
Trotzdem war in ihr das Unbehagen zu einem nagenden Angstgefühl geworden.
2. Kapitel
Was ist? Man sollte meinen, die lange Reise hätte Euren verweichlichten Schreiberleib genügend gestärkt, um Schritt halten zu können.» Einer der beiden Sachsen, die Michael durch Zufall in einem Gasthaus in Merseburg getroffen hatte, verlangsamte den Schritt und drehte sich zu ihm um.
Michael verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die der eines verspotteten Kindes nicht unähnlich war. «Ich halte Euch zugute, Sigbert von Wenkheim, dass Ihr den Mann nicht kennt, zu dem Ihr mit diesem Eifer unterwegs seid.»
Der Sachse lachte. «Schon gut. Ihr habt mehr als einmal erwähnt, dass es klug ist, vorsichtig zu sein! Dennoch könntet Ihr Euren Schritt ein klein wenig beschleunigen, sonst sind wir heute Abend noch nicht da.» Er sah aus wie ein Krieger, hatte blonde, weiche Haare, eine hoch gewachsene, kräftige Gestalt mit hängenden Schultern und riesigen, wie Schaufeln aussehenden Händen. Michael hatte in dem Wirtshaus, in dem er sich nach der langen Reise eine Mahlzeit gegönnt hatte, mit angehört, wie Sigbert sich mit seinem Begleiter über Marinos unterhielt. Einem Impuls folgend, hatte er die beiden angesprochen. Er hatte herausgefunden, dass auch sie auf dem Weg zu dem Byzantiner waren, und sie waren schnell übereingekommen, ihn gemeinsam aufzusuchen.
Nun aber, da er hinter den beiden her durch die Stadt eilte und kaum Schritt halten konnte, war sich Michael nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee gewesen war. Er hatte nicht die Absicht, völlig durchgeschwitzt und außer Atem vor Marinos zu treten, und er konnte die beiden Sachsen einfach nicht dazu bringen, ihre langen Schritte den seinen anzupassen.
Er biss die Zähne zusammen. «Schon gut!»
Sigbert lachte noch lauter. Dir wird das Spotten schon noch vergehen, dachte Michael säuerlich. Spätestens, wenn du Marinos gegenüberstehst und feststellst, dass er dich mit einer Hand zerquetschen kann.
Wieder wollten ihn die Erinnerungen an Gregor einholen, doch diesmal drängte er sie erfolgreich zurück, indem er sich in Erinnerung rief, was er von Marinos wusste. ‹Der Byzantiner› wurde er von vielen genannt, als sei es gefährlich, seinen richtigen Namen auszusprechen, und vielleicht war es das auch. Das Auffallendste an ihm, so sagte man, seien seine seltsamen Augen; schwarz sollten sie sein, und von so undurchdringlicher Tiefe, dass man nicht erkennen konnte, wo seine Pupille aufhörte und wo die Iris begann. Es hieß, Marinos anzusehen bedeute, in ein abgrundtiefes, finsteres Loch zu blicken. Michael kannte den Grund für die merkwürdigen Augen des Byzantiners. Wie ein gutes Dutzend anderer Männer war er ein direkter Nachkomme von Romanos Lakapenos, bei dem diese auffällige Augenfarbe zum ersten Mal aufgetreten sein sollte. Durchaus gelehrte Männer hatten Michael gegenüber behauptet, sie sei eine Strafe Gottes für die Brutalität gewesen, mit der Romanos damals … Schnell schüttelte Michael diesen Gedanken wieder ab. Es war wohl besser, sich nicht ausgerechnet jetzt mit Marinos’ Verbindung zu dem seit vielen Jahren verstorbenen Admiral zu belasten.
Mit langen Schritten eilte er den Sachsen nach, vorbei am Laurentiusstift und dessen Kathedrale, quer über den Platz vor der kaiserlichen Pfalz und hinein in das Händlerviertel, das von der Burgmauer in zwei Teile geteilt wurde. Das Haus, auf das sie jetzt zusteuerten, lag im Inneren der Burganlage. Sigbert hielt einen vorbeigehenden Händler an. «He, guter Mann, könnt Ihr mir sagen, ob in diesem Haus ein gewisser Marinos Phokainos wohnt?»
«Ihr meint den Byzantiner? Ja.»
Sigbert deutete eine Verbeugung an. «Ich danke Euch!» Der Händler ging seiner Wege, und Sigbert trat vor die Tür des Hauses. Das Geräusch seiner Faust auf dem Holz hallte dumpf durch das Gebäude, und mit einem Mal schlug Michael das Herz bis zum Hals.
«Marinos ist auch aus Byzanz?» Sigberts Begleiter, Theodor von Sesto, sah Michael fragend an. Die Sachsen waren, wie Michael ebenfalls, aus dem Oströmischen Reich nach Merseburg gekommen. Es irritierte Michael, wie ähnlich sich die beiden sahen, obwohl sie keine Brüder waren. Zumindest hatten sie das behauptet.
«Marinos Phokainos ist ein Nachfolger von Romanos Lakapenos.» Michael starrte auf die Tür, während er das sagte, und bemühte sich, nicht atemlos zu klingen vor Nervosität. Mit einem raschen Seitenblick nahm er Theodors arglose Miene zu Kenntnis. Er stöhnte innerlich auf und fragte sich, ob es ein Zeichen innerer Schwäche war, dass die neuen Krieger, die Byzanz in den Westen schickte, nicht einmal mehr über den Ursprung ihrer Bewegung informiert waren. Michael überlegte, ob er Theodor erklären sollte, wer Romanos Lakapenos und die silentiarii waren, entschied dann aber, dass es besser sein würde, den Mund zu halten. Ohnehin wurde in diesem Moment die Tür geöffnet, und ein junger Diener streckte den Kopf heraus. Sigbert stellte sich und seine beiden Begleiter vor. «Dein Herr erwartet uns.»
«Kommt herein.» Der Diener führte sie durch eine Art Vorraum und brachte sie in einen großen Saal, der fast das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes einzunehmen schien. Michael bekam keine Gelegenheit, sich ausgiebig umzusehen, denn sein Blick wurde sofort von einem Mann auf sich gezogen, der mit dem Rücken gegen einen der hölzernen Deckenpfeiler gelehnt stand. Wie ein sprungbereites Raubtier wirkte er. Seine extreme Magerkeit, die Sehnen, die sich unter seiner hellen Haut wie Seile abzeichneten, und die langen schwarzen Haare verstärkten diesen Eindruck noch. Nur wenige graue Strähnen zogen sich an Marinos’ Schläfen entlang, und sie waren neben den eingefallenen Wangen das einzige Anzeichen dafür, dass der Byzantiner bereits über fünfzig Jahre zählte. Michael drohte sofort in den Sog seiner tiefen, schwarzen Augen zu geraten, und so sah er rasch zur Seite. Ihm war klar, dass ihm dies womöglich als Schwäche ausgelegt würde, aber er konnte nicht anders. Er schluckte hart und entschied, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als den Stier bei den Hörnern zu packen. Mit zitternden Knien schob er sich an Sigbert vorbei und trat vor Marinos hin. Als er zu sprechen begann, hoffte er inständig, dass seine Stimme nicht bebte. «Ich grüße Euch.»
Weiter hinten im Saal hielten sich zwei weitere Männer auf. Sie waren in Schatten gehüllt und nur undeutlich zu erkennen: Alles, was Michael wahrnahm, war die weibisch wirkende Gestalt des einen. Da beide jedoch keine Anstalten machten, vorzutreten, vermutete Michael, es müsse sich um Diener handeln, und ignorierte sie. «Byzanz schickt Euch diese beiden Sachsen zur Verstärkung. Wir trafen uns in einem der Gasthäuser an der Stadtmauer, das die Leute hier weit gereisten Fremden empfehlen. Und so schloss ich mich ihnen an, als ich hörte, dass sie sich zu ihrem Dienstantritt bei Euch melden wollten.»
«Dann wart Ihr ebenfalls auf dem Weg zu mir?» Marinos hatte eine tiefe, sogar angenehme Stimme. Michael versuchte, dem Blick der schwarzen Augen standzuhalten, scheiterte jedoch zum zweiten Mal.
Rasch schüttelte er den Kopf. «Nein. Oder ja. Wie man es nimmt.»
«Ihr steht auch in Diensten der Kalenderreform, nicht wahr?»
«Ja, als Schreiber.» Michael betonte das Wort Schreiber, und Marinos nickte lächelnd.
«Natürlich. Man sieht deutlich, dass Ihr nicht zu Romanos’ Männern gehört.»
Zu deinen Männern, meinst du doch, schoss es Michael durch den Kopf. «Ich komme mit dem Auftrag eines Gelehrten in den Westen.»
«Und was wollt Ihr dann von mir?»
Michael zwang sich, seine Worte sorgfältig abzuwägen. Es schien ihm ratsam, den Byzantiner nicht zu reizen. Noch war er unverbindlich, ja sogar freundlich, und Michael beschloss, das auszunutzen. «Ich hoffe, dass Ihr mir bei meiner Suche behilflich sein könnt. In Byzanz sagte man mir, Ihr hättet engen Kontakt zum Kaiserhof?»
«Das könnte man sagen, ja.»
«Dann kennt Ihr wahrscheinlich die meisten hoch gestellten und gelehrten Männer. Ich bin auf der Suche nach einem Astronomen. Byzanz braucht den Rat eines Außenstehenden, und ich wurde beauftragt, jemanden zu finden, der uns helfen kann.»
«Einen Mann – sollte er hoch gestellt sein?»
«Ja, unbedingt. Und wenn er einen gewissen Einfluss hätte, wäre das von großem Vorteil.»
«Gut. Setzt Euch doch.» Marinos wies auf einige im Raum verstreute Stühle.
Michael wartete, bis Sigbert und Theodor sich gesetzt hatten, dann zog er sich einen Hocker heran und ließ sich vorsichtig auf dessen Kante nieder. Gespannt wartete er darauf, wessen Namen Marinos ihm nennen würde, aber er wurde enttäuscht. Entweder musste der Byzantiner erst über seine Frage nachdenken, oder er hatte einfach vor, Michael ein wenig zappeln zu lassen, jedenfalls richtete er das Wort jetzt an die beiden Sachsen. «Hat man Euch den Eid abgenommen?»
Sigbert nickte. Da der Byzantiner noch stand, musste er zu ihm aufschauen, und Michael konnte spüren, dass er zwischen Ärger und Unsicherheit schwankte.
«Wiederholt ihn mir gegenüber.»
Die beiden Sachsen schienen das erwartet zu haben, denn ohne die Mienen zu verziehen, erhoben sie sich von ihren Sitzen, knieten sich vor dem Byzantiner nieder, senkten die Köpfe und rezitierten einstimmig: «Ich schwöre, meine gesamte Kraft, mein Wissen und mein Können in den Dienst der Reform zu stellen. Mein Dienst soll zum Sieg oder meinem Tod führen. Ich werde bis zum letzten Atemzug den Befehlen jener gehorchen, die für die Reform streiten. Von nun an bin ich mit Leib und Seele ein silentiarius.»
Fasziniert betrachtete Michael, wie diese beiden hünenhaften Männer willig einen Eid schworen, dessen Inhalt und Tragweite sie nicht einmal im Ansatz erfassen konnten. Er kannte die Kunstfertigkeit, mit der Männer wie sie rekrutiert wurden, Männer, die meist durch eigenes Verschulden in der Gosse gelandet waren. Wahrscheinlich hatte ein wohlhabender Mann – ein Mann mit selbst für einen Byzantiner ungewöhnlich tiefschwarzen Augen, dachte Michael schaudernd – sie unter seine Fittiche genommen. Er hatte sich so lange um sie gekümmert, sie freundlich und mit Respekt behandelt, bis sie am Ende vertrauensselig jeden Eid für ihn geschworen hätten. O ja, Michael kannte die Methode, mit der Romanos’ – oder vielmehr Marinos’ – Männer neue silentiarii schufen, nur zu genau!
Sigbert und Theodor erhoben sich und kehrten zu ihren Stühlen zurück.
Marinos’ Stimme klang verträumt, als er in Michaels Richtung sagte: «Da sind sie nun silentiarii, und mir scheint, sie wissen gar nicht, was das bedeutet.»
«Es hieß, Ihr würdet es uns erklären», entgegnete Sigbert.
«Das werde ich. Vielleicht kann es aber unser Schreiber hier viel besser, was meint Ihr, Michael? Erklärt unseren beiden Sachsen, was ein silentiarius ist.»
Michaels Kehle war so trocken, dass sie beinahe schmerzte. Er sah Marinos an, konnte aber dem Blick dieser eindringlichen Augen nicht lange standhalten. Er kam sich vor wie eine Maus, mit der die Katze spielt. «Silentiarii», begann er und musste sich räuspern, um fortzufahren, «silentiarii sind jene Männer, die bei Hofe dafür zuständig sind, die Menge zur Ruhe zu bringen, wenn der Kaiser den Saal betritt. Eine Art Zeremonienmeister. Bis sich einst einer von ihnen der Reform verpflichtete.»
«Das stimmt. Noch etwas?» Marinos’ Blick bohrte sich in Michaels Gesicht.
Michael spürte, wie seine Wangen zu brennen begannen. «Mehr ist mir nicht bekannt.»
«Diese Reform», mischte sich Sigbert ein, «auch von ihr erzählte man uns in Byzanz sehr wenig. Wir wissen nur, dass wir ihr dienen sollen. Was hat es damit auf sich?»
«Michael?» Marinos gab die Frage mit einer Handbewegung weiter.
Der Schreiber spürte seine Sicherheit ein wenig zurückkehren. Hier bewegte er sich auf vertrautem Boden. «Die Reform ist eine Kalenderreform. Um es kurz zu machen: Kaiser Konstantin hat knapp dreihundert Jahre in den Kalender eingefügt, die es niemals gegeben hat.» Er wusste genau, welche Frage nun folgen würde, und darum fuhr er rasch fort: «Der Grund dafür liegt in einem komplizierten theologischen Problem. Es gibt zwei verschiedene Versionen der Heiligen Schrift, und die Zeitangaben darin differieren um die genannten dreihundert Jahre. Gott hat Konstantin ein Zeichen dafür gegeben, dass es seine Aufgabe sei, durch die Kalenderreform diesen Widerspruch aus der Welt zu räumen.» Kurz überlegte Michael, ob er mehr Einzelheiten preisgeben sollte, aber in den Blicken der Sachsen stand bereits jetzt gelindes Unverständnis.
«Ihr sagtet, Ihr dient der Reform ebenfalls», sagte Theodor. «Was ist Eure Aufgabe dabei?»
Michael beglückwünschte sich dazu, dass der Sachse keine andere, viel näher liegende Frage gestellt hatte, nämlich die, warum für eine Kalenderreform Krieger wie er und Sigbert gebraucht wurden. «Es gibt Hunderte von Schreibern und Gelehrten, die damit beschäftigt sind, die alten Urkunden mit neuen Daten zu versehen. Oder kleinere rechnerische Probleme zu beseitigen, die bei einem solchen Vorhaben immer auftreten.»