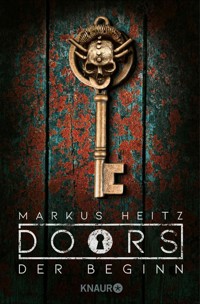9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook kommt mit eigens von Markus Heitz komponierter, musikalischer Untermalung, die einen die Geschichte noch intensiver und atmosphärischer erleben lässt. In Leipzig hütet ein Bestatter ein grausames Geheimnis, in Minsk führt eine skrupellose Wissenschaftlerin tödliche Experimente durch, in Paris rast ein Airbus ungebremst in ein Flughafenterminal … Die Ermittlungen zu dem Unglück beginnen sofort – aber die Ergebnisse sind rätselhaft: Sämtliche Insassen waren schon tot, bevor das Flugzeug auf das Gebäude traf. Was die Polizei jedoch nicht herausfindet, ist, dass es einen Überlebenden gibt. Konstantin Korff, der Bestatter aus Leipzig, kommt diesem Überlebenden hingegen schnell auf die Spur, ebenso wie die Wissenschaftlerin – denn diese drei Menschen tragen denselben tödlichen Fluch in sich. Einen Fluch, der sie zu einer Gefahr für jeden in ihrer Umgebung macht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Markus Heitz
Oneiros.Tödlicher Fluch
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Bestatter
Er gilt als einer der Besten seines Fachs, denn er kennt den Tod wie kein anderer.
Die Wissenschaftlerin
Sie führt grausame Experimente durch, die nur ein Ziel haben: den Tod zu betrügen.
Der Mann auf der Flucht
Er flieht vor sich selbst und seinen Fähigkeiten. Doch der Tod findet ihn überall.
Drei Menschen. Ein Fluch. Tausend Tode.
Inhaltsübersicht
Den Menschen, die täglich [...]
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
Abspann
Kurz-Interview mit Prof. Dr. Joachim Oertel, [...]
Den Menschen, die täglich versuchen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, ihm Tage, Wochen, Jahre abringen. Als Kranke, als Ärzte, als Pfleger, als Wissenschaftler, als Rettungskräfte und in jedem Beruf, den ich vergessen habe.
Gebt bloß nicht auf.
Prolog
»… wünschen wir Ihnen guten Appetit bei Ihrem Frühstück. In etwa zwei Stunden, gegen 10.45 Uhr, erreichen wir den Flughafen Paris-Charles de Gaulle, in ungefähr einer Stunde beginnen wir allmählich mit dem Landeanflug und verringern die Flughöhe. Näheres dazu dann wieder von mir. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen mein Team und ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.« Christine beendete die Ansage, die sie auf Französisch und auf Englisch mit charmantem Akzent tätigte. Sie machte ihren Kolleginnen Platz, die mit der Essensverteilung begannen.
530 Passagiere in jeweils drei Klassen auf zwei Decks wollten ihr Frühstück haben. Die Chefstewardess hoffte, dass es die Laune an Bord hob. Sie hatten zwei Stunden Verspätung, weil das Personal des JFK-Airports in New York überlastet gewesen war. Oder überfordert. Oder die Technik dort zu alt. Und das geschah nicht zum ersten Mal.
Christines Blick schweifte umher. Flug AF023 erwachte Platz um Platz zum Leben.
Sie mochte die Stimmung am Morgen. Die meisten Passagiere waren halbwegs munter, einige hatten noch die Schlafmasken auf den Augen und den Sitz zur Liege umgebaut, dösten vor sich hin oder hatten Kopfhörer auf den Ohren. Woanders wurde bereits ein Film geschaut; leises Gemurmel schwebte in der Luft, irgendwo in der hellen Kabine lachten Kinder. Sie musste lächeln, weil sie an ihren Sohn dachte. Olivier, sieben Jahre.
»Schaust du bitte mal nach Sitz 81?«, raunte Marlène ihr zu, während sie den ersten Servierwagen aus dem Küchenbereich schob. Es roch nach frisch gebrühtem Kaffee, gebratenen Eiern, Brötchen und Croissants; der Duft verbreitete sich langsam im A380-862.
»Was ist mit ihm?«
»Er nervt. Er hat schon den vierten Whiskey, hing vorhin in der Bar und beschwerte sich, dass ihm das Abendessen Diarrhö beschert hätte.«
»Was hat er gegessen?«
Marlène rollte mit den Augen und blieb stehen. »Zuerst eine Suppe, danach Lachs auf Zitronen-Safran-Reis mit Salat, dann noch ein weiteres Stück Lachs, zwei Croissants mit Schokoladencreme. Zwei Packungen Erdnüsse, eine Packung Chips. Mit scharfem Dip. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Claire sagte, dass er zwischendurch einige Gratis-Snacks vernichtet hat. Oh, und er hat eine halbe Flasche Gin gesoffen. Mein Magen würde da auch streiken.«
»Ich kümmere mich darum.« Christine sandte sie mit einem Nicken nach draußen, um das Frühstück auf dem Hauptdeck zu verteilen, wo die meisten Passagiere der niedrigsten Preisklasse untergebracht waren. Bei der Air France nannte man sie ein wenig verschleiernd Voyageurs, was edler klang als dritte Klasse. 340 Männer, Frauen und Kinder waren hier in langen Sitzreihen hinter- und nebeneinander untergebracht. Die Première, die erste Klasse, war im vorderen Teil des Flugzeugs strikt davon abgetrennt.
Christine machte sich schnell auf den Weg, damit sie gleich beim Austeilen der Portionen helfen konnte. Chefin zu sein, bedeutete mehr Verantwortung und nicht weniger Arbeit. Um zu Sitz 81 und seinem renitenten Okkupanten zu gelangen, musste sie allerdings erst ins höher gelegene Deck. Hier befanden sich 106 weitere Voyageurs sowie 80Affaires, die Business-Klasse.
Christine nahm die nächstbeste Treppe und erreichte das Oberdeck, schritt an den Reihen der Affaires entlang, um weiter nach hinten vorzudringen. Um sie herum schwärmten ihre Kolleginnen und Kollegen, um das durchaus luxuriöse Frühstück zu den Fluggästen zu bringen. Sie seufzte. Ausgerechnet im dicksten Trubel musste einer der Passagiere den Aufstand proben.
Im Vorbeigehen nickte sie den Stewardessen zu, die mit dem Verteilen des Essens begonnen hatten und die letzten Schlafenden mit einem gehauchten bonjour sanft aus den Träumen holten.
»Entschuldigen Sie!«
Christine zuckte zusammen, als sich kühle Finger um ihr Handgelenk schlossen und sie zum Anhalten zwangen.
»Kann ich bitte eine Kanne besonders starken Kaffee bekommen?«
Sie senkte den Blick und betrachtete den Mann. Er war um die vierzig, in einem vollkommen durchschnittlichen, nicht sehr kostspieligen Outfit. Christine konnte die Preise von Garderoben sehr genau einschätzen. Obwohl er sich offensichtlich ein Business-Class-Ticket leisten konnte, war seine Kleidung nicht mehr als hundert Euro wert, inklusive der Stiefel: Jeans, kariertes Hemd, Halstuch. Ein Pseudocowboy, obwohl er dem Akzent seines Englischs nach wohl aus Skandinavien kam. Er hatte ungepflegtes, blondes Haar, das schütter und wirr auf seinem Kopf lag, sowie tiefe Ringe um die hellblauen Augen. Er schien lange nicht geschlafen zu haben. »Monsieur, ich sage meinen Kolleginnen Bescheid.«
Der Mann ließ sie nicht los, seine Augen starrten eindringlich. Unbeweglich. »Bitte richten Sie ihnen aus, dass er sehr, sehr stark sein muss«, raunte er heiser und rieb sich mit der freien Hand über das bleiche Gesicht. Ein dünner Schweißfilm überzog die hohe Stirn.
Christine sah, dass auf dem heruntergeklappten Tisch vier leere Dosen Energiedrinks standen, und die bräunlichen, ringförmigen Spuren auf der ansonsten sauberen Plastikfläche verrieten, dass er bereits Kaffee getrunken haben musste. »Das tue ich sofort, Monsieur. Würden Sie mich bitte loslassen?«
»Stark! Das ist wichtig!« Sein Blick flackerte, dann senkte der Mann die Augen und fixierte die Dosen. »Verzeihung«, flüsterte er und löste die Finger von Christines Arm. Dann sank er in sich zusammen, was wohl als eine Art Entschuldigung dienen sollte; sein anschließendes Gemurmel verstand sie nicht.
Christine setzte ihren Weg fort und beschloss, den Namen des Mannes auf der Passagierliste zu prüfen, sobald sie zurückkam. Das war kein normales Verhalten. Außerdem sah er nicht aus, als würde er in die Business-Class gehören. Am Ende hatte sie es mit einem Junkie zu tun, der es vor Entzug nicht mehr aushielt und kurz vor der Landung ausrastete. Oder während der Landung.
Sie richtete im Gehen ihre marineblaue Jacke, das in einem helleren Ton gehaltene Halstuch sowie die Brosche mit ihrem Air France-Emblem und betrat das Reich der Voyageurs, wo die Passagiere im 2-4-2-Sitzsystem nebeneinandersaßen, ohne beengt zu sein. Kein Vergleich zu den alten Maschinen.
Sitz 81. Hellwach, schlecht gelaunt und eine Brechtüte in der Hand. Er redete auf seine Nachbarn ein, eine junge Frau mit ihrem Sohn rechts und ein Orientale links, die nickten, aber nichts antworten konnten, weil er unermüdlich erzählte. Gestikulierte. Sich echauffierte.
Christine analysierte ihn blitzschnell. Akzent: Italiener. Garderobe: um die fünfhundert Euro, ohne den Goldschmuck. Kategorie: geiziger Geschäftsmann, Angeber und cazzo.
»Monsieur?« Sie bleckte die Zähne und präsentierte ihr »Leck mich am Arsch«-Lächeln, das unverzichtbar zum Repertoire einer guten Stewardess gehörte. Eine Beleidigung, die keine war.
Sein schwarzer Lockenkopf zuckte herum, das leichte Doppelkinn wippte. Er war höchstens Mitte dreißig, aber eine bella figura machte er nicht. Eine leichte Alkoholfahne umgab ihn. »Si?«
»Monsieur, meine Kollegin sagte, dass Sie sich unpässlich fühlen. Was darf ich Ihnen zur Linderung bringen? Kohletabletten oder …«
»Porca miseria! Mir ist zum Kotzen, weil ich von diesem Franzosenfraß gegessen habe!«, stieß er auf Englisch hervor und machte eine sehr italienische Handbewegung dazu, die sagen sollte: Mit Alitalia wäre das nicht passiert. »Verspätung haben wir auch«, setzte er hinzu, als wäre die Unpünktlichkeit des Flugs Schuld an seinem Zustand.
Die Passagiere in seiner Reihe verdrehten die Augen, der Junge spielte gelangweilt mit einem bunten Stift mit einer kleinen Leuchtdiode herum. Der Orientale hatte eine Sauerstoffflasche vor sich abgestellt, ein durchsichtiger Schlauch führte von dort unter das Hemd und kam am Hals wieder zum Vorschein. Zwei dünne Enden ragten in seine Nasenlöcher.
Christine beugte sich nach vorne. »Monsieur, ich bedaure Sie außerordentlich. Unser Kapitän hat bereits alles versucht, um den Zeitverlust zu minimieren.« Christine warf den Sitznachbarn entschuldigende Blicke zu, die sich auf den Umstand bezogen, dass ausgerechnet sie diesen Passagier ertragen mussten. »Was das Essen angeht, so haben mir meine Kolleginnen zugetragen, dass Sie unter Umständen etwas viel durcheinander zu sich genommen haben. Darf ich Ihnen vorschlagen …«
Er verzog das Gesicht. »Haben Sie gerade gesagt, dass ich selbst schuld bin, dass ich kotzen muss und mein Darm mich alle paar Minuten auf das Klo zwingt?« 81 warf die Hände in die Luft, das Goldkettchen am rechten Handgelenk klirrte leise und funkelte im Licht der Leselampe. Den eingravierten italienischen Spruch konnte Christine nicht lesen. »Das muss ich mir nicht bieten lassen! Ich habe viel Geld bezahlt und werde dafür vergiftet!«
Christine atmete tief ein und richtete sich auf. Ihr Lächeln wurde noch breiter und verachtender. »Monsieur, bitte beruhigen Sie sich. Ich verspreche Ihnen …«
»Ich will die Hälfte meines Geldes zurück«, rief er und sah sie angriffslustig an, rülpste dabei unterdrückt. »Nein, am besten eine volle Rückerstattung, oder ich verklage Air France.« Die dunklen Augen blitzten, er kreuzte die Arme vor der Brust. »Wenn es sein muss, nehme ich eine Probe von meinem Durchfall und lasse ihn untersuchen.« Dann erhob er sich ruckartig, zwängte sich an seinen Nachbarn und der Chefstewardess vorbei und hastete zur Toilette.
Christine verstand, warum Marlène sie um Hilfe gebeten hatte. Dieses Mal bekam sie bedauernde Blicke von den Passagieren. »Ich kann mich für den Zwischenfall nur entschuldigen, messieurs dames«, sagte sie in die Runde.
»Kein Problem«, gab der Orientale, der ein traditionelles Gewand sowie einen dichten schwarzen Bart trug, schwer atmend zurück. Christine erinnerte sich an ihn, weil er eine Sondergenehmigung beim Einchecken für seine Sauerstoffflasche vorgezeigt hatte.
»Da können Sie mal sehen, dass Reisen bildet: Mein Sohn bekommt mehr italienische Schimpfwörter beigebracht, als er je brauchen könnte«, fügte die junge Frau ironisch hinzu. Der Junge kümmerte sich gleichgültig um den Leuchtstift.
Christine nickte dankbar. »Vielen Dank für Ihr Verständnis, messieurs dames. Ich werde schauen, ob ich für Besserung sorgen kann.« Sie ließ offen, ob sie damit den Zustand von 81 meinte, oder ob sie den Mann auf einen anderen Sitz verfrachten wollte, um die Geduld und die Nerven der übrigen Fluggäste zu schonen. Zwei Stunden an der Seite eines Profinörglers konnten sehr lange sein.
Schon wurde der Italiener wieder am Ende des Ganges sichtbar, drückte sich an die Kabinenwand neben der Toilette und winkte ihr verstohlen zu.
Christine ging zu ihm und bemerkte, dass er dabei auf ihre schlanken Beine schaute. »Monsieur, was kann ich für Sie tun? Ist das Toilettenpapier alle?«
Aber 81 gab sich friedlich. »Verzeihen Sie mein Auftreten«, sagte er leise und gestikulierte dennoch weiter, als würde er sich aufregen. »Ich wollte nicht, dass der Araber Verdacht schöpft.«
»Monsieur? Der Araber? Ich verstehe nicht.«
81 drehte sich so, dass man sein Gesicht von den Sitzen aus nicht erkennen konnte. »Er hat die ganze Zeit im Koran gelesen«, raunte er, »und vor sich hin gemurmelt.«
»Es ist in den Maschinen der Air France nicht verboten, religiöse Bücher zu lesen, Monsieur«, hielt sie dagegen. Ein anstrengender Fluggast mit Paranoia. Das hatte ihr noch gefehlt. Sie wusste genau, auf was er hinauswollte. »Die Dame auf Sitz 53 las vorhin die Bibel, und einer der Herrschaften in der Affaires hatte das Kommunistische Manifest vor sich liegen. Deshalb müssen sie nicht gleich Terroristen sein.«
»Die Sauerstoffflasche!«
»Monsieur, der Mann ist im Besitz einer Ausnahmegenehmigung der Air France. Auch wenn ich Ihnen das nicht sagen dürfte, doch zu Ihrer Beruhigung: Er ist lungenkrank und hat eine …«
»Aber er hat sie nicht aufgedreht.«
Christine musste zugeben, dass sie sich einen Moment verunsichern ließ. »Vielleicht muss er nicht die ganze Zeit inhalieren?«
Er warf ihr einen triumphierenden Blick zu. »Er hat sie kein einziges Mal benutzt, seit wir eingestiegen sind. Die Anzeige steht auf off. Ich kenne das Modell, mein Vater bekam unterstützend Sauerstoff. Dieser Araber ist nicht lungenkrank, darauf verwette ich meinen Goldschmuck.«
Jetzt war ihr Misstrauen tatsächlich geweckt, auch wenn sie es nicht mochte, dass 81 recht haben könnte. »Bon. Monsieur, ich lasse die Genehmigung nochmals prüfen.«
»Dann kann es zu spät sein!« Er packte sie am Arm, an der gleichen Stelle, wo sie vorhin der Affaires mit der kalten Hand und den müden Augen berührt hatte. »Wir haben elf Araber an Bord. Ich habe sie gezählt, und sie sind gut verteilt auf den Decks. Vorhin standen sie an der Bar zusammen und redeten leise. Sie kennen sich! Aber warum sitzen sie dann nicht zusammen?«, sprach er eindringlich. »Was ist, wenn sie zusammengehören und einen Anschlag planen? Wenn es eine Bombe ist oder … Giftgas, das der Mann neben mir dabeihat?« Er sah rasch über die Schulter. »Was machen wir?«
»Wir machen nichts, ich unternehme etwas, Monsieur.« Christine ärgerte sich, dass es 81 nun endgültig gelungen war, sie mit seinem Verfolgungswahn anzustecken. Es war zwar mehr als unwahrscheinlich, dass sich die italienischen Hirngespinste als etwas anderes als Paranoia herausstellten, aber Sicherheit ging vor. Bei über fünfhundert Menschen an Bord konnte sie nicht so tun, als hätte er nichts gesagt. »Sie kehren an Ihren Platz zurück, Monsieur. Ich prüfe die Passagierlisten und die Genehmigung des Mannes und leite Sicherheitsmaßnahmen in die Wege«, erklärte sie ihm rasch, damit er beruhigt war. »Sollte Ihnen etwas auffallen, tun Sie so, als wäre Ihnen schlecht, und ich komme wieder.« Christine nickte ihm zu.
Er nickte zurück und schien stolz auf seine Leistung, dann presste er für einen Moment die Hand auf den Magen. »Oh, mir ist wirklich nicht gut«, fügte er hinzu. »Aber Sie haben recht: Ich bin selbst schuld.« Trotz der aschfahlen Gesichtsfarbe zwinkerte er ihr sehr italienisch zu und kehrte zu seinem Sitz zurück.
Christine fand ihn nicht mehr ganz so unsympathisch und eilte zum Crewbereich, um die Prüfungen vorzunehmen.
»Denken Sie an meinen Kaffee«, rief jemand verlangend hinter ihr. »Extra stark, ja? Ich schlafe sonst gleich ein.«
»Aber ja, Monsieur!«, gab sie im Laufen zurück, ohne anzuhalten, was sie unter normalen Umständen niemals tun würde. Aber jetzt hatte sie Wichtigeres zu tun. Der Pseudocowboy sollte sich nicht so anstellen. Als würde Air France seichten Kaffee anbieten! »Ich sage es meiner Kollegin tout de suite.«
Christine erreichte das Hauptdeck, während im A380 die letzten Frühstücke verteilt wurden. Angespannt setzte sie sich an den Computer, nahm die Passagierlisten zur Hand, glich die Daten mit dem Sitzplan ab, überprüfte die vorhandenen Informationen.
Die fraglichen Orientalen stammten aus verschiedenen arabischen Staaten, es gab keinerlei Eintragungen, die sie irgendwie verdächtig machten.
Dann aber legte sich ihre Stirn in Falten, als sie den Namen des Passagiers neben 81 las: Rub al-Chali.
Sie meinte sich zu erinnern, dass eine Wüste im Oman so hieß. Früher war sie viel mit einer anderen Airline im dortigen Raum unterwegs gewesen, daher kannte sie sich etwas aus.
War es möglich, dass ein Mann und eine Wüste denselben Namen trugen oder …?
Wieso sollte sie einen der Sicherheitsleute einschalten. Unter den Passagieren befanden sich vier Bewaffnete, zwei auf jedem Deck, Mitglieder eines Spezialkommandos. Air France setzte sie bei Flügen von und nach New York ein, aus Umsicht und zur Abwehr von Entführungen durch Extremisten. Unauffällig, gekleidet wie normale Reisende.
Rub al-Chali.
Ihr wurde heiß und kalt, sie rieb sich vor Nervosität die Schläfen. Die italienischen Hirngespinste schienen immer weniger absurd.
»Warum ausgerechnet bei meinem Flug?«, murmelte Christine. Sie beschloss, den capitaine über ihren Verdacht zu informieren. Er sollte entscheiden, was zu tun war.
Tommaso Luca Francesco Tremante rutschte auf seinem Sitz herum und ließ den Araber neben sich nicht aus den Augen. Sein Leben gestaltete sich gerade zu schön, und es sollte nicht hier enden.
Er hatte sein Geld mit Immobilien gemacht und tat es noch immer: Er verkaufte reichen Franzosen günstige amerikanische Häuser, die es dank der Krise in den USA zuhauf gab. Die Geschäfte liefen gut. Das Letzte, was Tommaso wollte, war, von einem Extremisten gesprengt oder vergast oder zum Teil eines Flugzeuggeschosses gemacht zu werden, das auf ein französisches Bauwerk zusteuerte. Deswegen sein bühnenreifer Aufstand.
Nach zwanzig Minuten war die nette Mutter mit dem gelangweilten Kind aufgerufen worden, weil sie laut Durchsage angeblich an einem bordinternen Gewinnspiel teilgenommen hatte und nun zusammen mit ihrem Sohn einen Sitz in der ersten Klasse bekam. Die beiden freute es.
Nach zehn weiteren Minuten tauchte dann ein großer, breitschultriger Mann auf, der es sich neben dem Araber bequem machte, weil ihm im Hauptdeck zu viel Lärm herrsche. »Wie gut, dass hier etwas frei wurde«, hatte er lächelnd gesagt, eine Zeitung aufgeschlagen und gelesen.
Die bella donna, die Chefstewardess, hatte ihm mit einer kleinen Geste angedeutet, dass der Mann zum Personal gehörte. Sky Marshal oder etwas in dieser Richtung.
Das hatte Tommaso etwas beruhigt, doch er machte sich immer noch Sorgen.
Der Araber verhielt sich normal, aß ein Croissant und trank Kaffee, las im Koran; seine rätselhafte Sauerstoffflasche blieb nach wie vor verriegelt.
Tommaso hoffte, dass der Sky Marshal den Araber abknallen würde, sollte er sich auch nur ansatzweise auffällig benehmen.
Er fand es lustig, dass der Muslim mit Genuss das Croissant aß. Ausgerechnet. Denn gemäß einer Legende sollte das Hörnchen aus Blätterteig nach der Belagerung Wiens durch die Türken, also den Islam im weitesten Sinn, erfunden worden sein. Die Osmanen wollten einen Tunnel unter der Stadtmauer graben, was ein Wiener Bäcker bemerkte und der daraufhin Alarm schlug. Da Siege gerne mit einem den Gegner demütigenden Gericht verbunden wurden, kreierten sie ein Gebäck in Form des türkischen Halbmondes. So weit die Legende.
Ob es stimmte, wusste Tommaso nicht. Sein Magen schien sich jedenfalls nicht mit den drei fettigen Halbmonden anfreunden zu können, die er zum Frühstück mit Butter und Nussnougatcreme gegessen hatte. Oder war es die Aufregung wegen der Terroristen? Oder der ultrastarke Kaffee, den er unverlangt bekommen hatte? Als er eine Stewardess danach fragte, räumte sie ein, dass der Kaffee wohl für einen anderen Fluggast bestimmt gewesen war.
Beim Landeanflug machte er sich beinahe in die Hosen. Deshalb löste er sofort den Gurt, als die Räder des A380 auf dem Asphalt aufsetzten und die Maschine ihre Geschwindigkeit reduzierte. Es brodelte in Tommasos Innereien.
»Monsieur, das ist gefährlich«, sagte der Araber freundlich. »Wir stehen noch nicht. Wenn wir gerammt werden …«
»Bleiben Sie sitzen«, schaltete sich zu allem Überfluss auch noch der Sky Marshal ein und warf ihm einen belehrenden Blick zu. »Die Anschnallzeichen sind noch nicht erloschen.«
Tommaso ignorierte die Warnungen und schob sich in den Gang. »Passen Sie lieber auf den imbecille neben sich auf«, fauchte er den Sicherheitsmann an. »Ich scheiße mir sicher nicht in die Hose, wenn das Klo keine paar Meter weg ist. Schließlich war sie teuer.«
Er lief los, stützte sich an den Sitzen ab, um sicheren Halt zu haben, und näherte sich der erlösenden Toilette. Der Airbus war immer noch mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit unterwegs. Die Passagiere sahen ihm nach, manche verständnislos, andere lachten schadenfroh. Freunde hatte er sich mit seiner kleinen Einlage vorhin keine gemacht. Dabei hatte er sie alle gerettet!
Nur noch wenige Schritte, dann hatte er die Schüssel erreicht. Es wurde höchste Zeit. Er schwor sich, niemals mehr Croissants zu essen, Geschmack hin oder her.
»Monsieur!« Das war die Stimme der bella donna. »Setzen Sie sich sofort hin!«
»Scusi, geht nicht anders. Sie laufen ja auch herum«, gab er zurück und verschwand in die Kabine, warf die Tür zu und streifte die Hosen herab.
Die Erleichterung setzte schlagartig ein, und er seufzte glücklich.
Weniger schön war das wütende, maßregelnde Klopfen.
»Monsieur, kommen Sie raus! Sofort!«
Tommaso lachte. »Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht, bella.« Er rieb sich den Bauch. »Mir passiert schon nichts. Ich halte mich auch gut fest. Versprochen.«
Wieder das Pochen, dann ihre Stimme.
»Monsieur, ich weise Sie darauf hin, dass es verboten ist und Sanktionen nach sich zieht, gegen die Anweisungen des Personals zu verstoßen.«
Das Flugzeug fuhr eine sanfte Kurve, die Zentrifugalkräfte zwangen Tommaso, sich am Waschbecken und der Seitenwand festzuhalten.
»Mir egal. Ich bezahle die Strafe. Die wird nicht so teuer sein wie eine neue Hose«, rief er durch die Tür. »Lassen Sie mich in Ruhe kacken.« Ihm fiel auf, wie warm es in der kleinen Kammer war. Die Lüftung schien nicht zu funktionieren.
»Monsieur, ich warne Sie …«
Der Lautsprecher über ihm knackte, dann erklang eine weibliche Stimme und verkündete, dass man sicher gelandet sei. Die Ansage wurde begleitet vom gedämpften Klatschen der Passagiere. »Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit angeschnallt, bis die Maschine zum Halten gekommen ist und wir unsere Parkposition erreicht haben.«
Vor seiner Tür war es unterdessen still geworden. Kein drohendes Klopfen mehr, keine Befehle der überreizten Chefstewardess.
»Sie holen jetzt aber nicht den Mann mit der Waffe, oder?« Das Grollen und Rumoren in seinen Innereien hatte fürs Erste aufgehört, aber wirklich gut ging es ihm deshalb nicht. Zudem war das Toilettenpapier nicht gerade das weichste. Sein Hintern dürfte inzwischen leuchten wie ein roter Pavianarsch.
»Wir bedanken uns, dass Sie mit Air France …«, kam es aus der in der Decke eingelassenen Box, doch ein helles, unangenehmes Knistern wie von einem Störsender unterbrach die Ansage.
Tommaso musste sich die Ohren zuhalten, das hohe Summen zog an seinem Trommelfell und verursachte Kopfschmerzen.
Dann herrschte unvermittelt Ruhe.
»Was war das denn?« Tommaso erhob sich, betätigte die Spülung, zog die Hose hoch und wusch die Hände.
Die Triebwerksgeräusche hatten nicht nachgelassen, der A380 fuhr nach wie vor zügig übers Rollfeld und suchte seinen Platz. Die Piloten schienen es eilig zu haben.
Tommaso musterte sich im Spiegel, tupfte sein Gesicht ab und zwinkerte sich zu. Kritisch fuhr er das dickliche Kinn entlang. »Habe schon mal besser ausgesehen«, sagte er, entriegelte und öffnete die Kabine. »Ciao, bella! Wenn Sie mir unbedingt …«
Beinahe wäre er über den Körper zu seinen Füßen gestolpert, und er erkannte die Chefstewardess, die leblos davor lag. Ein Sturz? Sie hatte die Augen weit aufgerissen, eine Wunde konnte er nicht entdecken. Herzinfarkt? Schlaganfall?
»Maledetto!« Er bückte sich sofort und prüfte ihren Puls an der Halsschlagader, fand jedoch keinen. »Hilfe!«, rief er und lief in den Gang. »Ist ein Arzt an …« Tommaso verschlug es die Sprache: Die Passagiere saßen auf ihren Plätzen, die Glieder schlaff, die Köpfe auf der Brust oder zur Seite, einige hingen über die Lehnen. Was war hier los? Sie konnten doch nicht alle auf einen Schlag eingeschlafen sein.
Totenstille.
Panik erfasste Tommaso, als er an die Gasflasche des Arabers dachte, und er hielt sofort die Luft an. Giftgas! Er hatte doch recht gehabt!
Hastig trat er an einen Platz heran, riss an der Deckenverkleidung herum, bis sie wie durch ein kleines Wunder absprang und die Sauerstoffmaske darunter freigab.
Zumindest saß der bärtige Araber wie alle anderen auf seinem Sitz; er hatte die Augen geöffnet, eine Hand am Druckregulierer der Flasche, die bis zum Anschlag aufgedreht war. Leise zischend strömte der Inhalt in die Kabine.
Der Airbus rollte noch immer schnell vorwärts. Anscheinend hatte man im Cockpit nichts vom Anschlag bemerkt.
Ein Krachen erfolgte, und ein Zittern erfasste das Flugzeug, es begann zu schlingern.
Tommaso sah aus dem Fenster und erkannte, dass der A380 zwei Gangways umgefahren hatte. Im grellen Scheinwerferlicht rannte das Bodenpersonal rudelweise hektisch umher, Fahrzeuge mit rotierenden gelben Lampen begleiteten den Airbus. In der Ferne tauchten Blaulichter auf.
Da kam ihm der schreckliche Gedanke, dass das Gas auch bis zu den Piloten gekrochen war! Das erklärte, weswegen der A380 nicht bremste.
Vor ihm tauchten Ausleger der Terminals auf.
Er hegte keinen Zweifel, dass die Terroristen sich in der Kanzel befanden und den Airbus in eines der Gebäude jagen wollten.
»Porca miseria!« Vor Tommasos innerem Auge entstand ein Inferno: einstürzende Hallen, auslaufendes Kerosin, Explosionen und Flammen, Tod und Vernichtung.
Sein Blick fiel auf den Leichnam des Sky Marshals, der ein Auge geschlossen und ein anderes geöffnet hatte. Die Linke lag am Griff seiner halbautomatischen Pistole, zum Ziehen war er nicht mehr gekommen.
Was sollte er nun tun? Fliehen oder einen heroischen Angriff auf die Terroristen im Cockpit wagen? Und wenn er rauswollte, dann wie? Notrutschen und dergleichen konnte er vergessen, solange die Fahrt andauerte. Aber die Tür zur Kanzel, war sie nicht eigentlich schlagfest und nicht zu knacken?
Er fühlte den Schweiß, der über seinen Rücken nach unten rann und das Hemd tränkte.
Dann wurde ihm jede Entscheidung abgenommen, als die Schnauze des A380 mit dem Terminal 2E kollidierte und sich in die Konstruktion aus Stahl und Glas bohrte, ohne den Schub zu verringern.
Eine Turbine detonierte spektakulär, fegte das Plastikglas aus den kleinen, ovalen Bullaugenfenstern im hinteren Teil des Flugzeugs und drückte lodernde Flammenzungen in den Innenraum.
Tommaso wurde durch den Aufschlag nach vorne katapultiert, prallte gegen einen Sitz und stürzte bewusstlos in den Gang. Um ihn herum breitete sich das von ihm befürchtete Inferno aus.
I
Das Mädchen:
Vorüber! Ach, vorüber!
Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh, Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod:
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
Matthias Claudius (1740–1815), Der Tod und das Mädchen
Konstantin blickte auf die Uhr, die neben der Tür an der Wand hing und ihm zeigte, dass es kurz nach neun war.
Das Tagwerk wartete auf ihn und die Mitarbeiter von Ars Moriendi, seiner Firma, die er gern scherzhaft Ruhe Sanft GmbH nannte, wie das Bestattungsunternehmen in dem komödiantischen Horrorfilm mit Vincent Price, Peter Lorre und Boris Karloff. Mit deren mörderischen Methoden hatten sie jedoch nichts zu tun.
»Dann mal los, die Herrschaften. Oder gibt es noch Unklarheiten? Ich bin ab übermorgen wieder auf Reisen, aber über Handy erreichbar.«
In dem kleinen Büro wurden die Köpfe geschüttelt.
Die elf Damen und Herren passten kaum in das Zimmer, die meisten mussten stehen. Sie waren eben gemeinsam die Wochenliste durchgegangen: eine Handvoll regulärer Bestattungen auf den hiesigen Friedhöfen, zwei Überführungen ins Ausland, zwei Seebestattungen, davon eine im Atlantik und eine in der Ostsee; dazu kam die 24-Stunden-Abrufbereitschaft für neue Todesfälle.
In Leipzig starben jedes Jahr um die 5600 Menschen, das machte im Schnitt pro Tag fünfzehn Tote. Eine Beerdigung kostete zirka 5000 Euro. Viel Arbeit und hohe Einkommenschancen also, weshalb die Zahl der ansässigen Bestatter auch entsprechend hoch war. Das wiederum reduzierte das Einkommen.
Das Ars Moriendi hatte einen sehr guten Ruf. Dank ihm, dem jungen Chef mit den guten Ideen und der ruhigen Hand, die auch außerhalb Leipzigs ein hohes Ansehen besaß. Deshalb bekam er regelmäßig Aufträge in ganz Europa, was ihm einen Bonus und bezahlte Reisen bescherte.
»Bestens. Dann einen schönen Tag.« Konstantin sah zu den beiden jungen Männern, die sich als Erste erhoben. »Maik, Florian, ihr fahrt raus, wenn wir einen Auftrag reinbekommen. Geht das klar?«
Sie nickten.
»Und prüft nochmals die Kühlung von Wagen vier für die Überführung an den Atlantik. Es soll die ganze Woche heiß werden, und die Fahrtstrecke dauert mit dem Transporter zwei Tage. Könnte sonst eine böse Überraschung werden, wenn ihr Monsieur Contignac aus dem Sarg holt.« Konstantin erhob sich, während seine Leute einer nach dem anderen verschwanden und sich an die Arbeit machten.
Ich habe schon gute Mitarbeiter. Er trank seinen Tee im Stehen aus und beobachtete durch das Fenster zum Fuhrpark, wie sie sich auf die Fahrzeuge verteilten. Gestecke abholen, Bestattungen an verschiedenen Orten vorbereiten, Papierkram und vieles mehr gehörte zu ihrer Routine, und alle Arbeiten wurden mit aller Würde erledigt, wie es sich gehörte.
Konstantins Name stand im Gegensatz zu dem mancher Kollegen nicht für Abzocke, für überteuerte Preise oder einen laxen, unpassenden Umgang mit den Verstorbenen. Eine Leiche mochte streng genommen nur eine seelenlose Hülle sein, aber sie war einmal ein geliebtes Elternteil, ein geliebtes Kind oder ein geliebter Freund gewesen.
Sein Blick fiel auf sein Spiegelbild im Glas. Ich sollte dringend zum Frisör. Die dunkelbraunen Haare kitzelten im Nacken und weigerten sich trotz Wachs, in der Form zu bleiben, die er wollte. Dennoch: Für einen Mann von knapp vierzig Jahren sah er noch erstaunlich gut aus. Die meisten schätzten ihn auf Ende zwanzig, und das verdankte er nicht irgendwelchen Cremes oder Schönheitsoperationen. Wurde er nach seinem Geheimnis gefragt, antwortete er stets, dass der Tod ihn jung hielte. Und dass das Formalin, das er sich spritzte, besser als Botox sei. Bestatterhumor.
Die schwarzen Wagen rollten vom Hof, während Maik und Florian in die Werkstatt gingen.
Konstantin schlenderte ins Vorzimmer, wo Sekretärin Mendy Kawatzki saß und alles managte, was es zu managen gab, von Terminen bis zu Anträgen. »Meine Schönheit, wo bleibt der Bewerber?«
Mendy, eine Mitdreißigerin und die treue Seele des Unternehmens, sah über den Rand ihrer schwarzen Brille. »Warum haben Sie sich denn einen Bart stehenlassen? Sie sehen aus wie Johnny Depp in diesem Film …«
»Sie meinen hoffentlich nicht Jack Sparrow?«
»Nein. Sie wohnen zwar auch auf einem Schiff, aber ich meinte … wie hieß er denn?« Sie bemerkte einen offenen schwarzen Knopf an ihrer weißen Bluse und schloss ihn. »Mit der Jolie. In Venedig.«
»The Tourist.« Konstantin lächelte. Er hatte den Film gesehen und den Bart des Schauspielers gar nicht schlecht gefunden, was auch der Grund für sein verändertes Aussehen war. Johnny Depp glich er aber wirklich nicht. Sein Gesicht war etwas länger, mit schlanken Wangen. »Steht er mir nicht?«
Mendy lächelte. »Doch. Aber immer wenn ich mich daran gewöhnt habe, wie Sie aussehen, verändern Sie etwas.« Sie zuckte mit den Schultern und zeigte auf den Bildschirm. »Der Azubi-Anwärter hat eine Mail geschickt. Er kommt eine halbe Stunde später, weil er noch ein Zeugnis besorgen muss.«
Konstantin brummte unzufrieden. »Das fällt ihm aber früh ein.« Er trat zu der Tür, die durch einen nüchternen Flur in den Arbeitsraum führte. »Schicken Sie ihn gleich zu mir, wenn er kommt. Ich fange schon mal an.«
Sie sah ihn prüfend an. »Aber nicht die harte Tour, oder?«
Er musste lachen. »Sind Sie sein Fürsprecher, Frau Kawatzki?«
»Nein. Aber er sieht nett aus.«
»Und kommt zu spät. Dafür hätte er schon einen Blick auf Herrn Meininger verdient.« Konstantin grinste. »Dank Ihnen bleibt ihm das erspart.«
Die Behandlung von Herrn Meininger oder besser das, was von ihm übrig geblieben war, konnte man als hart verdientes Geld bezeichnen: Ein Mann im besten Alter, nach einer feuchtfröhlichen Nacht in einen Leipziger Kanal gefallen und darin ertrunken, von der Strömung sanft entführt und nach Wochen von entsetzten Spaziergängern an einer Böschung gefunden. Nach der Freigabe durch die Polizei hatten die Angehörigen von Herrn Meininger seine aufgedunsene, gewässerte und von Pathologieskalpellen zerschnittene Leiche durch das Ars Moriendi abholen lassen.
Der Anblick und vor allem die Gerüche von Herrn Meininger dürften selbst den hartgesottensten Bewerber in Ohnmacht fallen lassen. Es sei denn, er müsste sich vorher mehrfach übergeben; dann könnte ein Malheur ins andere übergehen.
Konstantin zeigte auf seine Uhr. »Aber wenn er mehr als eine halbe Stunde zu spät ist, hat er verloren. Dann gibt es die harte Tour.«
Er verschwand durch die Tür und ging den gekachelten Korridor entlang, in dem es leicht nach Desinfektionsmittel roch und der in den eigentlichen Arbeitsbereich führte. Die zwei Welten von Ars Moriendi.
Den Namen seiner Firma hatte er nicht zufällig gewählt oder weil sich eine Bezeichnung auf Lateinisch schicker anhörte als Bestattungsunternehmen oder Pietät.
Übersetzt bedeutete es die Kunst des Sterbens und bezog sich einerseits auf die christlichen Bücher, die im späten Mittelalter entstanden und den Menschen im christlichen Sinn auf den Tod vorbereiten sollten, zum anderen auf den Umgang mit den Toten und deren Herrichtung für eine angemessene, würdevolle Beisetzung.
Nicht zuletzt war das Sterben für Konstantin tatsächlich eine Kunst.
Die Literatur überbot sich mit verschiedenen Mythen von Unsterblichen wie Zombies, Vampire, Seelenlose, es gab Flüche, Tinkturen, Alchemie, Magie, göttliches Wirken, Teufelspakte und vieles mehr.
Er dagegen hatte eine ganz eigene, besondere Art, mit dem Schnitter umzugehen.
Konstantin betrat die Umkleide, tauschte die schwarze Stoffhose und das schwarze Polohemd gegen einen gleichfarbigen Trainingsanzug. Hundert Prozent reinstes Polyester, denn nur aus dem Kunststoff ließen sich Gerüche und Flecken restlos auswaschen. Außerdem war er billiger zu ersetzen als Kleidung aus Baumwolle.
Über den Anzug kam eine langarmige, weiße Schürze, danach die lilafarbenen Kautschukhandschuhe für die Finger. Die bequemen Turnschuhe erhielten folienartige Überzieher.
Es kann losgehen. Konstantin schritt durch die Schwingtür und betrat seinen Arbeitsplatz.
Als Erstes schaltete er den MP3-Spieler ein. Der Zufallsgenerator wählte einen Song aus, und schon drang aus den Boxen der Mix aus getragenem, schwerem Stehbass und Synthie-Elementen der Leipziger Band Lambda. Die wundervolle Stimme der Sängerin erfüllte den fünfundzwanzig Quadratmeter großen, gefliesten Raum mit einem Liebeslied. Manche hätten die Musik vielleicht als unpassend empfunden, aber für Konstantin stand sie nicht im Widerspruch zu dem, was er im Begriff war zu tun.
Sein Reich, sein Arbeitsplatz. Zwei höhenverstellbare Metalltische mit Abflusssystem und Handbrause standen in der Mitte, an der linken Wand führte ein Durchgang zur Kühlkammer. In einer Ecke befand sich eine große Spüle mit einem Hängeschrank darüber, in dem die wichtigsten Utensilien lagerten, die Konstantin benötigte. Chirurgische Instrumente, Skalpelle, Scheren, Wundverschlusspulver, spezielles Sprühpflaster, Feuchtigkeitscreme. Dann gab es noch Tübchen mit Vaseline, Haarspraydosen und eine ganze Batterie von Make-up-Zubehör, Föhn sowie Bürste. Nicht zu vergessen Nähzeug und Fixierband. Jeder, der schon mal einen Krimi gesehen hatte, würde sich in der Pathologie oder in einem Operationssaal glauben.
Es gehörte zum Service des Ars Moriendi, die Toten herzurichten, sie zu waschen, einzucremen und anzukleiden, selbst wenn sie nicht offen aufgebahrt wurden. Die Männer erhielten dazu noch eine Rasur, Frauen wurden geschminkt. Fotos, die ihnen die Angehörigen übergaben, dienten dabei als Vorlage.
War eine offene Aufbahrung gewünscht und es verstrichen Tage zwischen Todeszeitpunkt und Bestattung, kamen Konstantins Künste der Thanatopraxie zum Einsatz. Deswegen verfügte der rechte Tisch über ein Pumpsystem, mit dem das Blut der Verstorbenen aus dem Körper entfernt und eine spezielle, rosa gefärbte Flüssigkeit in die Arterien geleitet wurde, die bis in die kleinsten Blutgefäße drang. Durch die rosa Flüssigkeit bekam der Verstorbene seine natürliche Hautfärbung zurück. Die Chemikalienmischung, die Konstantin selbst zusammenstellte, bestand zu einem gewissen Prozentsatz aus Formaldehyd, das den Verwesungsprozess aufhielt.
Vereinfacht ausgedrückt, machte er die Leichen haltbar, so dass sie nicht mehr auf Kühlung angewiesen waren und sogar extremste Wetterbedingungen überstanden. So konnten Verwandte und Freunde am Sarg defilieren, ohne von Gerüchen oder anderen Auflösungserscheinungen belästigt zu werden.
Konstantin sah auf die Liste der Toten, die für heute anstanden, und überflog die Information zu dem ersten Namen darauf. Das wird ein leichter Fall. Genau richtig für einen Montagmorgen.
Er ging in die Kühlkammer und schob die Bahre mit Gerd Pamuk, einundachtzig Jahre, in das Behandlungszimmer.
Er vermutete, dass der alte Mann einen friedlichen Tod gehabt hatte. Maik hatte den Körper gestern aus einem Seniorenheim abgeholt. Herzinfarkt, konstatierte der Totenschein, kurz nach dem Kaffeekränzchen. Die Leiche war in den obligatorischen Plastiksack eingepackt und schräg gelagert, mit den Füßen abwärts, damit das Blut nicht in den Kopf lief und seine Züge blau verfärbte.
Gerd Pamuks Verwandtschaft hatte den Wunsch geäußert, den alten Herrn nochmals zu sehen. Im offenen Sarg. Heute Vormittag sollte das geschehen, in Trauersaal eins des Ars Moriendi, also richtete Konstantin ihn her. Und das mit größtem Respekt.
»Schauen wir mal, wie viel ich zu tun habe.« Er öffnete den Sack.
Dünne, silberne Haare erschienen zuerst, es folgte eine hohe, faltige und gebräunte Stirn, buschige Augenbrauen, dann der Rest eines freundlichen Greisengesichts. Der Tote wirkte mit seiner bleichen, wächsernen Haut regelrecht puppenhaft. Die Augen waren geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Süßlicher Geruch stieg aus dem Plastiksack auf. Zersetzungsbakterien arbeiteten schnell, trotz der Lagerung bei fünf Grad.
Gerd Pamuk war geradezu zierlich, der runzlige Körper mit wenig Fleisch versehen. Also konnte Konstantin ihn problemlos alleine auf den Behandlungstisch hieven. Durch die Steifheit des kühlen Leibs, die rigor mortis, wurde es noch einfacher.
Dabei bemerkte Konstantin eine alte Tätowierung am linken Oberarm. Blassblau und grob gestochen, segelte ein Zweimaster über die zerknitterte Haut, darunter stand ein unleserlicher Name. Vielleicht war Gerd Pamuk einmal Seemann gewesen, mit einem Mädchen in jedem Hafen? Immer an Deck, bei Wind und Wetter. Zwei uralte Einschussnarben in der linken Schulter ließen den Schluss zu, dass er im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Der betagte Skipper war von Bord des Lebensschiffes gegangen.
Ob er es zu schätzen gewusst hat, dass er sterben durfte? Vermutlich war Pamuk der Tod ungelegen gekommen, mitten beim Tanztee und umringt von Damen, die sich an dem rüstigen Rentner erfreuten.
Es klopfte an der Tür.
»Kommen Sie«, rief Konstantin und sah gespannt zur Schwingtür. Er hatte die Schritte in der Umkleide gehört und gewusst, dass es nicht Mendy Kawatzki war. »Ich hoffe, Sie sind bereits umgezogen?«
»Bin ich, Herr Korff«, erfolgte die Antwort. Herein trat ein junger Mann mit schwarzgefärbten Haaren, einem Nasenpiercing, je vier Ringen in den Ohrmuscheln und Kajal um die Augen. Ein Gothic, von denen es in Leipzig einige gab. Sein Alter lag bei etwas über zwanzig. »Mein Name ist Jaroslaf Schmolke«, stellte er sich vor. »Ich muss mich für meine Verspätung entschuldigen. Mein ehemaliger Arbeitgeber hatte vergessen, mir das Zeugnis zu schicken.«
Na wunderbar. Konstantin seufzte innerlich. Gerd Pamuk lag auf dem Tisch wie eine Barrikade zwischen ihm und seinem möglichen Azubi. »Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, aber Sie sind nicht zufällig Fan von SixFeetUnder oder NavyCIS?« Seit es solche Serien gab, hatte ein Bewerberansturm auf die Gerichtsmedizin begonnen, und auch das Ars Moriendi bemerkte eine steigende Nachfrage nach Ausbildungsstellen. Die meisten Bewerber gaben jedoch bei der harten Tour auf. »Sie sollten keine falschen Vorstellungen von diesem Beruf haben.«
Jaroslaf blieb ungerührt; auch der Anblick des Toten schien ihm nichts auszumachen. »Nein, Herr Korff. Ich nehme an, Sie spielen auf die Forensikerin bei NavyCIS an, die den Quotengrufti mimt? Ich kann Ihnen versichern, dass mein Interesse an diesem Beruf keine Modeerscheinung ist oder ich ein Klischee bedienen möchte.«
Reden kann er. Konstantin hatte schon mit den schrägsten Vögeln zu tun gehabt, von ehemaligen Metzgern bis hin zu esoterisch angehauchten Yogalehrerinnen, die bei ihm anfangen wollten. Er bedeutete ihm, näher zu kommen. »Sie waren nach der Schule zunächst in einem anderen Beruf tätig?«
»Rettungsdienst. Ich kenne den Anblick eines menschlichen Körpers in verschiedenen Zuständen.« Jaroslaf lächelte. »Der Herr hier sieht im Vergleich zu einem Motorradunfall noch sehr gut aus.«
Konstantin nickte, und Hoffnung keimte in ihm auf, endlich einen guten Anwärter gefunden zu haben. »Sie können mir ein wenig zur Hand gehen, und wir reden dabei.« Er besprühte den Körper des Toten mit einem Desinfektionsmittel und schob eine Stütze aus Plastik in den Nacken. Von Jaroslaf ließ er sich Watte um eine Pinzette wickeln und in Alkohol tauchen, damit reinigte er Pamuks Ohren. Mit zwei weiteren alkoholgetränkten Wattebäuschchen fuhr er unter den weißen Wimpern und unter den Fingernägeln entlang. Augenhöhle, Nase und Mund wurden ebenso gründlich behandelt, um jede Verunreinigung zu beseitigen. Sonst bildeten sich Keime, die für üblen Geruch sorgten. Er bemerkte, dass die Zahnprothese locker saß. »Sie haben eine Ausbildung bei einem meiner Kollegen abgebrochen, wie ich las?«
»Ja. Er war nicht gut genug.«
»Ah. Und wieso denken Sie das?«
»Er ist nachlässig und kann mir nicht die Kenntnisse in Thanatopraxie vermitteln, die mich interessieren. Sie dagegen, Herr Korff, gelten als der beste Thanatologe in Deutschland und, soweit ich weiß, auch in Europa.«
Konstantin lächelte. »Wer sagt so etwas?«
»Es steht in Fachzeitschriften. Sie werden immer dann gerufen, wenn ein Fall besonders schwer ist oder andere Ihrer Zunft eine Einbalsamierung mit vorangehender Rekonstruktion abgelehnt haben.« Jaroslaf sprach ruhig, aber überlegt. Eine unaufdringliche, angenehme Stimme.
Konstantin betätigte die Handbrause und spritzte kaltes Wasser über den Toten. Warmes Wasser begünstigte Bakterien. »Holen Sie mir bitte das Bild von Herrn Pamuk, das auf der Ablage liegt«, wies er Jaroslaf an und tupfte das faltige Wachsgesicht mit einem weichen Schwamm ab. Er wusch die weißen Locken mit ein wenig Shampoo, spülte sie behutsam aus und knetete sie mit einem Handtuch trocken. »Stellen Sie sich dahin und halten Sie das Bild.« Konstantin frisierte die Haare wie auf dem Foto, der Föhn übertönte das nächste Lied von Lambda, das sich passenderweise Charon nannte. »Das ist genau mein Lied. Warum wollen Sie das Handwerk der Thanatopraxie erlernen? In Deutschland ist die Aufbahrung von Toten nicht weit verbreitet. Sie schwankt zwischen fünf bis zehn Prozent, wie Sie bestimmt schon wissen«, fragte er, als er den Föhn ausschaltete.
»In England sind es neunzig Prozent«, kam es von dem jungen Mann wie aus der Pistole gefeuert. »Ich denke daran, nach ein paar Berufsjahren ins Ausland zu gehen. Dorthin, wo es warm ist und ich gebraucht werde.«
Clever ist er auch. Konstantin hatte ein sehr gutes Gefühl bei diesem Bewerber, der anatomische Vorkenntnisse und Ehrfurcht mitbrachte, aber genug Wissensdurst besaß, um sich selbst fortzubilden. »Was wissen Sie über den Ursprung der Thanatologie?«
Jaroslaf schien mit der Frage gerechnet zu haben und antwortete, ohne zu zögern. »Jean Nicolas Gannal, französischer Offizier und Chemiker, geboren 1791 in Saarlouis. Abgesehen von einigen anderen Erfindungen, wurde er für seine Einbalsamierungsmethoden berühmt.«
»Wie kam es dazu?«
»Er wollte tote Soldaten nicht mit grausamen Verstümmelungen oder Entstellungen zu ihren Verwandten zurückschicken. Es ging darum, einen geliebten Menschen in guter Erinnerung zu behalten und nicht als verwestes, zerfetztes Stück Fleisch.«
Konstantin nickte beeindruckt. Das könnte was werden. Er massierte behutsam die Wangen des Toten von den Schläfen zur Mitte hin, um die Leichenstarre zu lösen. Als sich der Kiefer bewegen und der Mund öffnen ließ, streute er vorsichtig ein Pulver in Mund und Nase des Toten. »Wissen Sie, was ich eben gemacht habe?« Absichtlich hielt er das Etikett der Dose zu.
»Das müsste Ardol sein. Ein geruchs- und feuchtigkeitsbindendes Puder, das sich zu einer Masse verfestigt, sobald es mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Man sichert üblicherweise noch mit Wattestücken ab, um zu verhindern, dass Körperflüssigkeit ausläuft. Oder Knetwachs, das tut es auch.« Jaroslaf hielt noch immer das Bild in die Höhe. »Übrigens hat das mein vorangegangener Chef nicht gemacht. Das meinte ich mit nachlässig.«
»Sie wissen schon sehr viel. Respekt. Geben Sie mir die Eye Caps und die Creme vom Tischchen, bitte.«
Jaroslaf reichte ihm die halbrunden, glatten Halbschalen sowie die kleine Tube.
»Danke.« Konstantin trug die Haftsubstanz auf, setzte die Caps auf die Augen des Toten und verschloss Gerd Pamuks Lider, damit sie sich nicht während des Defilés öffneten. Einen solchen Schock galt es für Besucher und Angehörige zu vermeiden. »Sie können wieder nach oben gehen und Frau Kawatzki ausrichten, dass Sie die Stelle auf Probe haben, Herr Schmolke. Solange Sie mit mir an den Verstorbenen arbeiten, dürfen Sie die Ohrringe und den Kajal weiter tragen, aber sobald es um Kundenkontakt geht, müssen Sie leider etwas mainstreamiger auftreten.«
»Selbstverständlich, Herr Korff!« Jaroslaf strahlte. »Darf ich Ihnen noch zuschauen, bis Sie Ihre Arbeit beendet haben?«
Bei den meisten anderen Bewerbern hätte Konstantin vermutet, sie wollten sich einschleimen. Nicht bei Jaroslaf. Er zeigte echte Begeisterung für den Beruf, für das Handwerk, für den letzten Dienst an den Toten. Das hat man selten. »Sie dürfen. Legen Sie das Bild weg, und schieben Sie bitte den hellen Sarg herein.«
»Geben wir Ardol hinein?«
»Nein. In der kurzen Zeit werden keine Flüssigkeiten austreten. Auf das Ausstreuen des Bodens können wir daher verzichten.«
Jaroslaf eilte hinaus.
Er denkt wirklich mit. Währenddessen vernähte Konstantin mit einer gebogenen Nadel Gaumen, Lippen und Kinn durch die Mundhöhle, damit sich die Kiefer später nicht wie zu einem Schrei öffneten. Die Ligatur, wie dieser Vorgang genannt wurde. Keine leichte Arbeit, weil Konstantin ein besonderes Verfahren benutzte. Er zog den Faden durch die Scheidewand der Nase, vor den oberen Schneidezähnen entlang und um den Unterkiefer unterhalb der Haut, bevor er die Enden verknotete. Die Lippen selbst wurden nicht vernäht. Da die Zahnprothese locker saß, schob er sicherheitshalber einen Mundformer aus gebogenem Plastik hinter die Lippen und bestrich sie dann mit leicht rosagefärbter Vaseline. Fertig.
Zwischendurch war Jaroslaf zurückgekehrt und hatte ihn stumm beobachtet, sog jeden Handgriff auf und assistierte, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Aber als er zur Schere griff und den schönen grauen Anzug, den Pamuk bestimmt nur sonntags getragen hatte, aufschneiden wollte, griff Konstantin ein.
»Was haben Sie denn vor?«
»Aufschneiden, damit wir die Sachen ganz einfach überstreifen können. Hat mein Chef so gemacht.« Er legte die Schere weg. »Dachte mir schon, dass das nicht gut ist.«
»Wenn Sie mich fragen, macht so etwas kein seriöser Bestatter! Kleidung wird ordnungsgemäß angezogen und nicht aufgeschnitten«, erklärte Konstantin seine Einstellung. »Sollte es vorkommen, dass Kleidung nicht passt, bitte ich die Angehörigen, andere Kleidung vorbeizubringen.« Er nickte Jaroslaf zu. »Merken Sie sich das.«
Sie kleideten den Toten an, und gemeinsam hoben sie ihn in den vorbereiteten Sarg.
Konstantin bettete den Kopf auf ein Kissen, bedeckte die Beine mit einer weißen Decke und massierte die steifen Totenfinger biegsam, damit er die Hände wie zum Gebet falten konnte. »Gute Arbeit«, entließ er Jaroslaf schließlich. »Schürze aus, Handschuhe und Überzieher wegwerfen, Hände desinfizieren und hoch zu Frau Kawatzki. Die Probezeit hat hiermit begonnen. Ab Montag immer um neun Uhr zur Besprechung.«
»Danke, Herr Korff!« Der junge Mann tat wie geheißen und verschwand in die Umkleide, aus der gleich darauf ein unterdrückter Freudenschrei drang.
Endlich einer, der was taugt. Auf die Gruftis ist Verlass. Konstantin grinste und stäubte Kosmetikpuder mit Hilfe eines großen Pinsels über das Gesicht des Toten, die letzte Tätigkeit, bevor er den Sarg hinaus in den Gang rollte. Dann ging er zurück in den Raum, reinigte das Arbeitsgerät und stellte alles wieder an seinen Platz zurück.
Nachdem er sich umgezogen hatte, fuhr er Gerd Pamuk in Trauersaal eins, schuf mit Kerzen und leiser klassischer Musik ein Ambiente, in dem die Verwandten Abschied nehmen und sich dem Verlustschmerz hingeben konnten. In aller Privatheit.
Er mochte den Spruch, den sich der Tote zu seinen Lebzeiten für seinen Grabstein ausgesucht hatte:
Wenn die Blätter fallen,
wirst du zum Kirchhof kommen,
mein Kreuz zu suchen.
In einer kleinen Ecke
wirst du es finden.
Und dort werden
viele Blumen wachsen.
Obwohl er als Bestatter schon viele Zitate zu Gesicht bekommen hatte, geschmacklose und geschmackvolle, hörte er die Zeilen von Lorenzo Stecchetti zum ersten Mal. Ihm gefiel die Kombination aus Abschied und Aufmunterung.
Konstantin kehrte zu Mendy zurück, die sehr fröhlich wirkte. »Was ist denn mit Ihnen los?«
»Sie haben den jungen Mann eingestellt«, rief sie überschwenglich. »Das finde ich so toll!«
»Er ist gut, egal, was er anzieht und welchen Schmuck er trägt. Ich wäre ein schlechter Chef, wenn ich das nicht erkennen und honorieren würde. Und noch muss er die Probezeit durchstehen.« Er ließ sich von ihr das schwarze Sakko geben, das in einem Garderobenschränkchen hing, und warf es über das Polohemd.
Die Trauernden würden in einer Stunde eintreffen, und Konstantin hielt sich an das, was er Jaroslaf gesagt hatte: gegenüber den Kunden zu jeder Zeit professionell aussehen. Das Jackett verbarg die eintätowierten Schriftzeichen auf der Innenseite seines rechten Unterarms. Er trug den mahnenden Satz seit einundzwanzig Jahren in seiner Haut, und die Buchstaben hatten ihn in mancher harten Stunde vor einem Fehler bewahrt. Einem Fehler, der Unschuldigen das Leben gekostet hätte.
Ein kurzer Blick in den Spiegel zeigte, dass er in dieser Aufmachung vor die Hinterbliebenen treten durfte. Das schwarze Sakko betonte seine sportliche Figur nicht zu sehr. »Die Pamuks kommen bald, es ist alles vorbereitet. Ist der Papierkram fertig?«
»Ja, natürlich.« Mendy schien sich immer noch über den neuen Azubi zu freuen. »Ah, bevor ich das vergesse: Ars Moriendi hat eine Anfrage für einen dringenden Auslandseinsatz erhalten. Kam via E-Mail.«
»Wo?«
»Paris. Am besten sofort, hieß es.«
Konstantin überlegte. Er musste übermorgen nach Moskau. Für einen Abstecher in die französische Hauptstadt blieb kaum genug Zeit. Schade. »Schicken Sie …«
Mendy schüttelte den blonden Schopf. »Sie wurden ausdrücklich verlangt: der beste Thanatologe Europas.« Sie wollte ihm den Ausdruck reichen, als Stimmen an der Eingangstür erklangen. Gerd Pamuks Angehörige.
»Leiten Sie mir die Mail weiter«, sagte er leise und ging den Menschen entgegen, die unsicher ins Foyer des Ars Moriendi traten, um sie zu empfangen und ihnen die Scheu zu nehmen. Vor dem Tod des geliebten Opas, Vaters, Freundes und vor dem Gedanken an die eigene Sterblichkeit.
Konstantin saß auf dem Oberdeck der Vanitas, seinem Hausboot, und genoss die letzten Sonnenstrahlen des wundervollen Tages, die auf der Oberfläche des Cospudener Sees glitzerten.
Er war nach der Arbeit noch im Gewandhaus gewesen, hatte die öffentlichen Proben für das Konzert von Felix Mendelssohn Bartholdys 5. Sinfonie in d-Moll, der sogenannten »Reformations-Sinfonie«, gehört und die adrette, blonde Cellistin bewundert, wie er es seit einem Jahr tat.
Und sie hatte ihm zugelächelt. Wie sie es seit einem Jahr tat.
Es war ein Ritual zwischen den beiden, das ein unglaublich festes, unausgesprochenes Band zwischen ihnen bildete. Ein Paar, solange sie im Gewandhaus saßen. Er dort unten, sie da oben.
Mehr passierte nicht zwischen ihnen, auch wenn es Konstantin gefallen hätte, und der Cellistin vermutlich auch. Sie hieß Iva Ledwon, war fünfundzwanzig, hatte Cello studiert und kam aus Stralsund, wie er in ihrer Vita im Internet gelesen hatte.
Er wagte es nicht, den Kontakt zu vertiefen, weil er keine Lust auf Geheimnistuerei hatte.
Weil die Gefahr für sie einfach zu groß war …
In Sachen unerfüllter Liebe kannte Konstantin sich bestens aus, und in Sachen Dramatik war er bis an sein Lebensende restlos bedient. Daher gab er sich mit den Gedanken an Iva Ledwon und den Träumen an eine schöne Zeit mit ihr in einem anderen Leben zufrieden.
Vielleicht sollte ich die Besuche im Gewandhaus ganz sein lassen. Die kommenden Wochen würden sie sich ohnehin nicht sehen, denn er war viel unterwegs, und Teile des Ensembles gingen auf eine Tournee durchs Baltikum und durch Russland. Seine hartnäckigen, unerwünschten Gefühle konnten abkühlen oder am besten ganz auf Eis gelegt werden.
Er fläzte sich in den Liegestuhl, nahm einen Schluck von seinem abgewandelten Red Russian und blätterte in einem Buch. Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest oder Ernst sein ist alles. Einer von Konstantins besten Freunden zitierte den Schriftsteller ständig.
Am Ufer, etwas weiter entfernt von seiner Anlegestelle, herrschte reger Betrieb. Menschen vergnügten sich in Kneipen und Bistros, Kinder lachten und kreischten ausgelassen. Es wurde geplanscht, mit Booten gefahren oder geschnorchelt.
Eine der besten Ideen, die die Stadtoberen je gehabt hatten, war die Flutung der Braunkohlegruben rund um Leipzig und in den angrenzenden Gemeinden. Das Leipziger Neuseenland, das wuchs und wuchs, war ein kleines Paradies, und die Wasserqualität steigerte sich von Jahr zu Jahr.
Konstantin hatte das Kunststück geschafft, an der Anlegestelle am Ostufer, an der Marina des Zöbigker Winkels, einen Festplatz für sein Hausboot zu ergattern. Mit seinem schnellen, wendigen Beiboot kam er über den See und durch die Kanäle bis in die Innenstadt von Leipzig. Besser ging es kaum.
Er wohnte gern auf dem Wasser. Es vermittelte ihm eine gewisse Sicherheit, obwohl ein Meer noch besser gewesen wäre. Spaßeshalber hatte er sich einmal nach den Preisen von ausrangierten Bohrplattformen erkundigt, die Idee aber schnell wieder verworfen. So viele Menschen konnte er gar nicht beerdigen, um das nötige Geld zu verdienen.
Er beobachtete die Besucher, die auf dem Steg der Marina entlangschlenderten und die Schiffe bestaunten. Nach einem weiteren Schluck Red Russian, der dank der drei hinzugegebenen Minzblätter eine wunderbar erfrischende Note hatte, wandte er sich wieder dem Buch zu.
Ein leises FIEP verriet, dass sein Smartphone eine SMS erhalten hatte.
Konstantin nahm das Gerät zur Hand und sah eine Nachricht von Mendy: »Vergessen Sie bitte nicht den Kunden aus Paris, auch wenn Sie schon Feierabend haben. LG MK«
Sie kennt mich zu gut. Er durchsuchte seinen Posteingang und fand die weitergeleitete Mail aus Frankreich.
Da er die Sprache aus seiner Vergangenheit noch fließend beherrschte, war es kein Problem, den Inhalt zu verstehen. Der Verfasser, das erkannte er an den ersten Sätzen, griff auf Formulierungen zurück, wie sie ein Mensch mit Umgangsformen benutzte.
Geschätzter und geehrter Monsieur Korff,
nach dem gestrigen schrecklichen Unfalltod meiner geliebten Tochter Lilou ist es mir ein enorm wichtiges Anliegen, ihren Leichnam im Rahmen einer Abschiedszeremonie der Familie, den Verwandten, Freunden und der Öffentlichkeit ein letztes Mal präsentieren zu können.
Dabei geht es weniger um mich, auch wenn mir der Verlust meines Kindes Herz und Seele zerreißt.
Aber meiner Gemahlin ergeht es weitaus schlimmer. Seit der verheerenden Nachricht steht sie am Rande des Wahnsinns und weigert sich, den Tod unserer Tochter zu akzeptieren. Sie isst nicht, schläft nicht, redet unentwegt von Lilous Rückkehr und gerät immer tiefer in eine Scheinwelt.
Wir haben Angst, dass wir auch sie verlieren!
Meine Ärzte rieten mir, meiner Gemahlin eine aktive Abschiednahme zu ermöglichen, da dies für den Trauerprozess wichtig sei. Damit das Begreifen einsetzt und die Ablehnung des Geschehenen endet. Je plötzlicher der Tod und je jünger der Verstorbene, desto wichtiger sei es, meinten sie.
Meine Tochter war gerade einmal siebzehn Jahre, Monsieur Korff, und eine herausragende Schönheit. Der Stolz unserer großen Familie.
Die Andeutungen, die mir die Behörden über ihre Verletzungen machten, genügten, dass ich mich unverzüglich dazu entschloss, Ihre Dienste in Anspruch zu nehmen.
Ich habe Ihnen die Nummer meines persönlichen Sekretärs beigefügt, Monsieur Carlos Caràra. Er kümmert sich um die Abwicklung meiner Geschäfte und wird Ihr Ansprechpartner in allen Fragen sein.
In aller Offenheit: Geld spielt keine Rolle!
Ich erstatte Ihnen Ihre Auslagen in doppelter Höhe und bezahle das dreifache Honorar.
Oder Sie nennen Monsieur Caràra eine Summe, die er Ihnen im Voraus überweisen wird, aber ich flehe Sie an:
Kommen Sie sofort nach Paris!
Retten Sie meine Frau vor dem Wahn!
Erhalten Sie meiner in Trümmern liegenden Welt wenigstens diesen Hoffnungsschimmer!
Ergebenst und voller abgrundtiefer Trauer
Erneste Xavier de Girardin
Im Anhang der E-Mail befand sich ein Bild von einer jungen Frau, die fröhlich in die Kamera lachte: Lilou.
Die langen braunen Haare wehten im Wind, die blauen Augen blitzten fröhlich, als würde sie sich über eine Nachricht aus vollem Herzen freuen. Um ihren Hals lag eine Kette mit einem wundervollen Edelstein, der in der Sonne glitzerte. Die Aufnahme schien auf einem Boot gemacht worden zu sein, im Hintergrund sah Konstantin die weißen Dreiecke von Segeln und einen blauen Himmel, wie es ihn nur am Meer gab.
Anmut, Lebensfreude, Eleganz. Diese Worte huschten durch seinen Kopf. Er schluckte und trank den Red Russian auf Ex aus. Da hat sich der Tod ein hübsches Opfer gesucht.
Deswegen fühlte Konstantin jedoch nicht mehr Mitleid als sonst. Das bewahrte er sich für gestorbene Kinder auf, vor allem solche, die durch einen plötzlichen Unfall starben. Auch Selbstmörder rührten ihn an, weil sie so verzweifelt gewesen waren, dass sie dem Tod freiwillig auf die Schippe sprangen.
Doch Lilou, das spürte er, hatte etwas Besonderes umgeben, das nur wenige Menschen ihr Eigen nannten.
Und da kam seine thanatologische Kunst ins Spiel: Er musste der Toten diese Besonderheit zurückgeben. Für ein paar Stunden, für einen Gottesdienst, bis sich der Sargdeckel schloss und die Zersetzung letztlich doch über die Chemie siegte. Dabei spielte weniger das Geld eine Rolle, als die Herausforderung.
Konstantin goss einhändig Wodka und Kirschlikör in sein Glas, während er die Nummer von Caràra eingab. Klirrend landeten just die Eiswürfel darin, als sein Anruf entgegengenommen wurde, so dass er den Namen des Mannes nicht verstand. »Bonjour, Monsieur Caràra«, sagte er und verfiel ins Französische. »Hier spricht Korff.«
»Ich freue mich, von Ihnen zu hören, Monsieur Korff. Darf ich annehmen, dass ich Monsieur le Marquis einen positiven Bescheid überbringen kann?« Caràra sprach mit Akzent, allerdings geschliffen und sehr deutlich. Kein Vergleich zu Konstantins Gossenfranzösisch.
Er war kurz überrascht. Marquis? Ich hätte den Namen Girardin im Internet prüfen sollen. »Das dürfen Sie, Monsieur Caràra. Spätestens morgen Mittag sollte ich in Paris sein.«
»Ich würde Ihnen empfehlen, mit dem Flugzeug nach Saarbrücken zu fliegen und den Rest der Strecke mit dem TGV zurückzulegen. Nach dem Unfall ist der Flughafen Paris-Charles de Gaulle vorerst geschlossen, und die übrigen sind hoffnungslos überlastet.«
»Danke für den Hinweis.« Konstantin fügte dem Cocktail noch einige Minzblättchen hinzu, schwenkte sein Glas, um Likör und Wodka zu mischen, und nippte daran. »Monsieur Caràra, ich hoffe, mit Ihnen kann ich offen sprechen, auch wenn es unschön ist? Ich bräuchte noch ein paar Einzelheiten zur Schwere der Verletzungen von Lilou de Girardin. Gibt es Fotos?«
»Nein, Monsieur. Der Marquis hat sich dagegen verwehrt. Ich kann Ihnen nur einen Obduktionsbericht anbieten.«
Er verzog das Gesicht. Obduktion und Unfall verhießen nichts Gutes für die Rekonstruktion. Es wunderte ihn nicht, dass man nach ihm verlangte. »Tun Sie das bitte, Monsieur Caràra. Ich schicke Ihnen gleich eine Liste von persönlichen Dingen, die ich benötige, damit ich Demoiselle Lilou für die Aufbahrung entsprechend herrichten kann.«
»Was meinen Sie damit, Monsieur?«
»Lieblingskleid, Parfüm, Accessoires. Um das zu betonen, was sie ausgemacht hat. Zumindest das Äußerliche.«
»Selbstverständlich, Monsieur Korff. Es wäre hilfreich, wenn Sie mir außerdem eine Liste mit Materialien schickten, die Sie brauchen, um die Rekonstruktion durchzuführen. Ich lasse Ihnen eine Suite im Hôtel de Vendôme reservieren. Es liegt sehr schön und bietet formidablen Service. Sobald Sie angekommen sind, rufen Sie mich an. Ich hole Sie ab und bringe Sie … an den Ort.«
Konstantin hob die linke Braue. »Den Ort? Monsieur Caràra, das ist ein wenig unpräzise.«
Es war dem Privatsekretär unangenehm, darüber zu sprechen, wie der Tonfall verriet. »Monsieur, Sie können das vermutlich nicht wissen, aber die Familie Girardin ist sehr bekannt in Frankreich. Um zu vermeiden, dass die Presse Demoiselle Lilous sterbliche Überreste findet, muss ich darauf bestehen, die Lage des Ortes geheim zu halten, wo sie … aufbewahrt wird. Nicht auszudenken, wenn ein Foto des unbehandelten Leichnams in die Öffentlichkeit geriete. Ich möchte Ihnen mit dieser Auflage keinesfalls unterstellen, die Medien einzuschalten, aber die Damen und Herren sind sehr fix, was solche Dinge angeht. Dazu nicht minder rücksichts- und anstandslos.«
Das verstand Konstantin, ohne beleidigt zu sein. »Kein Problem. Machen wir es so, wie es der Marquis wünscht.« Ihm fiel auf, dass Caràra kein einziges Mal nach dem Honorar gefragt hatte. Er sah in seinen Red Russian und überlegte, ob er noch etwas wissen musste.
»Monsieur Korff?«
»Ja, ich bin noch da. Ich … nenne Ihnen meine Mailadresse, damit Sie mir den Bericht schicken können.« Konstantin gab sie durch.
»Sehr gut, Monsieur. Bliebe noch die Entlohnung«, sagte Caràra. »Wie der Marquis Ihnen schrieb, spielt Geld keine Rolle. Ich nehme an, Sie haben einen Stundensatz, wenn Sie außerhalb von Ars Moriendi tätig sind?«
»Habe ich, Monsieur Caràra. Er liegt bei …«
»Monsieur Girardin bezahlt Ihnen fünfhundert Euro die Stunde, sofern diese Summer über Ihrem herkömmlichen Satz liegen sollte«, unterbrach ihn der Privatsekretär, »und zwar unabhängig vom Resultat Ihrer Bemühungen. Wenn Sie es schaffen, Ihrem Ruf gerecht zu werden, und Demoiselle Lilou so herrichten, dass sie schlafend anstatt tot erscheint, erhalten Sie einen Bonus von 100000 Euro. Ihre Diskretion wird der Marquis mit weiteren 150000 Euro belohnen, ohne dass eine deutsche Steuerbehörde jemals davon erfahren muss, sofern Sie das wünschen.« Caràra sprach über die schwindelerregenden Summen so nebensächlich wie andere Menschen über Obst oder die Farbe einer Wand.
»Sehr großzügig.« Konstantin nahm erneut einen Schluck von seinem Drink. »Aber zu großzügig. Richten Sie Monsieur de Girardin meinen Dank aus, doch ich möchte nicht von seinem Leiden profitieren. Ich nehme meinen üblichen Stundensatz.«
»Wie Sie wünschen, Monsieur Korff.« In Caràras Stimme schwang hörbar Hochachtung mit. »Sie rufen mich an, sobald Sie einsatzbereit sind? Denken Sie an die Materialliste. Guten Abend.«
»Guten Abend, Monsieur Caràra.« Konstantin legte auf und leerte den zweiten Red Russian. Es fühlte sich unglaublich gut an, auf das viele Geld verzichten zu können. Das Ars Moriendi warf genug ab, seine Zusatzeinsätze auch. Er musste keinen Trauernden und Verzweifelten ausplündern. Es ging um Professionalität.
Dafür war er früher schon geschätzt worden.
Vor seiner Tätigkeit als Thanatologe.
Er nahm das Buch wieder zur Hand und stockte: The Importance Of Being Earnest. Ernst sein ist alles.
Wilde hatte damals mit Ernst, als Begriff und als Name, ein Wortspiel getrieben. Das Schicksal hatte es so gewollt, dass sein französischer Auftraggeber Erneste hieß.
Nein, ich will gerade kein Ernst sein.
Nach wenigen Seiten wurde Konstantins innere Unruhe zu groß, um noch weiterzulesen. Die Gedanken an Paris und Lilou ließen ihn einfach nicht los.