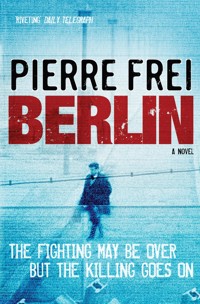9,99 €
Mehr erfahren.
Im Berlin der frühen Nachkriegszeit treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Ihm fallen vier Frauen aus unterschiedlichen Milieus zum Opfer: eine UfA-Schauspielerin, eine Psychiatrie- Krankenschwester, eine Prostituierte und eine Adelige im Auswärtigen Amt. Sie sind alle jung, blond und werden brutal zugerichtet und erwürgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Ähnliche
Das Buch
Berlin im Sommer 1945: Der fünfzehnjährige Ben, der nahe der U-Bahn-Station »Onkel Toms Hütte« in einem von den Amerikanern besetzten Viertel aufwächst, sammelt zwischen den Bahnhofsgleisen Zigarettenkippen für den Schwarzmarkt und stößt dabei auf die Leiche einer jungen Frau, die brutal misshandelt und erwürgt wurde. Inspektor Dietrich, der mit dem Fall betraut wird, sieht sich mit einem Serienmörder konfrontiert, dem in kurzer Zeit drei weitere Frauen zum Opfer fallen. Sie alle – eine UFA-Schauspielerin, eine Psychiatriekrankenschwester, eine Prostituierte und eine junge Adlige im Auswärtigen Amt – verbindet, trotz der unterschiedlichen Milieus, nicht nur ihr Aussehen, sondern eine enorme Leidensfähigkeit und Willenskraft. In ONKEL TOMS HÜTTE, BERLIN schildert Pierre Frei die außergewöhnlichen Schicksale dieser couragierten, lebenshungrigen Frauen und macht zugleich die Sehnsüchte der Zeit, die Gewissenskonflikte und bittersüßen Wendungen erfahrbar. Ein authentischer und bis zur letzten Seite fesselnder Roman.
Der Autor
Pierre Frei, Jahrgang 1930, wuchs im Viertel um den Berliner U-Bahnhof »Onkel Toms Hütte« auf. Seine ersten Kurzgeschichten veröffentlichte er als 16-jähriger Gymnasiast. Das folgende Studium der Publizistik verdiente er sich mit Zeitungs- und Rundfunkreportagen. Als freier Auslandskorrespondent berichtete der Autor später aus Rom, Kairo, New York und London, ehe er sich auf eine Farm in Wales zurückzog. Seit 1990 lebt der passionierte Reiter auf seinem Château im Südwesten Frankreichs.
Inhaltsverzeichnis
Für Catherine-Hélène
ERSTES KAPITEL
Der Junge ließ den Soldaten nicht aus den Augen. Der Amerikaner zog die letzte Lucky Strike aus der Packung und warf die leere Hülle achtlos auf die Gleise. Er zündete sich die Zigarette an und wartete, dass die von Krumme Lanke einlaufende U-Bahn hielt. Der Junge überlegte. Wenn der Ami nur die eine Station bis Oskar-Helene-Heim fuhr, würde er die halb gerauchte Zigarette dort nach dem Aussteigen in hohem Bogen wegschnipsen, und er konnte sie aufsammeln.
Ein Dutzend Kippen dieser Länge, das Aschenende mit einer Rasierklinge sauber abgeschnitten, brachte vierzig Mark. Fuhr der Ami jedoch weiter, war die Aussicht auf Ernte trübe, weil er den begehrten Stummel am Boden des Waggons zertreten oder aus dem sommerlich offenen Fenster katapultieren würde. Die Amerikaner waren in solchen Dingen völlig unbekümmert.
Ebenso unbekümmert hatte der Quartiermeister der US Army eine Quadratmeile um den U-Bahnhof Onkel Toms Hütte mit Stacheldraht eingezäunt und für die deutschen Fahrgäste nur einen schmalen Zugang gelassen. Auch die Ladenstraßen an den beiden Längsseiten des Bahnhofs wurden »Off Limits« erklärt und zum Einkaufszentrum der ringsum in den beschlagnahmten Wohnhäusern einquartierten Soldaten.
Jahrzehnte zuvor hatte ein Gastwirt sein Ausflugslokal im nahen Grunewald nach Harriet Beecher-Stowes Rührgeschichte »Onkel Toms Hütte« benannt, ein Name, den die Berliner Verkehrsgesellschaft Ende 1929 für ihre neue U-Bahn-Station übernahm. Den amerikanischen Besatzern des Jahres 1945 wurde »Aankel Taam« schnell ein fester Begriff.
Die U-Bahn hielt. Der Ami stieg ein, die Zigarette im Mundwinkel, und lehnte sich lässig gegen eine Haltestange. Ein nachfolgender Fahrgast schloss die Tür. Der Beamte in der Bahnsteigmitte hob die Kelle. Der Zugbegleiter ganz vorn gab mit einem Klopfen gegen die Scheibe das Zeichen an den Fahrer weiter und schwang sich in den anrollenden Wagen.
Der Junge sah dem Zug nach. Er hatte sich gegen den Stummel entschieden. Sobald der mit der Kelle ihm den Rücken zukehrte, sprang er auf die Schienen und steckte die leere Zigarettenpackung ein.
Über ihm erschien der Kopf des Kellenmannes. »Was machst du da unten?«, fragte er unwirsch.
»Kippen suchen.«
»Und? Welche gefunden?« Der Mann dachte an seine leere Pfeife.
»Keine Kippen. Nur ’ne tote Frau.« Der Junge deutete gleichgültig neben die Gleise.
Der Fahrdienstleiter setzte sich auf die Bahnsteigkante, legte die Kelle hin und ließ sich ächzend herab. Aus einem der seitlichen Einstiege, durch die man gebückt zu den Kabeln unter dem Bahnsteig gelangte, ragten zwei schlanke Beine in zerrissenen hellen Nylonstrümpfen, an den Füßen braune Pumps mit weißen Blenden und hohen Absätzen, wie sie zur Zeit in den USA Mode waren. Auf dem weißen Leder waren dunkelrote Blutflecken.
»Das is ’ne Amerikanerin. Lauf und hol die Amis.« Der Mann kletterte wieder auf den Bahnsteig und eilte in sein Kabuff. Er riss den Hörer des Streckentelefons von der Gabel und kurbelte durch. »Krumme Lanke? Hier Fahrdienstleiter Onkel Tom. Wir haben eine Tote auf Gleis eins. Stoppen Sie die Züge aus Ihrer Richtung. Ende.«
Der Junge hieß Benjamin, aber alle riefen ihn Ben. Er war ein dunkelblonder Bursche von fünfzehn, an dem die Ereignisse der letzten Monate scheinbar spurlos vorübergegangen waren: die Bomben der Engländer und Amerikaner, das Chaos der letzten Kriegstage, das Wüten der Roten Armee. Er hatte das Erlebte einfach in einer Schublade im Kopf abgelegt, um neuen Eindrücken Platz zu schaffen. Neu waren Glenn Miller, Chewing Gum, Hershey’s Chocolate und meilenlange Autos, wobei der Buick Eight ganz vorne lag, gefolgt von De Soto, Dodge und Chevrolet. Neu waren grellbunte Schlipse und knöchelkurze enge Hosenbeine, Old Spice und Pepsi Cola. Das alles kam über Nacht: als die Russen vereinbarungsgemäß halb Berlin räumten und nun auch die westlichen Alliierten Einzug in die zerstörte Hauptstadt hielten.
Ben stieg die breite Treppe zu den Schaltern hinauf und trollte durch die Stacheldrahtpassage hinaus in die staubige Sommerhitze, die einen sofort durstig machte. Er entschied sich im Geiste für eine kalte Waldmeisterbrause. Wenn man den Bügelverschluss öffnete, knallte es verheißungsvoll, und die Kohlensäure stieg rauchend wie ein Dschinn aus der Flasche. Aber es gab keine Waldmeisterbrause, nur staubige Hitze, in der ein Geruch von DDT-Insektenpulver und Spearmint-Kaugummi hing. Seit dem Einzug der Amis roch alles anders.
Langsam schlenderte Ben zum Posten an der Einfahrt des Sperrgebietes. Eile wäre ein Zeichen von Betroffenheit gewesen. »Dead woman on the U-Bahn«, sagte er lässig.
»Okay, buddy. It better be true.« Der Posten griff zum Telefon.
Der Anruf kam von der Military Police. Inspektor Klaus Dietrich nahm ihn entgegen. »Ja, danke, wir kommen.« Er legte auf und rief: »Franke, den Wagen!«
»Wird gerade angeheizt. Das dauert ’ne gute halbe Stunde.« Kriminalmeister Franke wies aus dem Fenster auf den alten Opel am Bordstein, aus dessen Heck eine Art abgesägter Badeofen ragte, den ein Polizist mit Holzresten fütterte. Erst wenn diese ausreichend schwelten, würde sich das zum Antrieb des Motors nötige Holzgas entwickeln. Benzin gab es für die Kriminalinspektion Berlin-Zehlendorf nicht.
»Wir nehmen die Fahrräder«, entschied Dietrich. Er war ein großer Mann von fünfundvierzig mit früh ergrautem Haar und infolge der Hungerrationen markanten Wangenknochen. Er trug einen grauen, zu weit gewordenen Zweireiher, den einzigen Anzug, den Inge aus der zerstörten Wohnung am Kaiserdamm hatte retten können. Das linke Bein zog er ein wenig nach. Die Prothese scheuerte bei warmem Wetter. Man hatte sie ihm im Hilfslazarett in der Zinnowaldschule angepasst, wo er das Kriegsende überdauerte. Eine Gefangenschaft blieb ihm wegen seiner Verletzung erspart. Schon im Mai durfte er nach Hause. Inge und die Jungs waren ganz in der Nähe bei den Eltern in der Riemeister Straße untergekommen. Inges Vater, Dr. Bruno Hellbich, hatte die Hitlerjahre zwangspensioniert, ansonsten aber unbehelligt überstanden. Danach kehrte er auf seinen Posten als sozialdemokratischer Bezirksrat ins Zehlendorfer Rathaus zurück und konnte dem Schwiegersohn eine Stellung als Inspektor bei der Kripo besorgen. Die Kriminalinspektion Zehlendorf brauchte einen kommissarischen Leiter. Dass Klaus Dietrich vor dem Krieg zweiter Mann in der Direktion der Wach- und Schließgesellschaft und politisch nicht vorbelastet war, machte das Fehlen des linken Unterschenkels und einer kriminalistischen Ausbildung wett. Im Übrigen fand er schnell heraus, dass sein gesunder Menschenverstand völlig ausreichte, um mit Schwarzhändlern, Dieben und Einbrechern fertig zu werden.
Sie erreichten den U-Bahnhof in einer Viertelstunde. Ihre Dienstausweise bahnten ihnen einen Weg durch die anwachsende Menschenmenge.
»Ach du Scheiße, mein Alter«, murmelte Ben und verdrückte sich.
Ein amerikanischer Offizier stand mit einem Militärpolizisten und dem Fahrdienstleiter auf den Gleisen. Sie hatten die Tote neben die Schienen gebettet. Sie war blond und hatte ein schönes, ebenmäßiges Gesicht. Ihre blauen Augen starrten ins Nichts. Blutunterlaufene Strangulierungsmale kerbten sich in den zierlichen Hals. Klaus Dietrich deutete auf ihre Nylonstrümpfe, die kaum getragenen Pumps und das helle, modische Sommerkleid. »Eine Amerikanerin«, meinte er besorgt. »Wenn das ein Deutscher getan hat, gibt’s Ärger.«
Kriminalmeister Franke kratzte sich am Kopf. »Irgendwie kommt mir ihr Gesicht bekannt vor.«
Der Offizier richtete sich auf. »Which of you guys is in charge here?«
»Inspektor Dietrich und Kriminalmeister Franke von der Kriminalinspektion Zehlendorf«, stellte Klaus Dietrich vor.
»Captain Ashburner, Military Police.« Der Amerikaner war groß und schlank, mit glattem blondem Haar. Ein hellwacher, intelligenter Blick traf den Deutschen. Er wies auf seinen Begleiter: »Das ist Sergeant Donovan.« Der Sergeant war untersetzt, mit kräftigen breiten Schultern und einem Bürstenhaarschnitt.
Dietrich hob den linken Arm der Toten. Das Glas ihrer Uhr war zersplittert, die Zeiger standen auf 22 Uhr und 42 Minuten. »Vermutlich die Tatzeit«, stellte er fest. Er winkte den Fahrdienstleiter heran. »Gestern Abend, gegen Viertel vor elf, wer hatte da Dienst?«
»Ich natürlich«, sagte der Mann beleidigt. »Bis zum letzten Zug um 22 Uhr 48, und wieder ab 6 Uhr früh. Man gönnt uns ja kaum noch Nachtruhe.«
»Warteten viele Fahrgäste auf den letzten Zug?«
»Ein paar Amis mit ihren Mädchen und zwei, drei Deutsche.«
»War die Tote unter ihnen?«
»Kann sein, kann nicht sein. Musste den Zug um 22 Uhr 34 nach Krumme Lanke abfertigen. Da sieht man sich die Fahrgäste nicht einzeln an. Nur dieser Verrückte mit Schutzbrille und Lederkappe sprang mir sozusagen in die Pupille. Herr Pastor geht Rodeln, dachte ich, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Schutzbrille und Lederkappe?«
»Wie ein Motorradfahrer, würde ich sagen. Aber ganz so genau sah ich ihn nun auch wieder nicht. Die Beleuchtung der hinteren Bahnsteighälfte ist seit Wochen im Eimer.«
»Er stand also im Halbdunkel.«
»Als Einziger, wenn Sie mich so fragen. Die anderen Fahrgäste warteten im Hellen.«
»Sahen Sie ihn einsteigen?«
»Nee. Ich muss ja dem Zugbegleiter vorne das Signal zur Abfahrt geben. Tschuldigung, der 11 Uhr 10.«
»Hey, Kraut, have a look.« Der MP-Sergeant reichte Dietrich eine Umhängetasche. »Keine Amerikanerin, sondern eine von euch. Karin Rembach, fünfundzwanzig. Arbeitet in unserem Dry Cleaning Shop da drüben.« Er wies durch das Trenngitter in die Ladenstraße. »Nylons und Schuhe hat vermutlich ihr Boyfriend für sie im PX gekauft. Soldat Dennis Morgan ist beim Signal Corps in Lichterfelde stationiert.«
Klaus Dietrich öffnete die Tasche. Ein Ausweis für deutsche Angestellte der US Army und ein Zettel mit Namen und Kasernenanschrift des Soldaten verrieten, woher die Weisheit des Sergeants stammte. »Ich würde diesen Morgan gerne vernehmen.«
»Ein Kraut will einen Amerikaner verhören? Hast du immer noch nicht kapiert, wer den Krieg gewonnen hat?«, bellte der Sergeant.
»Ich habe vor allem kapiert, dass der Krieg vorbei ist, und dass Mord jetzt wieder bestraft wird«, entgegnete Klaus Dietrich ruhig.
Einen Moment schien es, als würde der bullige Donovan auf ihn losgehen, aber sein Captain schaltete sich ein: »Ich werde Morgan befragen und Ihnen das Protokoll schicken. Sie schicken mir dafür den Obduktionsbefund. Eine Ambulanz unseres Medical Corps bringt die Tote, wohin Sie wollen. Goodbye, Inspektor.«
Der Kriminalmeister sah den Amerikanern nach. »Nicht sehr freundlich, die Herren.«
»Das Vorrecht der Sieger. Franke, was halten Sie von dem Mann mit der Schutzbrille?«
»Entweder ein Verrückter, wie der Fahrdienstleiter meint, oder einer, der nicht erkannt werden wollte. Herr Inspektor, warum nennen die uns Kraut?«
Klaus Dietrich lachte. »Unsere transatlantischen Befreier meinen, wir Deutschen äßen nichts als Sauerkraut.«
»Mit Eisbein und Erbspüree.« Die Stimme des Kriminalmeisters hatte plötzlich einen sehnsüchtigen Klang. Eine Sirene kam näher und verstummte. Zwei G.I.s mit Rotkreuz-Armbinden trugen eine Bahre die Treppe runter. Das Leichenschauhaus in Berlin Mitte war ausgebombt und lag überdies im sowjetischen Sektor. Klaus Dietrich ließ die Tote darum ins nahe Krankenhaus »Waldfrieden« bringen. Sein Freund Walter Möbius war dort Chefarzt.
»Ich nehme sie mir später vor«, sagte Dr. Möbius. »Ich muss die Lebenden operieren, solange das Tageslicht reicht und anschließend weiter bis zur Stromsperre um neun Uhr. Wenn du unbedingt dabei sein willst – ab drei Uhr früh haben wir wieder Strom.«
Ein jüngerer Mann im feinsten Vorkriegs-Glencheck zündete sich vor dem U-Bahnhof lässig eine extralange Pall Mall an. Ben blickte neidisch auf die dicken Kreppsohlen seiner Wildlederschuhe. Er kannte ihn flüchtig. Hendrijk Claasen war Holländer und Schwarzhändler. Nur ein Schwarzhändler konnte sich so einen scharfen Anzug leisten. Ben wollte auch einen Glencheck-Anzug und Kreppsohlen. Er malte sich aus, wie er Heidi Rödel maßgekleidet auf zentimeterdicken Sohlen gegenübertreten würde. Dann war Gert Schlomm in seinen lächerlichen kurzen Lederhosen abgemeldet.
Der Junge trottete vom Bahnhof nach Hause, froh, eine Begegnung mit seinem Vater vermieden zu haben. Papa hätte Fragen gestellt. In diesem Falle, wieso Ben tote Frauen auf U-Bahngleisen fand, statt in der Schule zu sein. Papa hatte eine leise, sarkastische Art, immer haargenau den wunden Punkt zu treffen.
Ben hatte nichts gegen die Schule an sich, nur gegen ihre Regelmäßigkeit. Das hinter ihm liegende Chaos hatte nicht nur Angst und Schrecken gebracht, sondern auch Abenteuer und Freiheit, und es fiel ihm schwer, sich wieder an eine festgefügte Ordnung zu gewöhnen.
Er steuerte das Haus von der Rückseite an, kroch in den Verschlag am Ende des Gartens und zog die Schultasche unter ein paar leeren Kartoffelsäcken vor. Seine Großmutter jätete an der Veranda Unkraut. Den Rasen hatte sie schon vor Monaten umgegraben und Tabak angepflanzt. Der Bezirksrat war ein starker Raucher. Sie trocknete die Blätter für ihn auf dem Herd. Es stank grässlich im ganzen Haus, doch das war das kleinere Übel. Hellbich war unausstehlich, wenn sein Körper vergeblich nach Nikotin lechzte.
»Bei Frau Kalkfurth gibt’s eine Sonderzuteilung Margarine. Ralf steht schon an. Geh und löse ihn ab. Deine Mutter kommt später. Sie ist zum Schuster. Hoffentlich kann er die Sandalen deines Bruders nochmal reparieren. Der Junge läuft inzwischen in zerlöcherten Turnschuhen rum.«
»Okay.« Ben stieg die steile Treppe hinauf ins Dachzimmer, das er mit Ralf teilte. Er warf die Schultasche aufs Bett. Das leere Päckchen Lucky Strike legte er zwecks späterer Verwertung zu der Rasierklinge in die Tischlade, ehe er wieder runterging.
In der Küche war niemand. Er zog die linke Schublade aus dem Küchenschrank, langte in die Öffnung, schob den Riegel nach unten und drückte die verschlossene Tür von innen auf. Inge Dietrich verwahrte unten im Schrank die Brotrationen der Familie: morgens und mittags für jeden zwei trockene Scheiben. Abends gab es »warm«.
Ben säbelte sich eine extradicke Scheibe ab und klemmte sie zwischen die Zähne. Er tat den Laib zurück in den Schrank, machte die Tür zu und zog den Riegel hoch. Er setzte die Schublade wieder ein. Dann trabte er los, den schlangestehenden kleinen Bruder abzulösen. Unterwegs verzehrte er seine Beute mit möglichst kleinen Bissen. Das verlängerte den Genuss.
Frau Kalkfurths Laden befand sich im ehemaligen Wohnzimmer eines Reihenhauses »Am Hegewinkel«. Andere der kleinen Straßen mit den bunten Eigenheimen hießen »Hochsitzweg«, »Lappjagen« oder »Auerhahnbalz«. Ein jagdbesessener Bezirksbürgermeister hatte sie einst so getauft. Die ans Haus gebaute Garage diente als Lager. Früher beherbergte sie das Familienauto. Die Kalkfurths hatten eine große Fleischerei im Osten Berlins. Inzwischen war die Fleischerei längst eine Ruine und das Automobil, ein »Adler«, nur noch Erinnerung.
Weil sie schon vor dem Krieg in der Branche tätig gewesen war, erhielt die Witwe Kalkfurth nach dem Zusammenbruch die kostbare Gewerbegenehmigung für ein Lebensmittelgeschäft. Ihr früherer Fleischergeselle Heinz Winkelmann stand hinter dem improvisierten Ladentisch. Sie selbst dirigierte das kleine Unternehmen vom Rollstuhl aus und klebte abends die Rationsabschnitte der Kundschaft auf große Bögen Zeitungspapier. Ein Vertreter der Zuteilungsstelle holte sie wöchentlich ab. Das Haus am Hegewinkel bewohnte sie alleine. Diskrete Gaben von Butter, Dauerwurst und Räucherspeck an den zuständigen Sachbearbeiter beim Wohnungsamt bewahrten sie vor der Einweisung Obdachloser.
Die Schlange vor dem Laden war endlos und grau. Viele der Frauen trugen alte Männerhosen und Kopftücher. Es gab keinen Friseur. Ralf stand ziemlich weit hinten. Er wischte mit einem abgebrochenen Zweig im Zickzack über den Gehsteig. Kalkfurths getigertes Kätzchen versuchte, den Zweig zu fangen. Das Spiel fand ein plötzliches Ende, als sich ein Dackel ganz am Ende der Schlange losriss und das Kätzchen attackierte. Es floh mit langen Sätzen in die Garage.
Ralf packte den kläffenden Hund am Halsband und zerrte ihn zu seinem Besitzer. »Können Sie nicht auf Ihren Köter aufpassen?«, rief er mit heller Stimme.
»Nich frech werden, mein Junge. Lehmann, sitz.« Der Mann nahm den Dackel an die Leine.
Ralf lief in die Garage, vor deren rückwärtigem Teil sich alte Gemüsekisten und zerbrochenes Mobiliar zu einem undurchdringlichen Wall türmten. »Mutzi, Mutzi«, lockte er. Klägliches Miauen antwortete ihm von der anderen Seite. Nirgends war ein Durchkommen. Oder doch? Die verschimmelten Türen des Kleiderschranks vor ihm hingen schräg in ihren Angeln. Die Rückwand war geborsten. Der Junge zwängte sich durch. Die kleine Katze kauerte im Halbdunkel auf einer zerschlissenen Steppdecke. »Komm, Mutzi. Der doofe Dackel is längst wieder an der Leine.« Er hob das verängstigte Tier auf. Es hatte sich so festgekrallt, dass es die Steppdecke mitnahm. Der Sattel eines Motorrades kam zum Vorschein. Vorsichtig befreite der Junge das Tierchen. Er legte die Decke wieder an ihren Platz und kroch mit seinem Schützling ans Tageslicht.
»Da biste ja endlich«, begrüßte ihn Ben vorwurfsvoll. »Wo stehst du?«
»Hinter der mit dem grünen Kopftuch.« Ralf ließ die Katze frei und trollte sich. Ben stellte sich widerwillig an seinen Platz. Er hasste es, anzustehen.
Er verkürzte die Wartezeit, indem er sich ausmalte, ein Mann in weißer Jacke mit dampfendem Würstchenkessel vor dem Bauch käme vorbei, wie damals im Strandbad Wannsee. Da war er noch ganz klein, und es gab keinen Krieg. Er meinte das quatschende Geräusch zu hören, mit dem der Mann den Senf aus dem Hahn auf den Pappteller drückte. Irgendwie klang es herrlich unanständig.
Seine Mutter kam gegen sechs. Meister Gritscher hatte Ralfs Sandalen zum zigsten Mal repariert. »Ein richtiger Zauberer«, sagte sie zur Nachbarin. »Geh, mach deine Hausaufgaben«, mahnte sie den Sohn. »Nimm deinen Bruder mit.«
»Was darf’s denn Schönes sein, Frau Dietrich?« Winkelmann strahlte gesund und satt über den Tresen. Er saß an der Quelle.
»Hundertfünfzig Gramm Eipulver, ein Brot und die Sonderzuteilung Margarine. Können Sie das Eipulver als Vorschuss auf die Ration nächste Woche anschreiben?«
»Da muss ich erst die Chefin fragen. Frau Kalkfurth, kommen Sie mal?«, rief er nach hinten.
Martha Kalkfurth hatte grau durchwobene dunkle Locken und ein alterslos glattes rundes Gesicht mit Doppelkinn. Sie saß schwer in ihrem Rollstuhl, den sie geschickt zwischen Säcken mit Trockenkartoffeln und Kartons voller Tüten Ersatzkaffee hindurchlenkte.
»Kann Frau Dietrich hundertfünfzig Gramm Eipulver anschreiben?«
»Bitte, Frau Kalkfurth, es ist nur bis Montag, da gibt’s neue Karten.«
Martha Kalkfurth schüttelte den Kopf. »Bei mir gibt es keine Extrawurst, auch wenn Ihr Mann bei der Polizei ist.« Sie wendete den Rollstuhl und fuhr wieder nach hinten.
Ben fand seinen Bruder vor der Eisdiele der Amis. Einer beugte sich zu ihm runter und gab ihm eine große Portion Ice Cream. Ralf hatte meistens Erfolg mit seiner Bettelei, weil kaum einer seinem Engelsgesicht widerstehen konnte. Sie löffelten das Vanille- und Schokoladeneis auf dem Heimweg mit den beigegebenen Waffeln. Das Leben war okay.
Aus dem »Club 48« drangen die weichen Klänge der »Starlight Melody« und der verlockende Duft gegrillter Steaks und weckten unerfüllbare Sehnsüchte in den vorübereilenden Deutschen. Die US Engineers hatten den Bau aus Fertigteilen in drei Tagen zusammengeschraubt und in einer Woche komplett mit Küche, Cocktailbar, Tischen und Tanzfläche ausgestattet.
Der Kommandant des American Sector of Berlin, ein Zweisternegeneral aus Boston, hatte den Club an die einfachen Soldaten und Unteroffiziere übergeben und mit seiner Frau eine Ehrenrunde getanzt, bevor er sich erleichtert ins nahe Harnackhaus zurückzog, wo die höheren militärischen und zivilen Chargen ihre Dry Martinis tranken.
Jutta Weber arbeitete in der Küche des »Fortyeight«. Die hübsche blonde Dreißigjährige schälte Kartoffeln, spülte Geschirr und schleppte die schweren Töpfe und Pfannen, in denen der Mess Sergeant Jack Panelli und seine Köche Konserven und Tiefgefrorenes zu herzhafter Kost ohne sonderliche Raffinesse verarbeiteten.
Gegen elf Uhr fuhr sie nach Hause. Die Fahrradlaterne erhellte schwach ihren Heimweg durch die Argentinische Allee. Die Häuser lagen im Dunkeln. Bis drei Uhr früh war Stromsperre im Viertel. Danach kam Steglitz dran. Die zur Hälfte zerbombten Turbinen der Stadtwerke und die Kohlenknappheit zwangen zur Rationierung der Stromversorgung. Aus der Nacht tauchte ein später Fußgänger auf. Jutta betätigte die scheppernde Klingel am Lenker, aber er kam direkt auf sie zu. Sie wich aus, schrammte mit dem Vorderrad den Bordstein und verlor das Gleichgewicht. Einen Moment lag sie hilflos auf dem Pflaster. Scheinwerfer näherten sich und streiften für den Bruchteil einer Sekunde das Gesicht über ihr. Die Gläser einer großen Schutzbrille blinkten. Doch schon verschwand das Gesicht wieder in der Dunkelheit.
Ein offener Jeep hielt. Der Fahrer sprang heraus. »Everything okay?« Er half ihr auf die Beine. Sie erkannte die Abzeichen eines Captains und die Armbinde der Military Police. Er war sehr groß, etwa eins neunzig, schätzte sie.
»Everything okay«, versicherte sie. »I’m on my way home. I work at the Fortyeight.« Sie wies ihren Ausweis als deutsche Army-Angestellte vor, der ihr den Heimweg auch nach der Sperrstunde gestattete. In der Nähe startete ein Motorrad und entfernte sich schnell.
»Ihre Lampe ist nicht sehr hell. Da kann man leicht ein Hindernis übersehen.« Offenbar hatte er den Mann mit der Schutzbrille nicht bemerkt. »Ich fahre Sie nach Hause.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, wollte sie ablehnen, aber da hatte er ihr Rad schon hinten auf den Jeep geladen, und es blieb ihr nichts übrig, als einzusteigen.
»Where do you want to go?«
»Geradeaus und rechts in die Onkel-Tom-Straße.«
Er fuhr an. Sie musterte ihn von der Seite. Viel von seinem Gesicht war unter dem Helm in der Dunkelheit nicht zu sehen. »Sind Sie immer so spät dran?« Er hatte eine ruhige, männliche Stimme, die ihr Vertrauen einflößte. Ein bisschen wie Jochen, dachte sie wehmütig.
»Ich habe nie vor elf Uhr Schluss. Außer mittwochs. Da komme ich schon um sieben raus.«
»Sie sollten nachts sehr vorsichtig sein. Man kann nie wissen, wer sich in der Finsternis rumtreibt.« Er bog in die Onkel-Tom-Straße ein. Nummer 133 war eines der zweistöckigen Wohnhäuser auf der rechten Seite, die ein farbenfreudiger Architekt in den zwanziger Jahren hatte bunt bemalen lassen. Er half ihr aus dem Fahrzeug und lud das Rad ab.
»Thanks, Captain.You were a great help.«
»It was a pleasure, Madam.« Er legte die Hand zum Gruß an den weißen Helm.
Netter Amerikaner, dachte sie. Sie schloss die Haustür auf, versperrte sie von innen und trug das Rad in den Keller, wo sie es mit Kette und Schloss sicherte. Leise ging sie hinauf. Nur die kleine Dynamolampe surrte, wenn sie den Hebel bewegte.
Die Wohnung oben links war frei geworden, nachdem ihr Mieter, ein NS-Ortsgruppenleiter, seine Frau und sich beim Einmarsch der Roten Armee erschossen hatte. Sie bestand aus drei Zimmern. Eines davon bewohnten die Königs mit ihrem zwölfjährigen Sohn Hans-Joachim. Jutta hatte das Zimmer daneben. In die Kammer gegenüber hatte das Wohnungsamt den frisch aus der Gefangenschaft entlassenen Jürgen Brandenburg eingewiesen, einen kleinen dunkelhaarigen Endzwanziger im blauen Tuch der Luftwaffe.
Die Tür zum Zimmer der Königs stand offen. »Frau Weber, kommen Sie doch rein, setzen Sie sich, es wird gerade interessant«, rief Herr König aufgekratzt. Er schenkte Kartoffelschnaps ein. »Aus der Geheimdestille meines Bruders. Der hat in Steglitz einen Schrebergarten. Mögen Sie ein Gläschen?«
»Nein, danke, Herr König.«
»Also, wo waren wir, Herr Hauptmann?«
Brandenburgs schwarze Blindenbrille spiegelte das Kerzenlicht wider. Mit schräg aufgestellten Händen demonstrierte er einen seiner zahllosen Luftkämpfe: »Der Engländer kommt von oben aus den Wolken. Ein zweimotoriger Moskito. Ein gefährlicher Bursche mit drei Bordkanonen. Ich kurve seitlich weg. Er taucht an mir vorbei, braucht einen Moment, um wieder zu steigen. Ich warte, dass er an mir vorbeiklettert, und beharke seinen Bauch. Ratatata – Peng – Volltreffer. Er fliegt mir in tausend Stücken um die Ohren. Mein fünfundzwanzigster Luftsieg. Für den gab’s das Ritterkreuz, und zwar von ›Ihm‹ persönlich.«
»Bravo!« Herr König war ganz aus dem Häuschen. »Das Ritterkreuz. Stellen Sie sich das mal vor, Frau Weber.«
Jutta blieb kühl: »Ich stelle mir lieber vor, dass das nun alles vorbei ist und dass ›Er‹ kein Blech mehr verteilt, sondern in der Hölle schmort. Haben Sie denn immer noch nicht genug von Ihren mörderischen Trapper- und Indianerspielen?«
Brandenburg sprang auf. »Das Blech verbitte ich mir.«
»Dann reden Sie auch keines, okay? Gute Nacht allerseits.« In ihrem Zimmer zündete sie eine Kerze an und trug sie ins Bad, zum Zähneputzen. Die starke amerikanische Zahnpasta überdeckte den scheußlichen Chlorgeschmack des Leitungswassers. Beim Einschlafen sah sie Jochen vor sich. Er war gleich zu Beginn des Krieges gefallen. Von nebenan tönten angeregt die Stimmen der Männer. Nimmt das denn nie ein Ende?, dachte sie bitter.
Der Motorradfahrer war enttäuscht und ärgerlich. Tagelang hatte er sein Opfer beobachtet, ehe er es für würdig befand. Sorgfältig, ja geradezu liebevoll hatte er es aus einem kleinen Kreis blonder, blauäugiger Anwärterinnen ausgewählt. Nicht jede hielt dieser Prüfung stand.
Ganz nah war er ihr schon gewesen, und dann hatte der Jeep alles zunichte gemacht. Wer weiß, wie lange er nun auf eine neue Gelegenheit warten musste.
Er sicherte nach allen Seiten, aber um diese Stunde hatte er nichts zu befürchten. Ungesehen brachte er die Maschine zurück in ihr Versteck, wo er auch Schutzbrille, Stulpenhandschuhe und Lederhelm verwahrte. Von da verlor sich sein Pfad in der Dunkelheit. Sein Heimweg war nicht weit.
Er ging gleich zu Bett, löschte das Licht und wartete geduldig auf den Traum. Der Traum war stets der gleiche: Er versank in den blauen Augen seiner Auserwählten, strich über ihr langes blondes Haar und küsste ihre schönen, vollen Lippen, die sich ihm bereitwillig öffneten. Sie seufzte, als er ganz zu ihr kam. Er war ein einmaliger Liebhaber, kraftvoll und ausdauernd. Doch wenn er erwachte, war er wieder der unbeholfene Tölpel, der nicht wusste, wie er sich einem Mädchen nähern sollte.
Auch mit Annie war es so gewesen. Annie, die in der Bäckerei-Konditorei Brumm gegenüber vom U-Bahnhof arbeitete. Endlose Sonntagnachmittage verbrachte er im Vorgarten, wo sie bediente, bestellte ungezählte Portionen Kaffee und Kuchen und folgte mit den Augen jedem ihrer Schritte. Seine viel zu großen Trinkgelder finanzierte er aus der Kasse des elterlichen Betriebes. Sie sagte artig: »Danke schön, der Herr«, und knickste. Er merkte nicht, dass sie sich lustig über ihn machte.
Er schenkte ihr Blumen und Schokolade und ein Paar Seidenstrümpfe, aber sie lachte nur: »Was du möchtest, ist ’ne Nummer zu groß für dich, mein Junge.« Sein rosiges Knabengesicht täuschte über sein Alter hinweg, er war schon fünfundzwanzig. Der Brillantring aus dem Schmuckkasten seiner Mutter änderte die Lage. Sie steckte ihn an den Finger und sagte: »Komm morgen Abend rauf.« Sie wohnte in der Mansarde über der Konditorei.
Er kam am Montag spät mit seinem Motorrad von der Arbeit. Er hatte noch den Fleischerkittel an. Sie erwartete ihn schon. Ihr nackter Körper schimmerte hell im Schein der großen Kerze neben dem Bett. Er stand mit herabhängenden Armen da, wagte nicht, sie zu berühren, wusste nicht, wo er hinschauen sollte. Sie half ihm aus dem Kittel. Irgendetwas klirrte. »Was is’n das?« Er zeigte ihr verlegen die Kälberkette, die er in der Tasche vergessen hatte.
Mit flinken Fingern zog sie ihn aus. Als sie sein winziges Glied erblickte, prustete sie los. Dennoch bemühte sie sich redlich. Doch es half nichts, er war total verkrampft. Achselzuckend gab sie auf. »Komm wieder, wenn du erwachsen bist, mein kleiner Schlappschwanz«, spottete sie und zog sich an.
Er wollte ihr nicht wehtun oder sie gar verletzen. Er wollte nur, dass sie ihm gehörte, so war es abgemacht. Er packte sie. Sie bockte und trat nach ihm wie ein Kalb vor der Schlachtbank. Er griff nach der Kette, die noch jedes widerspenstige Kalb gezähmt hatte. Ihr Widerstand ließ rasch nach. Er riss ihr den Schlüpfer runter und drang mit Macht in sie ein. Die Kerze im Leuchter ersetzte seine Männlichkeit. Ihr Röcheln nahm er als Zeichen der Lust. Ein überwältigender Höhepunkt schüttelte ihn, während er in ihr wühlte und erst von ihr abließ, als sie sich nicht mehr rührte.
Niemand war Zeuge, wie er sie in den nächtlichen Vorgarten trug und an einen der Tische setzte, das Kleid hochgeschoben, dass man ihren blutverschmierten Schoß sah. Die Leute sollten wissen, dass er sie besessen hatte. Den Ring zog er ihr ab.
So war es beim ersten Mal, und so war es immer wieder, wenn das Verlangen zu groß wurde und es nur einen Weg gab, es zu befriedigen: mit einer jungen, blonden, blauäugigen Frau und einer Kälberkette.
Es war drei Uhr früh. Im Kellergeschoss roch es nach Formalin und Verwesung. Dankbar ließ sich Klaus Dietrich von der Schwester einen Atemschutz vor Mund und Nase binden. Die Tote lag auf dem Marmortisch, eine gut gewachsene junge Frau mit schlanken Gliedern.
Walter Möbius war Stabsarzt beim Afrikacorps gewesen. »Da hatten wir auch Probleme ohne Kühlung. Deine Karin muss schnellstmöglich unter die Erde.«
»Meine Karin. Wie sich das anhört. Ich kenne die Tote überhaupt nicht. Aber ich möchte wissen, wie und wann sie starb.«
»Vergangene Nacht, ungefähr gegen 23 Uhr. Mit einer fingerdicken Kette erwürgt. Hier, sieh dir am Hals die Eindrücke der Kettenglieder an. Aber das ist nicht alles.« Der Arzt wies auf den Schoß der jungen Frau. Ihre blonden Schamhaare waren blutverklebt. Er nahm ein Spekulum zur Hand und öffnete sachte die Schenkel der Toten. Der Inspektor drehte sich taktvoll weg. »Diese Bestie«, sagte Möbius nach kurzer Untersuchung. »Ein scharfer Gegenstand. Gewaltsam eingeführt und brutal hin und her bewegt.«
»Eine Knebelkette«, überlegte der Inspektor laut. »Eine Knebelkette, mit der er sie einhändig würgen konnte, während er mit der anderen Hand …« Er stockte. »Gegen 23 Uhr? Vermutlich vor dem letzten Zug um 22 Uhr 48. Der Bahnsteig war so gut wie leer, die Beleuchtung zum Teil defekt. Der Mörder lauerte im Halbdunkel. Die Würgekette erstickte ihre Schmerzensschreie. Als er mit ihr fertig war, stieß er sie auf die Gleise, sprang hinterher, zerrte den Körper außer Sicht unter den Bahnsteig, erklomm die Plattform wieder und wartete seelenruhig auf den letzten Zug. So könnte es gewesen sein.«
Der Arzt legte das Spekulum in eine Schale. »Schwester Dagmar hat die Tote entkleidet. Sie hatte keinen Schlüpfer an. Weiß man irgendwas über sie?«
»Kriminalmeister Franke meint, ihr Gesicht schon mal irgendwo gesehen zu haben. Genau kann er sich nicht erinnern.«
»Ich öffne jetzt die Leiche. Willst du zusehen?«
»Nein, danke. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich nach rückwärts falle. Einer unserer Leute wird deinen Befund später abholen.« Dr. Möbius sah mitleidig auf die schöne Tote. »Wer sie wohl war, diese Karin Rembach?« Er setzte das Skalpell an.
Karin
Am schönsten waren in Weißroda die Sommersonntage. Da döste nach dem Mittagessen das ganze Dorf, und man konnte sich davonstehlen, den Feldweg entlang und dann in den hohen Roggen. Teilte man die Halme auf den ersten Metern vorsichtig, so schlossen sie sich hinter einem zum undurchdringlichen Vorhang. Mitten im Kornfeld hatte der Wind eine kleine Lichtung hinterlassen. Da öffnete man die Zöpfe, dass das Haar lang auf die Schultern fiel, legte sich hin und träumte in den Himmel, und manchmal fand die Hand den Weg zur Mitte, dass es in einem schier unerträglich zu summen begann und man gar nicht aufhören konnte, so gut war das.
Die siebzehnjährige Karin mochte es, wenn sie sich ganz allein gehörte; wenn ihr niemand sagte, was sie zu tun hatte, den Hühnerstall ausmisten oder das Pferd füttern. Sie war nun schon zwei Jahre bei den Werneisens auf dem Hof, seit ihre Mutter, Anna Werneisens Schwester, am schwachen Herzen gestorben war. Mit Karins Vater war sie nie verheiratet gewesen. Der war Engländer und fuhr als Steward im Liniendienst zwischen London und Hamburg. Wenn er in Cuxhaven war, sprach er englisch mit seiner Tochter. Irgendwann wurde er nach Fernost versetzt. Sie hörten nie mehr von ihm. Nicht, dass die Werneisens es Karin direkt merken ließen. Aber wenn sie mal wieder den Schweinekoben nicht richtig zugemacht oder sonst was versäumt hatte, hieß es, das Stadtkind gehöre eben nicht hierher. Sie merkte selber, dass sie anders war und anders sprach: das reine Hochdeutsch des Nordens statt der unterschwellig stets hämisch klingenden Mundart der Menschen hier am Rande Thüringens. Sie war blond und hatte lange, schlanke Glieder, auch das unterschied sie von ihren stämmigen Verwandten.
Als sie genug geträumt hatte, setzte sie sich auf und flocht ihre Zöpfe neu, die Enden von kleinen Lederriemen mit Druckknöpfen gehalten statt von Schleifen wie die der Dorfmädchen. Sie erhob sich, strich das Kleid glatt und bummelte den Feldweg zurück. Am Gasthof hing ein Plakat:
»DIE DAME IN BLOND« MIT NADJA HORN UND ERIK DE WINTER
Es war die Ankündigung eines Ensembles aus Berlin, das während der Sommerpause in der Provinz gastierte. Karin betrachtete zum zigsten Mal das Bild der Hauptdarstellerin, einer schönen Dame mit blond gelacktem Haar und Weißfuchsstola, daneben das ihres Partners, einem traumhaft gut aussehenden Mann im Frack. Sie konnte sich gar nicht losreißen.
Hans Görke wartete vor der Schmiede auf sie. Er war sauber gewaschen, nur seine schwarzen Fingernägel konnten die Arbeit am Amboss nicht verleugnen. Hans war drei Jahre älter als Karin, ein untersetzter rothaariger Bursche mit schweren Armen und großen Händen.
»Wollte dich abholen.«
»Na und?« Betont gleichgültig schaute sie hinauf zur Hakenkreuzfahne, die über der Schmiede wehte. Görke senior war Parteimitglied.
Sie wollte weiter, aber er hielt sie am Unterarm fest. »Wo warste denn?«
»Geht dich gar nichts an.«
»Geht mich doch was an, wo du mein Meechen bist.«
»Bild dir bloß nichts ein.« Sie befreite sich von seinem Griff, indem sie seine Finger einen nach dem anderen aufbog, was er widerstandslos geschehen ließ. Er hätte sie mühelos festhalten können.
»Machen wir nächsten Sonntag nach Eckartsberga? Da ist Tanz im ›Löwen‹.«
»Hab keine Lust zum Tanzen«, schnappte sie.
»Gehn wir’n Stück?«
»Muss zum Melken.«
In ihrer Kammer zog sie das dünne Kleid mit dem Blumenmuster und dem weißen Kragen aus, ebenso die Sandalen und die weißen Socken. Sie vermied es, in den Spiegel am Schrank zu sehen, weil sie den Anblick der blauen Trikotschlüpfer mit den Gummizügen an den Schenkeln ebenso hasste wie das hochgeschlossene Leibchen. Sie setzte sich auf den Bettrand, zog die bereitliegenden dicken Wollstrümpfe an und schlüpfte in den Overall aus schmutzig weißem Drillich, der zu weit war und zu viele Knöpfe hatte.
Anna Werneisen stand am Herd und bereitete die Mehlsuppe für den Abend. Karin sah voll Abscheu die dicken Klütern an der Oberfläche schwimmen. »Der Hans war da«, meldete ihre Tante.
»Weiß ich.« Karin stieg in die Gummistiefel, die neben der Tür standen.
»Den Hans, den halte dir mal. Der ist für dich der Richtige. Er will nach Kösen zu den Reitern, als Beschlagmeister. Das ist so gut wie ein Feldwebel, was den Sold angeht. Ich weiß es vom alten Riester, der hat bei der Kavallerie gedient.« Anna Werneisen war eine praktische Frau.
»Er hat schwarze Ränder unter den Nägeln und riecht nach Ruß.« Karin wartete nicht ab, was die Tante darauf zu erwidern hatte, sondern ging mit schlabbernden Gummistiefeln in den Stall. Ihre Kusinen Bärbel und Gisela saßen schon an den Kühen. Karin rückte ihren Schemel rechts neben Lieses Hinterteil und stellte den Eimer drunter. Sie massierte das Euter, nahm zwei Zitzen und begann: sanften Druck mit Daumen und Zeigefinger, die übrigen drei Finger nacheinander folgen lassen, fast wie beim Klavierspielen, zugleich ein leichter Zug nach unten, und die Milch strullte in den leeren Eimer, mit dunklem blechernem Ton, der heller wurde, während der Eimer sich langsam füllte. Liese wandte zufrieden kauend den Kopf. Die Kusinen kicherten miteinander, es handelte sich um zwei Burschen aus Braunsroda, mit denen sie im Stroh gewesen waren.
Karin trug den vollen Eimer nach draußen und leerte ihn durchs Sieb in die Milchkanne. Drinnen muhte Rosa ungeduldig. Sie war als Nächste dran. Die drei Mädchen molken zweimal täglich je vier Kühe. Das Füttern und Ausmisten besorgte Vater Werneisen.
Nach der Mehlsuppe saßen sie um den »Volksempfänger«, einem schwarzen Bakelitkasten mit drei Knöpfen und stoffbespanntem rundem Lautsprecher, aus dem die Stimme eines Reporters tönte, der begeistert aus Wien berichtete. Der Führer hatte Österreich heim ins Reich geholt. »Satt ist der längst nich«, prophezeite Werneisen düster.
Karin hörte nicht zu. Sie blätterte in einer alten Nummer der Dame und träumte über den Hochglanzfotos schöner, eleganter Menschen von der blondgelackten Nadja Horn und von Erik de Winter, dem Traummann im Frack.
An einem Freitagmorgen im Juli hielten ein Reisebus mit der Truppe und ein Lastwagen mit den Versatzstücken auf dem Hof des Gasthauses von Weißroda. Karin war beim Ausmisten, als Bärbel mit der Nachricht in den Hühnerstall platzte. Sie ließ die Gabel fallen. Das musste sie sehen.
Aus dem Bus stiegen Darsteller, Bühnentechniker und der Regisseur Theodor Alberti, ein Herr mit Löwenmähne, Monokel und einem Scotchterrier. Und Erik de Winter, der Filmschauspieler.
Karin erkannte ihn sofort: das dunkle, gewellte Haar, das weiche Kinn, die samtbraunen Augen. Er trug helle Flanellhosen und einen weißen Tennispullover und hatte einen Packen Zeitschriften unter dem Arm. Er lachte und winkte, wie er immer lachte und winkte, wenn Publikum in der Nähe war. Die Nachricht von der Ankunft der Künstler hatte sich noch nicht herumgesprochen, und so war Karin das einzige Publikum. Unbefangen winkte sie zurück.
Erik de Winter war seltsam berührt von der schlanken Mädchenfigur im viel zu großen Overall, vom ebenmäßigen Gesicht mit den ausdrucksvollen blauen Augen. »Eine junge Schönheit«, sagte er, während er seiner Partnerin aus dem Bus half.
»Deine Vorliebe fürs Ländliche ist mir neu«, bemerkte Nadja Horn spöttisch. Sie ähnelte nur sehr entfernt der blondgelackten Dame im Weißfuchs. Sie trug ein hochgeknüpftes rotes Kopftuch zum schwarzen Haar und weite Strandhosen à la Dietrich. »Trotzdem, dein Geschmack ist wie gewöhnlich tadellos.« Sie ging mit langen, energischen Schritten auf das überraschte Mädchen zu und reichte ihm die Hand. »Ich bin Nadja Horn.«
»Sie sind ja gar nicht blond«, entfuhr es Karin.
»Wir Schauspieler sind stets so, wie sich das Publikum uns wünscht. Schwarz, rot, blond, brünett. Darf ich Sie mit meinem Partner bekanntmachen? Herr Erik de Winter – Fräulein … Wie sagten Sie gleich?«
»Karin Rembach.« Karin wischte sich den Hühnerdreck aus dem Gesicht.
Ein langer Blick aus samtbraunen Augen. »Freut mich sehr, Fräulein Rembach.«
»Mich auch. Ich habe Sie im Film gesehen. Da spielten Sie einen Flieger.«
»Der Film hieß ›Die Himmelstürmer‹.« Er sah sie unentwegt an. »Kommen Sie heute Abend? An der Kasse liegt eine Freikarte für Sie.«
Belustigt folgte Nadja Horn der Begegnung. Die kleine Landpomeranze schien ja allerhand Eindruck auf ihn zu machen. »Besuchen Sie uns doch nach der Vorstellung«, schlug sie vor. »Dann können Sie uns sagen, wie Ihnen das Stück gefallen hat. Herr de Winter und ich würden uns freuen.«
»Ich werde Tante Anna fragen«, versprach sie wie ein braves kleines Mädchen und hätte sich dafür ohrfeigen können.
Der Hof hatte sich mit Neugierigen gefüllt. Atemlos verfolgte das halbe Dorf, wie de Winter sich zum Kuss über Karins Hand beugte. Ihr Herz klopfte, aber sie ließ sich nichts anmerken. »Also, bis heute Abend«, rief sie, dass alle es hörten, und lief beschwingt in den Hühnerstall.
Später in der Küche fragte sie die Tante um Erlaubnis. »Nimm ein paar Rosen aus dem Garten mit und komm nicht zu spät nach Hause«, war Anna Werneisens einziger Kommentar. »Kann dem Kind nichts schaden, mal andere Menschen zu sehen«, rechtfertigte sie dem Gatten gegenüber ihre Entscheidung.
Das Stück war eine Gesellschaftskomödie mit witzigen Dialogen, die am Großteil des Publikums spurlos vorübergingen. Karin erfasste instinktiv die feine Ironie und den Doppelsinn und genoss die elegante Garderobe der Darsteller. So wollte sie auch sein.
Umso mehr schämte sie sich ihres dünnen Sommerkleides mit dem weißen Krägelchen, als sie nach der Vorstellung ihre neuen Freunde besuchte. Die beiden waren in den zwei besten Zimmern des Gasthauses untergekommen.
»Kind, wie nett von Ihnen.« Nadja Horn kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Sie trug ein fließendes Hauskleid. Die blonde Perücke hatte sie abgelegt und war nun wieder schwarz. »Die schönen Rosen. Vielen Dank. Hat Ihnen das Stück gefallen?«
»Ja, sehr. Besonders die Stelle, wo Verena van Bergen so tut, als hätte sie Armand eine Ewigkeit nicht gesehen, obwohl er nebenan auf sie wartet.« Karin nahm die lange Zigarettenspitze vom Tisch und stellte sich mit lässig abgewinkelter Hand in Positur. »Meine Liebe, wo denken Sie hin? Armand interessiert mich so viel wie Doktor Duponts Dackel. Oder war es ein Dobermann?« Sie traf genau Nadja Horns Tonfall.
»Bravo!« Erik de Winter applaudierte. Er hatte den Frack gegen ein seidenes Dressing Gown mit Halstuch vertauscht und sah hinreißend aus. »Einen Schluck Sekt?« Er schenkte ein, reichte Karin das Glas.
Das Zeug kribbelte in der Nase. Karin musste niesen. Sie lachte, gar nicht verlegen. »Hab so was nämlich noch nie getrunken.« Sie nahm noch einen Schluck, diesmal ohne zu niesen.
Er hob ihr sein Glas entgegen. »Ihr Dorf gefällt mir. Lauter nette Leute.« Es klang etwas gönnerhaft.
Dabei weiß er nicht mal den Namen des Kaffs, dachte Nadja, und stellte die Rosen in einen Krug. Eine Vase gab es nicht.
»Es ist nicht mein Dorf. Ich bin aus Cuxhaven.«
Nadja nippte an ihrem Glas. »Sie sind zu Besuch bei Ihren Verwandten und helfen ein bisschen auf dem Hof?«
»Ich wohne und arbeite hier, seit Mutti tot ist. Aber ich gehe bald nach Berlin.« Sie glaubte es selber, als sie es sagte. Um ihre schönen vollen Lippen war ein entschlossener Zug.
Aufmerksam beobachtete Nadja Horn das Mädchen, hörte das saubere Deutsch, registrierte die natürliche und zugleich selbstbewusste Haltung. Das war kein Landei, da steckte mehr drin. Erik hatte das richtig erkannt. Sie erhob sich. »Kommen Sie, Kind. Erik, Darling, schenk uns nach.«
Karin folgte ihr nach nebenan. Nadja schob die beiden Hälften eines großen Schrankkoffers auseinander, in dem ein Dutzend Abendkleider hing. Sie wählte eines und warf es Karin zu. »Probieren Sie das mal.« Karin hatte sich noch nie vor einer Fremden ausgezogen. Sie ging ins Bad, doch ihre Gastgeberin folgte. Zögernd streifte sie das dünne Sommerkleid ab. »Das ist ja grässlich!«, rief Nadja beim Anblick des blauen Trikotschlüpfers entsetzt. »Warten Sie.« Sie verschwand und kehrte mit einem hauchzarten Hemdhöschen und anderen traumhaften Zutaten zurück. »Na los, Kleines, du willst doch schön sein«, lockte sie. Karin überwand ihre Scheu und streifte die schreckliche Unterwäsche ab.
Nadja sah eine vollendet gewachsene junge Frau mit langen, schlanken Schenkeln und schön geformten Brüsten. »Setz dich da vor den Spiegel.« Sie löste Karins Zöpfe und bürstete ihr das Haar, bis es in goldenen Wellen auf die Schultern fiel. Sie zog die Augenbrauen behutsam nach und legte eine Spur Lippenstift auf, mehr brauchte das ebenmäßige junge Gesicht mit dem makellosen Teint nicht.
»Steh auf.« Duftender Nebel aus Nadjas Parfumzerstäuber umhüllte kühl den nackten Körper, dass die Brustspitzen sich aufrichteten. Bei Strumpfhaltern und Seidenstrümpfen und wo es ihr sonst nötig erschien, legte Nadja mit Hand an. Es knisterte, als sie Karin das lange Kleid über Hüften und Schultern zog. Ein paar Ösen und Haken vollendeten das Werk. Alles passte, auch die silbernen Pumps mit den hohen Absätzen. Entzückt schlug Nadja die Hände zusammen.
»Das hat aber lange gedauert«, beschwerte sich Erik de Winter gut gelaunt. Dann sagte er nichts mehr, so überwältigt war er von der blonden jungen Frau im engen schwarzen Abendkleid, das vorne hochgeschlossen war und einen Rückenausschnitt bis zur Taille zeigte. Ungläubig begriff Karin, dass sie ihn völlig aus der Fassung gebracht hatte.
»Armand, wo bleibt der Champagner? Ich bin halb verdurstet«, kopierte sie Nadja im zweiten Akt und setzte sich wie ihr Vorbild auf eine Sessellehne, dass sich der Schlitz des Kleides bis zum Knie teilte.
Erik hatte sich gefangen. »Nur wenn Sie mit mir tanzen, meine Liebe«, spielte er seine Rolle und kurbelte das Koffergrammophon an.
Karin hatte ihn und Nadja auf der Bühne tanzen sehen. Jetzt gab sie sich einfach in seine Arme und schwebte mit ihm über den knarrenden Fußboden. Sie roch sein herbes Eau de Cologne und fühlte die Seide seines Dressing Gowns. Er spürte ihren jungen Körper und hörte auf zu denken.
Es klopfte. Regisseur Theodor Alberti steckte seinen Löwenkopf durch die Tür. »Theo, kommen Sie rein. Einen Schluck Sekt?«, flötete Nadja.
Das Monokel blitzte. Wohlgefällig musterte er Karin von oben bis unten. »Wen haben wir denn da? Doch nicht etwa eine bezaubernde neue Kollegin?«
Nadja Horn sah ihren Schützling nachdenklich an. »Vielleicht.«
Ausgelassen tanzte Karin über das Kopfsteinpflaster der Dorfstraße nach Hause. Tante Anna hatte die Pforte im Hoftor offengelassen. Als sie nach dem Türknauf griff, schnellte eine Hand aus dem Dunkel und packte sie am Arm. »Mit dem Schauspieler haste Lust zum Tanzen«, keuchte Hans Görke. Alkoholdunst schlug ihr entgegen. »Na warte, der kommt ooch noch dran.« Er ließ sie los und entfernte sich mit schweren Schritten.
In der Kammer hatte sie die Begegnung schon wieder vergessen. Sie zog ihr dünnes Kleid aus. Die Dessous darunter hatte Nadja Horn ihr geschenkt. Sie ging in den hauchzarten Nichtigkeiten zu Bett und dachte an Erik de Winter. Glücklich schlief sie ein.
Am Sonnabend war die zweite und letzte Vorstellung. Görke hatte den Sohn unter Hausarrest gestellt, nachdem Regisseur Alberti ihm von den Drohungen gegen ein Mitglied seines Ensembles berichtet und »Maßnahmen der Reichskulturkammer« in Aussicht gestellt hatte. »Dann fliegen Sie in hohem Bogen aus der Partei, mein Bester«, hatte er übertrieben.
So blieb Erik de Winter unbeschädigt, und auch die Abschiedsvorstellung wurde ein voller Erfolg. Karin bekam er nicht mehr zu sehen. »Anordnung von Theo«, beschied ihn Nadja. »Glaub mir, es ist besser so. Wenigstens im Moment.« Er meinte einen viel versprechenden Unterton in ihrer Stimme zu entdecken.
Am Sonntagvormittag machte Nadja Horn den Werneisens ihre Aufwartung. Sie wurde in die gute Stube gebeten, wo sie auf dem Sofa Platz nehmen musste. Abwartend saßen ihr die Werneisens gegenüber.
Die Schauspielerin kam gleich zur Sache: »Ich möchte Ihre Nichte nach Berlin holen. Nicht sofort, sondern im Frühjahr. Sie kann bei mir wohnen und sich um den Haushalt kümmern. Das lässt ihr genügend Zeit für die Schauspielschule. Sie bekommen von der Bühnengenossenschaft ein Leumundszeugnis zu meiner Person.«
»Ach ja? Schauspielschule?«, wiederholte Werneisen hämisch.
»Karin gehört nicht in den Kuhstall, das wissen Sie ebenso gut wie ich. Sie hat Talent, das muss ausgebildet werden.« Instinktiv wandte die Horn sich zu Anna Werneisen. »Geben Sie ihr diese Chance.«
Die Bäuerin hörte aufmerksam zu. »Nicht dass wir der Karin Steine in den Weg legen wollen. Aber was das kostet«, gab sie zu bedenken.
»Kost und Logis hat sie bei mir frei. Bleibt die Frage des Schulgeldes.«
»Sie hat etwas Geld von ihrer Mutter. Eigentlich soll das für ihre Aussteuer sein.«
»Und das solln wir rausrücken?« Werneisens Augen wurden schmal. »Auch wenn Sie uns für dumme Bauern halten – so dumm sind wir nicht.«
»Ein von Ihnen bestimmter Notar würde das Geld treuhänderisch verwalten und nach Prüfung die jeweils erforderlichen Zahlungen für Karin vornehmen. Die Verantwortung für das Geld eines jungen Mädchens zu übernehmen – so dumm bin ich nämlich nicht, Herr Werneisen.«
Der Bauer sah sie verblüfft an. »Sie sind mir eene. Lassen wir die Karin gehen, Mutter?« Anna Werneisen nickte. Damit war die Sache beschlossen.
Es wurden ein langer Herbst und Winter für Karin. Sie ließ niemanden ihre Ungeduld merken, sondern verrichtete ihre Arbeit zuverlässiger denn je. Sogar zu Hans Görke war sie nett, wenn auch distanziert.
Nadja Horn bewohnte eine Etage am Südwestkorso, wo viele Künstler ihr Quartier aufgeschlagen hatten. Karin sah vom Fenster ihres Zimmers auf den grünen Breitenbachplatz und seinen zwischen Sträuchern und Frühlingsblumen verborgenen U-Bahn-Eingang. Sie war nun drei Wochen in Berlin und tastete sich mit unstillbarer Neugierde in das Leben der Hauptstadt hinein. Der Treuhänder hatte ihr ein kleines Budget für Kleidung bewilligt. Einige Geschenke ihrer Gönnerin ergänzten die Garderobe. Aus dem Landei wurde rasch eine schicke junge Berlinerin.
Lore Brucks Schauspielschule in der Kantstraße war bequem mit dem Autobus T zu erreichen. Nadja hatte ihren Schützling dort in die Anfängerklasse eingeschrieben. »Da machst du nichts als Atemübungen, bis dir die Puste wegbleibt«, beklagte sich Karin.
»Das Gretchen spielst du noch früh genug«, tröstete Nadja sie.
»Mit Erik de Winter als Faust«, träumte Karin. »Man hört so gar nichts von ihm.«
»Er dreht mit Josef von Baky auf Rügen.«
»Bleibt er da länger?«
»Du wirst dich wohl ein bisschen gedulden müssen. Sie haben gerade erst mit den Außenaufnahmen begonnen.« Nadja zögerte unmerklich. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir reden. Du bist jung und schön. Du wirst viele Männer kennen lernen. Sie werden alle versuchen, dich ins Bett zu kriegen. Auch Erik. Ich nehme an, als Mädchen vom Lande bist du hinreichend im Bilde.«
»Sie meinen, wie die Kuh zum Bullen geführt wird? Das weiß doch jedes Kind.«
»Aber weißt du auch den Unterschied? Die Kuh hat keine Wahl. Im Gegensatz zu dir. Wähle deinen ersten Mann aus Liebe. Vom zweiten an wähle klug.«
Erst verstand Karin nicht, wie Nadja das meinte. Dann begriff sie. Ihr Innerstes lehnte sich auf. Es würde für sie nur den Einen geben. Nadja ahnte ihre Gedanken und lächelte leise.
Die Anfängerklasse der Schauspielschule hatte an diesem Junimorgen Fechten. Lore Bruck pflegte gute Beziehungen zum Reichsführer SS, und so unterwies ein Sportwart der »Leibstandarte« die angehenden Mimen. Er hieß Siegfried und war ein blonder Hüne, der das Florett erstaunlich leicht und elegant schwang. Er stand hinter Karin und führte ihre Hand. Scheinbar konzentriert folgte sie seinen Bewegungen. Dabei drückte sie den Po wie zufällig gegen seine Vorderseite. Die anderen Mädchen kicherten. Siegfried wurde rot.
Es war eine ihrer kleinen Einlagen, mit denen sie den Unterricht auflockerte, zum Beispiel indem sie die Bruck vollendet kopierte, bis sich alles vor Lachen bog. »Karin, man sieht, Sie haben ein gewisses komödiantisches Talent«, kommentierte die Lehrerin diese kleinen Eskapaden. »Dennoch bitte ich um etwas mehr Ernst. Auf der Bühne können Sie auch nicht dauernd herumalbern.«
Lore Bruck war eine glühende Nationalsozialistin. Sie hatte ihre große Zeit in den frühen zwanziger Jahren am Deutschen Theater und beim Stummfilm erlebt. Inzwischen war aus der eleganten Dame eine mütterliche Figur geworden, die ihre Zöglinge wie eine Glucke hütete. Die jungen Darsteller verehrten sie und kamen mit all ihren Sorgen zu ihr.
»Ich zeige Ihnen jetzt eine Terz«, kündigte der Fechtlehrer an. Niemand beachtete ihn. Lore Bruck war eingetreten und mit ihr Erik de Winter. Er wurde sofort von den Schülern und Schülerinnen umringt und mit Fragen und Autogrammbitten bestürmt. Gut gelaunt wehrte er ab: »Herrschaften, ihr bringt mich ja um.«
Karin hielt sich im Hintergrund und wartete, bis er sie bemerkte. Er löste sich aus der Gruppe und ging auf sie zu. »Wie geht es Ihnen, Karin?«, fragte er förmlich. »Frau Bruck sagt, Sie machen Fortschritte.«
»Danke, es geht«, erwiderte sie hölzern. Ihr Herz klopfte bis zum Hals.
»Wie ich höre, Karin, ist Herr de Winter ein Freund Ihrer Familie«, sagte die Bruck. »Ich gebe Ihnen daher ausnahmsweise für den Rest des Tages frei.«
»Das ist lieb von dir, Lore.« Er umarmte sie und zwinkerte Karin zu. Karin genoss die neidischen Blicke der anderen, als er sie an der Hand nahm und aus dem Übungsraum zog. Unten wartete ein cremefarbenes »Wanderer«-Cabriolet mit offenem Verdeck. Er half ihr galant in den Wagen. Zwei Passanten erkannten ihn und blieben stehen. Er winkte ihnen lachend zu, setzte sich ans Steuer und startete.
Sie fuhren durch die Kantstraße zur Masurenallee, am Reichsrundfunk vorbei bis zum Adolf-Hitler-Platz und mit zunehmender Geschwindigkeit die Heerstraße bergab. Karin genoss den warmen Fahrtwind. Sie schwieg, weil er schwieg. An der Stößenseebrücke bogen sie links in die Havelchaussee, die sich am Fluss entlangwand.
Beim Schildhorn steuerte er das Cabriolet an den Straßenrand und hielt. Aus dem sonnenheißen Grunewald stieg harziger Kiefernduft. Auf dem Wasser blinkten weiße Segel. Über ihnen brummte das dicke kleine Reklameluftschiff von Odol. Er neigte sich zu ihr und küsste sie. Es kam für sie völlig unerwartet und war ganz anders als die unbeholfenen Küsse des Nachbarjungen damals in Cuxhaven oder die Bühnenküsse im Unterricht. Instinktiv öffnete sie die Lippen und begegnete seiner suchenden Zunge. Schauer durchliefen ihren Körper und strömten an einem Punkt zusammen. Es war wie im Kornfeld, wenn sie sich selbst berührte, nur viel schöner.
Er nahm ihren Kopf zwischen die Hände. Seine Stimme war warm und voller Zärtlichkeit: »Das war es, was ich dir sagen wollte.« Er fuhr langsam weiter. Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Ein unsägliches Glücksgefühl erfüllte sie. Er hatte den rechten Arm um sie gelegt und ließ den Wagen im vierten Gang rollen. Erst als die Havelchaussee hinter ihnen lag, schob er sie sachte beiseite und schaltete. »Magst du Aal grün?«, erkundigte er sich. Sie hatte keine Ahnung, was das war.
Auf den Wannseeterrassen bestellte er das typisch märkische Gericht mit Petersilienkartoffeln und grüner Sauce und dazu einen Mosel. »Schmeckt gut«, lobte sie mit vollem Mund.
Wie jung sie ist, dachte er.
»Film – wie ist das?«, wollte sie wissen.
ENDE DER LESEPROBE
2. Auflage
Der Karl Blessing Verlag und der Wilhelm Heyne Verlag sind Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Taschenbucherstausgabe 07/2005 Copyright © 2003 by Karl Blessing Verlag GmbH München Copyright © dieser Ausgabe 2005 by Wilhelm Heyne Verlag, München Umschlagmotiv: mauritius-images/SuperStock Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung einer Vorlage von Network! Werbeagentur GmbH
eISBN: 978-3-641-17266-4
www.heyne.de
www.randomhouse.de